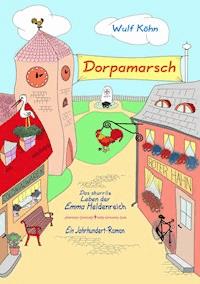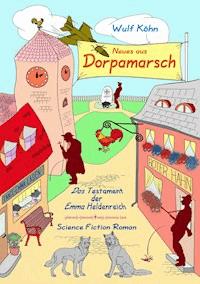Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Schwerpunkt dieses fantastischen Romans liegt trotz der vielen Abenteuer in dem gefühlsbetonten Erleben des Helden, der alles andere als ein Held im klassischen Sinn ist. Immer stärker entstehen in ihm Zweifel an den Worten der Alten, und er will nicht mehr blindlings glauben, sondern den Sinn des Überlieferten verstehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wulf Köhn
Drachenkinder
Fantastischer Roman
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Der Heuler
Die Schlucht der Höhlen
Altersbestimmung
Das Tier erwacht
Das Unglück
Die Höhle aller Höhlen
Vater und Sohn
Worte der Überlieferung
Die Nacht im Wald
Drachenkämpfer
Die Freunde
Die großen Jäger
Die Nacht in der Steppe
Junge Kämpfer
Die Herde
Das große Projekt
Kampf um das Dorf
Außenseiter
Balders Sohn
Herde in Gefahr
Die Speerspitze
Das Gesetz
Muth, der Drachentöter
Lebensblätter
Der lebendige Tod
Der Schmied
Felsenbilder
Die Felswand
Der letzte Kampf
Die Worte der Mutter
Trents Vermächtnis
Das Beben
Der Bergrutsch
Die Entscheidung
Das Wiedersehen
Der alte Mann
Epilog
Über den Autor
Impressum neobooks
Der Heuler
Und der Drache trat vor das Weib, das gebären sollte,
auf dass, wenn sie geboren hätte, er ihr Kind fräße.
Offenbarung des Johannes, 12:3
Trent erwachte und öffnete die Augen. Die Dunkelheit in der Hütte war fast vollkommen. Durch einige Ritzen der geflochtenen Wände schimmerte das fahle Licht des Silbernen Wächters. Trent wusste zunächst nicht, was ihn geweckt hatte, doch er war unruhig. Es musste etwas Wichtiges sein. Langsam schweifte sein Blick durch das Dunkel seiner Umgebung. In den Ecken der Hütte knackte es leise, und wenn er sich bewegte, knarrten die Zweige seiner Schlafstatt. Der schwere Pelz, der ihm Wärme während des Schlafes gegeben hatte, raschelte leise bei jeder Bewegung, als würde der Wulp noch leben. Es waren alles bekannte Geräusche, die ihm ebenso vertraut waren, wie das leichte Pfeifen des Windes, der sich in den Winkeln und Ecken der Hütte brach. Doch irgendetwas war anders.
Trent setzte sich auf und versuchte, sein Gefühl der Unruhe zu analysieren. Es war keine Angst, die er verspürte. Es schien keine Gefahr vor der Hütte zu lauern. Es war eher eine instinktive Wahrnehmung, etwas, das in sein Unterbewusstsein eindrang und dort den Wunsch erzeugte, aufzustehen und ins Freie zu treten.
Er schlang den Schlafpelz um seine Schultern und stand auf. Trotz der Dunkelheit erkannte er alle Einzelheiten seiner Umgebung.
Sein Lager stand in einer Ecke der Hütte, die aus einem einzigen Raum bestand. Es war aus elastischen Ruten geflochten und mit Fellsäcken gepolstert, die mit Pflanzenfasern gefüllt waren. Ein bequemeres Lager ließ sich kaum vorstellen. Er ging hinüber zur Feuerstelle und rückte den schweren Stein zur Seite, der über die Glut gelegt war. So wurde gleichzeitig die Hütte vor einem nächtlichen Feuer bewahrt und die Glut für den nächsten Morgen geschützt.
Mit einem Federbüschel wischte er die Asche beiseite und fächelte der Glut etwas Luft zu. Sofort glühte sie hell auf und bildete kleine Flammen, an denen er einen Kienspan entzündete. Dieser beleuchtete die Hütte jetzt in einem rötlichen Licht. Trent steckte den Kienspan in eine Ritze über der Feuerstelle und schaute sich um.
Es war nichts Besonderes zu entdecken. Auf dem Tisch standen noch die Reste der Mahlzeit vom Abend: derbes selbstgebackenes Brot, ein Krug mit vergorenem Beerensaft und ein Streifen luftgetrocknetes Fleisch. Trent fasste sich stöhnend an den Kopf, als er den Krug sah. Ein säuerlicher Geschmack im Mund erinnerte ihn an den süßen Wein, der ihm gestern so schnell zum Schlaf verholfen hatte.
Doch jetzt brauchte er etwas Frisches. Er griff zu dem Krug neben dem Feuer und trank einige Züge von dem klaren Wasser. Den Rest goss er sich über den Kopf. Das tat gut! Aber die Unruhe wollte nicht weichen. Etwas ging dort draußen vor. Er löschte das Feuer des Kienspans, indem er es zwischen Daumen und Finger zerdrückte. Es würde ihm vor der Hütte ohnehin nichts nützen.
Trent öffnete die Tür und trat hinaus. Einen Augenblick lang schaute er zum Silbernen Wächter empor, der das Dorf in ein fahles Licht tauchte. Der Silberne Wächter blickte zur Nachtzeit über das Land, wenn der Goldene Drache hinter den Bergen verschwunden war. Er war zugleich unheimlich und beruhigend, denn ohne sein Licht wäre das Volk während der Nachtzeit hilflos den Raubtieren ausgeliefert, wenn sie die schützenden Zäune des Dorfes verließen. Unheimlich war er den Sapien, weil sie nicht wussten, warum er nur erschien, wenn die Große Mutter, der Goldene Drache, abwesend war. Manchmal war von ihm auch nur ein schmaler Streifen zu sehen, und manchmal war er völlig verschwunden.
Welchen Auftrag hatte er von der Großen Mutter bekommen? Sollte er die Welt nur beleuchten oder auch berichten, was in ihrer Abwesenheit geschah. Die Männer bezogen ihn deshalb in ihre Gebete ein, die eigentlich nur der Großen Mutter gewidmet waren.
Das Dorf war völlig ruhig. Die anderen Sapien, die es bewohnten, schliefen. Im Lichte des Silbernen Wächters konnte Trent die Hütten erkennen, die um den runden Dorfplatz herum standen. Nur wenige waren jeweils von einem einzigen Mann bewohnt. In den meisten lebte ein Vater mit seinem Sohn.
Aus dem Schatten einer der Hütten löste sich eine Gestalt, in der Trent beim Näherkommen den Dorfältesten Kaan erkannte.
„Ich wusste, dass du ihn hören würdest“, sagte Kaan.
„Ich bin aufgewacht, doch ich habe nichts gehört“, erwiderte Trent und lauschte in die Nacht hinein. Er hörte nur die wohlbekannten Geräusche der Nacht, das Rauschen des Windes in den Blättern der Bäume und das leise Pfeifen, wenn er durch die Ritzen der geflochtenen Wände strich. Manchmal waren in der Ferne Tiere zu hören, die in der Dunkelheit auf die Jagd gingen. Es waren unheimliche Geräusche darunter, deren Verursacher nur zu ahnen waren. Oft ging ein Klagen und Jammern durch den Wald, doch das waren die Geister der Nacht, welche die Sapien warnen wollten, wenn gefährliche Tiere unterwegs waren. Heute hörte sich der Wald nicht gefährlich an.
„Du musst in dein Inneres hineinhören!“, forderte Kaan ihn auf, und Trent erinnerte sich an das Gefühl, das er bereits in der Hütte gehabt hatte. Da war ein merkwürdiges Ziehen, voller Sehnsucht und Verlangen, das ihn ins Freie getrieben hatte.
Jetzt spürte er es wieder mit größerer Stärke. Ganz langsam erfüllte es seinen Kopf, bis er bemerkte, dass es sich um ein leises Heulen handelte, das ganz aus der Ferne zu ihm hergetragen wurde. Er lächelte verstehend, und Kaan schaute ihn ebenfalls lächelnd an.
„Hast du ihn jetzt gehört? Er braucht deine Hilfe! Er ist wehrlos dort draußen. Du musst dich beeilen!“
„Wie kann ich ihn finden?“, fragte Trent unsicher.
„Du wirst ihn finden, denn er ruft dich – nur dich allein – seinen Vater“, zerstreute Kaan beruhigend Trents Bedenken. „Bisher wurde jeder Heuler gefunden! Achte auf das Heulen und die Geräusche des Waldes. Die Geister werden dir helfen!“
„Ist es nicht gefährlich, in der Dunkelheit das Dorf zu verlassen?“, wollte Trent wissen.
„Natürlich ist es gefährlich!“, bestätigte Kaan. „Deshalb schützen uns ja auch die Palisaden vor den wilden Tieren des Waldes, die nur zur Nachtzeit ihre Beute suchen. Doch du kannst dich wehren, aber der Heuler ist wehrlos. Du musst ihn finden, bevor ihn die Raubtiere wittern und bevor es Tag wird, denn dann sind die Drachen unterwegs.“
Trent, der noch immer mit dem um die Schultern geschlungenen Schlaffell auf dem Dorfplatz stand, kehrte in seine Hütte zurück. Nachdenklich schaute ihm Kaan hinterher.
„Er wird es schaffen!“, versicherte er sich selbst. Aus den Erfahrungen seines Alters wusste er allerdings, dass nicht jeder Mann von der Suche nach seinem Sohn zurückgekommen war, doch das hatte er Trent verschwiegen. Es war besser, wenn keine Angst seine Wahrnehmungsfähigkeit trübte. Dass es im nächtlichen Wald vielfältige Gefahren gab, wusste Trent auch selbst. Er war von seinem Vater fürsorglich auf das Leben vorbereitet worden. Leider hatte er seinen Sohn viel zu früh verlassen müssen.
Trent bereitete sich schnell aber sorgfältig auf seine Mission vor. Er wählte den derben Umhang aus Wulpfell, schnallte den breiten Gürtel um die Taille, steckte das kräftige Messer hinein und hängte sich einen Beutel mit den Resten des Abendessens um die Schulter. Den Wein ließ er stehen. Unterwegs würde er genügend Wasser finden.
Zum Schluss nahm er den langen Speer, den „Drachenwehrer“, und wog ihn prüfend in der Hand. Er würde ihn kaum brauchen, denn nachts war er vor den Drachen sicher, doch er gab ein zusätzliches Gefühl der Sicherheit. Es war nicht auszuschließen, dass er auf einen Wulp stieß. Auch wenn diese den Kontakt mit Sapien mieden, waren sie nachts auf Beutefang und deshalb unberechenbar. Wenn sie aufgeschreckt wurden, konnten sie gefährlich werden.
Trent verließ die Hütte, blieb aber nach ein paar Schritten stehen und eilte zurück. Er nahm ein kleines weiches Fell von der Wand, sah es liebevoll an und verstaute es in dem Beutel, bevor er sich nun endgültig auf den Weg machte.
Er verließ die schlafenden Hütten und schritt schnell voran. Der Silberne Wächter war ihm wohlgesonnen und erhellte die vor ihm liegende Lichtung, in deren Mitte das Dorf lag. Es war durch hohe Palisaden geschützt, die jeden Eindringling abwehren konnten. Nachts waren sie in ihrem Dorf sicher, denn die Tiere des Waldes wagten es nicht, sich den Palisaden zu nähern. Sie mieden die Sapien, doch sie wurden von den Männern gejagt, denn sie trugen die begehrten Felle, ohne deren Schutz die Sapien nicht auskommen konnten. Besonders begehrt war das zottige Fell des mehr als mannsgroßen Wulps, das nicht nur groß genug für einen Umhang ausfiel, sondern auch noch sehr strapazierfähig war.
Trent zog seinen Umhang fröstelnd zusammen und lauschte einen Augenblick in die Nacht. Dann überstieg er entschlossen auf den angestellten Leitern die Palisade.
Hier, außerhalb des Dorfes, hörte er den Heuler deutlicher. Es war kaum wahrnehmbar, schien aber den ganzen Kopf auszufüllen. Trent wunderte sich, dass er es nicht sofort beim Aufwachen bemerkt hatte.
Er änderte die Richtung etwas nach links und schritt in den Wald hinein. Hier war es dunkler, denn der Silberne Wächter konnte kaum durch die dichten Baumkronen schauen. Würde er ihn trotzdem beschützen? Trent vertraute auf die Geister der Nacht.
Das Heulen war so leise, dass er alle anderen Geräusche um sich herum trotzdem wahrnehmen konnte. Es wies ihm den Weg durch den unwegsamen Wald.
Am Anfang konnte Trent einen bekannten Pfad benutzen. Er war ihm oft am Tage gefolgt und durch den Wald zu den Weiten der Steppe gelangt, wo er bis an das Ende der Welt schauen konnte. Er hatte schon mehrmals versucht, das Ende zu erreichen. Er konnte es sehen, doch je weiter er ging, desto mehr entfernte es sich von ihm. Niemandem aus dem Dorf war es bisher gelungen. Viele waren ohne Erfolg zurückgekommen, einige für immer draußen geblieben.
Es gab in der Steppe auch keinerlei Deckung vor den Drachen, den einzigen wirklichen Feinden der Männer, riesige Ungeheuer mit kurzen Stummelflügeln und einem breiten gezackten Schwanz. Mit beiden zusammen konnten sie sich in die Luft erheben und von oben angreifen. Mit ihren dolchartigen Krallen konnten sie ganze Wulps erfassen und sie mit dem harten krummen Schnabel zerfetzen.
Trotz der Bedrohlichkeit der Nacht war Trent froh darüber, dass jetzt der Silberne Wächter seinen Weg beschützte. Wenn die Große Mutter den Tag erleuchtete, war man vor den Drachen nicht sicher. Unwillkürlich fasste Trent den Drachenwehrer fester und folgte dem Heulen.
Doch bald musste er den Weg verlassen, denn er hätte ihn in eine falsche Richtung geführt. Zögernd schlug er sich in das Unterholz zur rechten Seite. Der Wulppelz gab ihm einen guten Schutz gegen die spitzen Zweige und Dornen, die ihn sonst arg zerkratzt hätten. Trotzdem ließ es sich nicht immer vermeiden. Trent spürte die Schmarren kaum, die bald seine weniger geschützten Beine bedeckten. Er hörte nur das Heulen, das ihn nun unwiderstehlich anzog. Er fiel in einen leichten Trab, hörte aber gleich wieder auf, als er mehrmals über Wurzeln stolperte.
Dicht neben ihm setzte plötzlich ein langgezogenes Klagen ein, das er bisher nur aus der Entfernung kannte. Es klang nicht bedrohlich, jedoch ängstlich und übertrug diese Angst auch auf ihn. Trent blieb stehen und lauschte dem Geist der Nacht. Er schien ihn vor einer Gefahr warnen zu wollen. Die Bäume und Sträucher warfen unheimliche Schatten auf den silbern glänzenden Waldboden. Noch nie war Trent allein in der Nacht unterwegs gewesen. Welche Schatten waren ihm wohlgesonnen? Wie sahen die guten Geister der Nacht aus, von denen man sich an den Feuern erzählte, und die bösen Geister, vor denen sie mit ihren Klagelauten warnen wollten?
Das Klagen brach plötzlich ab, und ein dunkles Tier rannte an ihm vorbei. Es hätte ihn fast umgerannt und war mit ein paar Sätzen in der Dunkelheit verschwunden. Gleich darauf sprang ein anderes viel größeres Tier aus dem Schatten hinterher. Trent hörte ein wildes Grunzen, einen angstvollen Schrei und ganz plötzlich atemlose Stille.
Der ganze Wald schien die Luft anzuhalten. Aber das leise Heulen blieb weiterhin in seinem Kopf. Es zog ihn unerbittlich weiter in den Wald hinein. Trent hörte nur noch seine eigenen Schritte auf dem Waldboden und das Rascheln im Unterholz, das er beim Laufen selbst verursachte.
Das Dickicht wurde immer dichter, und Trent hatte Mühe, sich durch die Zweige hindurchzuarbeiten. Er bereute es, sein breites Schwert nicht mitgenommen zu haben. Es hätte ihm jetzt gute Dienste geleistet, denn der Drachenwehrer nutzte ihm hier nicht viel.
Ab und zu blieb er stehen und lauschte in die Dunkelheit. Er versuchte, die Geräusche des Waldes zu deuten. Auf den Heuler brauchte er nicht zu lauschen – ihn hörte er die ganze Zeit und von Minute zu Minute eindringlicher. Trent wunderte sich, wie das möglich war. Das Heulen wurde nicht lauter und kam auch nicht durch die Ohren. Es überlagerte auch nicht die anderen Geräusche. Es war einfach in seinem Kopf. Ein innerer Drang trieb ihn weiter. Auch wenn er es gewollt hätte, wäre es ihm jetzt unmöglich gewesen, umzukehren.
Trent stolperte wieder und verlor den Boden unter den Füßen. Noch bevor er nach rettenden Zweigen greifen konnte, kollerte er einen schrägen Abhang hinab. Stöhnend richtete er sich unten in einer kleinen Schlucht auf. Die Dunkelheit war stärker geworden, denn die silbernen Strahlen des Wächters erreichten den Boden nicht mehr. Er betastete seinen Körper, ob er den Sturz unverletzt überstanden hatte. Die Schmerzen ignorierte er, und alles andere schien noch in Ordnung zu sein. Sein kräftiges Messer steckte im Gürtel, doch seinen Drachenwehrer hatte er verloren. Er musste irgendwo in der Dunkelheit des Abhanges liegen. Suchend tastete er umher, denn ohne ihn wollte er sich nicht weiterwagen, auch wenn der Heuler noch so eindringlich lockte.
Auf allen Vieren krabbelte er langsam den Hang hinauf, ständig nach allen Seiten tastend. Er musste schon großes Glück haben, den glatten Schaft des Speeres zwischen dem morschen Altholz und den glitschigen Blättern auf dem Boden zu erwischen.
Ein drohendes Knurren ließ ihn in der Bewegung erstarren. Er musste auf einen Wulp gestoßen sein, der ihn jetzt eindringlich warnte. Am Tage und mit der richtigen Bewaffnung, war ein Wulp kein Problem für ihn, auch wenn dieser einen erwachsenen Mann um mehr als Kopfgröße überragte, wenn er aufgerichtet war. Und bei Gefahr richtete sich ein Wulp immer auf, um sich mit seinen kräftigen Pranken, den langen messerscharfen Krallen und dem gewaltigen Gebiss zu verteidigen. Das war häufig auch sein Verderben, wenn er auf einen Sapien traf. Der lange Drachenwehrer machte auch mit einem Wulp kurzen Prozess. Meist gelang es ihm nicht, an den Sapien dicht genug heranzukommen, bevor sein Herz von dem Speer durchbohrt wurde.
Doch hier befand sich der Wulp in der besseren Position. Trent konnte nichts sehen und hatte seinen Speer verloren. Er war dem Wulp praktisch hilflos ausgeliefert. Er blieb weiterhin bewegungslos erstarrt, in der Hoffnung, dass der Wulp ihn gar nicht angreifen wollte. Vielleicht fühlte er sich nur in seiner Nachtruhe gestört.
Trent hörte den erregten Atem des Tieres an seiner rechten Seite. Behutsam versuchte er sein Messer zu ertasten. Ein erneutes Knurren war die Antwort. Also blieb er bewegungslos liegen.
Doch er konnte nicht ewig so liegenbleiben. Er musste weiter, den Heuler retten, der vielleicht ebenso gefährdet und noch hilfloser war. Langsam zog sich Trent von dem Wulp zurück, der jede seiner Bewegungen mit drohendem Knurren begleitete. Er schien gar nicht an einem Kampf interessiert zu sein. Wenn er das beabsichtigte, hätte er ihn längst mit einem Prankenschlag erledigen können. Diese Erkenntnis gab Trent wieder einigen Mut zurück. Trotz des Knurrens schob er sich immer weiter aus der Reichweite des Wulps zurück. Seinen kostbaren Speer musste er allerdings zurücklassen. Vielleicht konnte er ihn später einmal bei Tageslicht suchen gehen.
Mit zunehmender Entfernung gab der Wulp das Knurren auf. Trent schien seinen Aggressionskreis verlassen zu haben. Vorsichtig richtete er sich auf und ging einige Schritte rückwärts, immer noch in Verteidigungsbereitschaft. Doch schon wieder stolperte er über ein Hindernis und fiel zu Boden. Sofort grollte der Wulp wieder, kam aber nicht näher. Als Trent fühlen wollte, über was er gestolpert war, ertastete er den wohlbekannten glatten Schaft seines Speeres, der bei dem Absturz offensichtlich nach vorne geschleudert worden war. Trent fühlte sich sofort wieder sicherer und überlegte einen Augenblick, ob er nun seinerseits den Wulp angreifen sollte. Doch er verwarf den Gedanken sofort wieder, denn erstens war er dem Wulp dankbar dafür, dass er ihn in Ruhe gelassen hatte und zweitens rief der Heuler noch eindringlicher als zuvor.
Er wandte sich ab und folgte weiterhin dem Lockruf. Das war zunächst nicht so einfach, denn erst jetzt nahm er das Rauschen eines Wasserlaufs wahr, der sich in der Schlucht befand. Trent benutzte seinen Speer, um sich vorsichtig über den Boden zu tasten. Er wollte nicht noch einmal unversehens zu Fall kommen oder irgendwo herabstürzen. Ein breiter Bach tauchte plötzlich vor ihm in der Dunkelheit auf. Er leuchte wie ein silbriges breites Band, das sich durch die Schlucht schlängelte. Die Bäume am Ufer ließen zwischen sich genügend Platz, damit der Silberne Wächter seine Blicke hindurch schicken konnte.
Trent näherte sich dem reißenden Wasser, das er nun durchqueren musste. Der Heuler lockte unerbittlich von der anderen Seite. Trent versuchte an einigen Stellen über glitschige Steine zu balancieren, rutschte jedoch immer wieder ab. Als er bei einem weiteren Versuch völlig in das eiskalte Wasser fiel, watete er einfach weiter. Nun war er ohnehin nass bis auf die Haut. Die Strömung riss ihm mehrmals die Beine weg, bis er den Boden völlig verlor und vom Wasser mitgerissen wurde. Verzweifelt versuchte er zu schwimmen, ohne den Speer loszulassen. Er stieß sich an Steinen und angeschwemmten Baumstämmen, bis er schließlich das andere Ufer erreichte.
Erschöpft zog er sich an Land und blieb zunächst schweratmend liegen. Die Strömung hatte ihn ein ganzes Stück von seiner ursprünglichen Richtung abgetrieben. Doch der Heuler wies ihm den Weg und trieb ihn unerbittlich weiter.
Trent lief am Ufer entlang, bis er einen ausgetretenen Pfad fand, der in seine Richtung führte. Hier erreichte der Silberschein auch wieder den Boden, so dass Trent gut vorankam, ohne durch Unterholz behindert zu werden.
Nach kurzer Zeit wurde der Wald plötzlich lichter, und er erreichte die Steppe, die sich weit vor ihm öffnete. Wie auf ein geheimes Kommando begann das silberne Licht, das auf der Weite lag, sich langsam rötlich zu verfärben und einen goldenen Schimmer anzunehmen. Ganz weit am Ende der Welt erhob sich majestätisch der Goldene Drache, die Große Mutter, und überflutete die Ebene mit ihrem rötlichen Schein.
Fröstelnd, mit nassem Umhang, stand Trent am Waldrand und betrachtete das Wunder, das sich jeden Morgen wiederholte, jedoch vom Dorf aus nicht in dieser Schönheit gesehen werden konnte. Wie ein blutiger Ball erhob sich die Große Mutter, zunächst kreisrund, bekam dann vereint mit den Wolken Flügel und einen bizarren Schwanz, der sich ständig in der Form veränderte, bis sie auf ihnen weiter steigen konnte, um ihre lebenspendenden Strahlen über das Land auszubreiten.
Bald konnte Trent sie nicht mehr anschauen, da ihm die Augen zu verbrennen drohten. Er schaute auf den Boden und auf die Grashalme zu seinen Füßen, die noch voller Tautropfen hingen. Er fühlte aber auch die Wärme, die seinen Umhang trocknete. Auch der mitgeführte Beutel war nass geworden. Behutsam nahm Trent das kleine Fell heraus und legte es über einen Stein, auf dem es die Strahlen der Großen Mutter erreichen konnten. Das Brot war aufgeweicht und nicht mehr zu gebrauchen. Das Fleisch war zwar auch feucht geworden, hatte aber keinen Schaden genommen. Trent schnitt mit dem Messer ein paar dünne Stücke ab und schob sie sich in den Mund. Nach den Strapazen der Nacht benötigte er eine Stärkung.
Er hatte aufgehört zu frieren und genoss die warmen goldenen Strahlen. Aber er ließ sich nicht viel Zeit. Die Mutter hatte den Heuler abgelegt und wartete nun auf ihn. Er musste ihn erreichen, bevor die Drachen auf ihn aufmerksam wurden.
Die innere Stimme war leiser geworden, aber immer noch unüberhörbar. Trent schien nicht mehr weit entfernt zu sein. Entschlossen stand er auf, stopfte das Fleisch zurück in den Beutel und befestigte das kleine Fell an seinem Speer, damit es besser trocknen konnte. Mit lang ausgreifenden Schritten, den Drachenwehrer wie einen Wanderstab benutzend, schritt er in die Steppe hinaus. Alle Schmerzen, alle Gefahren waren vorbei – Trent verspürte nur noch ein ungeheures Glücksgefühl.
Ein entferntes Flattern ließ ihn erschreckt zum Himmel schauen. Ein Drache hatte sich vom Wald her genähert und beobachtete ihn interessiert von oben. Das war der einzige wirkliche Feind der Männer, besonders hier in der Steppe, in welcher der Drache ungehindert aus der Luft angreifen konnte. Trent hatte zwar gelernt, sich mit dem Drachenwehrer vor einem solchen Angriff zu schützen, doch nicht immer blieben die Männer Sieger. Auch sein Vater war nach einem Drachenkampf nicht mehr in seine Hütte zurückgekehrt. Die Überlieferungen sagten, es sei das natürliche Schicksal eines jeden Mannes, eines Tages von einem Drachen zerrissen zu werden. Sein Vater war also ehrenhaft gestorben, ebenso wie alle anderen Männer, die Trent gekannt hatte.
Die Sorge um den Heuler verlieh ihm ungeahnte Kräfte. Er stürmte vorwärts, nur ab und zu nach oben schauend, wo der Drache noch immer seine Kreise zog.
Ein Geräusch ließ ihn plötzlich stocken. Direkt vor ihm erhob sich ein Jelly aus dem tiefen Gras und flüchtete. Das ekelhafte Schleimwesen konnte erstaunlich schnell sein, auch wenn es sich sonst nur sehr langsam durch die Steppe bewegte. Die Männer mieden jede Begegnung, denn es sonderte eine übelriechende Flüssigkeit ab, die sich bei Berührung nur schwer wieder entfernen ließ. Da auch das Fleisch ungenießbar war, gab es keinen Grund, das Tier zu jagen. Ansonsten war es aber harmlos und hatte noch nie einen Sapien angegriffen. Es schien sich von den Gräsern der Steppe zu ernähren und fiel tagsüber in eine merkwürdige Erstarrung, aus der es erst wieder erwachte, wenn es dunkel wurde.
Trent schaute dem Jelly nachdenklich hinterher. Schon öfter hatte man eines dieser Tiere in der Nähe der Heuler aufgescheucht und in die Flucht getrieben.
Und plötzlich war er am Ziel seiner Wanderung angekommen. Er näherte sich einer flachen Mulde, die von hohem Gras umwachsen war. In der Mulde war das Gras plattgedrückt, als hätte sich ein schweres Tier darin herumgewälzt. Deutlich hing der üble Geruch des Jellys noch in der Luft, und Trent bemerkte den klebrigen Schleim an den Gräsern. Eine plötzliche Sorge überkam ihn. Sollte der Jelly dem Heuler ...?
Doch seine Befürchtungen waren unbegründet. Vor ihm, mitten in dem niedergetretenen Gras, sah er den Heuler. Er lag in einer weichen, lederartigen Kapsel, die ihn einhüllte und schützte.
Das Heulen in Trents Kopf hörte in dem Moment auf, in dem er ihn sah. Er nahm ihn auf, löste ihn vorsichtig aus der Hülle und betrachtete voller Glück das kleine Gesicht, aus dem ihm zwei helle Augen entgegenblickten. Beruhigend redete er auf den kleinen Kerl ein, der aufmerksam lauschte.
„Ich werde dich Muth nennen, denn mutig sollst du werden und unerschrocken den Drachen gegenübertreten, wenn du ein Mann bist. Bis dahin werde ich für dich sorgen und dir alles beibringen, wie es mein Vater auch für mich getan hat.“
Die Verbindung war hergestellt. Trent war glücklich – er hatte jetzt einen Sohn, und dieser Sohn sollte groß und stark werden. Dafür würde er als Vater schon sorgen.
Er schaute zum Himmel und hielt nach dem Drachen Ausschau. Doch dieser war verschwunden. Auch von dem Jelly war nichts mehr zu sehen, und Trent hatte keine Lust, der Schleimspur zu folgen.
Die Schlucht der Höhlen
Die Hauptfarbe des Flickenteppichs war rot in allen Schattierungen mit grünen Flecken. Koster starrte aus dem Fenster des Flugzeuges nach unten und beobachtete, wie sich der Teppich entfernte und immer weiter ausbreitete, bis er am Horizont im Dunst verschwand.
Pünktlich um 14.00 Uhr war er in Madrid gestartet und auf dem Weg nach Sevilla. Madrid lag in einer riesigen Ebene, die überwiegend rötlich leuchtete. Das Flugzeug flog nach Süden, und Koster konnte aus dem Fenster nach Westen sehen. In der Ferne zog sich eine Bergkette dahin, mit einem schneebedeckten Gipfel. Er fischte sich die Bordillustrierte aus dem Vordersitz, suchte nach einer Landkarte und fand eine ausgezeichnete geographische Spanienkarte. Koster hatte sich schnell orientiert. Die Bergkette musste das Kastilische Scheidegebirge sein, mit dem 2592 m hohen „Pico de Almanzor“. Unten lagen meist wenig bewachsene Flächen aus rotem Stein oder Sand. Nur vereinzelt leuchteten grüne Flecken dazwischen: graugrünes Grasland mit dunkelgrünen einzelnen Bäumen und Sträuchern oder olivgrüne Wälder. Im Gegensatz zu deutschen Landschaften gab es kaum rechteckige Flächen. Hier waren alle Linien gewunden wie zufällig liegengebliebene Bindfäden. Es war von hier oben nicht zu erkennen, ob die Linien Straßen oder Wasserläufe waren. Inzwischen war die Maschine schon einige tausend Meter hoch, und der Horizont verschwand im Dunst. Nach unten konnte er aber noch gut sehen.
Zehn Minuten später lag ein riesiger Stausee unter ihm. Der hohe, leicht gebogene Staudamm war deutlich zu sehen. Das musste der Stausee von Cijara sein, der den Lauf des Guadiana hemmte. Mehrere langgestreckte Höhenzüge in Ost-West-Richtung waren den Bergen der Sierra Morena vorgelagert, die vor ihnen lagen. Koster schaute nachdenklich hinunter. Dort unten, an einem der schroffen Felsen, lag sein eigentliches Ziel. Aber das war nur über Land zu erreichen.
Die Berge unter ihm wurden höher und zerklüfteter. An den Nordseiten der Täler lag noch Schnee. Es zogen immer mehr Wolken auf, doch ab und zu war ein Blick nach unten möglich. Gegen 14.50 Uhr machten die Berge einem weitgestreckten, grünen Tal Platz. Ein Fluss wand sich hindurch, undeutlich konnte Koster eine Stadt im Dunst erkennen. Es waren der Guadalquivir und Sevilla. Das Flugzeug ging in den Landeanflug über, und wenige Minuten später waren sie am Boden.
Lewin wartete schon ungeduldig hinter der Gepäckausgabe. Er konnte seine Aufregung kaum bändigen.
„Es ist überwältigend! Das müssen Sie unbedingt sehen!“, stürzte er auf Koster zu, kaum dass er ihn entdeckt hatte.
„Ja, ja, das haben Sie mir schon am Telefon gesagt! Deshalb bin ich ja hier“, wehrte Koster ab. Er war zwar auch begierig auf diese kleine Sensation, die sein Assistent entdeckt haben wollte, doch er blieb eher skeptisch. Echte Neuentdeckungen waren selten geworden.
„Haben Sie inzwischen alles vorbereitet?“, fragte er betont zurückhaltend.
„Ja, wir können sofort weiterfahren. Ich habe vorsichtshalber eine Ausrüstung zusammengestellt, die uns weitgehend unabhängig macht.“
Koster nickte zufrieden. Auf Lewin konnte er sich verlassen. Neben dem Terminal wartete schon ein geländegängiger Unimog mit Kastenaufsatz, der entfernt an ein Motorhome erinnerte. Bevor sie losfuhren, ließ er sich noch die Ausstattung zeigen. Über eine kleine Klappleiter an der Heckseite kam man in den Innenraum, der vollgestopft mit Kisten und technischen Geräten war.
„Ich musste etwas improvisieren“, erläuterte Lewin, „Natürlich durfte ich über den Zweck unserer Reise nichts verlauten lassen. Man hält mich hier für einen spinnerten Geologen, der nur Steine sammelt. Na ja, so falsch ist das ja auch nicht.“
Er zeigte auf die geschlossenen Kisten und erläuterte kurz den Inhalt. Mehrere Klapptische und Stühle standen an der Seitenwand. Wenn das Wetter mitmachte, konnten sie weitgehend im Freien arbeiten. Trotzdem hatte er auch ein größeres Zelt für die Arbeit und zwei Schlafzelte aufgeladen.
Koster war zufrieden. Er hielt es für ebenso unnötig, sich in Sevilla ein Hotelzimmer zu nehmen, wie Lewin. Die nächsten Tage würden sie ohnehin in den Bergen übernachten. Also konnten sie auch sofort losfahren. Auf der nördlichen Umgehungsstraße umfuhren sie Sevilla, überquerten den Guadalquivir und bogen nach Norden auf die Straße Richtung Merida ab. Nach einigen Kilometern hatten sie das breite Tal des Flusses verlassen und fuhren immer höher in die Berge der Sierra Morena. Noch befanden sie sich auf der gut ausgebauten Europastraße und kamen zügig voran. Koster hatte Zeit genug, die Geschehnisse der letzten Tage an sich vorbeiziehen zu lassen. Als Anthropologe auf dem Spezialgebiet der Paläoanthropologie und Paläontologie besaß er zwar einen Lehrstuhl der Fakultät für Geowissenschaften an der Universität München, doch seine Arbeit trieb ihn immer wieder in die Welt hinaus, wenn es um neue Funde ging, die seine Forschungen über die Entstehung der Menschheit unterstützten. Es war ihm aber unmöglich, an jeder Ausgrabungsstätte anwesend zu sein, um nach Hinweisen zu suchen. In dieser Hinsicht unterstützte ihn sein wissenschaftlicher Assistent und „Hans Dampf in allen Gassen“ Dr. Josef Lewin. Wie ein Sensationsreporter verfolgte er weltweit alle Hinweise auf Ausgrabungen und paläontologische Funde und recherchierte sorgfältig, ob sie für die Forschung Kosters Bedeutung haben könnten. Vor einigen Wochen war ihm eine kleine Pressemitteilung aufgefallen, die jedoch kaum allgemeines Interesse erweckt hatte.
An einem Höhenzug nördlich der spanischen Sierra Morena war es durch geotektonische Verschiebungen zu einem Bergsturz gekommen, bei der einige bis dahin unzugängliche Höhlen freigelegt wurden. Ein Schafhirt hatte eine Höhle betreten und die Knochen eines angeblich großen Tieres gesehen. Der Veterinär der nächsten Kleinstadt identifizierte sie als „ungewöhnlich große Rinderknochen“, und damit schien die Angelegenheit zunächst erledigt zu sein. Nicht jedoch für Lewin, dem die „ungewöhnlich großen Rinderknochen“ nicht aus dem Kopf gingen. Mit Genehmigung der Universität und im Auftrag Kosters fuhr er persönlich dort hin, um sich den Fund anzusehen. Er fand schnell heraus, dass es keine Rinderknochen sein konnten, denn sie unterschieden sich erheblich von denen in Form und Größe. Telefonisch teilte er Koster mit, dass er es für angebracht hielt, wenn dieser den Fund persönlich begutachtete.
So kam es denn, dass sich Koster auf den Weg machte. Heute früh war er in München in einer Linienmaschine nach Madrid gestartet und dort in ein kleineres Inlandflugzeug nach Sevilla umgestiegen. Den Rest der Strecke konnte man nur mit dem Auto zurücklegen.
Lewin kannte sich inzwischen aus. Er war die Strecke in den letzten Wochen schon mehrmals gefahren. Das Ziel in den Bergen war heute nicht mehr zu erreichen. Sie beschlossen deshalb, in einem kleinen Motel kurz hinter Santa Olalla del Cala zu übernachten, um dann am nächsten Morgen ausgeruht weiterzufahren.
Die Sonne brannte schon früh am Morgen, als die Männer aufbrachen. Nach wenigen Kilometern bogen sie auf eine kleinere Straße Richtung Llerena ab und kletterten auf der Serpentinenstrecke immer höher in die Berge. Sie hatten kaum einen Sinn für die landschaftlich eindrucksvolle Fahrt. Koster war begierig, die versprochene Höhle zu besichtigen und Lewin noch aufgeregter in der Erwartung, seine Entdeckung zu zeigen.
Eine Schotterstraße führte sie zu dem kleinen Dorf Puebla del Valle, in dem der Schafhirt Ortega wohnte. Doch zunächst suchten sie diesen nicht auf, sondern fuhren weiter auf abenteuerlichen Pfaden in ein schmales Tal hinein. Zu beiden Seiten erhoben sich steile Felsen, die sich zum Teil mehrere hundert Meter über das Niveau des Weges erhoben. Es wurde immer schwieriger, mit dem Unimog zu fahren. Der Pfad bestand hauptsächlich aus dem Geröll, das im Laufe der Jahrhunderte von den Bergen herabgefallen war. Ein schmaler Trampelpfad war gut zu erkennen, auf dem wahrscheinlich seit Urzeiten Schafe und Menschen gewandert waren. Lewin hatte mit Hilfe des Schafhirten in den letzten Tagen einige größere Felsbrocken beiseitegeschafft, um die Auffahrt mit dem Unimog zu ermöglichen.
Das Tal stieg gleichmäßig an, und im gleichen Maße wurden die Berge zu beiden Seiten niedriger. Stundenlang schaukelten die beiden Männer im Schritttempo voran. Lewin erwies sich als hervorragender Fahrer auf dieser schwierigen Piste.
Als sich das Tal verbreiterte, konnte Koster die geologischen Schichtungen an der Nordwand besser erkennen. Er versuchte, sie einzuordnen. Die harten Abrisskanten deuteten auf erdgeschichtlich späte Erhebungen hin. Die Erosionen waren noch nicht sehr stark ausgeprägt.
Lewin zeigte auf einen Bergrutsch an der Nordwand, der das Tal erheblich schmaler gemacht hatte.
„Wir sind da!“
Koster betrachtete beim Näherkommen prüfend die Wand und entdeckte eine ganze Reihe von Höhleneingängen, die offensichtlich durch diesen Erdrutsch freigelegt worden waren. Es sah so aus, als wäre ein haushoher Felsenkeil durch Erosion abgesprengt und in die Schlucht gefallen. Riesige scharfkantige Steine lagen am Fuß der Felswand und reichten fast bis zu einem Drittel hinauf.
Lewin hielt den Unimog am Fuße des Geröllhaufens an.
„Dort hinauf!“, zeigte er auf ein dunkles Loch, das über den Bergrutsch zu erreichen war. Die Männer begannen, über die Felsbrocken hinaufzusteigen. Nach einigen Metern fasste sich Lewin an den Kopf und stieg wieder hinab. Mit zwei kräftigen Akkulampen machte er sich erneut an den Aufstieg. Koster hatte inzwischen geduldig gewartet. Er wollte Lewin nicht den Triumph nehmen, ihm die Höhle persönlich zu zeigen. Von der ungewohnten Anstrengung nach Atem ringend, kamen sie oben an. Der Höhleneingang war so hoch, dass sie aufrecht gehen konnten. Die Lampen benutzten sie zunächst nicht. Langsam gingen sie hinein. Der Boden war glatt und sah so aus, als wäre er über lange Zeit begangen worden.
Sie folgten einem etwa vier bis fünf Meter langen Gang, in den zurzeit die tief stehende Nachmittagssonne hineinschien. Danach öffnete sich der Gang zu einer mehrere Meter breiten Höhle.
Hier lag eine Vielzahl von Knochen. Ganz vorn war ein merkwürdig geformter Schädel zu sehen, danach folgten weitere Knochen, die offensichtlich zu einem langgestrecktem Tier gehörten, das hier gestorben und danach nicht mehr bewegt worden war. Eine Reihe von Schwanzknochen verlor sich im Halbdunkel der Höhle.
Koster schüttelte den Kopf. Das war äußerst untypisch. In solchen verschlossenen Hohlräumen, die durch Abspaltungen frei wurden, konnte man normalerweise niemals Reste von Lebewesen finden. Wie sollten sie auch hineingeraten sein?
Jetzt erst schaltete er seine Lampe an. Die Knochen waren gut erhalten. Koster kramte in seinem Gedächtnis, ob er derartig geformte Knochen schon gesehen hatte. Sie passten zu keinem Tier, das ihm bekannt war, einschließlich der prähistorischen. Ohne Zweifel waren es aber keine Rinderknochen, wie es der Veterinär behauptet hatte.
Das Tier hatte eine Körperlänge mit Hals und Kopf von ca. drei Meter, zuzüglich einem Schwanz von etwa der gleichen Länge. Es lag auf fast sechs Meter ausgestreckt. Wer dieses mit einem Rind verwechseln konnte, musste schon sehr schlecht sehen können. Koster schaltete seine Lampe ab und wies Lewin ebenfalls dazu an. Im Halbdunkel waren jetzt nur noch die Schädel- und Halsknochen gut zu erkennen. Der Rest verlor sich in der Dunkelheit der Höhle. Wenn man sich nun noch die Situation am Vormittag vorstellte, wenn die Sonne nicht durch den Gang schien, dann war der Irrtum des Veterinärs vielleicht verständlich.
„Na, was sagen Sie nun, Professor?“, fragte Lewin gespannt.
Kosters Aufregung war bereits von nüchterner Überlegung verdrängt worden. Trotzdem stellte sich eine ungeheure Spannung ein.
„Das ist eine Sensation!“, sagte er anerkennend, „Das ist die ungewöhnlichste Entdeckung, die wir jemals gemacht haben.“
Kopfschüttelnd schritt er die Länge des Skelettes ab, als wollte er sie messen.
„Ich weiß nur nicht, was das sein soll. Vielleicht eine völlig neue Spezies. Das wäre wahnsinnig!“
Entschlossen drehte er sich um und hob die Hand zu einem triumphalen Schlag in die ebenso erhobene Hand Lewins. Dann umarmte er gegen alle Gewohnheiten seinen Mitarbeiter und Freund, der gar nicht wusste, wie ihm geschah.
„Es liegt viel Arbeit vor uns!“, sagte Koster. „Erst das Standardprogramm: Altersbestimmung, chemische Zusammensetzung der Knochen und der Umgebung, geologische Besonderheiten, Altersbestimmung der Höhle, Rekonstruktion und so weiter. Doch zunächst bleibt alles geheim: keine Presse, keine Auskünfte an Dorfbewohner etc. Wir wollen keine schlafenden Hunde wecken. Wir müssen erst wissen, was das ist, ehe wir an die Öffentlichkeit gehen.“
„Vielleicht ist es ja auch nichts“, fügte er nachdenklich hinzu.
„Natürlich ist es was!“, protestierte Lewin: „Das hab ich im Gefühl!“
Koster hob besänftigend die Hand.
„Abwarten.“
Sie verließen die Höhle wieder und schauten in die untergehende Sonne. Sie hatten nicht mehr viel Zeit, um sich für die Nacht einzurichten.
Unter einem Felsvorsprung an der gegenüberliegenden Wand fanden sie einen geschützten Platz für die Zelte. Lewin hatte sie schnell aufgebaut, während Koster schon die Ausrüstung sichtete. Das große Zelt richteten sie als Arbeitsraum und Laboratorium ein. Der Einfachheit halber stellte Koster auch sein Feldbett hinein. Er hasste die kleinen Schlafzelte. Lewin stellte siegesgewiss eine Flasche schweren Portwein auf den Klapptisch, als sie alles eingerichtet hatten.
„Wir haben einen Grund zum Feiern!“, sagte er, Koster ein gefülltes Glas reichend. „Den Rest der Flasche trinken wir, wenn wir wissen, was es ist.“
Befriedigt saßen die Männer anschließend in der warmen Abendluft und nutzten die Gelegenheit, wieder einmal ausgiebig miteinander zu reden. Lewin hatte viel zu erzählen und neigte dazu, seine Erlebnisse mit weiteren Arabesken zu versehen. Koster schmunzelte. Er kannte seinen Freund gut und freute sich immer wieder über diese seltenen Abende, die sie für sich allein hatten. Als sich Lewin schließlich in sein Schlafzelt zurückzog, hatten sie die Flasche doch schon geleert.
Am nächsten Morgen stiegen sie mit Fotoapparaten, Maßbändern und Zeichenbrettern nach oben. Bevor sie auch nur einen Knochen berührten, wurde die ganze Szene ausgiebig fotografiert. Die Lage in der Höhle war ebenso wichtig, wie die Position der Knochen zueinander.
Dann folgte eine Aufmessung des Skeletts. Kosters Schätzung vom Vortag war ziemlich genau. Das gesamte Skelett vom Kopf bis zum Schwanz hatte eine Länge von 5,90 Meter, wovon fast genau drei Meter auf den Schwanz entfielen. Dem ersten Anschein nach, konnte es ein Saurier sein. Doch dann musste es eine bisher unentdeckte Art sein. Das Skelett passte zu keiner der bekannten Typen. Völlig verblüfft war Koster, als er schließlich einen Knochen aufnahm. Er hatte offensichtlich kein Fossil – also keine Versteinerung – in der Hand, sondern einen Knochen im Originalzustand. Er war ungewöhnlich leicht und bestand aus einer Vielzahl feinster Lamellen, die zu einer luftigen Konstruktion allerfestester Bauart gewachsen waren. Ähnliche Knochen hatten auch die heutigen Vögel und die flugfähigen Echsen der Vorzeit. Koster zweifelte plötzlich an der Sauriertheorie. Das Skelett musste erheblich jünger sein. Vielleicht war der Fund aus prähistorischer Sicht doch wertlos. Aber er deutete auf eine noch nicht entdeckte Tierart hin.
Lewin hatte sich inzwischen in der Umgebung umgesehen und kam mit der Nachricht zurück, dass er in einer anderen Höhle ein weiteres Skelett entdeckt habe. Die Höhle war nur durch eine waghalsige Klettertour zu erreichen, da sie einige Meter oberhalb des Geröllberges lag. Trotzdem stieg Koster hinauf. Wie Lewin bereits berichtet hatte, lag auch in dieser Höhle ein Skelett gleicher Art und etwa gleicher Größe. Doch Koster fiel sofort eine Besonderheit auf. Auf dem flachen Brustbein war eine deutliche Kratzspur zu sehen, die unmöglich erst nach dem Tod des Tieres entstanden sein konnte. Koster befühlte den scharfkantigen Riss, der die zarte Lamellenstruktur an der Oberfläche zerstört hatte. Nach den Erfahrungen ähnlicher Funde handelte es sich eindeutig um die Einwirkung mit einem scharfen Gegenstand – wahrscheinlich einer Waffe.
Die Entdeckung wurde immer rätselhafter. Nachdenklich schaute Koster die Felswand empor, nachdem er wieder abgestiegen war. Viele dunkle Löcher deuteten auf weitere Höhleneingänge hin. Sollten sich in den Löchern noch andere Skelette befinden? Hatten sie hier eine ganze Kolonie unbekannter Spezies entdeckt, die in ihren Höhlen gesessen hatten, wie Bienenlarven in ihren Waben?
Das Projekt schien plötzlich zu groß für nur zwei Personen zu werden. Das Institut in München musste ihnen weitere Unterstützung schicken. Über Handy nahm Koster Verbindung auf und schilderte die vorgefundene Situation. Ihm wurden zwei Geologen bewilligt, die sich mit weiterer Ausrüstung auf den Weg machen sollten. Inzwischen arbeitete er mit Lewin weiter.
Zunächst war es wichtig, das Alter der Knochen zu bestimmen. Allerdings war das mit den vorhandenen Instrumenten nicht möglich. Eine genaue Datierung ließ sich nur mit der Radiocarbon-Methode erreichen. Die erforderlichen Geräte befanden sich aber in München. Koster schickte Lewin mit einem ausreichend großen Schwanzknochen nach Sevilla, um dort die kostbare Sendung als Luftfracht aufzugeben. Der örtlichen Post wollte er nichts anvertrauen.
Für Hin- und Rückfahrt benötigte Lewin zwei Tage. In der Zwischenzeit arbeitete Koster weiter. Kurz nachdem Lewin abgefahren war, erschien ein Einheimischer, der sich als Ortega, der Schafhirt vorstellte. Er trieb eine Schafherde durch die Schlucht und kam dabei an den Zelten vorbei. Koster nutzte die Gelegenheit, ihn über die geographische Situation vor dem Erdrutsch zu befragen. Er erfuhr, dass die Schlucht vorher zu beiden Seiten von steilen Felswänden begrenzt gewesen war. Die Höhleneingänge waren erst durch den Erdrutsch zum Vorschein gekommen. Koster musterte die geologische Schichtung der Felswände zu beiden Seiten und stellte deutliche Übereinstimmungen fest. Das deutete darauf hin, dass die beiden Felswände früher einmal verbunden gewesen waren und irgendwann in grauer Vorzeit durch Verschiebung getrennt wurden. Eine Auswaschung durch Erosion schied aus. Dafür gab es keine eindeutigen Hinweise. Wenn das aber stimmte, folgerte Koster, müssen die Hohlräume früher in dem intakten Felsen gewesen sein. Die Anwesenheit der Skelette wurde dadurch noch unerklärlicher.
Als Ortega seine Schafe weitertreiben wollte, forderte er Koster auf, mitzukommen. Beide stiegen schweigend die Schlucht hinauf. Koster ließ seinen Gedanken freien Lauf, was ihm während solcher Wanderungen immer am besten gelang. So merkte er kaum, dass sie oben angelangt waren.
Sie standen plötzlich auf einem Hochplateau mit weitem Blick über eine bis zum Horizont reichende Ebene. Die fantastische Aussicht nahm Koster gefangen. Obwohl sie nun schon einige Tage in der Nähe kampierten, waren weder Lewin noch er selbst auf die Idee gekommen, die Schlucht bis nach oben zu gehen.
Die Schafe verteilten sich und knabberten an dem kärglichen Gras, und Koster ging bis an den Rand des steilen Felsens, der hier oben schon kräftig abbröckelte. Er setzte sich auf einen Stein und entspannte seinen Geist, der in den letzten Tagen auf Hochtouren gearbeitet hatte. Eine Stunde hier oben, schien wie ein ganzer Tag Urlaub zu sein. Er verstand plötzlich den Schafhirten viel besser, der mit seinem Leben völlig zufrieden war.
Ortega setzte sich zu ihm und bot ein Stück Brot an, das er von einem runden Laib abbrach und wickelte einen Schafskäse aus einem schmuddeligen Tuch. Doch das störte Koster nicht. Es war schon Mittag, und selten hatte es ihm so geschmeckt.
Nachmittags machte sich Koster wieder an den Abstieg. Ortega blieb oben. Eine alte Decke, in die er sich nachts einrollen konnte, reichte ihm völlig aus. Am Abend des nächsten Tages traf auch Lewin wieder ein. Er hatte nicht nur die wertvolle Fracht aufgegeben, sondern auch gleich die beiden Geologen Menzel und Lukas mitgebracht. Beide gehörten schon seit Jahren zum Team, und Koster vertraute ihrem Sachverstand bedingungslos.
In ihrer Ausrüstung brachten sie auch einige Aluminiumstangen mit, aus denen man ein leichtes Gerüst aufbauen konnte, um die übrigen Höhlen zu erforschen.
Die nächsten Tage waren nicht nur mit wissenschaftlicher sondern auch mit harter körperlicher Arbeit angefüllt, denn die Gerüste mussten immer wieder auf- und abgebaut werden, um die einzelnen Eingänge zu erreichen. Es erwies sich als zweckmäßig, bis an den oberen Rand der Felswand zu klettern, um dort Seile zu befestigen, an denen Steckleitern aufgehängt und Gerüstteile gesichert werden konnten.
Der Einsatz lohnte sich. In fast jeder der Höhlen wurde ein Skelett gefunden.
Altersbestimmung
Für den wissenschaftlichen Mitarbeiter Becher in München schien es zunächst nur ein Routineauftrag zu sein, das Alter des Knochens nach der Radio-Carbon-Methode zu bestimmen. Die Form interessierte ihn nicht im Mindesten, höchstens das Gewicht, denn er benötigte eine ganze Menge, um das erforderliche Kohlendioxidgas zu extrahieren. Doch der vorhandene Knochen reichte aus, in mehrere Liter Gas verwandelt zu werden. Danach war er allerdings aufgebraucht und fehlte somit in dem Skelett. Aber es gab ja genügend davon.
Er leitete das Gas in den großen Low-Level-Messdetektor, um mit dem Geiger-Müller-Zählrohr die Aktivität des C14-Gehalts zu messen. Das nahm einige Zeit in Anspruch. Die Werte wurden ständig gemessen und digitalisiert an einen Computer weitergeleitet. Das lief alles vollautomatisch. Zum Schluss brauchte Becher nur noch das ermittelte Alter abzulesen. Beruhigt begab er sich zum Frühstück in den Aufenthaltsraum.
Als er wieder zurückkehrte, fiel ihm sofort das auf dem Bildschirm blinkende Wort „Fehlmessung“ ins Auge.
„Schei … benkleister!“, fluchte er laut, denn die nun verlorene Probe kam ihm sofort in den Sinn.
Die Auswertung des Computerprotokolls zeigte keinerlei Anzeige von C14-Zerfällen an. Das war nicht möglich, denn jeder Knochen hatte nachweisbare C14-Isotopen. Der Versuch war missglückt, und Becher konnte sich nicht erklären, welchen Fehler er gemacht hatte. Es blieb ihm nichts weiter übrig, als zu Professor Koster telefonisch Kontakt aufzunehmen und um eine weitere Probe zu bitten. Das würde wieder einige Tage dauern.
Diesmal schickte Koster eine ganze Kiste Knochen nach München. Es waren jetzt genügend vorhanden.
Der erneute Versuch brachte ebenfalls keinen Nachweis an C14 Isotopen, und Becher sicherte sich die Unterstützung des Laborleiters. Gemeinsam unternahmen sie den dritten erfolglosen Versuch. Es gab nur zwei Erkenntnisse, die sich daraus ergaben: Entweder handelte es sich nicht um organische Knochen oder ...
Die zweite Alternative war so unwahrscheinlich, dass sie eigentlich ausschied. Doch Becher fing an zu zweifeln. Bei der Radio-Carbon-Methode misst man das Verhältnis der Strahlenaktivität des Probenkohlenstoffs zu derjenigen von rezentem Kohlenstoff, also zum Beispiel in frischen Knochen. Der letztere Wert war ständig im Computer eingespeichert.
Die Strahlung nahm mit einer Halbwertszeit von 5730 Jahren ab. Durch die Zählung der Zerfälle einer Probe in empfindlichsten Messröhren konnte das Alter so lange bestimmt werden, bis keine Zerfälle mehr nachweisbar sind. Diese Grenze war allgemein nach neun Halbwertszeiten oder etwa 50.000 Jahren erreicht. Danach wurden die Messungen zu ungenau oder waren unmöglich.
Das Ergebnis stand plötzlich deutlich vor Bechers Augen. Wenn in der Probe kein Zerfall mehr nachgewiesen werden konnte, war sie erheblich älter als 50.000 Jahre.
Nach telefonischer Rücksprache mit Koster, bat dieser, mit anderen Methoden das ungefähre Alter zu bestimmen. Das Projekt wurde nun in München zur Chefsache erklärt. Ein ganzes Laborteam versuchte, dem Alter auf die Spur zu kommen. Dies gelang schließlich mit der Uran-Helium-Methode, bei der die in der Probe ermittelten Alpha-Teilchen gemessen wurden, die sich beim Uran-Zerfall in Helium-Atome umwandelten. Die Methode war zwar sehr viel umständlicher und das Ergebnis nicht sehr genau, doch auf einige Jahrhunderte kam es jetzt nicht mehr an. Mehrere Versuche brachten identische Ergebnisse:
Die Knochen waren mit ziemlicher Sicherheit etwa 10 Millionen Jahre alt.