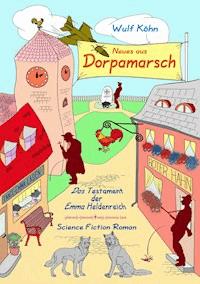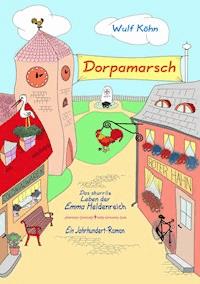
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Emma Heldenreich im Jahre 2014 starb, war sie vermutlich die älteste Frau Deutschlands. Im Roman verbindet sich ihr Leben mit zahlreichen historischen Ereignissen, die von ihr und ihrer Familie teilweise auf skurrile Weise beeinflusst werden. Emma Heldenreich wird am 1. Januar 1900 als erstes Kind des 20. Jahrhunderts im Kaiserreich Deutschland in dem kleinen norddeutschen Dorf Dorpamarsch als Tochter eines Kaufmanns geboren. 1906 kommt ihre Schwester Berta und 1914 ihre Schwester Dora zur Welt. Die drei Mädchen wachsen in behüteter familiärer Umgebung auf, während der erste Weltkrieg und die Inflation über Deutschland hinwegziehen. Der Vater August Heldenreich entwickelt ein eigenes listenreiches System zum Überleben. Er stirbt mit dem Ende der Inflation beim Verzehr eines Hechtes. Die Geschichte der Familie ist auf verschiedene Weise mit einigen historischen Ereignissen verwickelt. Der "Hauptmann von Köpenick" ist daran ebenso beteiligt, wie der Untergang der Titanic und der Großbrand des Passagierschiffes "Europa" im Hamburger Hafen. Nachdem die Mutter auf dramatische Weise den Tod findet, stehen die Mädchen als Vollwaisen da, was allerdings nur für die 14-jährige Dora von Bedeutung ist. Sie soll von der Jugendbehörde in ein Waisenhaus eingewiesen werden. Um das zu verhindern, heiratet Emma und übernimmt die Vormundschaft für ihre Schwester. Die drei Schwestern Emma, Berta und Dora beschließen, ihr ganzes Leben lang zusammenzubleiben und bekräftigen das mit dem Schwur der drei Musketiere: "Eine für alle – alle für Eine!". Dieses halten sie auch bis zu ihrem Tode durch. In den folgenden Jahrzehnten erleben sie das Dritte Reich und wehren sich auf eigene Weise gegen die Auswüchse der Hitlerdiktatur, verstecken zwei Jahre lang drei jüdische Familien in ihrem Haus und erleben den Einmarsch der Russen. Es gelingt ihnen mit List, sich selbst und alle Frauen des Dorfes vor den gefürchteten Vergewaltigungen zu retten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wulf Köhn
Dorpamarsch
Das skurrile Leben der Emma Heldenreich
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
1900 - Es hat Zwölf geschlagen
1906 - Kaiserlicher Hof- und Marinelieferant
1906 - Ein Schuster auf der Durchreise
1912 - Flaschenpost
1914 - Die Helden von Dorpamarsch
1919 - Augustmark
1924 - Der Kopf des Hechtes
1926 - Hochzeit mit Rosenstrauch
1928 - Zubrowski
1929 - Das Ende Europas
1929 - Eine für alle – alle für Eine!
1933 - Nomen est omen
1936 - Helden der Lüfte
1937 - Hindenburg
1939 - Schon wieder Krieg!
1941 - Das Gewölbe
1942 - Flaggenparade
1943 - Schweinebacke und die Juden
1945 - Die Russen kommen
1946 - Sturmfest und erdverwachsen
1948 - Ein Euter in der Not
1958 - Janus, der Zweiseitige
1959 - Über die Alpen mit Äskulap
1959 - Diebe haben’s schwer
1960 - Begleitservice
1961 – Die Sicherung der Staatsgrenze
1965 - Stromklau
1971 - Kampf um den Laden
1985 - Moorwanderung
1986 - Der Nichtentrick
1988 - Ab in die Pilze!
1989 - Tante Emmas Heidetropfen
1989 - Seniorenresidenz Heidemoor
1989 - Menschenraub
1990 - Das Lotterielos
1990 - Tod im Schneckenhaus
1990 - Das Leben geht weiter – zu dritt!
1991 - Emmas Grab
1996 - Scharade
2000 - Emma wird 100
2000 – Doras seltsames Verschwinden
2002 - Die Schiffstaufe
2003 - Das Geburtstagsgeschenk
2004 - Sturmwarnung
2014 - Die älteste Frau Deutschlands
Epilog
Personen
Über den Autor
Impressum neobooks
Jeder von uns ist ein Teil der Weltgeschichte.
Prolog
Es war ihr Wunsch gewesen, in ihrem Heimatdorf beerdigt zu werden, und so kehrte Emma Heldenreich im Jahre 2014 nach einem langen Leben wieder zurück.
Als sie nach Hause kam, folgte ihr der längste Trauerzug, den Dorpamarsch jemals gesehen hatte. Die halbe Schiffsbesatzung war von Bremerhaven aus angereist, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Die kleine Kapelle des Friedhofs reichte bei Weitem nicht aus, die vielen Trauergäste aufzunehmen, doch der Chief hatte die technischen Voraussetzungen geschaffen, die Feier per Lautsprecher nach außen zu übertragen.
Neben dem Pastor verabschiedete sich der Kapitän und bedankte sich im Namen der ganzen Mannschaft für die Wärme, die sie allen entgegengebracht hatte.
Die Matrosen bildeten ein Spalier von der Kapelle bis zur ausgehobenen Grube. Sechs Offiziere trugen den Sarg auf ihren Schultern, während ein Trompeter der Bordkapelle „Il Silenzio“ spielte. Der Arzt sprach leise den Abschiedstext:
Buona notte, amore
Ti vedrò nei miei sogni
Buona notte a te che sei lontana
Gute Nacht, Liebste,
Ich sehe dich in meinen Träumen,
Gute Nacht dir, die du so fern bist.
Als der Sarg in die Grube gesenkt wurde, pfiff der Maschinenwart Seite nach alter Marinetradition.
1900 - Es hat Zwölf geschlagen
Natürlich war Emma nicht von Anfang an die älteste Frau in Deutschland. Das ergab sich naturgemäß erst in späteren Jahren, nachdem alle vor ihr geborenen Frauen verstorben waren. Doch dazu kommen wir später.
Um aber etwas mehr über diese bemerkenswerte Frau zu erfahren, müssen wir bereits bei ihrer Geburt anfangen. Und das war auch schon aufregend genug.
Es begann am Silvesterabend 1899 in dem kleinen Dorpamarsch, einem unbedeutenden Dorf im Norden Deutschlands, irgendwo im Marschland an dem kleinen Flüsschen Dörpe. Es war so unbedeutend, dass die Einwohner es auch manchmal als Dorp am Arsch aussprachen. Vielleicht war das ja auch der Ursprung des Namens. Niemand hatte das bisher so richtig erkundet. Doch es besaß immerhin einen Kaufmannsladen und ein Dorfgasthaus, das interessanterweise den Namen „Zum Roten Hahn“ trug, wahrscheinlich, weil sich dort immer die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr trafen – und das waren praktisch alle männlichen Einwohner Dorpamarschs, die bereits laufen konnten.
Natürlich gab es auch eine Kirche in der Mitte des Dorfes, gleich neben dem Roten Hahn, mit einem trutzigen viereckigen Turm, der weit über das flache Land hinwegschaute. Das Beste aber waren die vier großen Uhren an jeder Seite des Turmes. Eigentlich war es nur eine einzige Uhr im Innern des Turmgemäuers mit vier gewaltigen Zifferblättern nach allen Himmelsrichtungen. Das war für die meisten Bewohner die einzige Uhr, die ihnen zur Verfügung stand. Die Bauern auf dem Felde, die Schulkinder, der Briefträger, der Dorfgendarm – alle hatten die Uhr ständig im Blickfeld. Sie war sozusagen die Normzeit des Dorfes und die wenigen Standuhren oder seltenen Taschenuhren wurden nach ihr gestellt.
Dass die Turmuhr auch immer richtig ging, dafür sorgte Küster Schaapmann, der einmal wöchentlich in das Turmuhrenstübchen kletterte, um mit einer Handkurbel den schweren Stein nach oben zu ziehen, der das gewaltige Uhrwerk antrieb, und gleichzeitig nach seiner eigenen Taschenuhr zu stellen. War er dann wieder unten, verglich er seine eigene Uhr mit der Turmuhr. Wenn beide exakt die gleiche Zeit anzeigten, konnte er befriedigt feststellen, dass die Zeit wieder einmal stimmte.
Sie würde in dieser Silvesternacht noch eine bedeutende Rolle spielen, auch wenn die Zeiger in der Dunkelheit gar nicht zu erkennen waren. Dafür schlugen die Uhrglocken umso lauter. Zu jeder vollen Stunde war die Stundenzeit zu hören und zu jeder Viertelstunde ein einzelner Schlag. Da der Rote Hahn direkt daneben lag, lauschten alle Anwesenden jeden Abend auf die zwölf Schläge, denn um Mitternacht machte der Wirt dicht. „Feierabend!“, verkündete er dann formell und wartete, bis die Gäste in aller Ruhe noch ihr Glas ausgetrunken hatten. Das konnte noch mal ein Viertelstündchen dauern, doch Nachschub gab es nicht mehr. Meist tranken die Gäste aber ihr Glas zügig aus und machten sich auf den Heimweg, denn ihre Frauen hatten die mitternächtlichen Glockenschläge ebenfalls gehört und warteten. Wo sollten die Männer auch sonst hin um diese Stunde?
An diesem Silvesterabend war aber alles etwas anders. Heute gab es keine Sperrstunde! Man wollte ja in das neue Jahr hineinfeiern. Es stand sogar ein neues Jahrhundert bevor! Dachte man jedenfalls, denn genau genommen, begann das neue Jahrhundert ja nicht am 1. Januar 1900, sondern erst ein Jahr später. Das hatte der alte Dorfschullehrer Nils Hempelmann versucht, den Dörflern am Stammtisch einmal klarzumachen. Doch so richtig begriffen hatte das keiner, genauso wenig, warum 1901 das Zwanzigste Jahrhundert anfangen sollte, obwohl doch jeder sehen konnte, dass das Jahr mit einer „19“ begann. „Der Lehrer spinnt!“, dachten die Bauern, nur der Pastor Leverenz meinte, der Lehrer könnte wohl recht haben.
Der Kaufmann August Heldenreich gab ihm ebenfalls recht, denn der kannte sich schon von Berufs wegen mit der Rechnerei aus. Aber an diesem Silvesterabend 1899 spielte das alles keine Rolle. Man feierte in das neue Jahrhundert hinein, weil man das überall so machte.
Zu diesem Anlass waren ausnahmsweise auch die Damen des Ortes, die sonst zu Hause geduldig auf ihre Männer warteten, im Roten Hahn versammelt. Der Wirt hatte die Gaststube mit einigen Girlanden geschmückt, ein frisches Fass Bier angestochen und für die Damen einige Flaschen Aprikosenlikör bereitgestellt. Sicherheitshalber hielt er für Mitternacht auch noch einen Kasten Schaumwein, den er großzügig als „Schampus“ bezeichnete, bereit.
Bier und Schnaps flossen reichlicher als an gewöhnlichen Tagen durch die Kehlen, die Damen hielten sich etwas zurück, doch wurde die Stimmung immer fröhlicher und vor allem immer lauter.
Nur einer konnte sich nicht so richtig auf die Feier konzentrieren. Es war August Heldenreich, der ohne Frau gekommen war.
August Heldenreich hieß eigentlich Karl Heinrich Hermann, genannt August, Heldenreich. Ja, das „genannt August“ gehörte wirklich zu seinem behördlich eingetragenen Vornamen. Das hatte auch seinen Grund: Er war der Sohn des Landwirtes Hinz Heldenreich, der seinem Namen viel Ehre machte und innerhalb von sechs Jahren gleich vier Helden zeugte. Was tat man nicht alles für Kaiser und Vaterland! August war der jüngste Sohn, der wie seine Brüder die gleichen Taufpaten hatte. Das waren die drei Brüder seines Vaters Karl, Heinrich und Hermann Heldenreich. Alle drei gaben ihre Namen an die jungen Helden weiter. So kam es, dass alle vier Knaben die Vornamen Karl Heinrich Hermann bekamen. Das war bei den ersten drei kein Problem, denn sie wurden Karl Heldenreich, Heinrich Heldenreich und Hermann Heldenreich genannt. Nur bei dem Jüngsten wurde es problematischer. Es blieb kein Rufname für ihn übrig. So nannte man ihn einfach „August“, obwohl er Karl Heinrich Hermann hieß. Das ganze Dorf nannte ihn so, und er selbst hörte von Kindesbeinen an auch nur auf den Namen August, bis er seine Frau Wilhelmine ehelichen wollte und dem Bürgermeister Brödermann, der zugleich Standesbeamter war, seinen Taufschein vorlegte. Der fand sofort das Haar in der Suppe, aber nicht den Vornamen August. „So geht das aber nicht, August!“, entschied er. „Du kannst nicht unter dem Namen August heiraten, wenn du ganz anders heißt!“
Da war guter Rat teuer. Jeder der drei anderen Namen hätte in dem kleinen Dorf unweigerlich zu Verwechslungen und Missverständnissen mit seinen Brüdern geführt. Da entschied Brödermann, den Zusatz „genannt August“ offiziell in seine Papiere einzufügen. Damit konnten alle Beteiligten leben.
Das war vor gut einem Jahr gewesen, und heute war Wilhelmines und August Heldenreichs großer Tag. Ein neuer Held wollte das Licht des Tages erblicken, auch wenn das in diesem Fall das Licht einer Petroleumlampe war.
Um Mittag hatten die Wehen begonnen, und die Nachbarin Emma Hibbel hatte Lisbeth gerufen. Die alte Hebamme war herbeigeeilt und hatte zunächst einmal August hinausgeworfen. „Mannsleute haben hier nichts zu suchen! Ihr habt euer Vergnügen gehabt, nun sind die Weiber dran!“, verkündete sie resolut und forderte heißes Wasser, saubere Tücher und eine Kanne Kaffee. Das konnte beim ersten Kind lange dauern!
August überließ das Feld also den drei Frauen, verzog sich in den Roten Hahn und freute sich schon auf seinen Helden. Ein bisschen Sorge hatte er natürlich auch um Wilhelmine, denn eine Geburt war immer mit einer gewissen Gefahr verbunden.
„Eine Runde auf Wilhelmine und meinen Sohn!“, verkündete er lauthals am Stammtisch.
„Und wenn es doch eine Deern wird?“, wandte Pastor Leverenz ein.
„Das wird kein Mädchen! In meiner Familie sind bisher immer nur Helden gezeugt worden. Das hängt mit meinen Erbanlagen zusammen!“, erwiderte August. Davon war er überzeugt.
Inzwischen widmete sich Lisbeth zu Hause dem Kaffee, während Wilhelmine in immer kürzeren Abständen ihre Wehen spürte. Lisbeth kramte unter ihren vielen Unterröcken eine Taschenuhr hervor und legte sie demonstrativ auf den Nachtschrank. „Das wird heute noch!“, stellte sie fest. „Das letzte Baby in diesem Jahrhundert!“ Die Uhr zeigte kurz nach 11 Uhr. Noch fast eine Stunde bis zum Jahreswechsel. Der Lehrer Hempelmann hätte sicherlich wegen des neuen Jahrhunderts protestiert, wenn er denn da gewesen wäre, doch er befand sich gerade in einem Streitgespräch im Roten Hahn und bekam deshalb nichts von Lisbeths Bemerkung mit.
Diese hatte nicht ohne Grund ihre Uhr aus den Unterröcken hervorgekramt, denn bei der heutigen Geburt war die Uhrzeit besonders wichtig. Kaiser Wilhelm der Zweite hatte schon vor einem Monat im ganzen Reich verkünden lassen, dass er für das erste im neuen Jahrhundert geborene Kind persönlich die Patenschaft übernehmen wolle, sofern es ein Knabe wäre. Sollte es aber ein Mädchen werden, würde er ein Goldstück spendieren, immerhin im Werte von 20 Mark.
Nun hoffte August, dass sich sein kleiner Held noch bis ins neue Jahr Zeit lassen würde. Dann hätte er Chancen auf die kaiserliche Patenschaft. Das wäre ein guter Start ins Leben.
In diesem Moment ging es im Hause des Kaufmanns aber richtig los. Die Wehen folgten jetzt in immer kürzeren Abständen, und Lisbeth schaute erneut auf die Uhr. Bis Mitternacht war jetzt nicht mehr viel Zeit. Doch gerade als Emma Hibbel mit einem neuen Stapel Tücher herbeieilte, hörte sie die Turmglocke läuten. Erschrocken blieb sie stehen und zählte die Schläge mit. „Es ist Mitternacht!“, stellte sie fest.
„Unsinn!“, widersprach Lisbeth mit einem Blick auf ihre Taschenuhr. „Noch fünf Minuten! Nun komm schon! Das Kind will raus!“
Doch die Nachbarin blieb erstarrt stehen und zählte mit: „Zehn, elf, zwölf!“ – Wilhelmine stieß einen schrillen Schrei aus, der in einem langen Aufatmen endete. Mit beherztem Griff hatte Lisbeth zugepackt, und im nächsten Moment meldete der kleine Erdenbürger sein Dasein an. Es war geschafft!
Emma Hibbel hielt Lisbeth eines der Tücher hin, und diese schaute erst kritisch auf das Kind, dann auf die Uhr auf dem Nachtschrank. „Na also!“, stellte sie fest. „Kurz vor Mitternacht!“
„Es hat aber schon 12 geschlagen!“, wand Emma ein.
„Die Kirchturmuhr geht falsch!“, wehrte Lisbeth ungehalten ab. „Hier gilt nur meine Uhr, und die zeigt zwei Minuten vor zwölf. Geburtstag ist also der 31. Dezember 1899! Schluss damit!“
„Was ist es denn?“, wollte die Nachbarin wissen.
„Na, was soll es schon sein!“
Mit wehenden Röcken eilte die Hibbel zum Roten Hahn, um die gute Nachricht dort sofort zu überbringen.
„Dein Kind ist da, August!“, rief sie in die Gaststube hinein, wo gerade die erste Welle „Prost Neujahr!“ auf ihrem Höhepunkt war. Und jetzt diese Nachricht!
„Mein Sohn ist da!“, tönte August laut, und als der Wirt auffordernd die nächste Kiste Schampus auf den Tresen stellte, schob August hinterher: „Schampus für alle!“
Es wurde ein feucht-fröhlicher Willkommensgruß für den neuen Erdenbürger.
Unterdessen hatte Lisbeth das Kind gebadet, in ein trockenes Tuch gewickelt und Wilhelmine in den Arm gelegt. „Hier hast du deine Deern“, sagte sie bedauernd.
„Ein Mädchen?“, fragte Wilhelmine.
„Ja, es ist nun mal kein Held geworden.“
So kam August und Wilhelmine Heldenreichs Tochter auf die Welt.
Doch als August sie am nächsten Morgen – das war am 2. Januar – beim Bürgermeister offiziell anmelden wollte, gab es noch einen kleinen Streit zu klären. Lisbeth hatte als Geburtstermin den 31. Dezember 1899 angegeben, und jetzt gab August den 1. Januar 1900 an. Was war denn nun richtig? War der Nachwuchs jetzt das letzte Baby im 19. oder das erste im 20. Jahrhundert? Das war schon wichtig!
Der Bürgermeister ließ alle Beteiligten zu sich kommen, um die Angelegenheit zu klären. Emma Hibbel sagte, dass die Kirchturmuhr bereits Zwölf geschlagen hatte, als das Kind zur Welt kam. Brödermann überzeugte sich davon, dass die Uhr der Hebamme gegenüber der Kirchturmuhr nachging. Lisbeth schwor, dass ihre eigene Uhr die einzig ausschlaggebende war, denn sie hatte alle von ihr zur Welt gebrachten Kinder nur nach dieser Uhr registriert. Die Kirchturmuhr konnte also nur falsch gehen.
Das war eine verzwickte Angelegenheit, die der Bürgermeister da lösen musste. Er rief den Dorfgendarmen hinzu, der als Amtsperson ein gewichtiges Wort mitsprechen konnte. Doch es stellte sich heraus, dass auch dieser seine Uhr täglich mit der Kirchturmuhr verglich. Bei dem Briefträger war es genauso. So kam man also nicht weiter. Doch der Briefträger hatte eine ganz andere Idee.
„Die Eisenbahn!“, fiel ihm ein. „Auf allen Bahnhöfen im Land zeigen die Uhren die gleiche Zeit an, denn die Lokführer sind verpflichtet, ihre Amtsuhren nach der Uhr der Kreisstadt zu stellen und mit jeder Bahnhofsuhr auf ihrer Strecke zu vergleichen. Auf diese Weise gibt es auf der ganzen Strecke keine Zeitunterschiede.“
Genauer konnte die Zeit also gar nicht festgestellt werden. Der Gendarm bekam nun den standesamtlichen Auftrag, mit dem Fahrrad in die Kreisstadt Pamphusen zu fahren, um seine zur Amtsuhr aufgewerteten Taschenuhr mit der Eisenbahnzeit zu vergleichen. Der Küster war über diese Maßnahme etwas erbost, denn er hielt es für selbstverständlich, dass die Kirchturmuhr die richtige Zeit anzeigte. Und er bekam recht. Der Dorfpolizist konnte die Richtigkeit bestätigen. Er hatte in dieser Streitfrage die körperlich anstrengendste Arbeit geleistet, was der Bürgermeister mit einem gehörigen Schluck Bier honorierte. Jetzt konnten alle zufrieden sein, außer der Hebamme, die nun ihre Taschenuhr zum ersten Mal korrigieren musste. Das ging ihr gewaltig gegen den Strich.
So wurde das immer noch namenlose Mädchen der Heldenreichs das erste Kind des neuen Jahrhunderts im Dorf, und der Bürgermeister notierte nicht nur gewissenhaft Datum und Uhrzeit, sondern schrieb noch „mit dem Glockenschlag“ dahinter.
Als das Kind dann von Pastor Leverenz getauft werden sollte, stellte sich heraus, dass die Eltern zwar viele Jungennamen parat hatten, jedoch keinen für Mädchen. Doch sie waren der Nachbarin Emma Hibbel so dankbar für ihr gutes Gehör, dass sie ihr anboten, Namenspatin zu werden. Endlich hatte Emma Heldenreich, geboren am 1. Januar 1900, null Uhr, mit dem Glockenschlag, in Dorpamarsch, ihren Namen.
Es stellte sich heraus, dass es im ganzen Deutschen Reich keine frühere Geburt gegeben hatte, und der Kaiser ließ Emma ein echtes Goldstück schicken, das ihr zusammen mit einer gewaltigen Urkunde vom Bürgermeister ausgehändigt wurde.
Zunächst nahm August beides entgegen und gab beim Schreiner den Auftrag, einen schönen Rahmen zu bauen. So hing fortan die Urkunde an der Wand des Kaufmannsladens und die Münze verschwand in einer Schatulle.
Die kleine Emma wurde im Dorf aber nur noch „Kaiserdeern“ genannt. Schade: Aus der Patenschaft war ja nun nichts geworden, doch der „genannte“ August und Wilhelmine waren trotzdem recht stolz.
1906 - Kaiserlicher Hof- und Marinelieferant
Neben der Eingangstür von Augusts Kaufmannsladen prangte ein Schild mit der Aufschrift:
„August Heldenreich, Colonialwaren, Delikatessen, Tabak und Cigarren, Bisquits, Tee, Kaffeesurrogate, Fisch, Nährmittel und Waren des täglichen Gebrauchs, Eisenwaren, landwirtschaftliche Bedarfsartikel und Sämereien“.
Mit anderen Worten: August verkaufte alles, und was er gerade nicht vorrätig hatte, konnte er bestellen.
Wie es sich gehörte, hatte August sich bei Kaiser Wilhelm II mit einem artigen Brief im Namen seiner Tochter für das Goldstück bedankt und auch noch eine Packung Kautabak hinzugefügt – eine echte Norddeutsche Spezialität. Das würde Kaiser Wilhelm Zwo als Freund und Förderer der Marine sicherlich gefallen. Zu seiner Verblüffung erhielt er Antwort von der Kaiserlichen Marine in Wilhelmshaven mit einer Bestellung von zehn Päckchen Kautabak bester Qualität für Marineoffiziere und durfte sich fortan als „Kaiserlicher Hof- und Marinelieferant“ bezeichnen, was in einem Begleitschreiben ausdrücklich bestätigt wurde. Ein zweiter Bilderrahmen mit dem kaiserlichen Schreiben machte sich an der Wand seines Ladens recht gut und belebte das Geschäft.
Leider war sein Kundenkreis in Dorpamarsch sehr begrenzt. Die wenigen Einwohner bestanden zum größten Teil aus den Familien der Bauern und ihren Knechten und Mägden. Die waren überwiegend Selbstversorger. Sie lebten und ernährten sich im wahrsten Sinne des Wortes vom Land und seinen Früchten. Nur was sie nicht selbst anbauen konnten, mussten sie bei August kaufen. Seit Reichskanzler Otto von Bismarck seinen Widerstand gegen Deutsche Kolonien im Ausland aufgegeben hatte, nahmen die dort angebauten Früchte einen immer größeren Rahmen in deutschen Geschäften ein. Bald wurde der Begriff „Kolonialwaren“ für Lebensmittel aller Art benutzt.
Es zeigte sich auch bald, dass es für August gut war, einen Fuß bei der Marine in Wilhelmshaven in der Tür zu haben. Dort war Alfred Tirpitz wenige Tage vor Emmas Geburt gerade Vizeadmiral geworden. Das Empfehlungsschreiben des Kaisers hatte seine Aufmerksamkeit auf August Heldenreich gelenkt, und er ging davon aus, dass dieser ein erfahrener Lieferant und Schiffsausrüster sei. Wann immer man bei der Kaiserlichen Marine, und besonders auf der Kaiserlichen Werft, etwas benötigte, bestellte man es der Einfachheit halber bei ihm, was den Herren Ausrüstungsoffizieren eine Menge Zeit und Arbeit sparte. Teilweise waren es aber für die Schiffsausrüstung typische Waren, die er erst bei ortsansässigen Handlungshäusern in Wilhelmshaven bestellen musste. Das fiel denen natürlich negativ auf. Um aber die positiven Geschäftsentwicklungen nicht zu gefährden, ließ er die Wilhelmshavener Lieferungen direkt über die örtlichen Firmen ausliefern. In der Praxis leitete er alle Bestellungen an die Firmen weiter, welche schon vorher geliefert hatten, und strich lediglich eine erkleckliche Provision ein. So blieb alles beim Alten: Die Marine verlor nicht die Erfahrungen der alteingesessenen Firmen und diese behielten ihre Einkünfte. Die Handelsvertreter vertraten jetzt nicht nur ihre bisherigen Firmen, sondern auch das Handlungshaus „August Heldenreich“ und strichen auch von ihm Provisionen ein. So waren alle glücklich und zufrieden.
Vizeadmiral Tirpitz fühlte sich verpflichtet, dem Kaiser bei passender Gelegenheit von den Auswirkungen des Empfehlungsschreibens zu berichten. Wilhelm der Zweite konnte sich zwar nicht mehr daran erinnern – er hatte fürwahr ganz andere Dinge im Kopf – doch da Tirpitz seine eigenen Verdienste in dieser Angelegenheit in aller Bescheidenheit ausdrücklich darstellte, wurde er noch im gleichen Jahr in den Adelsstand erhoben und durfte sich jetzt „Alfred von Tirpitz“ nennen. Obwohl er 1903 zum Admiral und 1911 sogar zum Großadmiral der Kaiserlichen Marine ernannt wurde, was sicherlich eine indirekte Folge der Geschäftsbeziehungen mit August Heldenreich war, lernte er diesen und seine Tochter, die Kaiserdeern, niemals persönlich kennen. War vielleicht auch besser so!
In dieser gut situierten, jedoch dörflichen Umgebung von Dorpamarsch, wuchs Emma wohl behütet auf. Mit den Geschäften ihres Vaters hatte sie zum Glück wenig zu tun, ebenso wie auch ihre Mutter, doch die Familie gehörte zu den reichsten des Dorfes, was sie aber nicht erkennen ließ. Die Nachbarn bekamen von den lukrativen Geschäften Augusts nicht viel mit.
Als Emma begann, ihr Umfeld mit immer mehr Interesse wahrzunehmen, fragte sie eines Tages ihren Vater, warum sie im Dorf allgemein nur Kaiserdeern genannt wurde. Da holte August das Goldstück aus der Schatulle und erklärte: „Dieser Taler ist ein Geschenk des Kaisers zu deiner Geburt, weil du das erste Kind des neuen Jahrhunderts bist. Es soll dir immer Glück bringen und es hat uns schon jetzt viel Erfolg eingebracht. Und weil alle Dorfbewohner das damals mitbekommen haben, nennen sie dich seitdem Kaiserdeern, aber für uns wirst du immer unsere Emma sein!“
Emma nahm das Goldstück ehrfürchtig in die Hand und schaute es sich genau an. Auf einer Seite war der Kopf des Kaisers mit seinem hochgezwirbelten Schnurrbart zu sehen. Emma konnte noch nicht lesen, doch Ihr Vater erklärte, dass „WILHELM II. (Er sagte Wilhelm der Zweite) DEUTSCHER KAISER KÖNIG V. PREUSSEN um den Kopf herum geschrieben stand. Ganz unten stand noch ein einsames „A“, was August nicht erklären konnte. Er meinte, das könne eine persönliche Widmung für ihn sein, denn sein Vorname fing ja mit „A“ an.
Auf der anderen Münzseite konnte Emma einen gefährlich aussehenden Adler mit grimmig geöffnetem Schnabel und scharfen Krallen erkennen. Darüber schwebte eine Krone, und vor dem Bauch war noch ein Wappen. Am Rand standen die Wörter „DEUTSCHES REICH 1894“ und zwischen zwei Sternen „20 MARK“. Das war ihr Glückbringer und gleichzeitig ihr gesamtes eigenes Vermögen, und das war immerhin noch mehr als alle anderen Kinder des Dorfes zusammen besaßen. Taschengeld hatte ohnehin niemand von ihnen, doch Emma durfte ab und zu in eines der Bonbongläser im Laden greifen. Das machte sie bei allen Dorfkindern beliebt, denn sie teilte auch gerne.
Im Alter von sechs Jahren wurde sie eingeschult. Nun übernahm der Lehrer Nils Hempelmann zu einem großen Teil die Erziehung, wie es auch bei den anderen Kindern üblich war. Hempelmann unterrichtete alle 56 Kinder des Dorfes in einem einzigen Klassenraum. Er war ein gestrenger Lehrmeister, der ihnen mit Kreide und Rohrstock das Lesen, Schreiben und Rechnen beibrachte. Für die religiöse Erziehung zog er einmal wöchentlich den evangelischen Pastor Leverenz hinzu. Ob jemand im Dorf einer anderen Konfession angehörte, war ohne Belang. Es gab ja auch keine katholische Kirche. Hier im Norden spielte sie seit dem Dreißigjährigen Krieg ohnehin keine große Rolle mehr, besonders, weil ja der Alte Fritz gesagt hatte: „Jeder soll nach seiner Façon selig werden.“
Der Pastor nahm seinen Lehrauftrag ebenso ernst wie Hempelmann, und der Rohrstock stand immer in der Ecke bereit. Jede noch so kleinste Verfehlung wurde bestraft. Nur so konnten die Kinder zu einem wertvollen Mitglied der Dorfgemeinschaft erzogen werden. Besonders die Jungen bekamen den Stock oft auf dem Hosenboden zu spüren, und manch einer stopfte sich vorsorglich etwas Laub oder Gras in die Hose, um den Schmerz in Grenzen zu halten. Hauptsache, man schrie aus vollen Kräften. Das machte Eindruck bei den Mädchen, welche der Exekution atemlos zuschauten. Emma hielt für solche Fälle immer ein Bonbon in ihrem Taschentuch bereit – als Tröstung für den Delinquenten.
Sie selber blieb übrigens weitgehend verschont, denn der Lehrer wurde von der Dorfgemeinschaft hauptsächlich in Naturalien entlohnt. Da ihr Vater sich recht freigiebig zeigte, wollte Hempelmann die Quelle nicht versiegen lassen. Bei den anderen Kindern wurde jede Gabe sorgfältig geprüft, ob die Gans auch schön fett war oder die Kartoffeln nicht vom letzten Jahr. Ein mageres Schwein brachte dem Sohn des Spenders unweigerlich Verdruss. Man konnte den Lehrer irgendwie verstehen. Er musste ja auch leben.
August Heldenreich dehnte inzwischen seine Handelstätigkeit immer mehr aus. Das Militär war eine fast unerschöpfliche Einnahmequelle, die er als Hoflieferant beliebig melken durfte. Das Militär und die Marine waren das Wichtigste, was der Kaiser kannte. August war das ganz recht, denn er konnte vortrefflich davon leben. Die meisten Bürger des Deutschen Reiches wurden daran gemessen, ob und in welchem Regiment sie „gedient“ hatten. Die Entlassungsurkunden aus dem Militärdienst schmückten fast jedes Wohnzimmer. Bei den Heldenreichs fehlte sie aber, denn August hatte es geschafft, dem Wehrdienst zu entgehen, und später schienen dem Staat seine Handelsverdienste um das Vaterland wichtig genug.
Im Sommer des Jahres 1906 kündigte sich bei ihnen weiterer Nachwuchs an. Nach Emma sollte es nun ein richtiger Held werden. Emma selbst ahnte davon aber noch nichts, denn die Kinder waren damals nicht so aufgeklärt wie heute. Sie wunderte sich zwar, was ihre Mutter seit einiger Zeit unter ihrer Schürze versteckt trug, doch die tatsächlichen Zusammenhänge erriet sie nicht.
1906 - Ein Schuster auf der Durchreise
An einem warmen Spätsommertag hatte sie ihren Puppenwagen vor dem Laden in die Sonne gestellt und spielte mit den Puppen. Heute war Waschtag. Ihre Mutter war mit einer Haushaltshilfe bei der großen Wäsche. Das zog sich immer über zwei Tage hin. Am ersten Tag wurde die Wäsche eingeweicht und am nächsten Morgen gekocht, ausgewrungen, gespült … und das Ganze mehrmals. Das war eine wirkliche Knochenarbeit, aber einmal monatlich erforderlich.
Bei Emma war das einfacher. Sie begnügte sich damit, ihre drei Puppen komplett zu entkleiden, deren Wäsche symbolisch in einem leeren Eimer zu „waschen“ und die Puppen dann wieder anzukleiden. Als diese gerade nackt nebeneinander auf der Sitzbank saßen, fiel ein Schatten auf sie. Ein Mann stand vor ihr. „Darf ich mich zu dir setzen, kleines Frollein?“, fragte er höflich.
Emma schaute hoch und schob bereitwillig ihre Puppen zusammen, sodass noch genügend Platz für den Mann war. Schließlich war die Bank vor dem Laden für die Kunden aufgestellt, die vor oder nach dem Einkauf noch ein wenig rasten wollten.
Der Mann setzte sich schwerfällig hinzu und schaute Emma an. „Ich heiße Wilhelm“, stellte er sich vor, „und wie heißt du?“
„Ich bin die Kaiserdeern, heiße aber Emma“, erklärte sie zutraulich und stellte auch gleich noch ihre Puppen vor: „Das ist Augustine, das ist Wilhelmine und das ist Clara.“ Dann deckte sie schnell ein Tuch über sie, damit Wilhelm sie nicht länger nackt sehen sollte.
Wilhelm war schon älter, trug einen Schnauzbart und sah traurig aus. Seine schwarze Jacke war etwas abgestoßen, doch er strahlte eine gewisse Würde und Ruhe aus.
„Hast du auch eine Nummer?“, fragte Emma neugierig.
Wilhelm schien etwas erschrocken. Unwillkürlich musste er an die Nummer denken, die ihm im Gefängnis zugeteilt worden war. Sah man ihm das an? Das konnte er sich von Emma nicht denken.
„Was für eine Nummer?“, fragte er.
„Na, unser Kaiser, der mir die Goldmünze geschenkt hat, hat die Nummer Zwei. Du heißt doch auch Wilhelm, welche Nummer hast du denn?“
Wilhelm musste lachen. „Ach sooo“, sagte er, „nur Kaiser und Könige bekommen eine Nummer, damit man sie unterscheiden kann. Ich bin zu unbedeutend, um eine Nummer zu haben.“ Nach kurzem Nachdenken fragte er: „Der Kaiser hat dir eine Goldmünze geschenkt?“
Und Emma erzählte ihm die ganze Geschichte. Sie schloss mit den Worten: „Und deshalb bin ich die Kaiserdeern und ein Glückskind!“
Wilhelm schaute sie interessiert an und fragte: „Darf ich die Goldmünze einmal sehen?“ Er hatte nämlich noch nie in seinem Leben eine Zwanzigmarkgoldmünze gesehen.
Emma lief bereitwillig ins Haus, um die Münze aus der Schatulle zu holen. Wilhelm bewachte indessen die Puppen. Zögernd nahm er die Münze von Emma entgegen und betrachtete sie mit glänzenden Augen. Er konnte sich an nichts erinnern, das schöner gewesen wäre. „Du bist wirklich ein Glückskind!“, sagte er und gab Emma das Goldstück zurück. Diese verschwand wieder, um es in die Schatulle zurückzulegen.
In diesem Moment kam Emmas Mutter aus dem Haus, um nach ihrer Tochter zu sehen. Sie erblickte den alten Mann neben Emmas Puppen und kam näher. Wilhelm stand höflich auf und stellte sich vor „Ich heiße Wilhelm und passe auf die Puppen auf. Emma ist gerade ins Haus gegangen.“ Sein Blick wanderte über Wilhelmines gerundeten Bauch. Da kam Emma herausgehüpft und sagte fröhlich: „Ich habe Wilhelm meinen Glückstaler gezeigt.“
Die Mutter erschrak etwas, doch der Alte sah zwar abgeschabt, aber nicht wie ein Dieb aus. Sie wandte sich ab, um August zu holen. Das war eine Sache unter Männern.
„Du bekommst bald ein Brüderchen oder Schwesterchen!“, stellte Wilhelm fest.
Emma war erstaunt: „Woher weißt du das?“
Wilhelm hatte durchaus nicht vor, an dieser Stelle die Aufklärung Emmas in die Wege zu leiten. Er murmelte deshalb: „Wart’s nur ab!“, und beließ es dabei. Er wurde von August aus weiterer Erklärungsnot gerettet, als dieser forsch aus dem Haus eilte.
„Was kann ich für Sie tun?“, fragte der ganz geschäftsmäßig.
Wilhelm zeigte auf die Bank und meinte, er hätte sich nur etwas ausruhen wollen, da er auf der Durchreise von Wismar nach Berlin wäre, wo er eine wichtige Angelegenheit regeln wolle.
Da neben Emmas Puppen nicht genügend Platz für zwei Männer und die Puppenwäsche noch lange nicht beendet war, bat August den Alten in die Wohnstube, um sich bei einem Bier mit ihm zu unterhalten. Die „wichtige Angelegenheit“ interessierte ihn sehr. Nicht umsonst hatte er seine Geschäfte immer mehr erweitern können, da er stets die Ohren offen hielt. Und die Hauptstadt interessierte ihn ganz besonders. So erfuhr er die ganze bisherige Lebensgeschichte des Mannes.
Wilhelm war in Ostpreußen geboren worden und hatte das Schuhmacherhandwerk gelernt. Er gab bereitwillig zu, in den nachfolgenden Wanderjahren als Schuhmachergeselle mehrfach aus Not und wenn sich die Gelegenheit bot, kleinere Diebstähle begangen zu haben, wegen denen er auch ins Gefängnis gekommen war. „Meist habe ich nur etwas Essen auf dem Markt oder aus einigen Gärten gestohlen, wenn ich auf Wanderschaft war.“ Doch Diebstahl ist Diebstahl, und darauf stand Gefängnis. Das sah er ein. Doch seine handwerklichen Fertigkeiten waren überall anerkannt. Darauf legte er Wert.
August fragte, wo denn Wilhelm zuletzt gearbeitet hätte. Dieser kratzte sich verlegen am Kopf und erzählte, er hätte zuletzt eine Stelle bei Hofschuhmachermeister Hilbrecht in Wismar gehabt, hatte sich dort auch gut gemacht, bekam aber wegen der vorangegangenen Gefängnisstrafen Aufenthaltsverbot für die Stadt Wismar. Nun wolle er nach Rixdorf zu seiner Schwester, um dort Arbeit in Berlin zu finden.
Das war also die „wichtige Angelegenheit“.
August überlegte: Wenn Wilhelm tatsächlich bereits bei einem Hofschuhmachermeister gearbeitet hatte, ließ sich vielleicht etwas daraus machen. Jeder Soldat brauchte Stiefel, und Schuhe standen bisher noch nicht in seinem Hoflieferungsprogramm.
„Wie soll es jetzt weitergehen?“, fragte er Wilhelm.
„Für den Anfang reicht es mir schon, wenn ich ein paar Nächte hier übernachten kann!“
Platz im Lagerschuppen gab es genug, und schließlich machte sich Wilhelm in der Sattelkammer ein provisorisches Heulager. Gewohnheitsmäßig schaute er sich um, ob er etwas gebrauchen konnte, und wurde fündig.
Am nächsten Tag ließ er sich nur zu den Mahlzeiten sehen, zu denen er eingeladen war. Einen weiteren Morgen später erschien er nicht zum Frühstück. Stattdessen lag ein Paar winzig kleiner Babyschuhe auf den Treppenstufen zum Hauseingang. Das Material dazu hatte Wilhelm in der Sattelkammer gefunden.
Wilhelmine und August waren gerührt über dieses schöne Geschenk, und am 7. September 1906 bekam Emma tatsächlich ein kleines Schwesterchen. Es wurde auf den Namen „Berta“ getauft, und für Emma war es, als hätte sie eine lebendige Puppe. Sie liebte ihre Schwester von Anfang an über alles.
Von dem Schuster Wilhelm hörten sie nichts mehr.
Es stellte sich später aber heraus, dass er doch etwas aus dem Lagerhaus mitgehen ließ, was August aber verschmerzen konnte, da er ohnehin bisher keinen Abnehmer dafür gefunden hatte. Es war die alte Uniform eines Hauptmanns des preußischen 1. Garderegiments zu Fuß, die dieser bei einer Neuanfertigung zurückgelassen hatte. Nun hing sie seit einiger Zeit im Schuppen, und die Motten bekundeten schon heftiges Interesse. Vor diesem Schicksal hatte Wilhelm die Uniform sicherlich bewahren wollen, denn wozu könnte ein Schuster eine Hauptmannsuniform benötigen?
Am 18. Oktober 1906 traf ein mysteriöser Brief bei Heldenreichs ein. Der Brief war in Berlin aufgegeben und abgestempelt und beinhaltete einen unbeschrifteten Bogen mit dem Briefkopf der Stadtkasse Köpenick, in dem ein goldenes Zwanzigmarkstück eingeschlagen war. Das war sicherlich ein erneutes Geschenk des Kaisers Wilhelm des Zweiten zur Geburt des zweiten Kindes im Hause Heldenreich, vermuteten August und Wilhelmine und bedankten sich beim Kaiser artig auch für dieses Goldstück. Eine Antwort erhielten sie nicht, vielleicht weil man bei Hofe mit diesem Dank nicht viel anfangen konnte.
Mit dem Namen „Wilhelm“ hatten sich Heldenreichs nicht geirrt, doch sie ahnten nicht, dass statt des Zweiten Wilhelms der nummernlose Wilhelm dahintersteckte. Und das war so gekommen:
Der Schuster Wilhelm Voigt hatte sich nach der zweiten Übernachtung bei Heldenreichs frühzeitig auf den Weg gemacht, damit niemand das Fehlen der Uniform – eigentlich nur ein Uniformrock – bemerken konnte. Bezahlen würde er später. Das hatte er sich fest vorgenommen!
Zu Fuß und mit der Eisenbahn kam er bei seiner Schwester in Rixdorf bei Berlin an und sah sich nach Arbeit um. Damit geriet er in die Mühlen der kaiserlich-amtlichen Bürokratie. Er bekam keine Arbeit ohne offizielle Wohngenehmigung, keine Wohngenehmigung ohne Ausweis und keinen Ausweis ohne Arbeitsnachweis. So drehte sich das Bürokratenkarussell ohne Unterlass, und der Amtsschimmel wieherte dazu.
Das hatte der Schuster Wilhelm Voigt alles schon in Wismar erlebt. Nun erteilte ihm die Stadt ebenso ein Arbeits- und Aufenthaltsverbot für ganz Berlin.
Damit hatte er schon gerechnet und deshalb in Dorpamarsch einen Plan ausgeklügelt, den er jetzt in die Tat umsetzte.
Bei einem Trödler besorgte er sich mithilfe der Uniformjacke eine passende Mütze, zog sich auf der Bahnhofstoilette der Rixdorf-Mittenwalder Eisenbahn um und kam danach als Hauptmann wieder zum Vorschein. Wie erwartet, begegnete man ihm voller Hochachtung. Die Männer zogen ihre Mützen zum Gruß oder lüfteten die Zylinder, die Damen deuteten manchmal sogar einen leichten Knicks an. Mit jedem Schritt wurde Wilhelm sicherer und schlüpfte immer mehr in diese Rolle. Als ihm dann aber eine Gruppe Gardesoldaten begegnete und nur nachlässig grüßte, hielt er diese an, stauchte sie zusammen und stellte sie anschließend unter seinen persönlichen Befehl zu einem Sondereinsatz. Der Rest ist weitgehend in der Öffentlichkeit unter dem Namen „Hauptmann von Köpenick“ bekannt geworden, allerdings mit einer kleinen Abweichung, die nie aktenkundig geworden ist.
Wilhelm Voigt fuhr mit den Soldaten zum Rathaus Köpenick und überprüfte die Stadtkasse, die einen Fehlbetrag von 1,67 Mark aufwies. Im Schreibtisch des Bürgermeisters fand er ein Zwanzigmarkstück, dessen Herkunft der Bürgermeister nicht belegen konnte. Kurzerhand ließ er Bürgermeister und Stadtkämmerer verhaften und zur Aufklärung des Falls nach Berlin schicken, beschriftete einen Umschlag mit der Anschrift in Dorpamarsch, steckte den Goldtaler hinein und warf den Brief im Vorbeigehen in den Postkasten am Rathauseingang. Niemand bemerkte das, und kein Mensch fragte später nach dem Goldstück – auch nicht der Bürgermeister. Wer weiß, ob er nicht doch Dreck am Stecken hatte. Sein Ziel, einen Pass zu ergattern, hatte Vogt nicht erreicht, aber zumindest hatte er die Uniformjacke bezahlt.
1912 - Flaschenpost
Während Emma brav zur Schule ging, wuchs Berta wohlbehütet bei ihren Eltern in Dorpamarsch auf. Die nächsten Jahre vergingen ohne Höhepunkte, abgesehen davon, dass ihr Vater August Heldenreich noch immer gute Geschäfte mit der Marine machte. Er tat immer so, als würde er den Kaiser persönlich kennen, in Wirklichkeit bekamen sich die beiden jedoch nie zu sehen. Dafür war er bei Admiral von Tirpitz bestens bekannt, auch wenn die beiden sich ebenfalls nie persönlich kennen gelernt hatten. Das sollte sich aber am 28. Januar 1911 ändern. Einen Tag vorher war Alfred von Tirpitz von Kaiser Wilhelm dem Zweiten zum Großadmiral ernannt worden und am 28. Januar fand in Wilhelmshaven ein großer Empfang an Bord des Panzerkreuzers „SMS Blücher“ statt, zu dem alles eingeladen war, was in der Marine Rang und Namen hatte.
Auch an den Hof- und Marinelieferanten August Heldenreich hatte man gedacht, und Tirpitz erinnerte sich sogar an den Ehrentaler des Kaisers und fügte handschriftlich hinzu, dass auch Emma herzlich willkommen sei. Er wäre froh, seinen besten Lieferanten auf diese Weise einmal persönlich kennen zu lernen, und mit ein bisschen Glück könnten sie auch dem Kaiser vorgestellt werden.
August wunderte sich etwas, dass nur Emma eingeladen war, obwohl Berta je ebenfalls ein Goldstück bekommen hatte. Das konnte nur ein Versehen sein. Er beschloss deshalb, beide Mädchen mitzunehmen. Emma war gerade elf Jahre alt geworden und Berta viereinhalb.
Mit Postkutsche und Eisenbahn reisten die Drei nach Wilhelmshaven, staunten über die neue Kaiser-Wilhelm-Brücke, die vier Jahre zuvor fertiggestellte größte Drehbrücke Deutschlands, welche die Stadt mit dem Südhafen verband, und landeten schließlich am großen Portal zum Marinehafen. Dort kümmerte sich ein junger Leutnant zur See um sie und erklärte, dass er sie während des ganzen Empfangs begleiten werde. Er war extra für die Betreuung Emmas abgestellt worden. Dass jetzt zusätzlich auch noch Berta dabei war, schien ihn wenig zu erschüttern. Das war August durchaus recht, denn als Zivilist waren ihm die maritimen Gepflogenheiten nicht sehr geläufig.
Die erste Klippe mussten sie schon beim Betreten des Panzerkreuzers überwinden. Als sie in Begleitung des Leutnants die Gangway betraten, hörten sie vom Schiff her ein merkwürdiges Pfeifen. Dort stand ein Matrose und blies mit dicken Backen auf einer kleinen aber durchdringenden Pfeife.
Das war das in der Marine übliche „Seite pfeifen“, eine Ehrerweisung für Offiziere und hochrangige Gäste, die an Bord kamen oder das Schiff verließen. August nahm das nur so nebenbei wahr, ohne es als Ehre für sich selbst zu deuten. Die beiden Mädchen schauten interessiert nach unten ins Wasser. Plötzlich blieb Berta stehen, zeigte nach unten und rief: „Ein Fisch! Kuck mal, ein ganz großer Fisch!“
Auch August und Emma blieben stehen und beugten sich über die Reling nach unten. Tatsächlich: Dort schwamm ein recht großer Fisch im Wasser. Der Leutnant versuchte, die Mädchen zum Weitergehen zu veranlassen, doch diese waren vorrangig an dem Fisch interessiert. Sie bemerkten natürlich nicht, was sie damit an Bord auslösten, denn der Bootsmannsmaat, der die Pfeife blies, kam langsam in Bedrängnis. Das Protokoll verlangte, dass er während des ganzen Weges über die Gangway ununterbrochen zu pfeifen hatte. Doch niemand rechnete mit dem Interesse zweier kleiner Mädchen an einem großen Fisch. Nun ging dem Bootsmannsmaat langsam die Puste aus. Die Backen wurden immer dünner, sein Gesicht nahm eine blaurote Farbe an, doch tapfer presste der wackere Mann noch die allerletzte Luft aus seiner Lunge, bis der Ton schließlich mit einem erbärmlichen Piepser erstarb. Erst jetzt gelang es dem Leutnant, die Mädchen von der Reling loszulösen und mit ihrem Vater auf das Schiff zu führen. Der Bootsmannsmaat stand unbeweglich mit starrem Blick nach vorn auf dem Deck und würdigte die Gäste keines Blickes. Wahrscheinlich holte er schon wieder Luft für den nächsten Gast, der hoffentlich in normalem Tempo an Bord kam.
Diesen maritimen Lapsus nahm niemand den Mädchen übel, soweit man das überhaupt bemerkt hatte.
Der Leutnant kümmerte sich rührend um die Familie, und August wurde endlich dem Großadmiral von Tirpitz vorgestellt. Das heißt, eigentlich schloss er sich nur der Schlange von Gratulanten an. Als er endlich einem anderen Offizier seinen Namen nannte, der ihn dann dem Großadmiral vorstellte, sah Tirpitz nur kurz auf, um sich dann gleich dem nächsten Gratulanten zu widmen. Das war alles! Vom Kaiser sah er nur die Mütze aus der Ferne, denn dieser war umringt von einem noch größeren Kreis von Personen, die alle hofften, seine Aufmerksamkeit zu erringen. Darauf konnte August verzichten.
Die Mädchen genossen inzwischen einen Rundgang durch das Schiff. Das war mächtig aufregend, und der Leutnant bemühte sich, alle noch so kindlichen Fragen geduldig zu beantworten. Sogar auf die große Kanone wollten die Mädchen hinaufsteigen, und der Leutnant hob sie auf den Geschützstand, wo sie durch das lange Rohr schauen konnten. Er zeigte ihnen, mit welchem Hebel ein Schuss ausgelöst werden konnte. Die Mädchen versuchten es auch einmal. Es ging ganz leicht. „Nun habt ihr ein Schiff versenkt!“, meinte der Leutnant lachend.
Schließlich gelangten sie auch in die Offiziersmesse, in der eine gewaltige Batterie an Getränken aufgebaut war. Eine Sektflasche nach der anderen wurde von diensteifrigen Matrosen geöffnet, und die Mädchen zuckten jedes Mal zusammen, wenn die Korken mit lautem Knall herausflogen. Sie selber bekamen jede ein Glas Limonade, doch die Sektflaschen brachten Emma auf eine Idee: „Eine Flaschenpost!“, rief sie begeistert. „Wir schreiben eine Flaschenpost! Ist das möglich?“, fragte sie den Offizier.
„Alles, was ihr wollt!“, sagte dieser und griff zu einer leeren Sektflasche. „Jetzt braucht ihr nur noch Papier und Tinte. Ich besorge euch was. Bleibt so lange hier sitzen und rennt nicht weg!“
Damit verschwand er und kam nach einigen Minuten mit einem Bogen Papier, einem Tintenfass und einem Federhalter zurück. Die Mädchen zogen sich an einen Tisch in der Ecke der Messe zurück. „Was sollen wir schreiben?“, fragten sie den netten Leutnant.
„Was ihr wollt! Schreibt doch einfach, wo ihr gerade seid!“, machte er einen Vorschlag.
„Wie heißen Sie?“, fragte sie ihren Betreuer. Der antwortete überrascht: „Leutnant zur See Hellmuth von Ruckteschell.“
„Haben Sie auch Kinder?“, wollte Emma jetzt wissen.
„Das nicht, aber ich habe 13 Geschwister. Da kenn ich mich mit kleinen Mädchen aus. Mein Vater ist Pastor in Hamburg-Eilbeck.“
Emma nickte, tauchte die Feder ins Tintenfass und schrieb mit ihrer allerbesten Schrift:
Das ist eine wichtige Flaschenpost.
Wir sind hier auf dem Panzerkreuzer SMS Blücher zusammen mit Kaiser Wilhelm dem Zweiten und Leutnant zur See Hellmuth von Ruckteschell. Wir haben gerade ein Schiff versenkt. Das hat Spaß gemacht. Bitte schicken Sie diese Nachricht an Wilhelmine Heldenreich, Dorpamarsch im Deutschen Reich. Unser Vater ist gerade bei dem großen Admiral Tirpitz und lässt auch grüßen.
Viele Grüße von Emma und Berta.
Der Leutnant rollte das Blatt zusammen und steckte es in eine Sektflasche. Da es ihm nicht gelang, den dicken Korken wieder in die Öffnung zu quetschen, nahm er den Korken einer Weinflasche und verschloss die Flaschenpost.
„Nun werfen wir sie ins Wasser!“, forderte Emma, und die Drei gingen an Deck, wo sie Berta persönlich über die Reling warf.
Ebenfalls zu dem Empfang eingeladen war der Wissenschaftler Knud Rasmussen, der mit dem Bruder des Kaisers Prinz Heinrich von Preußen, nach dem später die bekannte Prinz-Heinrich-Mütze benannt wurde, befreundet war.
Rasmussen war der Sohn eines dänischen Missionars und einer Grönländerin. Er lebte in Grönland und war ein noch halbwegs unbekannter Polarforscher. Zurzeit befand er sich in Deutschland, um sich über die technischen Möglichkeiten von Fesselballons zu informieren, die er für seine Forschungen benutzen wollte.
Er stand zufällig in der Nähe, als Emma und Berta die Flaschenpost in das Hafenbecken warfen, und beschloss, ihr zu einer etwas weiteren Reise zu verhelfen. Als die Mädchen wieder unter Deck waren, ließ er die Flasche von einer Hafenbarkasse herausfischen und nahm sie an sich.
Ein Vierteljahr später kam er mit einem Fesselballon in sein Haus in der kleinen Missions- und Handelsstation Ilulissat in der Diskobucht an der Westküste Grönlands zurück. Die Flasche landete mit anderem Gepäck auf dem Dachboden und geriet vorerst in Vergessenheit.
Knud Rasmussen widmete sich seinen Forschungen, welche durch die Nähe des Jakobshavn-Gletschers ausgelöst worden waren. Dieser Gletscher galt als der produktivste der Welt, weil er sich täglich etwa 20 Meter ins Meer schob und dabei eine ungeheure Menge an Eisbergen abstieß.
Rasmussen wollte mithilfe des Ballons eine Gletscherzunge beim Kalben von Eisbergen beobachten.
Außerhalb der Siedlung ließ er den Ballon aufsteigen und stieg mit einem Gehilfen persönlich in den Korb, um sich bei günstigem Wind über die Gletscherzunge zu erheben. Dabei kam auch die Flaschenpost wieder zum Vorschein, und Rasmussen nahm sie schmunzelnd mit an Bord. Die Flaschenpost würde eine lange Reise vor sich haben.
Mit einigen Messgeräten stieg Rasmussen auf, und der Ballon näherte sich der Abbruchkante. Von hier aus war der Vorgang des „Kalbens“, wenn sich ein Eisberg von dem Gletscher löste, gut zu beobachten.
Als sich der Ballon gerade über der Eiskante befand, nahm Rasmussen die Flasche und ließ sie nach unten fallen. Gespannt beobachteten die beiden, ob sie zerschellte. Doch das Glas war so stark, dass es keinen Schaden nahm. Die Flasche landete genau in einem Riss, wo sie stecken blieb.
Dann begann etwas Erstaunliches, das die beiden Forscher fasziniert beobachteten. Durch die Wucht des Aufpralls weitete sich der Riss im Eis, verlängerte sich erst langsam, dann immer schneller nach beiden Seiten bis zum Eisrand. Dann wurde der Spalt breiter, bis sich ein riesiger Eisberg vom Gletscher löste und ins Wasser platschte. Der Begriff „Platschen“ kann nicht beschreiben, was tatsächlich geschah. Mit gewaltigem Getöse stürzte der Eisberg ins Wasser und erzeugte eine über hundert Meter hohe Welle. Die Forscher bekamen sogar Angst, von der Welle in ihrem Ballon erfasst zu werden. Doch das Wasser beruhigte sich bald wieder.
Die beiden Forscher fielen sich in die Arme. So gut hatte noch nie jemand das Kalben eines Gletschers und die Entstehung eines Eisberges beobachten können. Emmas und Bertas Flaschenpost hatte ihnen ungeahntes Glück gebracht.
Der Eisberg war auf diese Weise etwa einen Tag früher als normal auf seine lange Reise über den Atlantik gebracht worden. Es war der 2. August 1911.
Und die Flaschenpost? Die reiste mit. Sie blieb auf dem Berg liegen und fror nach kurzer Zeit fest.
Nach dem Besuch auf der SMS Blücher hatten die Mädchen in Dorpamarsch die Flaschenpost schon bald vergessen. Doch diese setzte ihren Weg fort. Der Eisberg hatte es nicht eilig. Er bewegte sich mit dem Westgrönlandstrom nach Norden in die Baffin Bay hinein. Doch das war eine Sackgasse. Nach Norden ging es nicht mehr weiter. Der Westgrönlandstrom machte deshalb kehrt, änderte seinen Kurs nach Süden und seinen Namen in „Baffinstrom“. Auf ihm segelten Eisberg samt Flasche an der Westküste Baffin Islands entlang in die Labradorsee.
Am 14. April 1912, um 23.40 Uhr Ortszeit befand sich der Eisberg nahe der Neufundlandbank. Dort traf er dummerweise auf das damals größte Passagierschiff der Welt, die „Titanic“, welche den Zusammenstoß nicht überlebte und am nächsten Tag gegen 02.20 Uhr sank. Ohne die verfrühte Absprengung des Eisberges hätte dieser erst einen Tag später die Stelle passiert und die Titanic höchstens aus der Ferne gesehen.
Durch die Wucht der Kollision brach die Flaschenpost aus dem Eisberg heraus und fiel auf das Deck der Titanic, wo sie zwischen anderen Eisbrocken liegen blieb. Dort bemerkte sie ein Matrose und wollte sie ins Wasser werfen. Dabei entdeckte er den eingeschlossenen Papierbogen und warf die Flasche in ein Rettungsboot, das er gerade ins Wasser lassen wollte.
Einige Stunden später wurde das Boot von den Matrosen der zu Hilfe geeilten „Carpathia“ aufgenommen. Mit Erstaunen sahen sie die Flaschenpost und brachten sie zu ihrem Kapitän, der sie öffnete und das zusammengerollte Blatt entnahm. Es war ein offizieller Briefbogen des deutschen Panzerkreuzers SMS Blücher, wie man dem Briefkopf entnehmen konnte. Wie kam dieser in die Flaschenpost?
Mit Verwunderung las Kapitän Arthur Henry Rostron die Nachricht:
Das ist eine wichtige Flaschenpost.
Wir sind hier auf dem Panzerkreuzer SMS Blücher zusammen mit Kaiser Wilhelm dem Zweiten und Leutnant zur See Hellmuth von Ruckteschell. Wir haben gerade ein Schiff versenkt. Das hat Spaß gemacht. Bitte schicken Sie diese Nachricht an Wilhelmine Heldenreich, Dorpamarsch im Deutschen Reich. Unser Vater ist gerade bei dem großen Admiral Tirpitz und lässt auch grüßen.
Viele Grüße von Emma und Berta.
Kapitän Rostron ließ das Blatt sinken und blickte hilflos herum. Der Brief war ihm ein einziges Rätsel.
War der Panzerkreuzer SMS Blücher mit Kaiser Wilhelm und Großadmiral von Tirpitz in der Nähe?
Wer waren Emma und Berta? Waren das Tarnnamen?
Hatten sie gerade die Titanic versenkt?
Das war unglaublich! Rostron entschloss sich, die Nachricht an die britische Admiralität weiterzuleiten, wo sie allerdings verloren ging. So erfuhren die beiden Mädchen nie, welche Abenteuer ihre Flaschenpost inzwischen erlebt hatte.
Kurz nach diesem Ereignis – nach den Sommerferien – musste Emma die Dorfschule verlassen und besuchte die Höhere Mädchenschule in Pamphusen. Sie bewohnte ein kleines Zimmer bei der ehrenvollen Witwe Zimper, die alles andere als zimperlich war. Mit aller Strenge achtete sie darauf, dass Emmas Lebenswandel den sittlichen Regeln einer jungen Dame entsprach. Die Witwe befand sich dabei durchaus in einem Interessenkonflikt, denn August Heldenreich bezahlte gut, und diese Einnahmequelle wollte sie nicht durch allzu kleinliche Regularien in Gefahr bringen, denn ihr war klar, dass Emma ein wichtiges Wort bei der Zimmerwahl mitsprechen konnte. Sie selbst hatte dabei eher den Status einer Dienstbotin, die von dem Logiergast bezahlt wurde. Also bediente sie Emma so gut es ging, weckte sie morgens rechtzeitig für den Schulbesuch, bereitete alle Mahlzeiten und servierte sie in Emmas Zimmer, während sie selbst in der Küche speiste. Die Kleidung wurde ebenfalls von ihr in Ordnung gehalten. So konnte Emma gut auskommen, doch in einem Punkt gab es wirklich keine Zugeständnisse: Niemals würde sie zulassen, dass gewisse Grenzen des sittlichen Anstandes überschritten wurden. Kurz gesagt: Kein männliches Wesen, egal welchen Alters, durfte sich dem Logiergast nähern.
So lebte Emma zwar in der Kreisstadt, hatte aber außer ihren Schulkameradinnen – und die waren ja ebenfalls weiblich – keine anderen Kontakte.
Jeden Sonnabend nach dem Unterricht holte August sie persönlich mit dem Zweispänner ab, damit sie das Wochenende zu Hause verbringen konnte. Auf der Fahrt gab es immer viel zu erzählen, und so ergab sich ein immer stärkeres Vertrauensverhältnis zu ihrem Vater. Auch auf Berta freute sie sich jedes Mal. Diese litt am meisten unter der zeitweisen Trennung, denn die Schwestern hingen sehr aneinander.
1914 - Die Helden von Dorpamarsch
Anfang des Jahres 1914 schien im Deutschen Reich noch alles in Ordnung zu sein, solange August seine Geschäfte mit dem Kaiser machte. Doch seit einiger Zeit brodelte es überall auf der Welt. Eigentlich brodelte es immer irgendwo, und die Gründe waren genauso vielseitig wie in einer Familie mit vielen Kindern. Die Herrscherhäuser waren ja fast alle miteinander verwandt. Niemand heiratete ein Mädchen aus dem Volk. Der von Gottes Gnaden eingesetzte Herrscher musste schon die Tochter eines ebenfalls von Gottes Gnaden geduldeten anderen Herrschers heiraten, damit der Abstand zum Volk stets gewahrt wurde.
Das hinderte die Verwandtschaft aber nicht, sich ständig um etwas zu streiten. Meistens war es Land, das man entweder haben oder verteidigen musste. Es wäre einfacher gewesen, wenn sich die von Gottes Gnaden Eingesetzten selbst die Schädel eingeschlagen hätten, doch das wäre nicht wirkungsvoll genug gewesen. Deshalb musste das Volk herhalten. Das schlug sich stellvertretend für die Herrscher. Man musste den Bürgern nur lange genug erzählen, sie täten es für Volk und Vaterland. Nach einer Weile glaubten sie es, und wenn nicht, konnte man sie auf andere Weise überzeugen, notfalls auch mit dem Vorwurf des Hochverrats oder der Feigheit vor dem Feind, was meist mit dem Tode bestraft wurde. Das überzeugte zwar nicht mehr den Hingerichteten, dafür aber umso wirkungsvoller alle anderen.
Das Prinzip hatte sich Kaiser Wilhelm der Zweite keineswegs selbst ausgedacht. Er hatte es schon so übernommen, und eigentlich hat sich bis heute nicht viel daran geändert.
In einem so kleinen Dorf wie Dorpamarsch, war davon nicht viel zu spüren. So wuchsen die beiden Mädchen auch ohne weitere Höhepunkte so auf, wie es sich für gesittete Mädchen Anfang des 20. Jahrhunderts gehörte. Inzwischen trug ihre Mutter wieder etwas Geheimnisvolles unter ihrer Schürze, und Emma machte sich ihre eigenen Gedanken. Sie war jetzt 14 Jahre alt, ein Alter, in dem noch niemand auf die Idee kam, sie über das Wunder einer Geburt, geschweige denn über das Entstehen einer Schwangerschaft, aufzuklären. Im Gegenteil: Das Wort „Schwangerschaft“ wurde nie in ihrer Gegenwart in den Mund genommen. Sogar die Erwachsenen untereinander benutzten höchstens die Umschreibung „in anderen Umständen“ – was immer das für Umstände waren. August kürzte selbst dieses ab. Gegenüber Geschäftsfreunden sagte er mitunter: „Meine Frau ist i. A. U.“ Das hörte sich immer wie Katzenmiauen an.
Emma glaubte schon seit einiger Zeit nicht mehr an die Existenz des „Klapperstorchs“. Das schien eine besondere Rasse zu sein. Den normalen Storch sah man oft durch die Wiesen stelzen. Den kannte jedes Kind. Doch der Klapperstorch brachte die Kinder – und nie hatte ihn jemand dabei gesehen.
Mit der unergründlichen Logik eines Kindes ahnte Emma, dass die geheimnisvolle Wölbung unter Mutters Schürze mit einem neuen Geschwisterchen zusammenhing. Doch auf welche Weise das alles vor sich ging, konnte sie sich beim besten Willen nicht zusammenreimen. Selbst die unterschiedliche Gestaltung von Jungen und Mädchen, die sie beim Baden im Dorfteich schon bemerkt hatte, gab ihr nicht zu denken.
An einem Sonntagmorgen besuchte sie den Hof des Bauern Westphal, dessen Kuh gerade gekalbt hatte. Als sie den Stall betrat, war er gerade mit seinem Sohn Mattis dabei, das kleine Kalb mit Stroh abzureiben. „Willst du mithelfen?“, fragte er Emma.
„Ja gerne!“
„Dann kann ich ja gehen!“, murmelte der Bauer und drückte Emma einen Strohwisch in die Hand.
Mattis war schon 17 Jahre alt, also drei Jahre älter als Emma. Zwei Jahre lang hatten sie gemeinsam die Schule besucht, sich aber nicht besonders beachtet.
„Hast du schon einmal die Geburt eines Kalbs gesehen!“, fragte er. Emma schüttelte den Kopf, und Mattis zeigte auf die Kuh, die sich gerade erhob und anfing, ihr Kalb abzulecken.
„Die kam da raus!“, erklärte er. „Vater musste mit einem Strick nachhelfen. Wir haben es beide herausgezogen!“
Emma war beeindruckt. „Und wie ist es in die Kuh reingekommen?“
Auch das konnte Mattis beantworten und erklärte bereitwillig, welche Rolle der Stier dabei übernommen hatte. Für ihn war das alles selbstverständlich, und Emma begriff schnell.
„Und beim Menschen? Geht das genauso?“
„Na klar!“, feixte Mattis. „Du bist genauso auf die Welt gekommen. Deine Mutter war die Kuh und dein Vater der Stier.“ Dann brach er ab, da ihm klar wurde, mit wem er sprach.
„Sag bloß keinem, dass ich dir das erzählt habe!“ Ihm war das plötzlich peinlich, und beide sahen schweigend der Kuh mit ihrem Kalb zu.
So bekam Emma eine etwas merkwürdige Vorstellung von ihrer Geburt. Besonders der Strick ging ihr nicht aus dem Sinn. Wer mag wohl alles daran gezogen haben?
Von diesem Tage an zog es Emma jedes Wochenende zu Mattis, und die beiden nutzten jede Gelegenheit, alleine miteinander zu sein. Und die geheimnisvolle Wölbung unter Mutters Schürze war auch kein Geheimnis mehr.
Ende Juni 1914 hörte man auch in Dorpamarsch von dem Attentat in Sarajewo. Am 28. Juni waren der österreichisch-ungarische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Ehefrau Sophie von Hohenberg von einem bosnischen Nationalisten ermordet worden. „Das ist weit weg!“, sagten die Dorpamarscher. „Was geht es uns an?“
Doch sie irrten gewaltig. Keiner von ihnen begriff, warum das Attentat eine so gewaltige Wirkung hatte. Es schlug in die brodelnde Hexenküche Europas ein, wie eine Kanonenkugel in eine Gulaschkanone. Österreich-Ungarn war angegriffen worden. Das brachte viele Herrscher auf die Idee, in dem allgemeinen Durcheinander ihre eigenen Vorstellungen von Gebietsansprüchen durchzusetzen – natürlich mit Krieg. Überall wurde das Volk aufgerufen, das Vaterland zu verteidigen – oder zu vergrößern, zurückzuerobern – oder wie immer man das formulierte.
Der russische Zar Nikolaus der Zweite beschloss eine allgemeine Mobilmachung – man konnte ja nie wissen, wozu das gut war – Großbritannien lehnte eine Neutralitätsgarantie ab, da war Kaiser Wilhelm ja geradezu verpflichtet, einen Krieg in Erwägung zu ziehen.
Bald schlugen sich überall Menschen gegenseitig die Schädel ein, die eigentlich gar kein persönliches Interesse daran hatten. Da musste das deutsche Volk natürlich mithalten! Jedenfalls beschloss der Kaiser es so.
Der 1. August 1914 wurde für die Familie Heldenreich in zweierlei Hinsicht ein besonderer Tag. Gegen Mittag kam August aus dem Schlafzimmer in die Küche gerannt, wo Emma und Berta gerade beim Kartoffelschälen saßen, und forderte Berta auf, sofort die Hebamme Lisbeth zu rufen. Emma schickte er zur Nachbarin Emma Hibbel. Beide Frauen waren in kürzester Zeit zur Stelle, als hätten sie nur auf ein Startsignal gewartet, und stürmten ins Schlafzimmer zu Wilhelmine. Die beiden Mädchen wurden in die Küche verbannt und sollten einen großen Kessel Wasser heißmachen.
Emma ahnte, dass sich jetzt das Geheimnis der Wölbung unter Mutters Küchenschürze aufklären würde, während Berta mit offenem Mund auf die Schreie ihrer Mutter hinter der verschlossenen Tür lauschte.
Kurz nachdem die Kirchturmuhr wieder einmal zwölf Uhr geschlagen hatte (diesmal aber mittags), kam ein helleres Stimmchen dazu: ein Babyschrei!
Emma und Berta hatten ein neues Geschwisterchen, doch August wieder keinen Helden, obwohl der Kaiser gerade jetzt einen gebraucht hätte. Es war ein drittes Mädchen, das man einige Tage später auf den Namen Dora taufte.
Der 1. August 1914 wurde aber nicht nur ein stolzer Tag für die Familie Heldenreich, sondern auch für das Deutsche Reich.
Am Nachmittag läutete der alte Petermann, der manchmal im Auftrag des Bürgermeisters die Funktion eines Dorfboten wahrnahm, auf dem Platz vor dem Rathaus die Dorfglocke und verkündete die allgemeine Mobilmachung. Ansonsten verwies er auf einen Aushang neben der Rathaustür. Dann meldete er dem Bürgermeister Vollzug und holte sich den Schnaps ab, der ihm als Entlohnung zustand.
Der allgemeine Jubel war groß. Nun würde man dem Feind endlich eins auf die Mütze geben! Die jungen Männer des Dorfes wurden im Triumphzug zum Rathaus begleitet, um sich mustern zu lassen. Auch Mattis war dabei. Er war zwar noch keine 18 Jahre alt, doch sein Heldenmut und seine kräftige Statur glichen das vollständig aus. Solche Männer brauchte das Land – und vor allem der Kaiser!
Emma musste vorerst ohne die heimlichen Treffen auskommen, doch Mattis hatte versprochen, Weihnachten wieder zu Hause zu sein.