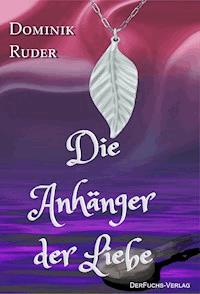Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: DerFuchs-Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Jeden Tag aufs Neue erleben. Niemals alt und gebrechlich werden. Stets den wichtigsten historischen Ereignissen der Menschheitsgeschichte als Zeitzeuge beiwohnen und tatsächlich der ewigen Liebe nachgehen ... Dies alles waren Dinge, die einem ein ewiges Leben bot! Dies wusste auch Dr. Age, als er die Formel für dieses Projekt entwickelte. Selbstverständlich war er nicht der Einzige, der sich dafür interessierte: Eine reiche Witwe verfolgte ihn und versuchte, hinter seine Geheimnisse zu kommen, teilweise mit recht fragwürdigen Methoden. Hätte Age gewusst, dass diese harmlosen Gedankenspiele sein Leben so dermaßen auf den Kopf stellen würden, hätte er sie möglicherweise verworfen. Ob er es schaffte, sein Geheimnis zu wahren? Und ob er es fertigbrachte, geliebte Personen aus der Schusslinie zu halten? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dr. Age und das ewige Leben
Ein Roman von
Dominik Ruder
Dieses Buch widme ich allen kleinen Forschern dieser Welt und solchen, die es werden wollen.
Kapitel 1
Angespannt drehte ich den Hahn auf und wusch mir das Gesicht mit eiskaltem Wasser. Ich musste unbedingt wach werden und vor allem wacher wirken, sonst würde es mir wohl niemals gelingen, genug Geld für meine Forschungen zu sammeln. Ich blickte in den Spiegel der Männertoilette und sah meine braunen Augen, die gerötet zu sein schienen. Meine spitze Nase juckte und ich wischte mir mit der Hand einen Wassertropfen weg, der dafür verantwortlich war. Das kurze, ebenfalls braune Haar war perfekt zurechtgemacht und ließ mich äußerst seriös erscheinen. Der klassische schwarze Anzug mit passender Krawatte saß elegant an meinem schlanken mittelgroßen Körper. Der ideale Anblick eines Mannes Anfang Dreißig.
Doch so gutaussehend ich mich selbst auch fand, es half mir kaum meine Müdigkeit und die Nervosität zu verstecken. Ich konnte die reichen Leute auf der Museumsgala wohl kaum zu Spendengeldern überreden, wenn ich völlig fertig aussah. Die Angewohnheit bis spät in die Nacht an meinen Forschungen zu arbeiten, sollte ich mir wohl abgewöhnen.
Ich warf einen letzten prüfenden Blick in den Spiegel, atmete tief durch und wappnete mich, dann ging ich zurück zur Gala.
Nachdem ich aus den Toilettenräumen getreten war, wusste ich zunächst nicht, wohin ich gehen sollte. Dieses Museum mit naturhistorischen Artefakten war riesig und es war leicht sich darin zu verlaufen. Ich hatte mich auf dem Weg zu den Sanitäreinrichtungen bereits dreimal verirrt. Nun wusste ich glücklicherweise wohin und ging einen großen und langen Flur entlang. An den Wänden aus Naturstein, zu meiner Rechten und Linken, standen vereinzelte Vitrinen mit Fossilien. Die Decke war ziemlich hoch und mit Zierleisten aus Marmor veredelt worden, worauf irgendein antikes Muster zu sehen war. Ich konnte es leider nicht exakt bestimmen, dazu fehlte mir das Fachwissen. Schließlich war ich ein Mediziner, in der Forschung tätig und kein Historiker.
Je näher ich dem großen Festsaal kam, desto lauter schallte die klassische Musik zu mir herüber. Sie spielten auf solchen Galas meist Stücke von Mozart oder Beethoven. Ich verstand nie wozu, vermutete jedoch, man wollte das Klischee der oberen Gesellschaftsklasse und deren Vorlieben aufrechterhalten. Angespannt erreichte ich den aufwendig geschmückten Festsaal. Ich musste die Augen zusammenkneifen, da es im Flur deutlich dunkler gewesen war als hier.
Es war die pompöseste und sicherlich auch kostspieligste Spendengala, die ich je besucht hatte. Von der gewölbten Decke aus Marmor hingen die verschiedensten Kronleuchter herab und auf manchen leuchteten tatsächlich echte Kerzen. Der Boden des Saals war aus glänzenden Natursteinfliesen. Die Wände glichen denen im Flur, aus welchem ich gekommen war. In der Saalmitte stand ein Springbrunnen in dem jedoch kein Wasser, sondern der beste Champagner floss.
Entsprechend dem Anlass waren auch die Gäste gekleidet. Überall sah man reiche Frauen und Männer in feinster Abendgarderobe. Jedes Kleid und jeder Smoking rangen um Aufmerksamkeit der anderen Gäste. Natürlich hielt jeder von ihnen ein Champagnerglas in der Hand und unterhielt sich mit den verschiedensten Leuten. Sie alle lachten und schienen Spaß zu haben, doch meist war dies nur Schein. Ich persönlich ging nur äußerst ungern auf solche Veranstaltungen. Es war mir schlicht zuwider, reichen und arroganten Menschen erklären zu müssen, worum sich meine Forschungen drehten. Zudem musste ich es ihnen so schmackhaft machen, dass sie Interesse daran bekamen und mich und die Firma mit einer großzügigen Spende unterstützten. Genau diese gängige Praxis war mir schon immer ein Rätsel gewesen. Wie sollten wir Wissenschaftler in der Forschung schnelle und bahnbrechende Erfolge erzielen, wenn unsere Fördermittel davon abhingen, ob wir einem verwöhnten Menschen, der keine Ahnung von dem Forschungsfeld hatte, eben genau dieses gut verkaufen konnten?
Kaum hatte ich zwei Schritte unter die Leute getan, kam bereits einer der ersten potenziellen Spender auf mich zu.
»Ah! Da ist er ja!«, rief dieser hocherfreut, als er mich erblickte. »Der berühmte Doktor Frederik Age, wie er leibt und lebt ...«
Ich lächelte freundlich und versuchte unauffällig herauszufinden, mit wem ich wohl das Vergnügen hatte. Ein weiterer Nachteil der Spendenbettelei war es nämlich, dass man die Namen sämtlicher reichen Pinkel der Stadt auswendig lernen musste und diese Gabe lag mir zumeist fern. Glücklicherweise fiel mir hier im letzten Moment wieder ein, wie der Herr hieß.
»Aber natürlich«, gab ich gekonnt freundlich mit meinem leicht englischen Akzent zurück. »Ich hoffe, Sie haben einen wunderbaren Abend, Mister Smuggels.«
Smuggels war der Leiter der weltweit führenden Firma, die sich auf den Anbau von Tabak spezialisiert hatte. Er beaufsichtigte diverse Fabriken in Äquatornähe, um dort die Klimabedingungen für den besten Anbau gut auszunutzen. Dass er dafür Unmengen von Hektar des Regenwaldes abholzen oder aber sogar Völker aus ihrer Heimat hatte vertreiben müssen, war ihm egal. Es ging ihm lediglich um den steigenden Profit.
»Sagen Sie, Doktor Age, ist es denn wahr, dass Sie an einem Mittel gegen Lungenkrebs arbeiten?«, fragte er gespannt und betrachtete mich eingehend. Ich fühlte mich augenblicklich wie ein Objekt unter dem Mikroskop.
»Ähm ... Ja, das stimmt. Aber die Forschung steckt noch in den Kinderschuhen«, gab ich zurück.
»Mensch, aber das ist kolossal!«, Smuggels erhob sein Champagnerglas und reichte mir ebenfalls eins, welches er einem Kellner vom Tablett genommen hatte. »Dann stoßen wir auf Ihre Forschungen an, Doktor Age! Sie heilen die Leute vom Lungenkrebs und ich sorge dafür, dass sie selbst danach noch in den köstlichen Genuss von Tabak kommen können!«
Eigentlich war mir das Anstoßen darauf zuwider, doch ich hatte keine andere Wahl. Für einen Abend musste ich meine Werte und Prinzipien außer Acht lassen und das Theater mitspielen, sonst würde keiner in meine Forschungen investieren. Dieser ständige Spießrutenlauf war wirklich nichts für mich ...
Nachdem ich mit Mr. Smuggels auf einen erfolgreichen und dennoch entspannten Abend angestoßen hatte, schritt er weiter und entdeckte einen befreundeten Geschäftsmann aus der Handfeuerwaffenbranche. Unterdessen setzte ich meinen Weg durch die Halle fort. Das Problem bei solchen Veranstaltungen? Dass es ein reines Glücksspiel war ... Man durfte nicht auf die Spender zugehen, sondern sie mussten einen selbst ansprechen. Andernfalls hielten sie einen für aufdringlich und gingen einem Gespräch mit dir aus dem Weg. Man musste also hoffen, dass sich die Leute über dich und deine Forschungen informiert hatten oder dass ein Geldgeber bereits in dich investierte und nun vor seinen reichen Freunden damit prahlen wollte.
Plötzlich tippte mir jemand auf die Schulter und ich wandte mich um. Vor mir stand ein noch recht junger, aufgeweckter Mann in weißem Smoking, der mich mit leuchtenden Augen ansah.
»Sie sind doch Doktor Age, richtig?«, frage er hoffnungsvoll.
»Ja, der bin ich«, gab ich leicht verwirrt zurück. »Und Sie sind?«
»Oh, natürlich! Mein Name ist Huntington, Steven Huntington. Ich bin der Vorsitzende von Huntington Industries.«
Ich erinnerte mich an den Namen. Er leitete eine Prozessorfirma und machte in den letzten Jahren Unmengen an Geld mit dem Verkauf seines Quantenprozessors für Jedermann. Er bastelte an Prototypen, nach eigenen Aussagen, in der Garage seiner Eltern und fand relativ schnell einen willigen Investor. Daher war es kaum verwunderlich, dass er mit Mitte Zwanzig bereits Multimillionär war.
»Oh ja, ich habe schon von Ihnen gehört«, sagte ich lächelnd.
»Natürlich haben Sie das. Ich auch von Ihnen! Wieso müssen Sie denn auf solch einer Veranstaltung um Spendengelder betteln? Sollten Sie mit Ihren bisherigen Ergebnissen nicht unlängst selbst Millionär sein? Ich meine, das waren doch Sie, der mit seiner Technik zur erfolgreichen Verknüpfung von abgetrennten Nervenfasern im menschlichen Körper Querschnittsgelähmten auf die Beine half, oder?«
»Nun, zugegeben, das war meine Erfindung. Allerdings arbeitete ich damals für einen Pharmakonzern und dieser hat sich die Lizenzrechte dafür unter den Nagel gerissen und mich nach einer misslungenen Klage fristlos entlassen. Das ist allerdings schon lange her und ich bin froh, dass meine Technik wenigstens vielen Menschen helfen konnte.« Der Jungmillionär blickte mich skeptisch an, nahm anschließend noch einen Schluck Champagner und machte bereits Anstalten weiterzuziehen.
»Ja, aber natürlich. Nur die gute Tat zählt am Ende«, antwortete er mir geradezu abwertend und verschwand in der Menge.
Ich ließ mir den Ärger darüber nicht anmerken und machte mich auf den Weg zum Champagnerbrunnen. Für diesen Abend bedarf es eindeutig an mehr Alkohol. Ansonsten wäre es mir unmöglich, noch länger dieses Schmierentheater mitzuspielen. Dort angekommen hielt ich ein Glas unter den Hahn und ließ den Champagner hineinlaufen. Plötzlich ertönte hinter mir eine raue Stimme.
»Doktor Age, wie ich sehe, benötigen Sie etwas Unterstützung, um diesen gesellschaftlichen Anlass zu überstehen?«
Erschrocken drehte ich mich um und sah eine alte Frau vor mir. Sie war ein wenig kleiner und schmaler als ich, trug ein langes schwarzes Abendkleid und ein Schönheitsfleck zierte ihre linke Wange. Ihre dünnen braunen Haare hatte sie zu einer Hochsteckfrisur zurechtgemacht und ich schätzte sie auf etwa siebzig. Nur die kalten blauen Augen passten irgendwie nicht zum schlichten Erscheinungsbild. Sie lösten in mir ein unbehagliches, beinahe verstörendes Gefühl aus. Darin fand sich nichts von der Wärme und Eleganz ihres Äußeren.
Sie schien meine Irritation bemerkt zu haben und stellte sich vor.
»Oh, verzeihen Sie. Wo bleiben nur meine Manieren. Ich bin Miss Sophie Abbanathy. Mein Mann war ein landesweit bekannter Kunsthändler. Leider verstarb er vor kurzem und hinterließ mir ein Vermögen, mit dem ich nicht so recht etwas anzufangen weiß.« Ihre Aussage verstärkte meine Irritationen weiter. Bot sie mir gerade Geld an, oder verstand ich Mrs. Abbanathy vielleicht falsch? Zum Glück fing ich mich.
»Aber natürlich, Mrs. Abbanathy. Es ist mir eine Freude Sie kennenzulernen«, gab ich zurück und ließ dabei meinen Charme spielen. »Ich bin Doktor Age und forsche auf dem Gebiet der ...«
»Ach, Sie müssen gar nicht weiterreden«, unterbrach sie mich. »Ich weiß sehr gut, wer Sie sind und auch, womit sich Ihre Forschungen beschäftigen. Also reden wir doch bitte direkt Klartext, einverstanden?«
Diese Frau entwickelte sich immer mehr und mehr zum Rätsel, doch egal welches Spiel sie spielen wollte, ich würde mitspielen und am Ende sicherlich nicht als Verlierer dastehen. Mit einem Nicken zeigte ich ihr, dass ich verstanden hatte.
»Doktor Age, in gewissen Kreisen erzählt man sich, dass Sie gerade an einem sehr interessanten Thema arbeiten sollen.«
»Ach, ist das so, Mrs. Abbanathy? Um was für Kreise handelt es sich denn dabei genau?«, fragte ich mutig.
Das war ein gewagter Schachzug von mir. Zum einen konnte sie meine Frage beleidigen, oder sie verstand den Anreiz. Tatsächlich interessierte mich, woher sie diese Information hatte. Ich forschte genau nach zwei Arten in meinen Forschungsprojekten. Die einen, welche ich öffentlich machte und für die ich die entsprechenden Spendengelder sammelte und natürlich noch jene, die meist nur als Prototypen existierten und die ich noch nicht zu Ende gedacht hatte. Schlussendlich konnte ich nur dann Gelder für Projekte verlangen, wenn sie den Investoren auch Erfolg versprachen.
Ihre faltige Haut straffte sich, als Mrs. Abbanathy zu Lächeln begann.
»Das tut hier nichts zur Sache, Doktor Age. Ich spreche von den Mitteln, Maschinen und Methoden, die das ewige Leben realisieren können«, gab sie in immer leiser werdendem Ton von sich.
Ich erschrak. Meine Forschungen auf diesem Gebiet waren noch unbekannt und privat. Ich hatte niemandem davon erzählt, nicht einmal den Forschungskollegen. Wie um alles in der Welt konnte sie davon wissen?
»Woher wissen Sie ...?«, wollte ich schockiert wissen und kniff misstrauisch die Augen zusammen.
»Oh, Doktor Age«, sagte sie. »Sie können mir vertrauen. Wissen Sie, tatsächlich interessiert mich das ewige Leben sehr. Ich meine, es gibt noch so vieles auf der Welt zu sehen und zu erleben. Dafür reicht ein Leben nicht aus! Ich kenne all Ihre Aufzeichnungen. Sie haben für jedes Problem des ewigen Lebens eine Lösung ausgearbeitet, ist es nicht so?«
Ich wusste gar nicht, was ich darauf antworten sollte. Sie hatte zwar Recht, aber wie kam sie an meine Notizen und Aufzeichnungen? Im Kopf ging ich die verschiedensten Möglichkeiten durch, doch da ich mir nicht erklären konnte wie Mrs. Abbanathy an diese Informationen gelangte, bemühte ich mich um Schadensbegrenzung. Möglicherweise würde ich ihr noch einen Hinweis entlocken können.
»Nun ja, das mag sein. Allerdings existieren all diese Lösungsansätze bislang lediglich in der Theorie und nicht in der Praxis. Es steht also noch alles am Anfang und kann mitunter noch Jahre dauern, bis sich manches davon realisieren lassen könnte«, formulierte ich vorsichtig.
»Oh, das ist äußerst bedauernswert«, gab Mrs. Abbanathy von sich. »Wissen Sie, ich halte ein ewiges Leben für durchaus erstrebenswert. Was sollte ich schließlich sonst mit dem Reichtum anfangen? So wie es aktuell aussieht, werde ich wohl nicht mehr lange genug leben, um alles ausgeben zu können.«
Ich versuchte inständig, besorgt auszusehen, aber es schien mir nicht zu gelingen. In ihrem kalten Blick erkannte ich, dass sie mir misstraute. Wäre es nur das gewesen, wäre es nicht so schlimm. Anschließend starrte sie mir so intensiv in die Augen, dass mir unbehaglich wurde. Ich wollte so schnell, es eben ging, weg von dieser Frau. Ich wusste nicht, was es war, aber irgendetwas an ihr ließ mir das Blut in den Adern gefrieren.
»Wenn Sie mich nun entschuldigen würden, ich habe gerade Mr. Wellington gesehen und würde ihm gerne eine neue Idee von mir vorstellen«, log ich und suchte Reißaus.
»Oh, aber natürlich!«, antwortete Mrs. Abbanathy und warf mir erneut diesen kalten und intensiven Blick zu, als ich mich von ihr entfernte.
Bereits wenig später verging mir die Lust am Spendensammeln und ich machte mich erfolglos auf den Heimweg. Sicherlich hätte ich noch den einen oder anderen Investor überreden können, aber Mrs. Abbanathy sorgte dafür, dass ich keinen vernünftigen Gedanken mehr hatte fassen können, sobald mich jemand auf meine Forschungen ansprach. Immer wieder versuchte ich dahinter zu kommen, wie sie an die Aufzeichnungen herangekommen sein konnte und wie sie überhaupt davon erfahren hatte.
Gedankenverloren verließ ich das Museum und versuchte auf dem Heimweg im Taxi einen klaren Kopf zu kriegen. Diesen würde ich am nächsten Tag im Labor schließlich dringend benötigen, wenn ich dem Sicherheitspersonal ordentlich die Leviten las.
Kapitel 2
Es war ein ziemlich angenehmer Morgen. Als ich die Augen öffnete, da mein Wecker mich weckte, lächelten mir die ersten Sonnenstrahlen des Tages entgegen. Die Vögel draußen zwitschern bereits. Vorm Fenster stand eine alte Eiche und ihre Äste wogen sich sanft im Wind. Jedenfalls glaubte ich, das zu sehen, als ich den Blick dahin wendete und langsam zu Bewusstsein kam.
›Heute wird ein guter Tag‹, ging es mir durch den Kopf und ich erhob meinen Körper von der Matratze.
Gleich nachdem ich aufgestanden war, machte ich mein Bett und nahm anschließend Kurs aufs kleine Badezimmer. Es war, wie das Schlafzimmer, sehr schlicht eingerichtet. Man sollte meinen, dass schlaue Leute wie ich als Wissenschaftler, genug Geld für ein eigenes Haus verdienten, tatsächlich bekam ich jedoch gerade noch so viel, dass ich die kleine Zweizimmerwohnung bezahlen konnte. Da ich sowieso kaum Zuhause war, sondern die meiste Zeit des Tages im Labor verbrachte, gab es auch nicht sonderlich viel zu sehen. Hier und da hingen Bilder von mir mit Freunden und Verwandten an den Wänden. Auf Dekorationsartikel verzichtete ich komplett und das Meiste meines Mobiliars war ebenfalls schlicht weiß.
Als ich mich im Badezimmer rasiert, meine Zähne geputzt, das Gesicht gewaschen und meine Haare gebändigt hatte, suchte ich aus dem Kleiderschrank etwas Passendes zum Anziehen heraus. Erfreut darüber, dass der Pullover vom Vortag noch nicht stank, sodass ich ihn erneut anziehen konnte, trat ich in den Flur und packte meine Tasche. Frühstücken konnte ich morgens nie. Ich bekam zu so früher Stunde einfach noch nichts runter.
Ich ging zur Kommode im Flur und schnappte mir dort meine Zugangskarte für die Räumlichkeiten auf der Arbeit. ›Hypermed‹ stand ganz oben auf der laminierten Chipkarte. Sie bot die einzige Möglichkeit das Labor sicher zu betreten und ich hatte sie zum Glück noch nie verloren. Ich schnappte mir meine Notizen, welche direkt daneben lagen und steckte sie und die Chipkarte in meine braune Umhängetasche.
Nachdem ich mir die Tasche über die Schultern geworfen und nach meinem Schlüssel und dem Portmonee gegriffen hatte, ging ich hinüber zur Eingangstür und schloss diese auf. Als ich mich zur Seite drehte, blieb mein Blick jedoch an einem Foto an der Wand hängen. Darauf zu sehen waren ein Mann mit grauen Haaren, einem herzlichen Lächeln und braunen Augen, sowie eine Frau mit kurzem, weißen Haar und einem Eis in der Hand. Sie standen wie ein glückliches Paar vor einer Waldhütte. Meine Eltern. Dort hatten sie oft und gern Urlaub gemacht. Sie konnten so dem Trubel des Stadtlebens am besten entfliehen, meinten sie stets.
Bei dem Anblick des eigentlich glücklichen Bilds kamen in mir Gefühle an die Oberfläche, die ich lange versucht hatte zu unterdrücken. Meine Eltern starben vor gut zehn Jahren bei einem Autounfall. Sie waren anlässlich ihres Hochzeitstags schick essen gegangen und auf dem Heimweg von einem LKW, dessen Fahrer eingeschlafen war, gerammt und von der Straße direkt gegen einen Baum geschleudert worden. Die Polizei hatte mir damals zwar versichert, dass beide direkt tot gewesen waren, glauben konnte ich es allerdings nie. Ich bekam mitten in der Nacht den furchtbaren Anruf, fuhr sofort vom Studentenwohnheim zur Unfallstelle und sah alles. Nie würde ich diese schrecklichen Bilder und Erinnerungen vergessen können ...
Ich atmete tief durch und trat anschließend aus der Wohnungstür. Das enge Treppenhaus war eine Katastrophe. Nicht nur, dass es immer schmutzig war, weil sich keiner der Hausbewohner an den Putzplan hielt, nein, natürlich hatte man es auch noch so eng bauen müssen, dass immer nur eine Person auf die Treppe passte. Sobald eine weitere Person hoch oder runter ging, musste man warten, bis diese den Weg beendet hatte. Bei den zwei rüstigen Rentnerinnen aus dem obersten Stock dauerte es schon mal ein paar Minuten.
Als ich endlich das Erdgeschoss erreichte, zog ich meinen Schlüssel aus der Hosentasche und öffnete den Briefkasten. Ich erwartete einen wichtigen Brief, doch zu meiner Enttäuschung schien der Postbote noch gar nicht da gewesen zu sein. Genervt, aber fest davon überzeugt, dass mein Tag nach dem dürftigen Start eigentlich nur noch besser werden konnte, öffnete ich die Haustür und trat auf die Straße.
Womit ich jedoch keineswegs gerechnet hatte, was meine Augen nun erblickten, war eine lange schwarze Limousine, die vor dem Haus parkte. Ich bemerkte, dass auf dem Fahrersitz ein Chauffeur mit uniformtypischer Mütze saß.
»Was zum ...?«, entschlüpfte es mir leise und ich hatte kaum den Mut einen Schritt weiter zu gehen.
›Das muss ein Irrtum sein. Die ist nicht für mich‹, dachte ich und war schon drauf und dran, mich nach rechts und in Richtung Straßenbahnhaltestelle zu wenden, doch kaum hatte ich einen Fuß vor den anderen gesetzt, fuhr plötzlich das Fenster der Limousine herunter und das Gesicht einer alten Frau erschien. In der Hand hielt sie eine Zigarette und nahm einen kräftigen Zug, ehe sie den Rauch durch das Autofenster hinauspustete.
»Doktor Age!«, rief sie mit rauer Stimme. »Welch eine Freude Sie wiederzusehen!«
Mich traf in dem Moment, als ich erkannte, wen ich da vor mir hatte, beinahe der Schlag. Im ersten Augenblick traute ich mich nicht, etwas zu sagen, geschweige denn einen Schritt auf sie zuzugehen. Nachdem sich ihre Mundwinkel zu einem kalten Lächeln verzogen und sie mir wieder denselben herausfordernden Blick zuwarf, den ich bereits auf der Spendengala ertragen hatte, musste ich etwas sagen.
»Mrs. Abbanathy?!«, fragte ich irritiert. »Was machen Sie denn hier?«
»Oh, junger Doktor Age, ich war gerade hier in der Nähe zu ein paar Erledigungen und dachte mir, dass ich Ihnen doch einen Besuch abstatten könnte«, sagte sie noch breiter das Gesicht verziehend.
»Ähm ..., ja ..., okay ..., aber macht man das nicht eher abends? Ich meine, wir haben sieben Uhr morgens und die meisten Menschen sind auf dem Weg zur Arbeit.«
Irgendetwas führte sie im Schilde, dessen war ich mir bewusst. Keineswegs war ihr Besuch bei mir ein Zufall, ganz gewiss nicht!
»Ach, so? Ist das der gewöhnliche Arbeitsrhythmus der Gesellschaft? Wie eintönig! Jedenfalls würde ich Sie gern zum Kaffee in mein bevorzugtes Lokal einladen. Ich denke, dass wir noch einiges zu besprechen haben, Doktor Age.«
Ich hatte absolut keine Ahnung, worauf sie hinauswollte. Was sollten wir noch zu besprechen haben? Tatsächlich hatte ich sogar gehofft, dass ich sie nach der Gala nie mehr zu Gesicht bekam. Da lag ich wohl falsch.
»Oh, ähm, ich danke Ihnen, Mrs. Abbanathy. Leider muss ich meinem Arbeitsrhythmus folgen und selbst zur Arbeit ins Labor. Aber kommen Sie demnächst gern wieder, dann habe ich hoffentlich etwas mehr Zeit«, sagte ich.
Die Einladung zu einer anderen Zeit war reine Höflichkeit. Ich wollte Mrs. Abbanathy schließlich als potenzielle Spenderin nicht komplett vergraulen. Leider waren meine Forschungen auch auf ihre Spendengelder angewiesen, so wenig ich diese unsympathische Frau auch leiden konnte.
»Oh, nun haben Sie sich doch nicht so! Ich lasse meinen Chauffeur auf Ihrer Arbeit anrufen und Bescheid geben, dass wir eine wichtige Verabredung haben. Ich habe nämlich das Gefühl heute in Geberlaune zu sein und da wird Ihr Boss Ihnen sicherlich nicht böse sein. Also los, steigen Sie schon ein, Doktor, und wir machen uns auf den Weg!«
Leider fiel mir daraufhin keine passende Ausrede mehr ein und als ich registrierte, dass ihr Chauffeur tatsächlich sein Smartphone nahm und jemanden anrief, konnte ich nicht mehr auf der Arbeit erscheinen. Mrs. Abbanathy fuhr das Fenster der Limousine hoch und öffnete mir die Tür. Sie rutschte im Wagen einen Sitz weiter und machte Platz. Ich setzte mich zu ihr auf die Rückbank und sie wirkte begeistert.
»Warten Sie, bis Sie das wundervolle Ambiente des Lokals sehen! Es ist wahrhaftig exquisit!«, schwärmte sie und bedeutete dem Fahrer mit einer Handbewegung, loszufahren.
Etwa eine halbe Stunde später saßen Mrs. Abbanathy und ich uns in einem wirklich schönen Café gegenüber. Die Clubsessel waren aus schwarzem Leder und der Boden mit einem schönen roten Teppich ausgelegt. Diverse Wandmalereien von den verschiedensten Künstlern schmückten die Decke und es spielte leise Jazzmusik im Hintergrund. Die Kellner trugen allesamt feinste Abendgarderobe und wirkten hochprofessionell. Es gefiel mir wirklich hier!
»Guten Morgen, die Herrschaften«, sagte einer der Kellner, als er zu uns kam, um die Bestellung aufzunehmen. »Darf ich Ihnen schon etwas zu trinken bringen?«
»Oh, aber gerne doch! Ich nehme einen Latte Monte Chillon mit Blattgold und meine Begleitung«, zwitscherte die alte Dame und blickte mich an.
»Ich nehme nur einen schlichten schwarzen Kaffee, danke.«
»Gewiss doch, wie Sie wünschen. Ich danke Ihnen und werde mich unverzüglich darum kümmern«, sagte der Kellner und machte sich davon in Richtung Küche.
Ich fragte mich, ob es sie nicht furchtbar nervte, immer so geschwollen sprechen zu müssen. Es klang zwar sehr vornehm, aber für mich war es meisten furchtbar anstrengend. Es war schlimm genug, auf offiziellen Veranstaltungen ständig den englischen Akzent nachmachen zu müssen und das nur, weil ich einige Auslandssemester in England gewesen war. Eigentlich war ich in Amerika geboren und aufgewachsen, aber ich hatte die Erfahrung gemacht, dass der englische Akzent bei den hiesigen Investoren und Spendern einfach besser ankam.
Jetzt, da der Kellner verschwunden war, bemerkte ich, dass mich Mrs. Abbanathy mit Blicken förmlich löcherte. Die Ausstattung dieses Cafés war zwar exzellent, aber meine Gegenüber erzeugte mit dieser eisigen Ausstrahlung und starren Blicken eine so kühle und kraftraubende Atmosphäre, dass ich leicht zu zittern begann. Sie legte den Kopf schief. Es sah so aus, als würde sie nachdenken, was sie mit mir anstellen sollte. So stellte ich mir einen Mörder vor, wenn er darüber nachdachte, wie er nun die Leiche am besten entsorgte. Etwas stimmte hier nicht und mir war klar, dass sie dieses Treffen nicht in die Wege geleitet hatte, um mir irgendwelche Spendengelder zu überreichen.
»Wissen Sie, Doktor Age, ich habe Ihre Forschungsarbeiten genau gelesen und mir auch eine Zweitmeinung eingeholt. Der befreundete Professor war ganz begeistert und nannte Ihre Überlegungen bahnbrechend«, unterbrach sie die Stille und tippte die Fingerkuppen gegeneinander.
»Darf ich fragen, auf welche Forschungsergebnisse Sie sich hier beziehen?«, fragte ich und hoffte, dass sie mir nicht die Antwort gab, mit der ich rechnete.
»Bezüglich des ewigen Lebens natürlich! Wissen Sie, als ich dies alles las, von neuen Organen aus Druckern und kleinen Nanorobotern, die durch unsere Adern schwimmen und Krankheitserreger bekämpfen sollen, konnte ich kaum glauben, dass es tatsächlich in der heutigen Zeit schon umsetzbar sein soll. Sogar als mir der Professor versicherte, dass es machbar wäre, war ich nicht überzeugt. Wissen Sie, es klingt noch zu sehr nach Science-Fiction.«
In der Zwischenzeit brachte uns der Kellner die bestellten Getränke und Mrs. Abbanathy nippte genüsslich an ihrem.
»Nun, vergessen Sie aber bitte nicht, dass dies alles auf reiner Theorie basiert und noch nie erprobt wurde. Die Risiken und Nebenwirkungen sind gar nicht abzuschätzen.«
Eigentlich brannte mir die viel wichtigere Frage, wie sie an diese Ergebnisse herangekommen war, auf der Seele. Ich fürchtete jedoch, dass es nicht gerade klug wäre sie dies abermals zu fragen. Sie war schließlich eine potentielle Spenderin. Sie hatte sogar schon Kontakt mit meinem Vorgesetzten aufgenommen.
»Es wäre wirklich absoluter Wahnsinn meine Ideen in der heutigen Zeit umsetzen zu wollen. Schließlich steckt die dafür benötigte Technik noch im Entwicklungsstadium«, fügte ich rasch hinzu.
Mrs. Abbanathy runzelte die Stirn und schien nicht überzeugt.
»Also das bedaure ich sehr. Zum Glück haben Sie mit Ihren Forschungen schon einiges möglich gemacht, was viele Ihrer geschätzten Wissenschaftskollegen für reinen Unfug hielten, nicht wahr? Dann denke ich, dass wir in der Zukunft ebenfalls wahre Wunder von Ihnen erwarten können, Doktor«, sagte sie und trank einen weiteren Schluck.
»Nun ja, das mag vielleicht sein, aber ...«
»Reden Sie sich jetzt nicht heraus«, fiel sie mir ins Wort. »Tatsächlich denke ich, dass Sie Ihr eigenes Potential maßgeblich unterschätzen!«
Mir wurde es immer flauer in der Magengrube. Sicher, ich hatte schon einige großartige Leistungen vorzuzeigen, dennoch hielt ich mich mit all den Versuchen und Ergebnissen stets auf der sicheren Seite. Erst wenn meine Experimente mehrmals fehlerfrei abliefen und ich die Risiken realistisch abschätzen konnte, dann und auch nur dann, stimmte ich einer Veröffentlichung dieser mit gutem Gewissen zu.
Von Minute zu Minute wurde mir die Situation im Café suspekter und ich wollte schleunigst verschwinden. Noch nie hatte mich eine Spenderin auf einen Kaffee eingeladen und noch nie hatte ich ein so ungutes und seltsames Gefühl. Ich wollte zu meiner Arbeit und damit meiner Leidenschaft nachgehen.
»Nun gut«, sagte ich schließlich und erhob mich aus dem Clubsessel. »Wie Sie selbst schon sagten, habe ich möglicherweise noch große Dinge vor mir und daher sollte ich mich nun auf den Weg in mein Labor machen und dort weiter daran arbeiten.«
Während ich aufstand, bemerkte ich in Mrs. Abbanathys Augen einen Ausdruck, der alle bisherigen toppte. Dieser war so voller Kälte und Bosheit, dass ich fast dachte, mein Leben wäre in Gefahr. Ihre Augen fixierten die meinen und sie schaffte es, mir damit riesige Angst einzujagen. Ich gab mir die größte Mühe, weiterhin tapfer und selbstbewusst zu wirken, auch wenn ich dies nun nicht mehr war.
Ihr Gesichtsausdruck änderte sich erneut und ein falsches Lächeln sollte mich täuschen.
»Natürlich, da haben Sie absolut Recht!«, flötete sie. »Soll ich Sie mitnehmen und bei der Arbeit absetzen?«
So praktisch ihre angebotene Taxifahrt auch gewesen wäre, bedankte ich mich für den Vorschlag, zog es nun allerdings mehr denn je vor mit der Straßenbahn zu fahren. Nach weiteren höflichen Floskeln und guten Wünschen verließ ich das Lokal und bemerkte noch, wie mich Mrs. Abbanathys Chauffeur besorgt aus dem Autofenster heraus ansah. Es schien beinahe so, als würde er etwas wissen, was mir noch nicht klar war. Doch was könnte es sein?
Ich erreichte nur wenig später die nächste Straßenbahnhaltestelle und nahm in der wartenden Bahn Platz. Während der Fahrt blickte ich aus dem Fenster und achtete kaum auf die Aussicht. Ich versuchte verzweifelt dahinter zu kommen, welche Hintergedanken Mrs. Abbanathy haben könnte und was sich hinter diesem falschen Lächeln verbarg. Wieso interessierten sie meine Pläne zum ewigen Leben so sehr und wie kam sie überhaupt an die unveröffentlichten Notizen? Was könnte sie damit bezwecken? Sicherlich nichts Gutes, dessen war ich mir sicher.
Ich hatte in einem Magazin, kurz nach dem Tod ihres Mannes, einen Artikel über sie gelesen. Angeblich soll sie den Verlust kaum verkraftet haben und nachdem sie sich aus Verzweiflung schließlich selbst das Leben hatte nehmen wollen, wies man sie in eine geschlossene psychiatrische Anstalt ein. Nach nur einem halben Jahr verließ sie diese, nahm das Erbe ihres verstorbenen Gatten an und zog sich vollständig aus der Öffentlichkeit zurück. Warum und weshalb, das wusste angeblich niemand. Erst vor wenigen Wochen wurde sie auf einigen gesellschaftlichen Anlässen gesehen und wie ich jetzt feststellte, waren das hauptsächlich solche, auf denen auch ich war oder gewesen sein sollte. Die eine oder andere Gala hatte ich nicht besucht. War sie möglicherweise schon länger hinter mir her gewesen?
Über die Lautsprecherdurchsagen hörte ich, dass die nächste Haltestelle meine war. Ich warf mir meine Tasche über die Schulter und als die Straßenbahn zum Stehen kam, stieg ich aus. Ich verließ sie jedoch keinesfalls unbesorgt. Irgendetwas an diesem Abend im Museum hatte mein Leben auf eine grundlegende Art und Weise verändert und ich sah mich mittlerweile in der Annahme bestätigt, dass es etwas mit Mrs. Abbanathy zu tun hatte. Leider kam ich einfach nicht dahinter, um was es sich dabei genau handelte.
Kapitel 3
Seit des unangenehmen Aufenthalts im Café mit Mrs. Abbanathy war eine Woche vergangen. Ich hatte nichts mehr von ihr gehört und war darüber auch recht froh gewesen. Mein Leben verlief normal. Ich hatte einen sehr langen und anstrengenden Tag im Labor gehabt. Ein ernstzunehmender biologischer Unfall wäre sogar beinahe geschehen.
Meine aktuellen Forschungen handelten davon, das AIDS-Virus mithilfe eines anderen Virus im menschlichen Körper abzutöten, aber mit einem, von dem sich der Proband auch erholen konnte, also z.B. einem Grippevirus. Wir hatten den Virus bereits soweit genetisch modifiziert, sodass es nun in der Lage gewesen wäre, sich anhand von Aids-Viren zu vermehren. Dies würde es theoretisch so lange tun, bis keine schädlichen mehr im Probanden nachzuweisen wären. Als ich allerdings einen der Praktikanten darum gebeten hatte, mir die Petrischale mit dem BSE-Virus zu reichen, stolperte dieser unglücklich und ließ sie fallen! Wir hatten großes Glück, dass die Petrischale geschlossen geblieben und das Virus somit weiterhin sicher verwahrt war.
Leider bedeutete dies für mich eine ganze Menge nervigen Papierkram und meine rechte Hand wurde vom Chef in die Logistikabteilung strafversetzt. Dabei hatte ich mich noch für ihn eingesetzt, schließlich konnte jeder einmal stolpern.
Als ich selbst noch während meines Studiums als Praktikant in einem anderen Pharmaunternehmen tätig gewesen war, vertauschte ich unglücklicherweise einmal zwei Proben. Bis heute wusste mein damals leitender medizinischer Wissenschaftler nicht, weshalb sein Versuch zur Erschaffung eines neuen Migränemedikaments fehlschlug.
Zum Leid aller war mein heutiger Chef der größte Vollidiot auf diesem Planeten. Egal was ich sagte und wie sehr ich den Praktikanten auch in Schutz nahm, er ließ sich von seiner Idee der Strafversetzung nicht abbringen. Es tat mir schrecklich leid für den Jungen, denn er war einer meiner Besten und hatte wirkliches Potential!
An diesem Abend war ich froh, nach langer Straßenbahnfahrt, endlich meine Wohnung zu erreichen. Ich kramte den Haustürschlüssel aus der Hosentasche und schloss die braune Eingangstür auf. Quietschend öffnete sie sich und gab den Weg ins enge Treppenhaus frei. Ich lief nach oben zur Wohnungstür und schloss auch diese auf. Sofort stieg mir der wohlbekannte Duft in die Nase. Ich glaubte, dass jeder Mensch einen Eigengeruch in der Wohnung und natürlich auch an sich selbst hatte. Diesen rochen die Meisten auch am liebsten und genauso ging es mir. Nach tiefem Luftholen und einem entspannten Ausatmen betrat ich meine Wohnung, zog die Schuhe im Flur aus, legte meine Tasche auf der Kommode ab und schaute in den Spiegel.
So fertig, wie ich mich fühlte, sah ich zu meiner Überraschung gar nicht aus. Sicher, meine Haare waren ein wenig verwuschelt und das blaue Hemd wies einige Knitter auf, aber für die Umstände des Tags ging es noch. Vor einigen Monaten hatte ich aus Versehen Salzsäure im Labor verschüttet. An dem Abend sah ich eindeutig ramponierter aus.
Ich gähnte und freute ich mich darauf ins Wohnzimmer zu gehen, mich in meinen Lieblingssessel zu setzen und mit einem guten Buch den Abend ausklingen zu lassen. Müde schaltete ich das Licht im Wohnzimmer ein und wandte mich gerade meinem Sessel zu, als mich fast der Schlag traf.
»Mrs. Abbanathy?!«, rief ich geschockt, als ich sie sah.
Sie saß mitten im Wohnzimmer in meinem Sessel und schien es sich dort regelrecht gemütlich gemacht zu haben. Die alte Frau trug ein rotes Kleid und einen schwarzen Bolero, doch wirklich anschaulich sah sie damit nicht aus. In dem faltigen Gesicht spiegelte sich ein heimtückisches Lächeln wider und auf ihrem Schoß lag ein großer brauner Briefumschlag.
»Was zur Hölle machen Sie in meiner Wohnung? Wie sind Sie hier rein gekommen?«, brachte ich ärgerlich heraus.
»Ach, Doktor Age«, sagte sie seufzend. »Warum klingen Sie so vorwurfsvoll? Ich dachte, nach unserer letzten Verabredung seien wir Freunde geworden ... Und als Freundin darf ich Ihnen doch einen kleinen Besuch abstatten, oder etwa nicht?«