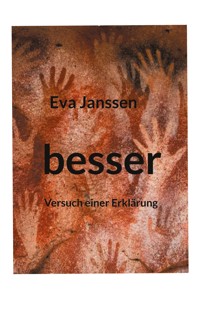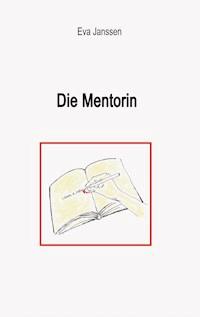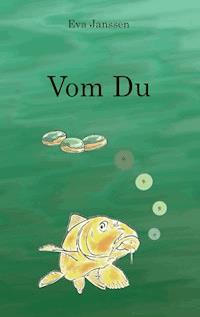Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Es war, als habe sich sein ganzes Leben auf diesen Tag hinbewegt." Der 84-jährige Joseph Zehnpfennig hat nahezu sein ganzes Leben im Kölner Stadtteil Bickendorf verbracht. Einen Tag, bevor er in ein Seniorenheim umziehen soll, erinnert er sich auf einem Spaziergang durch die heimatlichen Straßen an entscheidende Stationen seines Lebens. Vor den Augen der Lesenden entfaltet sich nach und nach die Lebensgeschichte des Kölners und mit ihr ein Stück Kölner Geschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 92
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zur Autorin dieses Buches
Eva Janssen wuchs im Kölner Friesenviertel auf. Nach ihrer Ausbildung in der Grafikabteilung des DuMont Buchverlages studierte sie Germanistik und Slawistik in Köln und am Gorki-Institut in Moskau. Im Anschluss war sie als freie Übersetzerin, Referentin und Kritikerin tätig. Heute arbeitet die Autorin als Lehrerin in der Erwachsenenbildung.
Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder
Für Bernhard
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
„Jojojo“
Drop jeschwore
E Jeschenk
Dr Quetschenbüggel
Em Bunker
Huh en dr Luff
Jeklatsch
Am Karesselche
Dä Engeländer
Dä Franzus
Ungerwächs op d´r Stroß
Fründe
Die Dude
Dä Katzekopp
De Moder
Marie
Epilog
Anhang
Vorbemerkung
Die Figur und Lebensgeschichte des Joseph Zehnpfennig sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die Daten zu historischen Begebenheiten, Persönlichkeiten und Orten wurden sorgfältig recherchiert. Namen von Firmen, die heute noch existieren, wurden verändert. Sollten mir dennoch Fehler unterlaufen sein, bitte ich dies zu entschuldigen.
Bei der Verschriftlichung der Kölschen Sprache habe ich mich, bis auf wenige Ausnahmen, an A. Wredes Wörterbuch „Neuer Kölnischer Sprachschatz“ aus dem Greven Verlag, Köln, gehalten.
Eine Übersetzung ausgewählter Stellen, die jeweils mit einem Sternchen versehen sind, findet sich im Anhang.
E. Janssen
I. „Jojojo“
„Jojojo“.
Joseph Zehnpfennig saß an einem Tischchen des kleinen Cafés in seinem Viertel, vor ihm eine halb volle Kaffeetasse. Es war ein erschöpfendes, aber noch kein endgültiges „Jojojo“, ein Leben, einen Augenblick umarmend, nicht resigniert, ein gedankenverlorenes, intuitives Resümee, ohne Faden, sprunghaft, nachdenklich, Beobachtungen und Assoziationen folgend.
Joseph Zehnpfennig erkannte Schemen von Schulkindern, die offenbar an der Drückampel warteten. Ihre schweren, mit mathematischen Aufgaben, vollgekritzelten Heften, Lesebüchern gefüllten Ranzen zogen die kleinen Rücken unnatürlich nach hinten, sie schubsten, drängelten, kicherten, schrien, bis die Fußgängerampel auf Grün sprang. Dann rannten sie über die Straße, rempelten sich mit den Ranzen an und verschwanden schließlich in der gegenüberliegenden Seitenstraße, während ihr Geschrei noch eine Weile zu hören war, bis es sich endgültig verlor. Doch all das entging Joseph Zehnpfennig. Nur noch dumpf drangen Geräusche in seine zwar riesigen, an Flügel erinnernden Ohren, die aber schon lange nicht mehr leisten wollten, was sie verhießen, und auch das, was man schlechthin als Augenlicht bezeichnet, war trüb geworden. Ins Café Schlösser, in dem er seit dem Tod seiner zweiten Frau Stammgast war, hatte ihn sein neuer Krückstock begleitet, gegen den er sich lange und heftig gestemmt oder eben nicht gestemmt hatte, denn Joseph Zehnpfennig war stolz.
„Jojojo“.
Ein LKW ratterte durch die Straße. Die Kaffeetasse vibrierte. Der Löffel klimperte.
Dr Jupp, wie er gerufen worden war, hatte auch einen Ranzen gehabt, einen braunen Lederranzen. Hinten hatte oft das obligatorische Schwämmchen herausgehangen. Die mit den Hausaufgaben beschriebene Tafel musste man vorsichtig in den Ranzen schieben, sonst verwischten die Aufgaben und dann gab es Stockhiebe. Dr Jupp wurde vom Lehrer Küppers nach vorne gerufen, musste sich mit dem Gesicht zur Klasse stellen, damit auch ja alle seine schmerzverzerrte Grimasse sehen und sein Jammern hören könnten. Er war nicht der einzige Boxsack, an dem Küppers trainierte. Dr Jupp war ein ganz normaler Junge gewesen, nicht auffällig, nicht besonders klug, nicht besonders dumm, nicht besonders frech, nicht besonders brav, nicht besonders mutig, nicht besonders feige. Normal eben.
Heute war in der Schule Lindweilerhof, die um die Ecke lag, so eine seltsame Einrichtung untergebracht. Die roten Ziegelsteine waren weiß getüncht worden, auf dem Vorhof standen Autos. „Förderschule“ nannten die Leute das Gebäude. Was sollte das sein? Joseph Zehnpfennig konnte sich darunter nichts Genaues vorstellen. Wurden Kinder denn nicht mehr in allen Schulen gefördert? Es waren große, lärmende, oft dicke Jungs, die morgens in diese Schule marschierten. Der Joseph war zwar auch ein robust gebauter, breitschultriger Junge gewesen, allerdings von nur geringem, etwas gedrungenem Wuchs. So viele Jungs! Das war schon ein Kampf, eine dauernde Rangelei, um den Rang eben, in der vorherrschenden Hackordnung. Man musste sich durchsetzen oder geschickt entziehen, bloß nicht runtergucken, wenn einem der Herrmann entgegenkam, „Da kütt dr Manes met singer Band“*. Auch konnte es einem schon einmal passieren, dass man Würmer fressen sollte. „Do! Fress!“ Udder beste ze fies dovör?“* Dr Jupp war im Innern ein sanfter Junge. Er ekelte sich nicht etwa vor den Würmern, nein, sie taten ihm leid! Dem Manes dagegen kam erst gar nicht ins Bewusstsein, dass seine eigentlichen Opfer die Würmer waren.
„Jojojo“
Mädchen, ja Mädchen! Die waren in der Volksschule streng getrennt von den Jungs unterrichtet worden. Trotzdem konnte man vor oder nach Schulschluss einen Blick riskieren. Bei der Marie hatte dem damals 9jährigen Jupp nur ein Blick genügt. Das war die Zeit, wo hier noch keiner diese Braunhemden mit dem albernen Schlöppchen trug und die langen, blonden Zöpfe von der Marie noch nicht arisch waren, sondern ganz normal blond. Aber es waren ja auch gar nicht die Haare gewesen, die den Jupp so in Unruhe versetzt hatten, auch nicht die hellgraublauen Augen – das kam viel später – da musste der Jupp die Augen senken. Da fehlte ihm der Mumm, den er beim Manes stets bewiesen hatte. Die Marie hatte dr Jupp bei der ersten Begegnung zunächst nur gehört. Auf dem Nachhauseweg. Jemand pfiff wunderbar klar, sagenhaft gekonnt und mit Trillern versetzt das Lied „Auf der Mauer auf der Lauer“. Dr Jupp lief bis an die Straßenecke, wo er den Erzeuger dieser bewundernswerten Vorstellung vermutete und spinkste um die Ecke. Und da sah er sie zum ersten Mal. Sie trug ein einfaches blaues Kleid mit Schürze und stieß mit ihrer rechten, dann mit ihrer linken braunen Sandale abwechselnd im Rhythmus des Liedes ein Steinchen vor sich her. Und dieser eigenwillige Tanz sah ebenso gekonnt aus, wie die Melodie klang. Ein Stück lief er hinter ihr her. Dann stoppte er.
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ´ne kleine Wanze,
Stoß Stoß Stoß Stoß
seht euch nur die Wanze an,
Stoß Stoß
wie die Wanze tanzen kann!
Stoß Stoß
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt –
Stoß Stoß
Das fremde Mädchen vor ihm war unerwartet stehengeblieben, hatte sich blitzschnell umgedreht und starrte ihn an. Offenbar hatte sie gespürt, dass er ihr gefolgt war. Ein schmales, blasses, ziemlich verdrecktes Gesicht, spitzes Näschen mit einer tiefen Einkerbung, dünne, zusammengekniffene, etwas schiefe Lippen, die doch eben noch so erstaunliche Töne hervorgebracht haben mussten, große, viel zu große, weit auseinanderstehende Augen – nicht gerade eine Schönheit. Dr Jupp versuchte ein Grinsen. Das Mädchen blinzelte kurz, drehte sich wieder um und lief davon. Und dr Jupp?
Eine Weile hatte er ihr hinterhergestaunt, dann hatte er sich gebückt und den kleinen weißen Kieselstein aufgehoben, den sie vor sich her gestoßen hatte, und ihn in die Hosentasche gesteckt.
„Jojojo“
Joseph Zehnpfennig zielte mit seiner Hand tastend nach der Tasse, die, unglücklich getroffen, zu Boden fiel und scheppernd zerbrach. Es war aus. Dies war endgültig sein letzter Besuch hier. Er hatte es bereits vorher gewusst. Tief, tief in sich hatte er es gewusst. „Losset sin“, hatte er vor sich hingebrabbelt, sich aber dann doch, wider diese wissende Vorahnung noch einmal an seinen Stammplatz, der täglich für ihn freigehalten wurde, begeben, noch einmal so tun wollen, als sei alles wie immer, noch einmal der Heimat, der eigenen Identität hinterherschnüffeln, denn der übergroße, leicht gekrümmte Zinken in seinem zerknitterten Gesicht tat noch sehr wohl seine Dienste. Und auch wenn der Gastwirt jetzt herbeisprang, ihm auf die Schulter klopfte, „Is doch nit schlimm, Jupp!“ in die Ohren brüllte – dass er brüllte, war dem Jupp sehr wohl bewusst und es berührte ihn peinlich, machte ihn grantig – auch wenn ein Mädchen bereits die Scherben zu seinen Füßen einsammelte, wusste dr Jupp, dass die zerbrochene Tasse nur eine Bekräftigung dessen war, was er niemandem erzählt hatte: Sein Leben hier war vorbei. Morgen würden sie ihn wegholen. Morgen erwartete ihn die letzte Station seines 84jährigen Lebens.
II. Drop jeschwore
Von seinen 84 Lebensjahren hatte Joseph Zehnpfennig – mit Unterbrechungen – 84 Jahre hier verbracht, hier, in diesem Veedel.
Im Jahr 1919 waren seine Eltern, Heinrich und Luise Zehnpfennig, geborene Otten, mit seinen vier älteren Geschwistern in eines der neugebauten Häuschen gezogen. Mit dem Bau der Siedlung hatte man 1914 nach dem Motto „Lich, Luff un Bäumcher“ begonnen, aber erst nach Ende des 1. Weltkrieges konnte sie schließlich fertiggestellt werden. Ein Projekt für kinderreiche Familien und Kriegsveteranen vor den Toren der großen Stadt. Mitten hineingeboren war dr Jupp im Jahr 1920 als fünftes Kind der Familie Zehnpfennig.
Joseph Zehnpfennig umklammerte unwillig seine Gehhilfe, die der Wirt ihm gereicht hatte, und humpelte – stockend eben – in Richtung seines Noch-Zuhauses.
Drüben auf der anderen Seite des Sandweges wusste er den Hochbunker. „Schutzbau“ hatte er geheißen. Schutzbau. Und dann die Schulen! Auf einmal hatten sie Schulschutzräume geheißen. Seine frühere Schule und die am Erlenweg! Schulschutzräume! „Et hätt kejne Schutz mih jejovve in denne Johr. Nirjendswo! Nit vör denne Nazis, nit vör dem Kreech, denne Bombardeerereje, nit vör dr Angs, dem eijenem Hätzschlaach. Kejne Secherhejt, kejn Schutz. Nirjends! Nirjends!“* Dr Jupp stieß heftig mit dem Stock auf den Boden. Wenn der Zorn ihn übermannte, war er immer noch stark. Die Adern auf seinen mit Altersflecken übersäten Händen quollen lila hervor. Ein böser, alter Mann mit fest zusammengezogenen Brauen. So stand er da.
Hatte er nicht auch einmal für Schutz sorgen sollen? Hatte er nicht einen Eid geleistet als Rekrut Zehnpfennig? Hatte es nicht geheißen „Wehrdienst ist Ehrendienst am Deutschen Volke“? Ja, bei der Rekrutengelobung, was hatte er da nicht alles geschworen? Bei Gott sowieso - „dr leeven Jott wor allt och wedder dobej“* - , hatte er geschworen, auf Adolf Hitler, den Führer des Deutschen Reiches und Volkes, hatte er geschworen. Unbedingten Gehorsam wollte er leisten und jederzeit bereit sein, zu sterben. „Jo, bej dem moot mer sich immer ducke, do hät mer kejne freie Welle mih. Söns worste dut.“* Das war kein Manes met singer Band, dem man nur mutig in die Augen blicken musste, der aber doch immer noch ein Junge war, wie er, ein Junge, gegen den man sich wehren konnte. Im Übrigen war der Manes ja dann auch zu der großen braunen Bande übergetreten, die mit der Mitgliedschaft zugleich seinen Sadismus legalisiert hatte.
Bei dem Eid hatte dr Jupp eine vage, nicht greifbare Beklemmung empfunden. Er erinnerte sich gut. Das Gefühl kannte er immer noch. Wie in der Schule bei Küppers hatte er sich abgemüht, die hochdeutsche Sprache über seine Lippen zu quälen. Aber der Singsang blieb. Der Eid klang weich und niedlich, bar des sonst so imposanten Pathos, einfach nicht mehr feierlich. Dr Jupp schämte sich seiner Kölschen Muttersprache. Nein, deren Gebrauch war kein Widerstand gewesen, wie später so einige seiner Vorgesetzten vermutet hatten. Er hatte sie nicht der Lächerlichkeit preisgeben wollen. Er hatte nie auch nur an Widerstand gedacht, sondern einfach nur gehorcht. Und dessen schämte sich der 84-Jährige heute, wie er so dastand, das Gesicht dem Bunker zugewandt. Andere hatten sich gewehrt – das wusste er wohl. Sein Freund, der Hans, zum Beispiel.