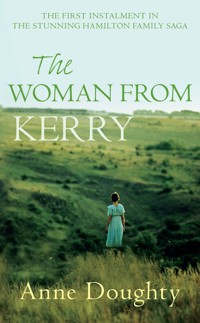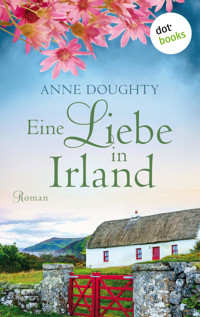5,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alte Geheimnisse, neue Anfänge und die Hoffnung auf das Glück … DAS COTTAGE UNTER DEN STERNEN: Irland, 1960. Die junge Studentin Elizabeth verbringt die Sommerferien im Süden der grünen Insel. Als sie dort den Gutsherrn Patrick Delargy kennenlernt, ist sie fasziniert von seiner genauso humorvollen wie einfühlsamen Art … Aber zu Hause in Belfast wartet ihr Freund George auf ihre Rückkehr – und hätte sie im gespaltenen Irland überhaupt eine Chance, ihren Träumen Flügel zu verleihen? DAS GEHEIMNIS VON IRLAND: Kaum etwas erinnert die Londoner Rechtsanwältin Ally Russell noch an ihre Kindheit im irischen County Cork. Doch nun muss sie in das verhasste Myrtleville zurückkehren, weil ihre Mutter Deidre im Krankenhaus liegt. So kommt es, dass sie in ihrem Elternhaus alte Briefe findet – aber wer ist der geheimnisvolle M., der ihrer Mutter vor langer Zeit schrieb? Eine geheimnisvolle Suche beginnt … DIE FREUNDINNEN VON GLENGARRAH: Laura, Nicola und Helen gehen durch dick und dünn. Das müssen sie auch jetzt, wo ihr Leben gehörig durcheinandergewirbelt wird: Als Laura, die diesen Sommer heiraten soll, herausfindet, dass auch Nicolas Ex vor den Altar treten wird, kann sie sich noch nicht ausmalen, was dieses Ereignis auslösen wird ... Werden die dramatischen Geständnisse zwischen den Freundinnen die Karten neu mischen? Ein gefühlvoller Irland-Sammelband für alle Fans von Maeve Binchy und Katie Fforde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch:
DAS COTTAGE UNTER DEN STERNEN: Irland, 1960. Die junge Studentin Elizabeth verbringt die Sommerferien im Süden der grünen Insel. Als sie dort den Gutsherrn Patrick Delargy kennenlernt, ist sie fasziniert von seiner genauso humorvollen wie einfühlsamen Art … Aber zu Hause in Belfast wartet ihr Freund George auf ihre Rückkehr – und hätte sie im gespaltenen Irland überhaupt eine Chance, ihren Träumen Flügel zu verleihen?
DAS GEHEIMNIS VON IRLAND: Kaum etwas erinnert die Londoner Rechtsanwältin Ally Russell noch an ihre Kindheit im irischen County Cork. Doch nun muss sie in das verhasste Myrtleville zurückkehren, weil ihre Mutter Deidre im Krankenhaus liegt. So kommt es, dass sie in ihrem Elternhaus alte Briefe findet – aber wer ist der geheimnisvolle M., der ihrer Mutter vor langer Zeit schrieb? Eine geheimnisvolle Suche beginnt …
DIE FREUNDINNEN VON GLENGARRAH: Laura, Nicola und Helen gehen durch dick und dünn. Das müssen sie auch jetzt, wo ihr Leben gehörig durcheinandergewirbelt wird: Als Laura, die diesen Sommer heiraten soll, herausfindet, dass auch Nicolas Ex vor den Altar treten wird, kann sie sich noch nicht ausmalen, was dieses Ereignis auslösen wird ... Werden die dramatischen Geständnisse zwischen den Freundinnen die Karten neu mischen?
Eine Übersicht über die Autorinnen finden Sie am Ende dieses eBooks.
***
Sammelband-Originalausgabe August 2025
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Eine Übersicht über die Copyrights der einzelnen Romane, die im Sammelband enthalten sind, finden Sie am Ende dieses eBooks.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: A&K Buchcover, Duisburg, unter Verwendung eines Bildmotives von depositphotos/foto.rigg.at, depositphotos/FrameAngel, depositphotos/tungphoto, depositphotos/ksena32, shutterstock/JeniFoto
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ma)
ISBN 978-3-98952-925-0
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Anne Doughty, Liz Balfour & Melissa Hill
Dreams of Ireland
Drei Romane in einem eBook
dotbooks.
Anne Doughty Das Cottage unter den Sternen
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Liz Balfour Das Geheimnis von Irland
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Aussprache der irischen Namen
Kleines Irland-Lexikon
Melissa Hill Die Freundinnen von Glengarrah
WIDMUNG
PROLOG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
EPILOG
DANKSAGUNG
Über die Autorinnen
Rechtenachweis
Lesetipps
Anne DoughtyDas Cottage unter den Sternen
Aus dem Englischen von Grace Pampus
Irland, 1960. Elizabeth, die im protestantischen Belfast aufgewachsen ist, konnte nie verstehen, warum man Katholiken in ihrer Heimat so verachtet. Die junge Studentin will sich ihre eigene Meinung bilden und verbringt die Sommerferien im Süden der grünen Insel. In dem heimeligen Cottage, in dem sie unterkommt, fühlt sie sich vom ersten Moment an wohl. Als sie dann den Gutsherrn Patrick Delargy kennenlernt, ist sie fasziniert von seiner humorvollen Art, die sie nicht nur zum Lachen bringt, sondern auch zum Träumen verführt … Aber zuhause in Belfast wartet ihr Freund George auf ihre Rückkehr – und hätte sie im gespaltenen Irland überhaupt eine Chance, ihren Träumen Flügel zu verleihen?
Kapitel 1
September 1960
Meine Aufregung nahm zu, je weiter sich der Zehn-Uhr-Bus nach Lisdoonvarna schaukelnd seinen Weg nach Norden suchte. Ich konnte kaum noch still sitzen. Strahlender Sonnenschein ergoss sich über die saftig grünen Felder, die weiß gekalkten Hütten glänzten vor dem strahlend blauen Himmel. An den Haltestellen stiegen sonntäglich gekleidete Leute zu, begrüßten den Fahrer mit Namen, setzten sich und unterhielten sich mit den anderen Fahrgästen.
Völlig anders war meine Zugfahrt von Dublin nach Limerick verlaufen. An einem regnerischen Abend unter dunklen Wolken stampften wir westwärts, an unzähligen schäbigen Bahnhöfen haltend, auf denen man selten eine Menschenseele zu sehen bekam. Ich erhaschte nur einen flüchtigen Eindruck von verlassenen Dörfern und einsamen, kurvenreichen Straßen, die sich durch brachliegende Felder schlängelten. Je weiter wir fuhren, umso verlassener erschien mir das Herz Irlands. Es wirkte so traurig und öde, dass ich mich nach den geschäftigen Straßen meiner Heimatstadt mit ihren roten Backsteinhäusern sehnte, die jetzt zweihundert Meilen hinter mir lag.
Durch die Schmutzstreifen des Fensters unseres klapprigen Busses entging mir jedoch keine Einzelheit der Landschaft. Der Anblick ließ mein Herz höher schlagen. Blühende Fuchsien, mit wunderschönen roten Glocken übersät, lehnten sich an eingestürzte Mauern. Katzen dösten auf sonnigen Fenstersimsen. Ein Hund lag schlafend mitten auf der Straße, so dass der Busfahrer hupen musste, damit er sich endlich bequemte, am Rand der Straße weiterzuschlafen. Auf ungepflegten Höfen, übersät mit alten Maschinenteilen, leeren Fässern und Strohballen, scharrten gackernd Hühner, auf den Feldern dahinter graste das Vieh. Die Kühe sahen aus, als wären sie gerade aus der Schachtel geklettert, in der ich meinen Spielzeugbauernhof aufbewahrte, mit dem ich als Kind so gern gespielt hatte.
Manche der Hügel waren mit Schafen dekoriert und sahen aus wie Röcke mit weißen Punkten. Gepflasterte Wege, sauber aufgeschichteter Torf und purpurrotes Heidekraut umrahmten das Moor. Ich malte mir aus, wie es wäre, einen Film zu drehen und ihn an einem der langen Winterabende meiner Familie vorzuführen, aber die hatte dieses Land längst abgeschrieben. Ein verrufenes Land wie eine verrufene Straße, dachte ich plötzlich, als wir in Ennistymon in einer breiten Straße mit billigen Läden und Kaschemmen hielten.
Eine Stunde später bahnte ich mir auf dem Marktplatz in Lisdoonvarna meinen Weg durch die Warteschlangen an den Bushaltestellen. Nicht weit die Straße hinunter erblickte ich hinter verrosteten Lastwagen, uralten Taxis und Pferdewagen, die eher verlassen als geparkt an der Bushaltestelle standen, eine Bank unter dem Fenster eines großen Hotels. Sie war frei, also ging ich hinüber und ließ mich darauf nieder. Was für eine Erholung, endlich auf einer Bank zu sitzen.
Es war schon nach ein Uhr. In regelmäßigen Abständen verschwanden die Busse, hinterließen eine große Abgaswolke und zogen einen Schwanz anderer Fahrzeuge nach. Innerhalb kürzester Zeit war der Platz wie leer gefegt. Ich sah mich um. Auf der anderen Seite stand ein Kriegerdenkmal in einer Umfriedung aus Stein. Die Mauern unter dem eisernen Geländer wurden von zwei massiven Säulen und einem silberglänzenden Tor unterbrochen. Auf jeder Säule lag eine flache Steinplatte voller Vogelkot. In der Anlage wuchs das Gras ungehindert, und die jungen Bäume und Sträucher begannen schon sich herbstlich zu färben. Der Sauerampfer schob seine rostigen Blütenstände durch das Tor und ließ seinen Samen zwischen Bonbonpapier und Eistüten, die sich im Windschatten der Mauer gesammelt hatten, fallen.
Nur das Klappern des Geschirrs in dem Hotel hinter mir und das Tschilpen der Spatzen im Straßenstaub waren zu hören. Außer einem müden, etwas ängstlichen Hund bewegte sich nichts. Er trottete zielstrebig zur rot und cremefarben gestrichenen Fassade der Greyhound Bar, hob am Nachbarladen das Bein, pinkelte an einen Ständer mit Strandbällen und verschwand durch eine offene Haustür. Ein Schild mit der verblassten Aufschrift »Bed and Breakfast« lehnte an einer gewaltigen dunkelgrünen Blattpflanze im Fenster der unteren Etage.
Was soll ich denn jetzt machen, fragte ich mich.
In diesem Augenblick bog das uralte Taxi, das zuvor Fahrgäste des Busses aufgenommen hatte, wieder auf den Platz. Zu meinem Erstaunen kreiste der Taxifahrer zuerst zweimal um den völlig leeren Platz, ehe er vor mir hielt. Der große, kantige Mann, der einen verbeulten Schlapphut trug, stieg umständlich aus, blickte sich verstohlen um und kam dann auf mich zu.
Aufmerksam sah ich mir die gegenüberliegenden Gebäude an, ein grün und cremefarbenes Gästehaus mit dem Namen Inisfail, eine Arztpraxis, eine Bar, ein Lebensmittelgeschäft und eine Straße stadtauswärts mit den Wegweisern »Cliffs of Moher« und »Öffentliche Toilette«. Die Bar und das Lebensmittelgeschäft waren Teil eines langen Gebäudes, das fast diese ganze Seite des Platzes einnahm und sich bis auf die Straße zu den Klippen und den Toiletten erstreckte. Auf den Braunbeigen Wänden hob sich in großen schwarzen Buchstaben Delargy's Hotel ab.
»Guten Tag, Miss. Sie haben sich einen schönen Tag für Ihren Besuch ausgesucht.«
Er stand vor mir und tippte mit dem Finger an die Krempe seines verbeulten Huts, den er vorher aus seiner rot glänzenden Stirn geschoben hatte. Die Ärmel und Hosenbeine des verknitterten braunen Anzugs waren viel zu kurz, so dass Arme und Beine aussahen, als versuchten sie dem Anzug zu entkommen. Dafür wurde die weite Hose von einem Ledergürtel zusammengehalten, und die Jacke hing wie eine kurze Pelerine in Falten an ihm herab.
»Sie werden sicher vom Hotelbus abgeholt, Miss. Ist unhöflich, sie so lange warten zu lassen«, meinte er entrüstet.
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, ich übernachte nicht im Hotel.«
»Ach so, nicht?«
Er nickte weise, als ob man mir ansehen könnte, dass ich nicht in Hotels übernachtete und er es nur nicht gleich bemerkt hatte. Er setzte sich ans andere Ende der Bank. Minutenlang betrachtete jeder für sich das Kriegerdenkmal, als wäre es die interessanteste Sache der Welt.
Er drehte sich um und lächelte, die Augen wässrig blau, die Zähne unregelmäßig und vom Tabak gelb.
»Haben sich Ihre Freunde verspätet? Vielleicht hatten sie eine Reifenpanne«, rätselte er.
Zufrieden, die Lösung für mein Problem gefunden zu haben, wartete er gespannt auf meine Antwort. Ich ahnte schon, dass ich hier keine Ruhe mehr hätte, wenn ich ihm nichts von mir erzählte.
Aus Erfahrung wusste ich, dass die Leute auf dem Land aus einer Art Selbsterhaltungstrieb neugierig sind. Fremde schaffen Unruhe, bis sie eingeordnet werden können. Und mich konnte er nicht einordnen. In seiner Vorstellung besuchten Leute, die mit dem Bus kamen und Gepäck hatten, immer Verwandte oder Freunde. Ich hatte einen Koffer und war mit dem Bus gekommen, aber niemand holte mich ab. Er schob den Hut noch weiter nach hinten und kratzte sich am Kopf.
»Ich ruhe mich vor dem Mittagessen nur ein wenig aus«, sagte ich und hoffte ihm damit seine missliche Lage erleichtern zu können. »Am Nachmittag fahre ich weiter nach Lisnasharragh«, erklärte ich ihm.
»Ach ja, Lisnasharragh.«
Wieder nickte er wissend, aber die Art, wie er den Namen aussprach, machte mich nervös. Es schien, als hätte er ihn noch nie gehört.
»Ich nehme an, Sie wollen dort Ferien machen«, meinte er heiter.
Ich brauchte lange, bis ich eine Erwiderung fand, denn ich hatte schon überlegt, was ich wohl tun würde, falls es Lisnasharragh wirklich nicht mehr geben sollte. 1929 hatte der Ort noch bestanden. Auf der neuesten Landkarte konnte ich ihn auch noch finden, und die Häuser, auf die in den Unterlagen von 1929 hingewiesen wurde, waren deutlich zu erkennen. Aber das hieß noch lange nicht, dass sie auch heute, 1960, noch bewohnt waren. Lisnasharragh war vielleicht eines der Dörfer, deren Einwohner verstorben, verzogen oder nach Amerika ausgewandert waren. Mehr konnte ich vor meiner Abreise aus Belfast leider nicht herauskriegen.
»Nein, ich verbringe hier nicht meinen Urlaub«, antwortete ich schließlich und erklärte geduldig: »Ich fahre nach Lisnasharragh, um eine Studienarbeit über diese Gegend zu machen.«
Warum ging er nicht endlich und ließ mich in Frieden nachdenken, wie dieses neue Problem zu lösen war?
»Tatsächlich?«
Seine kleinen Augen zwinkerten, und er beugte sich vor, um mich näher zu betrachten.
»Und werden Sie dann ein Buch darüber schreiben?«
Er lachte fröhlich, als hätte er auf meine Kosten einen Witz gemacht.
»Nun, ich denke schon«, räumte ich widerwillig ein.
Er sprang so schnell auf die Füße, dass ich erschrak, ergriff meinen Koffer und streckte mir die freie Hand zur Begrüßung entgegen.
»Michael Feely, zu Ihren Diensten, Miss. Niemand kennt sich in dieser Gegend besser aus als ich – Hotels, Gewässer, Aussichtspunkte, einfach alles. Ich würde mich sehr freuen, Ihnen bei Ihrer Arbeit helfen zu dürfen.«
Er hob meinen schweren Koffer in sein Taxi, als wäre es eine Handtasche, und öffnete mit einer Verbeugung die hintere Wagentür.
»Sie werden nun zu Mittag essen wollen, Miss«, sagte er bestimmt. »Ich fahre Sie direkt ins Mount. Es ist zwar nicht das größte, aber das beste Hotel in Lisdoon. Alle Gäste werden vom Besitzer persönlich betreut, und sie veranstalten sogar Besichtigungsfahrten für große und kleine Gruppen, ohne Aufpreis.«
»Vielen Dank, Mr. Feely«, sagte ich müde und schloss die Autotür.
Schon als er meinen Koffer nahm, wusste ich, dass ich keine andere Wahl hatte. Ich machte es mir in dem abgenutzten Ledersitz bequem und warf einen Blick in den Rückspiegel. Er hatte das gerötete Gesicht zu einem Lächeln verzogen und sah aus wie jemand, der in seinem Garten eine Ölquelle entdeckt hat.
Das Mount war ein großes, heruntergekommenes Haus mit einem ungepflegten Garten. Hohe Palmen und zwei liegende Löwen mit verwitterten Gesichtern ließen vermuten, dass das Hotel schon bessere Zeiten gesehen hatte. Er parkte das Taxi hinter dem Haus zwischen einer übervollen Mülltonne und einem Betonmischer, nahm meinen Koffer und marschierte zur Vordertür und durch die Vorhalle in einen Speisesaal, in dem es nach Kohlsuppe und anderen Speiseresten roch.
Dann befahl er einem blassen Mädchen in einem engen schwarzen Rock, die schmutzigen Teller und Gemüsereste von dem Tisch am Fenster zu entfernen, bot mir einen Stuhl an und ließ mich im grellen Sonnenlicht zurück, das ungehindert durch die nackten Fenster strahlte.
Die Löwen auf der holprigen Terrasse starrten mit leeren Augen auf ein paar Priester, die über den Rasen bummelten oder sich in Liegestühlen räkelten. Vor den Gänseblümchen, dem Löwenzahn und dem gestreiften Segeltuch der Liegestühle sahen die schwarzen Anzüge so deplatziert aus wie der Bambusstrauch und die japanische Pagode in diesem verwilderten Garten.
Meine Suppe wurde serviert. Entsetzt starrte ich auf die bunten Stückchen Trockengemüse in der lauwarmen Brühe und erkannte sie sofort – Frühlingsgemüse von Knorr, eines der vielen Päckchen, die meine Mutter immer »für alle Fälle« im Haus hatte. Doch sie ließ sie auf kleiner Flamme langsam köcheln, während sie unten im Laden bediente. Aber diese Suppe war voller Klümpchen, und ich rührte lustlos darin herum, während ich mich fragte, ob mich Mr. Feely wohl bewachte.
Glücklicherweise erschien er nicht. Die unberührte Suppe wurde ohne Kommentar abgeräumt. Meine Erwartungen waren nun nicht mehr so hoch, also war der Hauptgang keine Enttäuschung. Unter der dicken Bratensoße und einem Berg Kartoffelbrei mit Karotten entdeckte ich eine dünne Scheibe Rindfleisch, die offensichtlich eine Metamorphose durchgemacht hatte. Sie war zäh und schmeckte nach nichts, so wie zu Hause, aber ich tat mein Bestes. Das Gemüse war nicht ganz so schlecht, und mein Teller, garniert mit zahllosen Sehnen und Knorpelstücken, wanderte zurück in die Küche, ohne dass Mr. Feely erschien.
Während ich die riesige Portion Vanillepudding mit Backpflaumen in Angriff nahm, blickte ich mich in dem schäbigen Speisesaal um. Zwei sehr junge Mädchen, die enge schwarze Röcke und verknitterte weiße Blusen trugen, deckten die gerade abgeräumten Tische neu ein. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie sie Krümel wegwischten und Papiertischdecken über die gestärkten Stoffdecken legten. Der Nebentisch brauchte jedoch eine andere Behandlung. Gut getränkt mit Bratensoße, wurde die Tischdecke mit einem Ruck weggezogen und gab eine abgenutzte Tischplatte mit unzähligen Glasrändern frei.
Ich lächelte und dachte an Ben, meinen besten Freund. Wie viele Ränder wir wohl in den letzten zwei Monaten in die Eichentische der Rosetta Lounge Bar geätzt hatten? Morgen würde er mich vermissen, wenn nur noch Keith in der Küche stand und ihm niemand beim Bedienen und Abräumen half. Der Gedanke, die Arbeit in der Rosetta Bar allein machen zu müssen, erschreckte mich. Die ganze Geschichte wäre unerträglich gewesen, wenn mir Ben nicht geholfen hätte.
»Hallo, Lizzie, was machst du hier schon so früh?«, hatte er mich begrüßt, als ich gerade missmutig an der Haltestelle vor dem Curzon Kino stand und auf den Bus nach Cregagh wartete. Es war der erste Montag im Juli, morgens um halb acht. Verschlafen und säuerlich – ich hatte gerade meine Periode bekommen –versuchte ich mich davon zu überzeugen, dass das alles doch kein entsetzlicher Fehler war.
»Ferienjob in Cregagh.«
Er sah mich von oben bis unten an, besonders meinen schwarzen Rock, die weiße Bluse und die schwarzen Pumps, die ich schon in der Schulzeit in der Victoria School getragen hatte.
»Es ist nicht zufällig die Rosetta Bar, oder?«, fragte er und schielte auf den Doppeldecker, der die Straße heraufkam.
»Wie hast du das erraten?«
»Hab dieselbe Anzeige gelesen und hab auch vor, dort zu arbeiten«, verkündete er breit grinsend. »Wenn ich meinen Motorroller zurückbekomme, kann ich dich mitnehmen. Das spart dir eine Menge Fahrgeld.«
Seine Freude war nicht zu übersehen, und der Gedanke an die Begleitung besserte meine Laune, obwohl eine Warnglocke in meinem Hinterkopf ertönte.
»Doch wolltest du nicht eigentlich nach Spalding zum Erbsenpflücken?«, fragte ich verlegen. »Ist das nicht viel besser?«
»Du hast Recht.« Er nickte. »Aber Mum ist wieder krank. Ohne mich geht sie nicht zum Arzt. Du kennst sie ja. Also habe ich abgesagt. Rosetta war das Einzige, was ich jetzt noch kriegen konnte.« Er grinste. »Es hätten auch die öffentlichen Toiletten am Shaftesbury Square sein können.«
Der Bus hielt, wir kletterten sofort nach oben und ließen uns auf die vorderen Sitze nieder, damit wir durch die Zweige der Bäume schauen konnten, wie schon als Kinder.
Kaiser, König, Edelmann, Schuster, Schneider, Leinenweber, zählte ich schweigend, als ich den Rest meines Vanillepuddings auskratzte. Aber bevor mir der Pflaumenkern erzählen konnte, wen ich heiraten würde, erschien eine Tasse Kaffee vor meiner Nase, und meine Zukunft zerplatzte wie eine Seifenblase vor meinen Augen.
Der Kaffee war echter, frisch gebrühter Kaffee, die Sahne stand auf der Untertasse. Ich konnte es kaum glauben. Langsam und genüsslich schlürfte ich das heiße Getränk und beobachtete dabei, wie das blasse Mädchen mit den dunklen Haaren verbeulte Metallbehälter mit Besteck von Tisch zu Tisch trug. Wenigstens mussten wir das bei Rosetta nicht machen. Das Restaurant war nur abends geöffnet, also servierten wir mittags bloß Snacks an der Bar, Sandwiches und Gebäck aus einem Korb. Aber es gab auch andere Pflichten, die ebenso langweilig waren wie das Eindecken der Tische.
Jeden Morgen um acht Uhr fingen wir an, die Reste aufzuräumen, die die Abendschicht liegen gelassen hatte, um noch den letzten Bus zu erwischen. Stapelweise Geschirr, Gläser und Aschenbecher von der Bar. Danach mussten Eingang und Fußböden gewischt werden, dann erst konnten wir mit den Vorbereitungen für das Mittagessen beginnen. Am ersten Tag ließ uns die Geschäftsführerin einzeln arbeiten. Als wir um vier Uhr zur Bushaltestelle wankten, waren wir nicht nur ausgelaugt, sondern völlig erschöpft. Am nächsten Morgen hatte Ben eine gute Idee.
»Lizzie, lass uns zusammenarbeiten. Ich habe ein System ausgeklügelt.«
»Aber was sagen wir, wenn sie uns erwischt?«
»Abwarten«, antwortete er grinsend.
Es hatte keinen Sinn, ihn zu bedrängen, denn er konnte ein Geheimnis für sich behalten. Man hätte es eher geschafft, Wasser aus einem Stein zu pressen.
Unter einem der ägyptischen Könige im Dekor stellte Ben gerade einen Tisch zur Seite, während ich staubsaugte, als sie plötzlich auftauchte.
»Ich dachte, deine Aufgabe wäre der Abwasch?«, fragte sie ärgerlich.
»O ja, aber der ist schon fertig«, erwiderte Ben fröhlich. »Doch Sie verlieren dabei Geld.«
»Wie bitte? Was meinst du damit?«
Sie zog die Augenbrauen hoch, schielte in die Küche hinter der Bar und sah, dass alles blitzsauber und aufgeräumt war.
»Zeit und Bewegung«, sagte er unbefangen. »Ich habe für Sie gestern eine komplette Studie durchgeführt. Natürlich umsonst, ist mein Hobby. Aber als ich die Ergebnisse gestern Abend ausgewertet habe, war ich schockiert ...«
Er stellte den Tisch ab, zog einen Stuhl heran und machte ihr ein Zeichen, Platz zu nehmen.
»Es ist nicht gut für Ihre Venen, wenn Sie stehen, während Sie mit Angestellten reden. Leitende Angestellte müssen auf ihre Gesundheit achten, das ist das oberste Gebot einer erfolgreichen Geschäftsführung.«
Ich stand mit dem Staubsauger in der einen Hand und dem Staubwedel in der anderen da und konnte kaum ernst bleiben. Ben ist Medizinstudent, also kennt er sich mit Venen aus, es war die Zeit- und Bewegungsstudie, die mir Sorgen machte. Sein Charme war wirklich umwerfend. Nach dieser Szene ließ sie uns so arbeiten, wie wir wollten. Manchmal hatten wir sogar Spaß dabei.
Während ich meinen Kaffee trank, überlegte ich, was mein Mittagessen wohl kosten würde. Es war zwar nicht gut, aber teuer konnte es trotzdem sein. Dann war da noch das Fahrgeld für das Taxi nach Lisnasharragh und eine Übernachtung in einem Hotel, falls ich mich geirrt hatte. Plötzlich fühlte ich mich sehr allein, eine einsame Gestalt in einem leeren Restaurant. Ben, das Rosetta und mein vertrautes Leben waren weit weg. Mir wurde schmerzlich bewusst, dass ich eine Fremde war in einem fremden Ort.
Es dauerte einige Zeit, bis Feely wieder auftauchte. Er übersah meine Ungeduld, dass ich die Rechnung noch nicht erhalten hatte, und sagte, der Wagen stehe vor der Tür, und er sei bereit, mich nach Lisnasharragh zu fahren. Welche Straße ich denn nehmen wolle?
Meiner Karte nach gab es nur eine mögliche Strecke. Ich atmete tief durch und erklärte ihm ausführlich, dass das Dorf mindestens fünf, sechs Meilen abseits der Küstenstraße Richtung Cliffs of Moher lag.
Ich hätte mir gar keine Gedanken zu machen brauchen. Sobald wir die Stadt hinter uns gelassen hatten, verlangsamte er das Tempo, bis er auf dem geteerten Streifen inmitten des sumpfigen Landes, der die Straße sein sollte, nur noch dahinkroch. Ich konnte sagen, was ich wollte, er schlich weiterhin Meile für Meile durch völlig unbekanntes Gebiet. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich mehr Angst während der Fahrt als vor dem Loch, das diese Fahrt in meinen schmalen Geldbeutel reißen würde. Mit jeder Meile, die auf dem Taxameter verstrich, wurde ich nervöser. Sollte es sieben Meilen überschreiten, hatte ich mich geirrt. Entweder ich hatte meine Karte nicht richtig gelesen oder, noch schlimmer, Lisnasharragh existierte nicht mehr.
Als wir die Fünf-Meilen-Marke erreichten, war das Moor ganz plötzlich zu Ende. Auf der linken Seite stieg das Land steil an, und große, herausgebrochene Felsbrocken beherrschten die kleinen Felder. Auf der anderen Seite der Straße fielen die deutlich größeren Felder in einem weiten flachen Hang ab, der von Kalksteinhügeln begrenzt wurde. Bar jeder Spur von Vegetation, sah man die grauweiße Silhouette der Hills of Burren vor dem blauen Himmel.
Wir fuhren um eine Kurve. Plötzlich tauchte vor uns das Meer auf – bis zum weiten Horizont glitzerte es in der Sonne. Ungefähr eine Meile vor der Küste brachen sich die trägen Wellen an einer schwarzen, felsigen Insel. Dahinter lagen im blendenden Glanz der Sonne wie die Rücken riesiger Wale die Aran-Inseln Inisheer, Inishman und Inishmore.
Mein Herz hüpfte vor Freude. Wochenlang hatte mir die magische Anziehungskraft ihrer Namen keine Ruhe gelassen. Nun sah ich die Inseln tatsächlich vor mir. Nur das silbrige Meer lag noch zwischen uns. In meinem Kopf öffnete sich eine Tür, die lange verschlossen war, und ich konnte die Hand ausstrecken und etwas berühren, das mir bisher unerreichbar schien. Meine Sorgen waren wie weggeblasen. Diese Inseln waren ein Omen. Nun, da ich sie gefunden hatte, würde alles wieder gut werden.
Die Straße wurde steiler. Ich überschritt eine unsichtbare innere Grenze und trug sie auf der Karte ein. Jetzt wusste ich genau, wo ich mich befand.
»Es ist nicht mehr weit, Mr. Feely«, sagte ich schnell und versuchte erst gar nicht meine Erleichterung vor ihm zu verheimlichen. »Den Berg hinunter und dann über den Fluss. Dort befindet sich rechts eine Baumgruppe, und dahinter geht es dann den langen Weg hinauf. Vielleicht können wir ganz oben halten?«
»Ja, selbstverständlich. Jetzt haben Sie mich ertappt. Sie kennen sich ja in Lisara besser aus als ich.«
Feely drehte sich um und lachte. Er freute sich ebenso wie ich, Lisara gefunden zu haben. Es störte ihn keineswegs, dass ich ihm diesen kleinen Streich gespielt hatte.
»Aber nein, Mr. Feely, ich war noch nie hier«, versicherte ich ihm und blickte auf die Straße. Das hätte er auch hin und wieder tun sollen.
»Wirklich nicht?«
»Nein.« Ich schüttelte heftig den Kopf. »Noch nie!«
»Noch nie?«, fragte er verwundert.
Ich war sehr erleichtert, als er endlich aufhörte Schlangenlinien zu fahren.
Die letzten beiden Wochen des Sommersemesters hatte ich jeden Tag damit zugebracht, in der Spezialabteilung der Bücherei Karten zu kopieren und Monografien zu lesen. Im Hauptlesesaal fand ich Berichte über die Bevölkerungsstruktur des Landes. Sie waren so dick, dass ich sie kaum tragen konnte. Und ich hatte alle Schriften und Abhandlungen verschlungen, derer ich habhaft zu werden vermochte. Nun war das alles nicht mehr wichtig. Nichts davon hatte mich auf die Begeisterung vorbereitet, die ich jetzt, da ich das unbekannte Land am Ende der Welt endlich erreicht hatte, empfand.
Vor Monaten hatte mich eine innere Stimme aufgefordert, in dieses Land zu reisen. Es war mir gelungen, gute Gründe für diese Reise zu finden, aber ich hatte nie darüber nachgedacht, wie es hier wohl sein würde. Der Anblick der Inseln war das Schönste, das ich je gesehen hatte. Ich konnte es nicht fassen. Sosehr ich mich auch bemühte, ich fand keine Worte für meine Gefühle.
»Mr. Feely, würden Sie bitte hinter der nächsten Kurve anhalten? Dort steht auf der linken Seite eine Hütte, zu der ein schmaler Pfad führt. Wir könnten da parken und uns ein wenig umsehen.«
Als wir nach der Kurve in den Pfad einbogen, wurde mein Entzücken noch größer. Die Hütte war nicht nur sauber und ordentlich, sondern helle Flecken im Strohdach zeigten auch, dass es erst kürzlich ausgebessert worden war. Noch bevor wir anhielten, erschien eine junge Frau in der halb offenen Tür und blickte den Weg hinunter. Ich ging gleich auf sie zu und fragte, ob sie mir helfen könne, ich würde eine Unterkunft suchen und bestimmt keine Umstände machen.
»Das glaube ich Ihnen gern, Miss.«
Sie lächelte schüchtern, spielte mit einer Locke ihres dunklen Haars, überlegte kurz und sah dabei angestrengt und müde aus, obgleich sie nicht viel älter als ich sein konnte.
»Ich würde Sie gern aufnehmen, Miss, aber ich glaube, Sie werden bei vier kleinen Kindern für Ihre Arbeit nicht sehr viel Ruhe finden. Wollen Sie Gälisch lernen?«
Kaum öffnete sie die Tür, versuchte eines der Kinder hinauszulaufen. Als sie es mit dem Bein beiseite schob, sah ich auch die anderen, die sie keinen Moment aus den Augen lassen konnte.
»Ich überlege gerade, Miss, wo sie wohl eine Unterkunft finden könnten. Muss es denn Lisara sein?«
»Ja, aber wo genau ist nicht so wichtig.«
Als ich zum ersten Mal »Lisara« sagte, merkte ich, dass es den Ortsnamen Lisnasharragh für mich nicht mehr gab. Vielleicht hatte er noch nie existiert, vielleicht hatten ihn nur ein paar Generäle in die Karten eingetragen, ohne dass er je von den Einheimischen benutzt worden wäre. Wie auch immer, Lisara war zweifellos Lisnasharragh, genau wie es sein sollte, sonnig und gut erhalten.
»Nun, Sie könnten es bei Mary O'Dara oben auf dem Berg versuchen. Sie ist eine gute Seele und hat jetzt Platz, seit die ganze Familie weggezogen ist. Sagen Sie ihr, Mary Kane habe Sie geschickt.«
Müde lehnte sie sich gegen die weiß getünchte Hüttenwand.
»Das werde ich sofort herausfinden«, entgegnete ich schnell. »Wenn sie mich aufnimmt, darf ich dann vielleicht wieder reinschauen und mich mit Ihnen über Lisara unterhalten?«
»Ja, natürlich, Sie sind uns jederzeit willkommen«, antwortete sie herzlich. »Wir haben hier oben nicht viel Gesellschaft.«
Ich bedankte mich und ging zurück zum Wagen. Zu meinem Erstaunen eilte sie mir nach.
»Sie kommen doch wieder, Miss, nicht wahr?«
»Aber sicher. Auf Wiedersehen!«
Feely schaute finster drein. »Also hinauf zu O'Daras«, brummte er nur und fuhr los. Hatte ich etwas Falsches gesagt?
O'Daras Hütte war genauso sauber und gepflegt wie Mary Kanes, besaß jedoch keinen Vorgarten. Eine große rosarote Hortensie stand in voller Blüte. Auf den grünen Fensterbrettern waren Pflanzen in Töpfen und leeren Konservendosen. Ein kleiner, drahtiger Mann mit blauen Augen, stoppligem Kinn und der grellsten rosa Krawatte, die ich je gesehen hatte, saß Pfeife rauchend vor der Tür.
»Guten Tag, bin ich hier richtig bei O'Dara?«, fragte ich.
»Jawohl, Miss, Sie sind hier richtig.«
Obgleich ich flache Schuhe trug und nur einssechzig groß bin, konnte ich auf sein faltiges braunes Gesicht hinabsehen, als er sich erhob.
»Es tut mir Leid, dass ich Sie beim Rauchen störe, Mr. O'Dara. Könnte ich bitte Mrs. O'Dara sprechen? Mrs. Kane schickt mich.«
»Ah, Mary-am-Fuße-des-Berges.«
Er drehte sich zur Tür und erhob ein wenig die Stimme. »Mary, eine junge Frau möchte dich sprechen.«
Nach einer Weile kam Mary O'Dara zur Tür. Verwirrt und unglücklich und mit fleckigem Gesicht stand sie da, ein zerdrücktes Taschentuch in der Hand. Ich wäre am liebsten wieder gegangen, aber nun war es zu spät.
Trotz ihrer Trauer schaute sie mich aus dunkelbraunen Augen an. Ich erklärte ihr mein Anliegen. Als ich fertig war, zögerte sie einen Moment und putzte sich die Nase.
»Sie sind herzlich willkommen, aber mit mir ist im Moment nicht viel los. Meine Tochter ist heute Morgen mit den Kindern nach Amerika zurückgeflogen, und vielleicht sehe ich sie lange nicht wieder.«
Sie rieb sich die Augen und blickte mich an. »Sie hatten wohl auch eine lange Fahrt, Miss?«
»Ja, aber nicht ganz so weit wie Amerika. Der Abschied muss furchtbar schwer sein, wenn die Entfernung so groß ist«, antwortete ich mitfühlend. Nach einer Pause fügte ich hinzu: »Vielleicht kommen sie ja bald wieder.« Noch während ich sprach, erinnerte ich mich an Onkel Alberts Worte. Er war der älteste Bruder meines Vaters. »Du kommst bestimmt bald wieder, Elizabeth«, sagte er immer zu mir, wenn er mich nach einem Besuch in seinem Cottage am Rande von Keady zum Bus brachte. Außerdem sagten das alle zu den Tanten und Onkeln, die jeden Sommer aus Toronto, Calgary und Vancouver, Virginia und Indiana, Sydney und Darwin zu Besuch kamen. Fast jeder im Armagh-Land hatte Verwandte in Amerika, Kanada oder Australien.
»Ja, sie kommt bestimmt bald wieder, Miss. Bridget wird uns nie vergessen«, ergänzte ihr Mann lebhaft. »Und nun hör auf zu weinen, Mary. Lass die junge Lady hier nicht länger herumstehen.«
Aber Mary hatte ihre Tränen bereits getrocknet.
»Möchten Sie eine Tasse Tee, Miss?«
»Ich würde gern eine Tasse Tee mit Ihnen trinken, aber Mr. Feely wartet auf mich. Ich muss nach Lisdoonvarna zurück, wenn ich in Lisara keine Unterkunft finde.«
»Ah, sie würden Sie in den Hotels von Lisdoonvarna nur ausnehmen«, schimpfte Mr. O'Dara grimmig und warf seiner Frau einen bedeutungsvollen Blick zu.
»Natürlich, Paddy. Aber vielleicht ist die junge Lady so rückständige Behausungen nicht gewöhnt.«
»Aber ja, Mrs. O'Dara, das bin ich gewöhnt. Das Cottage meines Onkels Albert war genauso, und ich war dort immer sehr glücklich. Ich bin selbst auch ein bisschen rückständig.«
Vielleicht war es die Art, wie ich es sagte, oder mein nordischer Akzent, jedenfalls lachten beide. Mary O'Daras Gesicht wurde plötzlich sanft und sehr hübsch. »Gehen Sie ruhig und sagen Sie Mr. Feely, dass Sie bleiben, Miss.«
Sie kehrte in die geräumige Küche zurück und nahm einen rußgeschwärzten Kessel vom Herd.
»Paddy, hilf der jungen Lady mit ihrem Gepäck!«
Dann beugte sie sich über einen Emaileimer, um den Kessel mit Wasser zu füllen, und sah daher nicht, wie Paddy die Hacken zusammenschlug und die Hand stramm an die Stirn legte. Als wir hinaustraten, lächelte er mir verschmitzt zu.
»Gott segne Sie, Miss. Sie sind gerade zur rechten Zeit gekommen.«
Feely sprang auf, als Paddy meinen Koffer vom Gepäckträger hob.
»Bleiben Sie ein oder zwei Tage, Miss?«
»Vielleicht sogar zwei oder drei Wochen, Mr. Feely.«
»Wirklich?«
Ich hatte ihm natürlich erzählt, dass ich ein paar Wochen bleiben wollte, aber jetzt sah er aus, als käme die Nachricht völlig überraschend. Paddy war bereits mit meinem Koffer im Haus verschwunden. Nun wollte ich mich bei ihm bedanken.
»Ich weiß nicht, was ich ohne Sie getan hätte, Mr. Feely«, erklärte ich und nahm die Geldbörse aus der Jackentasche. Hoffentlich musste ich nicht noch eine Pfundnote aus dem Koffer holen.
»O nein, Miss, ist schon gut«, winkte er ab. »Das machen wir ein anderes Mal. Ich sehe Sie doch sicher wieder?«
Er ließ den Motor an und blickte erwartungsvoll zu mir. »Aber ja, ich bin bestimmt öfter in Lisdoonvarna. Jetzt weiß ich ja, wo ich Sie finde, nicht wahr?«
»O ja, natürlich«, sagte er hastig. »Sie wissen viel, sehr viel. Auf Wiedersehen!«
Er gab Gas, schoss in einer Abgaswolke davon und war schon wenig später auf der anderen Seite des Bergs zu sehen. Ich staunte, dass das Taxi so schnell fahren konnte. Noch ehe der Rauch um mich herum weg war, hatte Feely bereits die Grenze auf meiner Karte überquert und war auf dem Weg nach Lisdoonvarna.
Kapitel 2
Während ich mich mit Mary Kane unterhalten hatte, waren vom Meer her Wolkenbänder aufgezogen. Nun, als ich über die verlassene Straße zum Haus zurückging, wo Paddy schon auf mich wartete, schüttelte ein kräftiger Wind die schweren Blüten der Hortensie und kühlte den warmen Nachmittag ein wenig ab.
»Kommen Sie doch herein, Miss. Wir freuen uns. Mary und ich kriegen hier nicht sehr oft Besuch von Fremden.«
Mary bot mir einen der beiden Sessel am Ofen an und reichte mir eine Tasse Tee.
»Setzen Sie sich, Miss. Sie sind nach der Reise bestimmt müde. Es ist eine sehr lange Fahrt von Belfast.«
Sie schaute auf die Uhr, bewegte lautlos rechnend ihre Lippen und bekreuzigte sich.
»So Gott will, sind sie jetzt schon gelandet«, erklärte sie, zog einen Lehnstuhl ans Feuer und setzte sich ebenfalls. »Es sind nur vier Stunden von Boston, die ganze Familie kommt sie abholen. Sie werden heute Abend bestimmt kräftig feiern. Die arme Bridget ist wahrscheinlich ziemlich müde vom Tragen der Kleinen.«
Dann wurde sie still und sah sich gedankenverloren in dem Zimmer mit den hohen Decken und dem ausgetretenen Fußboden um.
Der Himmel hatte sich nun bewölkt, die letzten Sonnenstrahlen erloschen. Obwohl die Tür offen stand, drang nur wenig Licht in die dunklen Ecken des Raums. Die letzten Strahlen versanken im Steinfußboden oder wurden von den dunklen Möbeln und der rußgeschwärzten Decke über unseren Köpfen verschluckt.
Ich betrachtete den orangeroten Schein unter den eisernen Ringen des Ofens. Einer der Ringe war zur Seite geschoben, Rauch und wirbelnde Funken flogen herum. Als ich den vertrauten Geruch des Torfs einatmete, fühlte ich mich wie eine Weltreisende, die wildes, unbewohntes Gebiet durchquert hatte und nun nach endlosen Schwierigkeiten und mutigen Taten am Lagerfeuer gastfreundlicher Menschen angekommen war. Seit Jahren hatte ich mich nicht mehr so wohl gefühlt.
»Ist er Ihnen gut genug?«
Der ängstliche Ton in Mary O'Daras Stimme drang in meine Gedanken. Zuerst wusste ich gar nicht, was sie meinte. Dann blickte ich in ihr Gesicht und begriff. Augen, Mund und die sanfte braune Haut offenbarten ihre Gefühlswelt.
»Der Tee schmeckt sehr gut«, antwortete ich rasch. »Sie haben mich beim Träumen erwischt. Der Ofen ist schuld.« Sie lächelte erleichtert. »Ihr Ofen ist mir nämlich sehr vertraut. Allerdings habe ich schon seit Jahren kein offenes Feuer mehr gesehen. Torffeuer mag ich am liebsten.«
»Sie sind wahrscheinlich Besseres gewöhnt, Miss.«
»Seien Sie da nicht so sicher«, erwiderte ich kopfschüttelnd. »Früher habe ich sogar Fladen gebacken und den Herd mit einer Gänsefeder abgekehrt. Ich habe zwar keine Übung mehr, aber ich würde es gerne wieder versuchen.«
»Das spricht sehr für Sie«, meinte Paddy herzlich.
Er stellte seine Porzellantasse mit größter Vorsicht ab und zwinkerte mir spitzbübisch zu.
»Heutzutage gibt es kaum noch Mädchen, die Brot backen können. Es kommt alles vom Bäcker oder vom Supermarkt.«
Ich dachte an die Regale voller Brotlaibe in glänzendem Wachspapier an der Tür des Geschäfts meiner Eltern, Mutters ganzer Stolz. Sie öffneten den Laden jeden Morgen um acht Uhr, um der Nachtschicht auf dem Heimweg das Einkaufen zu ermöglichen. Um neun war das Brot schon ausverkauft. »Schade, dass wir nicht mehr lagern können«, bedauerte mein Vater oft. »Oder dass die Bäckerei nicht zwei- oder dreimal am Tag liefert.«
Brot war gut fürs Geschäft. Die Leute kamen, um einen Laib Brot zu kaufen, und verließen den Laden mit einer Tasche voll Waren. Und die armen Familien aßen sehr viel Brot, wie meine Mutter immer sagte.
»Mein Onkel Albert unten im County Armagh hat mir gezeigt, wie man Brot backt«, fuhr ich fort und versuchte die Gedanken an den Laden zu verdrängen. »Er mochte das Brot aus der Stadt nicht. Eigentlich mochte er nichts aus der Stadt, außer seinem Guinness. Er nannte es immer seine Medizin.«
Paddy O'Daras Gesicht hellte sich auf. Er schaute mich mit seinen blauen Augen aufmerksam an.
»Ah, natürlich, Miss. Jeder Mann braucht hier und da ein Schlückchen Medizin.«
»Teufelszeug«, entgegnete Mary O'Dara. »Es müssen immer zwei oder drei Schlückchen sein, oder noch mehr.«
Es stimmte, die Rechnung ging oftmals nicht auf. Ich konnte mich nicht daran erinnern, meinen Onkel Albert je betrunken gesehen zu haben, aber nach ein paar Gläsern Bier wurde er viel lebhafter. Dann konnte man ihn leicht dazu bringen, seine Geschichten zu erzählen.
»Sie sind immer ganz tolle Kerle, wenn sie ein paar Bier getrunken haben«, fügte sie sauer hinzu und bot uns noch Tee an.
»Nein danke, Mary. Eine Tasse reicht.« Paddy stand eilig auf. »Ich sehe nach den Gänsen.«
Ich musste lächeln, während sie mir noch Tee einschenkte. Onkel Albert ging immer »nach den Hühnern sehen«, wenn er getrunken hatte.
»Ich muss auch mal nach den Hühnern sehen, wenn ich ausgetrunken habe«, sagte ich heiter.
»Natürlich wussten Sie schon, dass wir keine richtige Toilette haben. Ich habe mir bereits Gedanken gemacht, wie ich es Ihnen beibringen soll.«
Die Erleichterung war ihr so deutlich ins Gesicht geschrieben, dass ich mich fragte, ob sie ihre Gefühle überhaupt verbergen konnte. Nur Leute ohne Bildung zeigen ihre Gefühle, hätte meine Mutter über Mary gesagt, das weiß jeder, der auch nur ein bisschen Fingerspitzengefühl besitzt. Man darf seine Gefühle nicht jedem zeigen, auch wenn man deshalb zu einer Notlüge greifen muss.
Meine Mutter legte großen Wert darauf, gute Ratschläge zu erteilen. Die meisten ihrer Geschichten handelten davon, wie sie den Soundso wieder auf die richtige Bahn gebracht, alles für ihn getan oder ihm nur gezeigt hatte, dass er nicht mehr von ihr verlangen konnte.
Was meine Mutter auch denken mochte, Mary war keine einfältige Seele. Ich hatte bereits entdeckt, dass sie eine Weisheit besaß, die auf der Wahrnehmungsfähigkeit der Freuden und Sorgen des täglichen Lebens beruhte. Achtzehn von meinen einundzwanzig Lebensjahren durfte ich mit dieser klaren Einstellung leben. Jetzt hatte ich sie wiedergefunden.
»Mrs. O'Dara«, warf ich rasch ein, »Sie müssen mir sagen, wie viel ich Ihnen für meine Unterkunft schulde, bevor Mr. O'Dara zurückkommt. Wären vier Pfund die Woche genug?«
»Vier Pfund, Miss ... Gott bewahre ... Ich kann Ihr Geld nicht annehmen. Wir teilen gern mit Ihnen, was wir haben, wenn Ihnen das reicht.«
»Es ist mehr als genug. Aber ich möchte etwas dafür bezahlen.« Ich ließ nicht locker.
Sie hatte ein Spülbecken unter dem Tisch an der Wand hervorgeholt und stellte die Tassen zum Abtropfen auf die saubere Wachsdecke.
»Haben Sie ein Geschirrtuch, damit ich abtrocknen kann?«
»Natürlich.« Verwirrt schaute sie mich an. »Zwei Pfund sind mehr als genug, Miss. Wie heißen Sie eigentlich?«
»Elizabeth, Elizabeth Stewart.«
»Nun, wenn Sie unbedingt etwas bezahlen möchten, Miss Stewart, macht es zwei Pfund.«
»Oh, Sie dürfen mich nicht so nennen, Mrs. O'Dara, Nur wenn meine Tutoren mit mir schimpfen, nennen sie mich so.«
Sie lachte höflich und strich sich eine graue Strähne aus der Stirn. »Nun, mich nennt auch niemand Mrs. O'Dara, außer dem Arzt und dem Priester. Noch nicht einmal Paddy. Er mag es sicher nicht, wenn ich Geld von Ihnen nehme, Miss ... ich meine Elizabeth.«
»Aber Sie nehmen ja kein Geld von mir, es ist doch nur für die Einkäufe«, versicherte ich ihr. »Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich lege das Geld jede Woche in die Teekanne auf dem Regal, die kleine mit dem Kleeblatt, dem Wahrzeichen von Irland. Sie können ihm erzählen, es seien die Kinder gewesen. Sagen wir drei Pfund?«
Ich nahm ein gestreiftes Geschirrtuch von der Eisenstange über dem Herd. Vor langer Zeit hatte ich gelernt zu handeln, wenn etwas zu teuer war. Das konnte ich gut. Hier musste ich das erste Mal den Preis nach oben handeln. Ich wusste, dass Mary O'Dara lieber Geld drauflegen als jemanden ausnehmen würde. Was für ein Dummkopf, würde meine Mutter denken, der nicht alles nahm, was er kriegen konnte.
Ich trocknete die Tassen ab und stellte sie in die leeren Regale des Küchenschranks. Sie ging zurück zum Tisch, wischte mit dem Geschirrtuch sorgfältig das Spülbecken ab, schob es in das untere Regal und breitete die Tischdecke und das Geschirrtuch auf der Eisenstange über dem Herd zum Trocknen aus. Sie bewegte sich leicht hinkend mit gekrümmtem Rücken, der die langen Jahre schwerer Arbeit erkennen ließ. Aber in ihren Bewegungen lag weder Groll noch Hast noch Ärger.
Plötzlich musste ich an einen Roman denken, den ich in der Schule gelesen hatte. Der Held der Geschichte glaubte, dass gute Arbeit ein Geschenk Gottes sei. Seine Vorgesetzten hielten ihn für verrückt. Er war Mechaniker, und das von ihm gewartete Flugzeug flog besser als jedes andere und hatte keinen einzigen Zwischenfall. Der Gedanke einer praktischen Religion, die auf Liebe beruhte, hörte sich für mich sehr verlockend an, denn die einzige Religion, die ich kannte, stützte sich auf das Prinzip der Vergeltung.
Ich lächelte. Nach Round the Bend hatte ich gierig alles von Nevil Shute gelesen. Als meine Mutter schließlich bemerkte, dass er nicht auf der Bestsellerliste stand, schimpfte sie wütend: »Du stopfst dir den Kopf nur mit Unsinn voll.«
Mary nahm Kartoffeln aus dem Sack und kam zu mir. »Sie hat mir mein Schutzengel geschickt, Elizabeth, weil mein Herz so schwer war. Manchmal werden unsere Gebete auf sehr ungewöhnliche Weise erhört. Setzen Sie sich an den Tisch, dann können wir uns unterhalten, während ich die Kartoffeln für das Abendessen schäle.«
»Natürlich, Mary. Aber zuerst muss ich unbedingt einen Blick auf die Aran-Inseln werfen.«
Sie lachte leise. Paddy kam wieder herein. Ich ging hinaus in die Richtung, aus der er gekommen war. Dort hinten hatte ich einen ausgetretenen Pfad entdeckt, der zu einem Toilettenhäuschen oder zur windgeschützten Ecke eines Feldes führte.
Der Pfad hinter dem Haus war derart steil, dass man Steinstufen in die Böschung geschlagen hatte. Als ich oben stehen blieb, konnte ich auf das Dach sehen. Das Haus stand so dicht am Hügel, dass ich es fast berühren konnte. Das Strohdach war ein Kunstwerk. Es war so ordentlich gekämmt, dass kein einziger Strohhalm herausstand, und wies ein kompliziertes Schneckenmuster am Dachfirst auf, ein dichtes Gewebe, das wie die Stickerei auf einer Bluse aussah und das Dach bei den heftigen Winterstürmen sicherte. Hinter dem Haus erstreckten sich Felder bis hinunter zum Meer. Unter dem wolkenverhangenen Himmel lag es grau und friedlich da, und ich konnte die Brandung hören. Nur zwei Felder entfernt brachen sich die draußen im Atlantik entstandenen Wellen an den steilen Klippen.
Ich zählte die Häuser. Sieben waren nach Westen zum Meer hin ausgerichtet. Vor jedem Cottage stapelte sich gestochener Torf. Rauchwolken stiegen aus den Schornsteinen. Vier weitere waren mehr oder weniger verfallen, Dachbalken und Mauern eingestürzt, und Unkraut wucherte auf den Strohdächern. Es musste noch einige Cottages nach Süden zur Liscannor Bay hin geben, aber von meinem Platz aus konnte ich sie nicht sehen. Erleichtert atmete ich auf. Immerhin waren weiter unten noch die Überreste der Gemeinde erhalten, die ich gesucht hatte, eine Gemeinde, die einst über hundert Einwohner zählte.
Ich stand eine Weile da und nahm jede Einzelheit der stillen grünen Landschaft und des weiten Meers mit den dunklen Konturen der Inseln in mich auf. Ich dachte an die Menschen, die einst in den jetzt verfallenen Ruinen lebten und sich gezwungen sahen, das Land zu verlassen. Die anderen, die in der Heimat blieben, ertrugen die Armut und harte Arbeit klaglos.
Vom Meer wehte Traurigkeit herüber. Ich wusste nichts über diese Menschen und ihr Leben in Lisara oder drüben in Amerika. Und doch hatte ich das Gefühl, sie und diesen Ort schon mein ganzes Leben lang zu kennen. Mit jedem Schritt, den ich den Hang hinaufstieg, wurde meine Traurigkeit stärker. Es war fast nicht zu ertragen, denn ich konnte mir meine Gefühle nicht erklären.
Als wir nach dem Essen das Geschirr abräumten, blies der Wind stärker, und dicke Regentropfen fielen aus den dunklen Wolken auf die Steine vor der offenen Tür. Widerwillig legte Paddy seine Pfeife beiseite, stand auf und schloss sie.
»Ich mache lieber die Petroleumlampe an, es wird bald dunkel, Mary. Ich glaube, wir kriegen eine stürmische Nacht.«
»Ja, es sieht so aus. Aber der Regen geht bald vorbei.« Paddy wartete, bis die niedrige Flamme den Docht erhitzte. Sein Gesicht leuchtete im weichen Schein der Lampe.
»Möchten Sie Kaffee, Elizabeth?»
»Ja, gern, Mary, aber nur, wenn Sie auch einen trinken. Machen Sie sich bitte meinetwegen keine Umstände.«
»Nein, nein. Ich trinke gern eine Tasse, und Paddy ebenfalls. Immer wenn Bridget kommt, bringt sie ein paar Päckchen mit.«
Paddy setzte das Glas wieder auf die Lampe und drehte die Flamme vorsichtig kleiner.
Das sanfte gelbliche Licht strömte heraus und vertrieb die dunklen Schatten. Ich schaute hinüber in die Ecke, wo schwere Mäntel an den Haken hingen. Dorthin hatten sich die Schatten verzogen und drängten sich bis hinter die Garderobe. Der Sack Mehl, der an der Wand lehnte, war in der Dunkelheit kaum noch zu erkennen. Mich konnte der Schatten nicht erreichen, ich saß in einem warmen, erleuchteten Raum. In dem bequemen Sessel ließ ich meiner Müdigkeit freien Lauf und war dankbar für die Ruhe.
Über meinem Kopf auf der dunklen Unterseite des Strohdachs tanzte der graue Staub im Lampenlicht. Die Sparren waren durch Alter und Ruß schwarz geworden. Über hundert Kreuze hingen an einem grob behauenen Balken entlang der Wand an der Seeseite des Hauses. Einige waren aus Holz geschnitzt, andere aus Binsen geflochten, die nun zu blassem Stroh vertrocknet oder honiggelb verräuchert waren. Für jedes Jahr eines?
»Ich hole nur die Suppe aus der Speisekammer.«
Mary öffnete die Tür. Der Wind fuhr ins Zimmer und ließ die Petroleumlampe wild aufflackern. Protestierend knisterte das Feuer. Als sie die Tür hinter sich zuzog, fiel mein Blick auf eine winzige rote Flamme, die plötzlich im Luftzug tanzte. Von einem Metallregal lächelte die Jungfrau Maria huldvoll auf den sauber abgewischten Tisch. Ihre erhobenen Hände segneten drei blau-weiß gestreifte Tassen und eine Vakuumpackung Maxwell House Kaffee.
»Der Wind da draußen würde einem Mann die letzten Haare von der Glatze blasen.« Mary schnappte nach Luft und musste ihr ganzes Gewicht gegen die Tür stemmen, um sie zu schließen. Sie umklammerte mit den Händen einen kleinen Glaskrug.
»Das ist ein netter Vergleich, Mary, den kannte ich noch nicht. Ich glaube, mein Onkel Albert hätte gesagt, der Wind bläst einem Kalb die Hörner vom Kopf.« Zweifelnd wiederholte sie den Satz, während Paddy sich vor Lachen schüttelte. »Aber Mary, du weißt doch, wie ein Kalb aussieht.« Paddy fügte einen Satz in Gälisch hinzu, den ich nicht verstand. »Kälber haben doch keine Hörner.«
Sie lachte und zog den Lehnstuhl ans Feuer. Ich sprang auf.
»Mary, setzen Sie sich hier hin, ich nehme den Stuhl.«
»Aber nein, Elizabeth, bleiben Sie nur sitzen.«
Ich gehorchte. Heute Abend konnte ich sie nicht überreden, ihren angestammten Platz einzunehmen. Zweifellos würde sich dadurch unsere Beziehung ändern. Aber für heute hatte sie anders entschieden.
Paddy stopfte sich die Pfeife, zündete sie an, zog kräftig daran und drückte noch einmal den Tabak in den Pfeifenkopf. Als sie ordentlich brannte, lehnte er sich zufrieden zurück. Der blaue Rauch stieg in einer Spirale zu den Dachsparren auf. Schweigend schauten wir ins Feuer. Es war kein verlegenes Schweigen, es war das Schweigen der Menschen, die sich viel zu sagen hatten. Aber sie waren dankbar dafür und konnten auf die richtige Zeit und Gelegenheit warten.
Zwei oder drei Stunden waren schon vergangen, als Mary den Kessel übers Feuer zog, um noch einmal Tee zu kochen. Paddy hatte mir von Lisara und den Menschen hier erzählt. Mary hatte von ihrer Familie berichtet – neun Söhne und Töchter, die verstreut in Irland, England, Schottland und den Vereinigten Staaten lebten. Ich sprach ein wenig über meine Diplomarbeit, erwähnte meinen Freund George, einen Kommilitonen, der den Sommer über in England arbeitete, und erzählte schließlich sehr viel über die langen Sommer bei Onkel Albert in County Armagh.
Erst als Mary aufstand, um den Tee aufzugießen, bemerkte ich, dass ich fast nichts über Belfast, meine Eltern oder die Wohnung über dem Laden auf der Ormeau Road berichtet hatte, obwohl ich dort seit meinem fünften Lebensjahr wohnte.
»Es ist wirklich schön, Gesellschaft zu haben. Bei schlechtem Wetter ist es hier oft sehr einsam, Elizabeth. Nur selten kommt abends mal ein Nachbar herüber.« Der Wind heulte ums Haus. Es war erst Anfang September.
»Die Januarstürme müssen schlimm sein.« Ich sah zu Paddy hinüber.
»O ja. Man muss auf das Strohdach aufpassen, sonst fliegt es bis nach Dublin. Ich weiß noch – es ist vielleicht zwei Jahre her –, als das Dach der Kapelle von Ballyronan eines Sonntagmorgens während der Messe komplett weggerissen wurde.«
Mit leuchtenden Augen sah er mich an und hob die Hände zu einer eindrucksvollen Geste.
»Und der Priester wurde fast mit fortgeweht.« Lachend drückte er die Pfeife aus.
»Gott behüte uns«, sagte Mary ebenfalls lachend und bekreuzigte sich schnell. »Der arme Mann schloss die Augen und fürchtete sich zu Tode, denn er sprach gerade das Gebet der Auferstehung.«
Sie schaute zu mir, ein schrecklicher Augenblick für mich. Wir hatten ausgerechnet das einzige Thema angeschnitten, das unsere Unbeschwertheit und Freude vertreiben konnte. Die Frage stand ihr ins Gesicht geschrieben, eine berechtigte Frage. Aber ich wusste wirklich nicht, was ich antworten sollte.
»Sind Sie auch katholisch, Elizabeth?»
»Nein, Mary, wir alle, meine gesamte Familie, sind Presbyterianer.«
»Oh, das ist schon in Ordnung. Man sagt, dass die Presbyterianer gleich nach den Katholiken kommen«, entgegnete sie und reichte mir eine Tasse Tee.
Wenn sie erklärt hätte, die Erde sei flach oder der Papst sei für die Geburtenkontrolle, wäre ich auch nicht verblüffter gewesen. Plötzlich sah ich tausende von Orangemen mit Melonen auf den Köpfen protestierend trommeln und ihre Banner schwingen. Meine Mutter hätte rot vor Zorn ihre Hände in die Hüften gestemmt und ihre neuesten Geschichten über die Fehler der Katholiken, die den größten Teil ihrer Kundschaft ausmachten, zum Besten gegeben. Ich sah zu Mary hinüber, die linkisch auf ihrem Lehnstuhl saß, und war sprachlos.
»Das ist wahr«, fügte Paddy entschlossen hinzu. »Waren Wolfe Tone und Charles Stuart Parnell nicht auch Presbyterianer? Große Iren, diese Männer, Gott schütze sie!«
Ich atmete erleichtert auf und war diesen mir völlig unbekannten Männern überaus dankbar. Die Namen hatte ich zwar schon einmal gehört, konnte sie aber nicht mehr einordnen. Die Geschichtslehrerin meines Belfaster Gymnasiums war Schottin und bevorzugte Knox und Calvin. Sie verschwendete keine Zeit mit den Schwierigkeiten der Iren, ihrem zügellosen Benehmen, ihren Aufständen und ihrer Weigerung, sich der Ordnung der britischen Regierung zu beugen.
Sie hatte britische, amerikanische und Commonwealth-Geschichte aus dem Vorlesungsverzeichnis für uns ausgewählt. Die Zusammensetzung der einzelnen kanadischen, indischen oder südafrikanischen Regierungen könnte ich noch immer aufzählen, und die wichtigsten Männer dieser Länder kenne ich auch noch, aber von den »großen Iren« wusste ich überhaupt nichts.
Gestern hatten mich die Hendersons bis Dublin mitgenommen und am Fluss in der Nähe des Bahnhofs aussteigen lassen. Ich setzte mich unter einen Baum und betrachtete das braune Wasser des Liffeys in einer Stadt, die ich nicht kannte. Ich war schon in Paris und London gewesen und als Studentin durch ganz Europa gereist, hatte mir Madrid, Rom und Wien angesehen, aber Dublin kannte ich nicht. Meine Eltern hatten mehr Einwände gegen meine Fahrt nach Clare gehabt als gegen meine zweimonatige Reise durch Europa.
Im Schatten der Bäume war es angenehm kühl. Das diesige Sonnenlicht zeichnete Muster auf das Pflaster, die ersten gelben Blätter kündigten den Herbst an. Ich mochte den Anblick der alten, leicht abgewohnten Gebäude, die Silhouette einer Kuppel vor dem Himmel, die sanft geschwungene Brücke, die ich auf dem Weg zum Bahnhof überqueren musste.
»Schmutziges Loch«, hörte ich die Worte meines Vaters. »Desolate Armut«, fügte meine Mutter hinzu. Sie waren beide noch nie hier gewesen.
Ich blieb so lange wie möglich auf der Bank sitzen. Doch schließlich musste ich gehen, sonst hätte ich den Zug nach Limerick versäumt. Als ich die Brücke erreichte, sah ich den Namen der Uferstraße, an der ich gesessen hatte. »Wolfe Tone Quay«, hatte in großen Buchstaben auf der Mauer gestanden.
Mary nahm zwei Leuchter vom Kaminsims. Ich zündete die Kerzen an, und Paddy drehte die Petroleumlampe herunter. Die lauernden Schatten krochen in die Küche und verschluckten alles. Nur die kleine Ecke, in der wir mit den brennenden Kerzen standen, blieb verschont. Paddy pustete noch einmal in die Lampe, um sicherzugehen, dass sie nicht mehr brannte.
»Gute Nacht, Elizabeth. Schlafen Sie gut. Ich hoffe, es ist alles zu Ihrer Zufriedenheit.« Mary gab mir meine Kerze.
»Gute Nacht, Elizabeth. Keine Angst, die irischen Hexen werden Sie schon nicht holen, Sie schlafen im Westzimmer«, erklärte Paddy. »Vielleicht hören Sie die Mäuse, die auf dem Dach Baseball spielen. Kümmern Sie sich nicht darum, sie lassen sich von Ihnen auch nicht stören.« Er grinste.
»Nun komm, alter Mann. Es ist Zeit, schlafen zu gehen.«
Er lachte und folgte seiner Frau zu der Tür links neben dem Kamin.
»Gute Nacht und vielen Dank. Es war ein schöner Abend.« Mit meiner Kerze leuchtete ich in die andere dunkle Küchenecke.
Ich öffnete die Tür zu meinem Zimmer, stieß sie auf und tastete automatisch nach dem Lichtschalter. Natürlich gab es keinen. Meine Finger berührten einen kleinen kalten Gegenstand, der scheppernd zu Boden fiel. Als ich mit der Kerze hinter der Tür hervorkam, sah ich eine Porzellanfigur, die Jungfrau Maria. Sie war etwas kleiner als die in der Küche. Aus ihrem gerafften Kleid hatte sie Weihwasser auf mein Bett verschüttet.
Gott sei Dank, sie war nicht zerbrochen. Ich hängte sie wieder an den Nagel und wischte die großen Wassertropfen weg, bevor sie in die dicke rosa Daunendecke eindringen konnten. Das Zimmer war kalt, der Wind heulte um den Giebel und ließ es noch kälter erscheinen. Ich zog mich schnell aus. Als ich die Kerze am Waschtisch ausblies, spürte ich den eisigen Linoleumfußboden unter meinen Füßen. Ich kroch ins Bett und rollte mich frierend zusammen. Der gestärkte Kissenbezug knisterte unter meiner Wange und roch nach Mottenkugeln.
»Und sage nicht, mich holt im klammen Bett der Tod im Schlaf. Es ist nicht klamm, nur kalt. Bald wird es wärmer werden.«
Ich lachte, weil ich oft die Worte meiner Mutter im Ohr hatte. Auch gestern Abend in Limerick. Wie leicht ich vorhersagen konnte, was sie von sich geben würde. Wie die psychologischen Assoziationstests, die meine Freundin Adrienne Henderson durchführte. Man musste ohne nachzudenken auf ein Wort reagieren. Mit meinen Eltern funktionierte das sehr gut. Ich kannte die entsprechenden Schlüsselwörter. Genauer gesagt, verbrachte ich meine Zeit damit, sie zu vermeiden. Wenn ich einmal über eines stolperte, bekam ich die Antwort, die ich erwartet hatte, so sicher wie eine Tonbandaufnahme.
Der Geruch des noch rauchenden Dochts lag in der Luft. Schon befand ich mich wieder in der kleinen Dachkammer in Onkel Alberts Cottage. Kerzenwachs tropfte auf den Mahagonitisch. Ich kratzte mit den Fingernägeln Wachstropfen ab, formte sie zu Wasserrosen und ließ sie auf der Regentonne vor dem Haus schwimmen. Plötzlich war ich wieder die Zehnjährige, die man zur Erholung aufs Land geschickt hatte.
Zehn Jahre alt zu sein war mir nicht fremd. Ich lag im Dunkeln und fragte mich, ob ich mich wohl auch noch mit dreißig, vierzig oder fünfzig an das Gefühl erinnern würde, zehn Jahre alt zu sein. Oder würde ich einmal einen Punkt erreichen, an dem ich die Dinge mit anderen Augen sähe? So lange ich denken konnte, hatten mir meine Eltern, Verwandten und die Nachbarn, die auf »unserer Seite« standen, immer versichert, dass ich die Welt so sehen würde wie sie, wenn ich »erwachsen« wäre oder »eine eigene Familie« hätte. Dieser Gedanke machte mir Angst.
Würde ich tatsächlich einmal wie sie in einem Gefängnis der Gewissheit sitzen, das ihr gesamtes Denken durchdrang? Sie wussten immer alles, waren von der Richtigkeit ihres Denkens unerschütterlich überzeugt. Die Vorstellung, so zu werden wie sie, versetzte mich in Angst und Schrecken. Konnte man diesen Prozess nicht stoppen? Wie ließ sich verhindern, eines Tages diese Sichtweise zu bekommen wie graue Haare, eine Brille oder die Rente – Ereignisse, die so unabwendbar waren wie der Sonnenaufgang?
Kapitel 3
Nachdem ich drei Tage über die Wege und Felder von Lisara gewandert war, freute ich mich am Donnerstagnachmittag auf einen Besuch in Lisdoonvarna. Paddy meinte, es nehme mich sicher jemand mit, aber als ich in Gedanken über die Erfahrungen der letzten Tage die Straße entlangwanderte, überholten mich nur voll besetzte Fahrzeuge mit Kindern und Gepäck. Ich war ganz froh, dass sie mir zuwinkten und mich in der Stille des schwülen Nachmittags allein ließen.
Ich erreichte die Außenbezirke der Stadt und stieg an den Heilquellen den Berg hinauf. Erstaunlich, überall waren Menschen. Sie gingen in Gedanken versunken und in sich gekehrt über die Straßen, wanderten zwischen den Badehäusern hin und her und überschwemmten den Platz. Nach der Stille der Natur und meiner Gedanken traf mich das plötzliche Getümmel und der Lärm wie ein Schlag. Ungeschickt bahnte ich mir einen Weg durch beieinander stehende Familien, umherwandernde Priester und braun gebrannte Touristen und musste bald feststellen, dass sich auch der Platz völlig verändert hatte.
Die sonst leeren Bänke waren nun voll bunter Gestalten. In der Nähe brachte ein Luxusbus eine weitere Ladung Kurgäste. Mit Handtaschen, Strandbeuteln und Rucksäcken standen sie ungeduldig um einen kleinen Gepäckhaufen herum und holten sich nacheinander bei einem uniformierten Reiseleiter ihr Gepäck ab.
Eigentlich wollte ich mich kurz niedersetzen, aber sogar die Mauer des Denkmals war von Eis essenden Familien in Beschlag genommen. Die moosbewachsene Bank auf meinem Rückweg war die einzige freie Sitzgelegenheit.
Die Schlange, die sich auf dem unebenen Gehweg vor dem Postamt gebildet hatte, begrüßte mich freundlich. Nur langsam bewegte sie sich vorwärts. Als ich endlich den Schalterraum erreichte, traf mich feuchter, modriger Geruch. Das Gebäude hatte jahrelang keinen Pinselstrich erlebt. Die Wände waren vergilbt und rissig. Hinter einem gewaltigen Metallgitter entwertete eine ältere Frau mit silbernem Haar Briefmarken und blätterte immer wieder in den Rententabellen nach, unbeeindruckt von der Schlange unruhiger braun gebrannter Ladys in weißen Hosen und grellen zitronengelben und rosa Sonnentops.
Ich schlurfte auf dem nackten Holzboden vorwärts. Vor mir warf eine ältere Frau missbilligende Blicke auf zwei andere, die auf dem winzigen Schreibpult, das zu diesem Zweck zur Verfügung stand, Postkarten schrieben. Sie starrte auf ihre nackten Schultern und Arme und die knappen Tops, die kaum ihre kleinen flachen Brüste bedeckten. Trotz der Mittagshitze trug sie selbst einen schwarzen Wollmantel und hatte ihren Filzhut mit großen Hutnadeln aus Horn an den Haaren befestigt.
Die Frau hinter mir trat ungeduldig von einem Fuß auf den anderen und hielt ihre Postkarten in der Hand, als wollte sie sich die Karten legen.