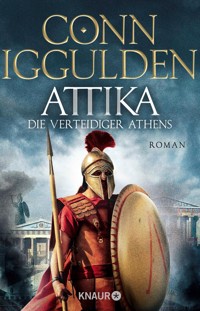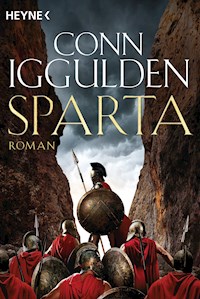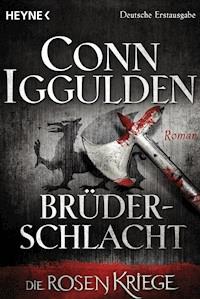9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Rosenkriege-Serie
- Sprache: Deutsch
England, im Winter 1461: Der Krieg zwischen den Herrscherhäusern Lancaster und York hat viele Opfer gekostet. Richard von York, der nach der Krone griff, ist tot, König Henry wird abgesetzt und gefangen gehalten. Die Königsgattin setzt den Kampf gegen das Haus York fort. Doch ihr Triumph ist nur von kurzer Dauer. Der junge Edward von York will England wieder in der Hand eines starken Königs sehen. In einem Sog von Niedertracht und Verrat wird Blut die Erde des Reiches tränken ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 659
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
DAS BUCH
England, im Winter 1461: Der Krieg zwischen den Herrscherhäusern Lancaster und York hat viele Opfer gekostet. Richard von York, der nach der Krone griff, ist tot, König Henry wird abgesetzt und gefangen gehalten. Die Königsgattin setzt den Kampf gegen das Haus York fort. Doch ihr Triumph ist nur von kurzer Dauer. Der junge Edward von York will England wieder in der Hand eines starken Königs sehen. In einem Sog von Niedertracht und Verrat wird Blut die Erde des Reiches tränken …
DER AUTOR
Conn Iggulden, geboren 1971, ist einer der erfolgreichsten Autoren historischer Stoffe. Iggulden lehrte Englisch an der University of London, bevor er sich dem Schreiben zuwandte. Drei Könige ist der dritte Band seiner Bestseller-Serie um die Rosenkriege. Iggulden lebt mit seiner Familie in Hertfordshire, England.
Mehr Informationen über den Autor und die Serie finden Sie unter www.conniggulden.com
CONN IGGULDEN
DREI
KÖNIGE
DIE ROSENKRIEGE 3
ROMAN
Aus dem Englischenvon Christine Naegele
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe
WARS OF THE ROSES: BLOODLINE
erschien 2015 bei Penguin Random House UK
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Vollständige deutsche Erstausgabe 09 /2016
Copyright © 2015 by Conn Iggulden
Copyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkterstraße 28, 81673 München
Redaktion: Heiko Arntz
Umschlagillustration: Nele Schütz Design, München,Verwendung eines Motivs von shutterstock / Galushko Sergey
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
Druck und Bindung: CPI books GmbH Leck
ISBN: 978-3-641-15507-0V002
www.heyne.de
Gewidmet meinem Vater,für seine Geduld und seinen Humor
PROLOG
Der Wind zerrte an ihnen, wild und tückisch. Plötzliche Böen nahmen ihnen den Atem, und die beißende Kälte schmerzte im Gesicht. Die beiden Männer wurden vom Sturm gebeutelt, aber sie kletterten weiter auf den eisernen Sprossen in die Höhe. Sie blickten nicht hinunter, aber sie wussten, dass die Menge dort unten sie beobachtete.
Beide waren im Süden Englands aufgewachsen, im selben Dorf in Middlesex. Jetzt waren sie weit von der Heimat entfernt, aber zusammen mit ihrem Herrn hatten sie ihren Auftrag von Königin Margaret persönlich erhalten, und allein darauf kam es an. Sie waren von der Festung Sandal weiter nach Norden geritten, hatten die blutgetränkte Erde mit den geplünderten Leichen hinter sich gelassen. Zwei Säcke hatten sie nach York mitgebracht, und der Sturm wurde immer stärker.
Sir Stephen Reddes sah zu ihnen hinauf, er hatte eine Hand erhoben, um sich vor den Eisnadeln zu schützen, die der Wind ihm ins Gesicht trieb. Es war kein Zufall, dass man das Micklegate-Tor gewählt hatte. Die englischen Könige hatten stets dieses Tor benutzt, wenn sie von Süden her in die Stadt York eingezogen waren. Sie hatten ihren Auftrag, ihren Befehl – und den führten sie aus.
Jetzt hatten Godwin Halywell und Ted Kerch einen schmalen hölzernen Vorsprung hoch über der Menge erreicht. Vorsichtig schoben sie sich darauf, doch immer wieder mussten sie sich zurücklehnen, wenn eine Bö kam und sie herunterzufegen drohte. Die Menschenmenge unter ihnen wurde dichter, Hagelkörner glitzerten auf dunklem Haar. Noch immer schlurften weitere Gestalten aus Haustüren und Wirtshäusern herbei, einige fragten die einheimischen Wachen auf der Mauer, was hier vor sich gehe. Aber sie bekamen keine Antwort, denn die Wachen waren nicht eingeweiht worden.
Etwa zwölf Fuß über dem Boden hatte man kurze, spitze Eisenstangen eingelassen, zu hoch, als dass Freunde der Hingerichteten sie hätten erreichen können. Insgesamt sechs, alle tief und fest in römischem Mörtel verankert. Vier von ihnen trugen verweste Köpfe, die in die Dunkelheit starrten.
»Was sollen wir mit diesen hier machen?«, rief Halywell. Mit einer ratlosen Handbewegung deutete er auf die Reihe der Köpfe zwischen ihnen. Sie hatten keine Anweisungen bekommen, wie sie mit den Überresten der zur Schau gestellten Verbrecher verfahren sollten. Halywell stieß einen kaum hörbaren Fluch aus. Seine Laune wurde zusehends schlechter durch den immer stärker werdenden Hagel, der ihm ins Gesicht peitschte.
In seiner Wut schaffte er es, seine Abscheu zu überwinden, und streckte die Hand nach dem ersten Kopf aus. Der Mund war voll weißer Eiskristalle. Halywell wusste zwar, wie unsinnig es war, aber plötzlich stellte er sich vor, dass er gebissen werden könnte, und er konnte sich nicht entschließen, zwischen die Kiefer zu greifen. Stattdessen hakte er die Finger unter den Unterkiefer und drückte kräftig nach oben, worauf der Kopf von der Stange rutschte und in der Dunkelheit verschwand. Fast hätte dieser Kraftakt Godwin Halywell gleich mitgerissen. Schwer atmend und mit weißen Fingern klammerte er sich an die Steine. Unten hörte man Schreie, und die Menge wich erschrocken zurück, als plötzlich gefährliche Gegenstände vom Turm des Torhauses geflogen kamen.
Halywell blickte an der Mauer entlang zu Kerch, und sie tauschten einen grimmig-resignierten Blick. Sie waren einfach nur zwei Männer, die gezwungen waren, die Drecksarbeit zu erledigen, während andere sie aus relativer Sicherheit angafften und kritisierten. Es dauerte etwas, bis sie auch die anderen Köpfe entfernt und nach unten geworfen hatten. Einer von ihnen zerbarst auf dem Pflaster, das Geräusch erinnerte an ein zerbrechendes Tongefäß.
Halywell ging davon aus, dass es gar nicht nötig gewesen wäre, alle Eisenstangen freizumachen. Sie hatten in ihren beiden Säcken nur drei Köpfe mitgebracht, aber irgendwie erschien es ihm pietätlos, die ihnen anvertrauten Köpfe neben gewöhnlichen Verbrechern zur Schau zu stellen. Zwar kam ihm plötzlich der Gedanke, dass Christus bei der Stätte Golgatha ja auch neben zwei Dieben gehangen hatte, aber darüber schüttelte er nur unwillig den Kopf. Er musste sich auf seine Arbeit konzentrieren.
Der Wind heulte, als Halywell seinen Sack an die rechte Schulter hob und darin suchte, bis er ein paar Haarsträhnen fühlte, die er um seine Finger wickelte. Die Köpfe klebten durch das geronnene Blut so fest am Sack, dass er ihn fast nach außen stülpen musste und dabei abermals Gefahr lief, vor Anstrengung von der Mauer zu stürzen. Doch obwohl er vor Angst und Erschöpfung keuchte, schaffte er es schließlich, den Sack ruhig genug zu halten, um den Kopf von Richard Neville, Earl von Salisbury, herauszuziehen.
Das Haar, das er um seine Finger gewickelt hatte, war eisengrau und die Augen waren nicht nach oben verdreht, sodass es schien, als sehe ihn das schlaffe Gesicht im Fackelschein an. Halywell murmelte ein fast vergessenes Gebet und wollte sich bekreuzigen oder ihm wenigstens die Augen schließen. Er hatte gedacht, er sei gegen Derartiges abgehärtet, aber es war doch etwas Ungewohntes, sich von einem Toten beobachtet zu fühlen.
Und einen Kopf auf einer spitzen Eisenstange zu befestigen war alles andere als eine leichte Übung. Niemand hatte es Halywell gezeigt, gerade so, als wisse jeder vernünftige Mensch schon von allein, wie man das mache. Zufällig hatte er in seiner Kindheit einen Sommer zusammen mit anderen Jungen damit verbracht, beim Schlachten von Schweinen und Schafen zu helfen und dafür den einen oder anderen Penny oder ein Stück Leber mit nach Hause gebracht. Er hatte eine ungefähre Vorstellung davon, dass es an der Schädelbasis einen Hohlraum gab, den er aber in der Dunkelheit nicht finden konnte. Er war fast den Tränen nahe, als er den Kopf hin und her drehte, wobei seine Hände immer wieder abrutschten und seine Zähne aufeinanderschlugen. Unter ihm stand die Menge, in der man sich jetzt Namen zuflüsterte.
Plötzlich fand die Eisenspitze ihren Weg, sie durchbohrte das Gehirn und stieß nach oben bis an die Schädeldecke. Halywell seufzte erleichtert auf. Unten bekreuzigten sich viele, es war eine Bewegung wie von einem aufflatternden Vogelschwarm.
Den zweiten Kopf packte er an seinem kräftigen, dunklen Haar, viel dichter als die grauen Locken des ersten. Richard, Duke von York, war im Augenblick seines Todes sauber rasiert gewesen, doch Halywell hatte gehört, dass die Bartstoppeln nach dem Tod noch eine Weile weiterwachsen. Richtig, er spürte ein unangenehmes Kratzen am Kinn. Er versuchte, das Gesicht nicht anzusehen, und schloss die Augen, als er den Kopf auf die eiserne Spitze rammte.
Mit blutverschmierten Händen bekreuzigte Halywell sich. In einiger Entfernung hatte Kerch den dritten Kopf neben York aufgespießt. Es war der eines Jungen. Ein schlimme Sache, wie jedermann wusste. Man erzählte sich, dass Yorks Sohn Edmund vom Schlachtfeld geflohen war, doch Baron Clifford hatte ihn aufgespürt und den Jungen umgebracht, nur aus Gehässigkeit gegen den Vater.
Alle Köpfe waren frisch, ihre Münder standen offen. Halywell hatte von Leichenbestattern gehört, dass sie den Unterkiefer an der Wange festnähten oder ihn mit einem Mundvoll Teer festklebten. Er fand, dass es egal sei, tot war tot.
Er sah, dass Kerch zu den Eisensprossen in der Mauer zurückkehrte. Ihre Arbeit war getan. Halywell wollte gerade dasselbe tun, als er hörte, wie Sir Stephen ihm etwas zurief. Bei dem starken Wind konnte er die Worte kaum verstehen, aber jetzt erinnerte er sich und fluchte laut.
Ganz unten im Sack war noch eine Papierkrone, steif und dunkel von getrocknetem Blut. Halywell entfaltete sie und sah Yorks Kopf von der Seite an. An seinem Gürtel hing ein Beutel mit einer Handvoll kleiner Klammern, aus trockenem Schilf geschnitzt. Er murmelte etwas von Blödsinn, aber er beugte sich vor und befestigte die Krone in dem dunklen, lockigen Haar. Im Schutz des Turmes mochte sie womöglich eine Weile halten, vielleicht würde sie der Wind aber auch schon durch die Stadt fegen, noch ehe er wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Ihm war auch das egal. Tot war tot. Und deshalb war es den himmlischen Heerscharen auch egal, ob man eine Krone aus Gold oder aus Papier getragen hatte. Was immer mit dieser Beleidigung zum Ausdruck kommen sollte – Halywell verstand es nicht.
Vorsichtig schwang er sich auf die Leiter und nahm die beiden ersten Sprossen abwärts. Als seine Augen auf gleicher Höhe mit den aufgespießten Köpfen waren, hielt er inne. York war ein tüchtiger Mann gewesen, ein tapferer Mann, wie er gehört hatte. Und Salisbury ebenfalls. Gemeinsam hatten sie nach dem Thron gegriffen und waren gescheitert. Halywell dachte daran, wie er seinen Enkeln erzählen würde, dass er es war, der Yorks Kopf auf der Stadtmauer aufgespießt hatte.
Der Wind schien sich zu legen. Und einen Moment war ihm, als stünde jemand neben ihm, er meinte den Atem an seinem Hals zu spüren. Stumm blickte er auf die drei schmachvoll getöteten Männer.
»Gott sei mit euch«, flüsterte er. »Möge er euch eure Sünden vergeben, falls ihr keine Zeit mehr hattet, ihn darum zu bitten. Möge er euch gnädig aufnehmen. Gott segne euch. Amen.«
Damit verließ Halywell diesen beklemmenden Ort und stieg hinab in die wimmelnde Menschenmenge.
TEIL EINS
1461
Der Lächler mit dem Messer im Gewand.
GEOFFREY CHAUCER, CANTERBURY TALES
1
»Ihr übertreibt, Brewer!«, fuhr Somerset ihn an, der beim Reiten sein Gesicht in den Wind hielt. »›Der Herr zog in einer Wolkensäule vor ihnen her‹, richtig? Columna nubis, wenn Ihr mit dem Buch Exodus vertraut seid. Schwarze Rußflocken in der Luft, Brewer! Das versetzt doch gerade diejenigen in Angst und Schrecken, die sonst immer noch gegen uns sein könnten. Und dagegen habe ich gar nichts einzuwenden.« Der junge Duke blickte zurück auf die dichten Qualmwolken, die immer noch hinter ihnen aufstiegen. »Die Männer müssen essen, das ist der langen Rede kurzer Sinn. Was sind denn schon ein paar Dörfer, nach allem, was wir erreicht haben? Ich würde sogar den Himmel in Brand setzen, wenn ich dadurch meine Männer satt kriege. Oder? Und überhaupt, bei dieser Kälte sollte man annehmen, dass die Menschen ein schönes Feuer zu schätzen wissen.«
»Aber die Nachricht davon wird uns vorauseilen, Mylord«, sagte Derry Brewer, der auf den Sarkasmus des Duke nicht einging. Er bemühte sich, höflich zu bleiben, obwohl auch ihm der Magen vor Hunger entsetzlich knurrte. In solchen Situationen vermisste er Somersets Vater, er vermisste dessen Scharfsinn und Verstand. Der Sohn war gewiss recht pfiffig und aufgeweckt, aber ihm fehlte ein gewisser Ernst. Mit seinen fünfundzwanzig Jahren hatte Henry Beaufort schon eine gute Portion jener militärischen Autorität, der sich die Leute gern unterordneten. Er hätte einen anständigen Hauptmann abgegeben. Doch leider war er der alleinige Befehlshaber sämtlicher Truppen der Königin. Daran dachte Derry, als er abermals versuchte, seinen Standpunkt klarzumachen.
»Mylord, es ist schlimm genug, dass Boten mit der Nachricht von Yorks Tod nach Süden unterwegs sind, während wir uns in jeder Stadt um Verpflegung bemühen müssen. Unsere Vorhut plündert und mordet, und die Leute brauchen den ganzen Tag, um mit ihnen Schritt zu halten – und inzwischen rennen die einheimischen Jungen ins nächste Dorf und warnen die Bewohner vor uns. Es dürfte immer schwerer werden, Verpflegung aufzutreiben, Mylord, wenn die Bauern ihre Vorräte verstecken. Und natürlich wisst Ihr auch, warum die Männer Feuer legen. Aber wenn sie in jedem Dorf, durch das wir kommen, ihre Untaten auf diese Weise zu vertuschen suchen, bringen wir das ganze Land gegen uns auf, noch ehe wir London erreicht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Eurem Sinne ist, Mylord.«
»Ich bin überzeugt, Ihr könntet mit Eurem Gerede einen Mann dazu bringen, Euch seine Kinder zu verkaufen, Brewer«, erwiderte Somerset. »Ihr redet zu viel, Brewer. Ihr wart einfach zu lange im Dienste einer Königin.« Somerset war sich seines Ranges und seiner Macht so sicher, dass er kein Problem damit hatte, seine Worte auf diese beleidigende Weise zu betonen. »Ja, ich denke, das ist das Problem. Aber alles hat seine Zeit, Brewer. Eure gründliche, um nicht zu sagen, langwierige, Art zu planen, das ganze … französische Getuschel, Brewer, das mag angebracht sein, wenn wir in London sind. Aber hier? Wenn es nach Euch ginge, sollten wir wohl auf den Märkten um eine Schüssel Suppe oder ein paar Hühner betteln, oder wie?« Seine Stimme wurde lauter, damit die Männer, die in den Kolonnen um sie herum marschierten, ihn hörten. »Der heutige Tag gehört diesen Männern, versteht Ihr? Seht Euch diese Leute an, diesen mächtigen Zug, der hier durch unser Land marschiert – meilenweit Bogenschützen und Soldaten, die gerade einen Sieg errungen haben. Und sie halten ihre Waffen bereit! Ihr braucht sie nur anzusehen, sie haben eine herrliche Schlacht geschlagen! Seht Ihr nicht, wie stolz sie sind?«
Das Anschwellen seiner Stimme verlangte eine Erwiderung, und die Männer um ihn jubelten bei seinen Worten. Selbstgefällig betrachtete Somerset Derry Brewer.
»Sie haben Blut vergossen, Brewer. Aber sie haben den Feind bezwungen. Jetzt bekommen sie Rindfleisch und Hammelbraten, und dann lassen wir sie auf London los, versteht Ihr? Wir werden dafür sorgen, dass Earl Warwick König Henry herausgibt und demütig um Vergebung bittet für die Scherereien, die er uns bereitet hat.«
Somerset musste lachen, seine Fantasie war mit ihm durchgegangen. »Ich sage Euch, wir werden die Welt wieder zurechtrücken. Versteht Ihr, Brewer? Und wenn die Männer sich in Grantham und Stamford, in Peterborough oder Luton ein bisschen wild aufgeführt haben, wen kümmert es? Und wenn sie die Schinken mitnehmen, die sie gefunden haben – nun ja, vielleicht hätten die Männer, denen sie gehörten, auch lieber mit uns kommen sollen, um York unschädlich zu machen!« Vorsichtshalber senkte er die Stimme, ehe er weiter sprach. »Und wenn sie dabei ein paar Kehlen durchschneiden oder wenn ein paar Landmädchen ihre Unschuld verlieren, dann feuert sie das wahrscheinlich nur noch mehr an. Wir sind die Sieger, Brewer, und Ihr seid kein Geringer unter uns. Seid also ruhig wütend, aber verschont uns wenigstens diesmal mit Euren Bedenken und Sorgen.«
Derry blickte sich nach dem jungen Duke um, er konnte seinen Ärger nur schlecht verbergen. Henry Beaufort war charmant und sah gut aus – und er konnte reden wie mit Engelszungen, wenn es galt, jemanden zu überzeugen. Doch er war noch so entsetzlich jung! Somerset hatte sich ausgeruht und gut gespeist, während die Städte, die dem Duke von York gehört hatten, in Schutt und Asche gelegt wurden. Grantham und Stamford waren dem Erdboden gleichgemacht worden, und Derry hatte auf den Straßen Gräueltaten mit ansehen müssen, nicht weniger grausam als die, die er in Frankreich erlebt hatte. Es ärgerte ihn, sich hier von diesem schnippischen jungen Adligen anhören zu müssen, die Männer hätten dies als Belohnung verdient.
Derry blickte zu Königin Margaret, die, in einen dunkelblauen Mantel gehüllt, an der Spitze ritt. Sie unterhielt sich offenbar mit Earl Percy und hatte ihm den Kopf zugewandt. Auf ihrer anderen Seite trabte ihr siebenjähriger Sohn Edward auf einem Pony, die blonden Locken des Jungen hingen schlaff herunter.
Somerset bemerkte den Blick des Meisterspions und grinste selbstsicher, als er sich mit dem älteren Mann verglich.
»Königin Margaret will ihren Mann zurückhaben, Master Brewer, und nicht Eure weibischen Bedenken über das Verhalten der Leute hören. Vielleicht solltet Ihr ihr ausnahmsweise einmal zugestehen, dass sie die Königin ist. Nur dieses eine Mal.«
Somerset holte tief Luft, warf den Kopf zurück und lachte laut über seinen Scherz. Im selben Moment streckte Derry die Hand nach dessen Stiefel aus, ergriff den Sporn und zog ihn ruckartig hoch. Mit einem Schrei verschwand der Duke über die Seite seines Pferdes, das wild tänzelte, weil die Zügel ihm am Maul rissen. Ein Bein Somersets zeigte fast senkrecht gen Himmel, und er kämpfte verzweifelt, um wieder in den Sattel zu kommen. Ein paar schreckliche Augenblicke lang hatte er die ledrigen Genitalien seines Pferdes im Blick, die neben seinem Kopf baumelten.
»Vorsicht, Mylord«, rief Derry, indem er sein Pferd etwas zurückhielt, um Abstand zu bekommen. »Die Straße hier ist sehr uneben.«
Obwohl seine Reizbarkeit hauptsächlich darauf zurückzuführen war, dass er die Fassung verloren hatte, war er doch auch wütend über den Duke. Margarets Kraftquelle und die Ursache eines großen Teils ihrer Autorität lag darin, dass sie recht hatte. Das ganze Land wusste doch, dass König Henry ein Gefangener der York-Anhänger war, alle samt und sonders Verräter. Es gab viel Sympathie für die Königin und ihren kleinen Sohn, die gezwungen waren, im Land umherzuziehen, um sich der nötigen Unterstützung zu vergewissern. Dem Unternehmen mochte etwas Rührseliges anhaften, aber immerhin hatte es ehrbare Männer wie Owen Tudor überzeugt und Armeen mobilisiert, die sonst zu Hause geblieben wären. Und es hatte ihnen schließlich den Sieg beschert, sodass das Haus Lancaster, das so lange unterdrückt gewesen war, sich wieder erheben konnte.
Aber es würde weder Margaret von Nutzen sein, noch würden sie einen einzigen weiteren Menschen für sich gewinnen, wenn man jetzt dieser Armee aus dem Norden gestattete, auf dem Weg nach London zu morden, zu notzüchtigen und zu plündern. Ihr hart errungener Sieg steckte ihnen noch in den Knochen, und sie waren wie trunken. Sie alle hatten miterlebt, wie Richard Plantagenet, Duke von York, in die Knie gezwungen und getötet worden war. Sie hatten mit angesehen, wie die Köpfe ihrer mächtigsten Feinde fortgetragen wurden, um auf der Stadtmauer von York zur Schau gestellt zu werden. Nach der Raserei und dem Wüten der Schlacht war der Sieg für diese fünfzehntausend Mann so viel wie klingende Münze in der Tasche. Zehn Jahre Kampf waren zu Ende, und York war tot auf dem Schlachtfeld geblieben, ein Opfer seines Ehrgeizes. Dieser Sieg bedeutete alles, und er war schwer verdient. Die Männer, die Yorks Kopf unter das Schwert gebracht hatten, erwarteten eine Belohnung – gutes Essen, Wein oder auch goldene Kelche von Altären, wie es sich gerade ergab.
Hinter Brewer zog sich die Kolonne hin und verschwand im Dunst, weiter, als das Auge an diesem Wintertag sehen konnte. Schotten mit nackten Beinen neben kleinen walisischen Bogenschützen und hochgewachsenen englischen Schwertkämpfern, alle abgemagert und mit zerfetzten Mänteln, aber noch marschierten sie, noch waren sie stolzerfüllt.
Etwa vierzig Yards weiter hinten war der junge Duke von Somerset mit hochrotem Kopf und mithilfe eines seiner Männer wieder in den Sattel gekommen. Beide funkelten Derry Brewer böse an, der gespielt respektvoll seine Stirn mit der Hand berührte. Ritter in Rüstung pflegten, wenn ihre Lords vorbeiritten, ihr Visier hochzuklappen, um ihr Gesicht zu zeigen. Diese Geste war zu einer Art Gruß geworden. Derry bemerkte allerdings, dass es die Empörung des jungen Mannes, den er aus dem Sattel geworfen hatte, nicht milderte. Wieder verfluchte Derry seine eigene Unbeherrschtheit. Wenn er Rot sah, schlug er zu, ohne nachzudenken. Das war immer seine Schwäche gewesen, obwohl es auch sehr befreiend sein konnte, wenn man ab und zu alle Vorsicht fahren ließ. Doch inzwischen war er zu alt dafür, fand er. Wenn er nicht vorsichtiger war, würde ihn einer dieser jungen Heißsporne umbringen.
Fast erwartete Derry, dass Somerset angeprescht kommen würde, um Satisfaktion zu verlangen, doch er sah, wie sein Begleiter flüsternd und offenbar dringlich auf ihn einsprach. Diese kleinen Streitereien waren eines Mannes von Somersets Rang nicht würdig. Derry seufzte, er würde sich die nächsten Nächte gut überlegen müssen, wo er schlief – und nie irgendwo allein hingehen. Sein ganzes Leben lang hatte er mit der Arroganz der Lords zu tun gehabt und wusste nur zu gut, dass sie es als ihr gutes Recht ansahen, nein, es fast für ihre wichtigste Pflicht hielten, Satisfaktion für Beleidigungen zu verlangen, entweder offen oder heimlich. Irgendwie wurde erwartet, dass diejenigen, die sie beleidigt hatten, dabei mitspielten, sich unsichtbar machten und ihnen auswichen, so gut sie konnten, bis die natürliche Ordnung wiederhergestellt war und man sie irgendwo fand, bewusstlos geschlagen und vielleicht mit abgeschnittenen Fingern oder Ohren.
Es hatte wohl etwas mit dem Altern zu tun, dass Derry für diese Art von Spielchen keine Geduld mehr aufbrachte. Er wusste genau, sollte Somerset ihm einen Trupp Schläger schicken, um ihn einzuschüchtern, würde er als Antwort dem Duke nachts die Kehle durchschneiden. Wenn die Kriegsjahre Derry Brewer etwas gelehrt hatten, dann dies, dass Dukes und Earls genauso leicht starben wie gewöhnliche Menschen.
Dieser Gedanke erinnerte ihn wieder an Somersets Vater, der auf einer Straße in St. Albans sein Leben verloren hatte. Der alte Duke war ein wahrer Löwe gewesen. Man hatte ihn töten müssen, er hätte nie aufgegeben.
»Gott sei mit dir, mein Alter«, murmelte Derry. »Verdammt noch mal. Also gut, er soll sicher sein vor mir, aber nur um deinetwillen. Aber würdest du mir den eitlen Gockel bitte vom Hals halten?« Er blickte zum Himmel, holte tief Luft und hoffte, dass sein alter Kumpel ihn hörte.
Derry nahm den Geruch von verkohltem Holz und Asche wahr, der seinen Hals reizte und ihn würgte. Die Vorhut sorgte schon wieder für Feuer und Chaos, sie zerrten Fleischteile und gepökelte Tierköpfe aus den Vorratsräumen und trieben Ochsen auf die Straßen, um sie zu schlachten. Am Ende eines jeden Tages erreichte die Kolonne der Königin die Spitze der Vorhut. Dann waren die Männer meist um die achtzehn oder zwanzig Meilen marschiert, und um den Preis eines Huhns, das sie braten und bis auf die Knochen abnagen konnten, verschlossen sie die Augen vor den abgebrannten Herrenhäusern und den verheerten Dörfern, die ihren Weg säumten. Fünfzehntausend Mann wollten essen, das wusste auch Derry, sonst würde die Armee der Königin sich bald in nichts auflösen, weil die Leute desertierten oder in den Straßengräben starben. Dennoch, es war nur schwer zu ertragen.
Der Meisterspion runzelte die Stirn und streckte die Hand aus, um Vergeltung den Hals zu tätscheln, dem ersten und einzigen Pferd, das er je besessen hatte. Das alte Ross wandte den Kopf und blickte hoch zu ihm, vielleicht hatte er ja eine Karotte. Doch Derry zeigte ihm seine leeren Hände, und Vergeltung verlor augenblicklich das Interesse. Vor ihm ritten die Königin und ihr Sohn, umgeben von einem Dutzend Lords, die immer noch stolzgeschwellt waren, obwohl es schon Wochen her war, seit York bei Wakefield gefallen war. Die Rückkehr nach Süden war kein Rachefeldzug, sondern ein gut geplantes Vorrücken der Streitkräfte, mit Boten, die jeden Morgen Briefe an Freund und Feind gleichermaßen beförderten. Vor ihnen lag London, und Margaret wollte nicht, dass ihr Mann doch noch umgebracht wurde, während sie schon auf dem Rückweg war.
Es würde nicht einfach sein, den König lebend zurückzubekommen, das wusste Derry. Earl Warwick hatte seinen Vater bei der Festung von Sandal verloren. Noch immer waren der Boden gefroren und die Nächte lang, und Warwick würde noch immer genauso verzweifelt sein über seinen Verlust wie Edward, Yorks Sohn. Zwei zornige junge Männer hatten in derselben Schlacht ihre Väter verloren – und König Henrys Schicksal lag in ihren Händen.
Derry erschauerte, als er sich an Yorks Worte kurz vor seiner Enthauptung erinnerte: dass sie sich damit nur den Hass der Söhne zuziehen würden. Er schüttelte den Kopf und wischte sich den Rotz weg, der auf der Oberlippe festgefroren war. Die alte Garde verließ diese Welt, einer nach dem anderen. Und die, die an ihre Stelle traten, taugten nicht viel, soweit Derry Brewer das beurteilen konnte. Die besten Männer waren alle unter der Erde.
Ein böiger Wind beutelte die Wände des Zeltes, als Warwick seine Brüder ansah und den Becher erhob.
»Auf unseren Vater«, sagte er.
John Neville und Bischof George Neville wiederholten die Worte und tranken, obwohl der Wein zu kalt war und der Tag noch viel kälter. Warwick schloss kurz die Augen und sprach ein Gebet für die Seele seines Vaters. Rundum zerrte der Wind an den Zeltplanen und ließ sie knattern, als befänden sie sich im Zentrum des Sturms und würden von allen Seiten gleichzeitig angegriffen.
»Welcher Wahnsinnige zieht auch im Winter in den Krieg?«, sagte Warwick. »Dieser Wein ist ein schreckliches Gesöff, aber alles andere ist leer getrunken. Aber wenigstens freue ich mich, dass ich mit euch zusammen sein kann und mich nicht zu verstellen brauche. Ich vermisse den Alten schrecklich …«
Er wollte weitersprechen, aber eine Welle des Schmerzes schnürte ihm die Kehle zu, und seine Stimme versagte. Sein Atem kam stoßweise, bis er keine Luft mehr hatte und seine Augen blind vor Tränen waren. Mit großer Anstrengung holte Warwick schließlich Luft, dann noch einmal, bis er endlich weitersprechen konnte. Seine Brüder hatten kein Wort gesagt.
»Mir fehlt sein Rat und seine Liebe«, fuhr Warwick fort. »Ich vermisse seinen Stolz und sogar seine tadelnden Worte. Wie gern würde ich mich jetzt von ihm tadeln lassen.« Die beiden anderen lachten leise, denn sie empfanden ebenso. »Jetzt ist es so, wie es ist, und alles ist gesagt. Wie gern würde ich manches Wort zurücknehmen oder ihm davon berichten, was ich in seinem Namen unterdessen getan habe …«
»Gott hört deine Gebete, Richard«, sagte sein Bruder George. »Alles Weitere ist ein heiliges Geheimnis. Du würdest dich der Sünde des Stolzes schuldig machen, wenn du denkst, du könntest seine Pläne durchschauen. Wir wissen nicht, was der Herr mit uns vorhat. Sein Wege sind unergründlich, Bruder. Und du sollst nicht um die trauern, für die es jetzt nur noch Freude gibt.«
Warwick umfasste liebevoll den Nacken des Bruders. Zu seiner Überraschung hatten die Worte ihn ein wenig getröstet, und er war stolz auf seinen jüngeren Bruder.
»Gibt es Neuigkeiten von York?«, fuhr George Neville mit ruhiger Stimme fort.
Von den drei Söhnen Nevilles schien der Bischof über den Tod des Vaters am wenigsten verstört, bei ihm gab es keinerlei Anzeichen von jenem Zorn, der John von innen aufzufressen drohte, von den Rachegefühlen, mit denen Warwick jeden Morgen erwachte. Ganz gleich, was kommen mochte, es galt noch eine Schuld zu begleichen für alle Kränkungen, die sie erlitten hatten.
»Edward schreibt nichts«, sagte Warwick sichtlich enttäuscht. »Ich wüsste nicht einmal, dass er die Tudors besiegt hat, wenn ihre zerlumpten Flüchtlinge nicht von meinen Leuten festgenommen und befragt worden wären. Das Letzte, was ich hörte, war, dass Edward von York auf einem Haufen toter walisischer Bogenschützen gethront und den Schmerz über den Tod von Vater und Bruder mit Wein ertränkt haben soll. Er hat auf meine Nachricht, wie sehr er hier gebraucht wird, nicht reagiert. Natürlich ist er erst achtzehn, aber in seinem Alter …«
Warwick seufzte. »Manchmal denke ich, dass seine Körpergröße darüber hinwegtäuscht, was für ein Junge er doch noch ist. Ich verstehe nicht, wie er sich in Wales herumtreiben und Trübsal blasen kann, während Königin Margaret uns immer näher kommt! Er ist nur mit sich selbst beschäftigt, mit seinem edlen Schmerz und Zorn. Ich habe das Gefühl, dass wir ihm ganz gleichgültig sind, samt unserem Vater. Aber bitte – das sage ich nur zu euch, und sonst zu niemandem …«
John Neville war mit dem Tod seines Vaters Baron Montagu geworden. Diese Würde zeigte sich in dem kostbaren neuen Mantel, der warm gefütterten Hose und den teuren Stiefeln, angefertigt auf Kredit von Schneidern und Schustern, die einem Lord Summen stundeten, die sie einem einfachen Ritter nie gewährt hätten. Doch trotz seiner warmen Kleider blickte Montagu auf die geblähten Zeltwände und fröstelte. Es war schwer vorstellbar, dass ein Spion sie bei dem brüllenden Wind belauschen könnte, aber es kostete nichts, vorsichtig zu sein.
»Wenn dieser Sturm noch schlimmer wird, wird das Zelt abheben und wie ein Falke davonfliegen«, sagte Montagu. »Bruder, wir brauchen diesen Sohn von York, auch wenn er noch so grün hinter den Ohren ist. Ich war heute früh bei König Henry, als er unter einer Eiche fromme Lieder sang. Wusstest du, dass ihm ein Schmied einen Strick ums Bein gelegt hat?« Warwick schreckte aus seinen Gedanken auf und blickte ihn an. »Es ist keine Fessel, Bruder. Nur ein geknotetes Seil, um unser königliches Unschuldslamm am Davonlaufen zu hindern. Du sprichst davon, dass Edward noch ein Junge ist, aber wenigstens ist er ein gut geratener, kräftiger Junge, der einen Willen hat und zuschlagen kann! Dagegen ist dieser Henry nichts als ein greinendes Kind. Ihm könnte ich mich niemals unterordnen.«
»Still, John«, sagte Warwick. »Henry ist der gesalbte König, ob er nun blind, taub, verkrüppelt oder … einfältig ist. An ihm ist nichts Böses. Er ist wie Adam vor dem Sündenfall, nein – wie Abel, ehe Kain ihn aus Neid umbrachte. Und es bringt Schande über uns alle, wenn wir ihn festbinden. Ich werde dafür sorgen, dass man den Strick löst.«
Warwick trat an die Verschnürung des Zeltes und zog an den Bändern, bis eine Bahn sich öffnete und den Wind hereinließ. Die Papiere, die in einer Ecke unter Bleibeschwerern gelegen hatten, wurden aufgewirbelt und flogen durch die Luft.
Der Eingang zum Zelt stand offen, und als die Brüder hinausblickten, bot sich ihnen ein Anblick, als hätte sich ihnen das Tor zur Hölle aufgetan. Südlich von ihnen lag St. Albans. Vor der Stadt, beleuchtet von Fackelschein, waren zehntausend Männer, geteilt in drei große bewaffnete Bataillone, damit beschäftigt, Befestigungen und Verteidigungslinien zu errichten. Überall flackerten Feuer, jede Schmiede war erleuchtet, doch sie gaben ebenso wenig Licht wie die Sterne am Himmel. Der Regen fiel erbarmungslos auf die arbeitenden Menschen, er fegte in böigen Sturzbächen über sie hinweg, als wollte er ihr Elend noch vergrößern. Man hörte die Rufe der Menschen, die Balken und andere Lasten trugen und brüllende Ochsen vor den Karren antrieben.
Warwick merkte, dass seine Brüder an seine Seite getreten waren und ebenfalls hinausstarrten. Das Herz des Lagers bestand aus etwa zweihundert Rundzelten, die alle nach Norden gerichtet waren, von wo man Königin Margaret mit ihrer Armee erwartete.
Warwick war gerade aus Kent zurückgekommen, als er vom Tod seines Vaters bei Sandal erfuhr. Seit diesem schweren Tag hatte er anderthalb Monate gehabt, um sich auf die Armee der Königin vorzubereiten. Sie wollte ihren Mann zurück, das wusste Warwick sehr gut. Denn auch wenn Henry körperlich schwach und sein Blick leer war – er war immer noch der König. Es gab nur eine Krone und einen Mann, der regierte, selbst wenn er sich dessen nicht bewusst war.
»Bei jedem Sonnenaufgang sehe ich neue Reihen von spitzen Pfählen und Gräben und …«
Bischof George Neville machte eine müde Handbewegung, ihm fehlten die Begriffe für die Werkzeuge und Todesmaschinen, die sein Bruder um sich versammelt hatte. Die Reihen der Kanonen waren nur ein Teil davon. Warwick hatte die Arsenale Londons durchsucht und jede grauenvolle Erfindung mitgenommen, die sich jemals in einem Krieg bewährt hatte – bis zurück zu den sieben angelsächsischen Königreichen und den römischen Invasoren. Ihre Blicke schweiften über mit Stacheln gespickte Netze, Krähenfüße, Fallgruben und Belagerungstürme. Es war ein Feld des Todes, bereit für den anrückenden Feind.
2
Margaret stand vor dem Eingang ihres Zeltes und sah zu, wie sich ihr Sohn mit einem einheimischen Jungen einen Kampf lieferte. Niemand wusste, woher der Bengel mit den dunklen Augen gekommen war, aber er hatte sich Edward angeschlossen, und jetzt wälzten sie sich mit ihren Stöcken, die sie wie Schwerter aufeinanderkrachen ließen, keuchend am feuchten Boden. Das kämpfende Paar rollte gegen einen Ständer mit Waffen und Schilden, an dem die farbenfrohen Banner von einem Dutzend Lords im Wind flatterten.
Margaret sah Derry Brewer durchs hohe Gras näher kommen. Sie hatten das heutige Lager auf einer Wiese aufgeschlagen, in der Nähe eines Flusses und mit Blick auf eine Hügelkette in der Ferne. Fünfzehntausend Mann, es war eine ganze Stadt, mit all den Pferden, Wagen und der Ausrüstung, die eine gewaltige Fläche einnahmen. Wäre jetzt Spätsommer gewesen, hätten sie Obst- und Gemüsegärten geplündert, aber Anfang Februar gab es wenig zu stehlen. Die Felder lagen brach, nirgendwo regte sich Leben. Die Männer sahen langsam wie Bettler aus, ihre Kleider hingen in Fetzen am Leib, und sie magerten immer mehr ab. Niemand kämpfte im Winter, außer es ging darum, dass man einen König zu retten hatte.
Derry Brewer hatte das Zelt der Königin erreicht und verbeugte sich. Margaret hob die Hand, er solle warten, also drehte er sich um und sah, wie der junge Prinz von Wales gerade seinen Gegner besiegte, indem er den schwächeren Jungen zu Boden warf. Der andere kreischte, es klang, als erwürge man eine Katze.
Weder Derry noch die Königin sagten etwas, und Prinz Edward rammte seine Waffe, der Verteidigung des Jungen geschickt ausweichend, fest gegen dessen Brust. Der Junge rollte sich zusammen und gab auf, während der Prinz seinen Stock wie eine Lanze erhob, die Hand an den Mund hielt und ein Triumphgeheul ausstieß. Derry grinste, amüsiert, aber auch überrascht. Der königliche Vater des Jungen hatte sein Leben lang nicht das geringste Interesse an kriegerischer Betätigung gehabt, und dennoch zeigte sein Sohn hier eine Begeisterung, die man nur empfindet, wenn man einen Gegner bezwungen hat. Derry erinnerte sich gut an dieses Gefühl. Edward streckte die Hand aus, um dem anderen Jungen auf die Füße zu helfen, als Derry sich einmischte.
»Prinz Edward, vielleicht solltet Ihr ihn allein aufstehen lassen.« Derry hatte an die Boxringe in London gedacht und gesprochen, ohne nachzudenken.
»Master Brewer?«, sagte Margaret, deren Augen vor Stolz leuchteten.
»Ach, Mylady, Männer sehen das anders. Manche nennen es ehrenhaft, wenn man denen Gnade zeigt, die man besiegt hat. Ich selbst halte es nur für eine andere Art von Stolz.«
»Ich verstehe. Aber manche Männer wären dafür, dass mein Sohn diesem Jungen wieder auf die Beine hilft? Du bleib, wo du bist.«
Letzteres hatte sie mit ausgestrecktem Finger an den Straßenjungen gerichtet, der gerade aufstehen wollte, hochrot im Gesicht, weil er von einer so edlen Dame angesprochen wurde. Verwirrt ließ er sich wieder zu Boden fallen.
Derry sah sie lächelnd an.
»Ja, Mylady. Sie würden den Arm ihres Feindes umklammern, ihm alles vergeben und damit zeigen, wie großherzig sie sind. Der Vater Eures Gemahls pflegte das zu tun, Mylady. Und es ist richtig, seine Männer liebten ihn dafür. Es zeugt von Größe, die allerdings nur die wenigsten besitzen.«
»Und wie haltet Ihr es, Derry? Was würdet Ihr tun?«, fragte Margaret leise.
»Ach, ich bin kein großer Mann, Mylady. Ich würde ihm vielleicht etwas brechen oder ihn ein bisschen mit dem Messer kitzeln. Es gibt viele Möglichkeiten. Das bringt einen Mann nicht um, aber man kann ihm damit eine Weile das Leben schwer machen.« Er schmunzelte über seinen eigenen Scherz, doch das Lächeln erstarb ihm auf den Lippen, als er den kühlen Blick der Königin gewahrte. Er zuckte die Schultern. »Wenn ich gewonnen habe, Mylady, dann will ich nicht, dass mein Feind wieder auf die Beine kommt, womöglich noch wütender als vorher. Nach meiner Erfahrung ist es am besten, wenn man dafür sorgt, dass sie liegen bleiben.«
Margaret neigte den Kopf, erfreut über seine Ehrlichkeit.
»Ich glaube, das ist der Grund, warum ich Euch vertraue, Master Brewer. Ihr versteht zweifellos etwas von diesen Dingen. Ich werde gegen meine Feinde niemals verlieren, sondern meine Ehre verteidigen, wenn sie auf dem Spiel steht. Ich würde immer den Sieg wählen und den Preis dafür bezahlen.«
Derry schloss einen Moment die Augen und nickte langsam, als er verstand. Er hatte Margaret schon als junges Mädchen gekannt, aber Verschwörungen, Schlachten und Verhandlungen hatten eine raffinierte und rachedurstige Frau aus ihr gemacht.
»Ich nehme an, Ihr habt mit Lord Somerset gesprochen, Mylady.«
»Das habe ich, Derry! Ich habe ihm die Führung meiner Armee anvertraut – und damit keinen Dummkopf gewählt. Ja, ich weiß, er fragt mich nicht gern um Rat, aber er wird es tun, wenn Ihr ihn dazu zwingt. Der junge Somerset ist ein Heißsporn, glaube ich, mit starkem Arm und starkem Herzen. Seine Männer lieben ihn, wenn er herumbrüllt. Aber kann er bei diesem Vater ein Dummkopf sein? Nein. Er sagt, Eurer Meinung nach hätten wir erst einmal im Norden bleiben und Vorräte anschaffen sollen, statt sie uns unterwegs zu beschaffen, was Euch anscheinend ein Problem bereitet. Doch Mylord Somerset hat nur ein Ziel, nämlich seine Leute bei Kräften zu erhalten und so schnell wie möglich London zu erreichen. Und es ist nichts dagegen einzuwenden, dass ihm in erster Linie das Wohl meiner Armee am Herzen liegt, Derry.«
Derry ließ sich seine Überraschung nicht anmerken. Er hatte nicht damit gerechnet, dass der junge Somerset seinen Stolz überwinden und wegen dieser Sache den Rat der Königin einholen würde. Das wies auf eine gewisse Reife und vor allem auf eine Loyalität hin, die Derry Hoffnung gab.
»Mylady, Warwick ist im Süden am stärksten. Seine Anhänger sind überwiegend Leute aus Kent und Sussex, diesen gottverlassenen, rebellischen Grafschaften. Wir müssen sie niedermachen und entweder Euren Gemahl befreien oder …«
Er sah zu den beiden Jungen hin, deren Stöcke jetzt wieder aneinanderkrachten. Sollte König Henry nicht überleben, dann bestand das ganze Haus Lancaster nur noch aus diesem Siebenjährigen mit der Beule an der Stirn, ein Junge, der im Moment gerade versuchte, seinen Gegner zu erwürgen.
Dann fing er Margarets fragenden Blick auf.
»Einerlei, wie es ausgeht«, sagte Derry, »von dem Tag an wird der König England in Frieden regieren müssen, Mylady. Man braucht nur ein paar passende Geschichten zu verbreiten, und König Henry könnte … ein neuer Arthur sein, zurückgekehrt aus Avalon, oder ein neuer Richard Löwenherz. Er könnte der wiederhergestellte gesalbte König sein – oder aber ein weiterer König Johann Ohneland, Mylady, dem auf Schritt und Tritt zweifelhafte Gerüchte folgen. Wir haben eine Schneise der Verwüstung durch halb England gezogen. Auf Hunderten von Meilen nichts als Tod und Verwüstung, und alle, die uns dafür verfluchten, werden jetzt verhungern. Kinder wie dieser Junge dort werden sterben, weil unsere Leute ihnen die Tiere und das Saatgut geraubt haben. Wie sollen sie im Frühjahr säen?«
Er hatte beim Sprechen die Jungen beobachtet, die sich immer noch im Dreck wälzten. Er wollte die Königin nicht direkt anblicken. Doch er unterbrach seinen tadelnden Vortrag, als er den Druck ihrer Hand auf dem Arm spürte. Er sah sie an, in ihrem Gesicht lag Resignation, aber auch Entschlossenheit.
»Ich … kann die Leute nicht bezahlen, Derry. So ist die Lage, bis wir London erreichen, und vielleicht auch noch danach. Und sie werden ganz bestimmt noch einmal kämpfen müssen, ehe ich genug Geld habe, um sie auszuzahlen, und wer weiß, wie das ausgehen wird. Und solange sie nicht bezahlt sind, das wisst Ihr genau, erwarten sie, dass man ihnen Freiheiten lässt, wie Jagdhunden. Statt ihres Lohns erwarten sie, dass sie plündern dürfen.«
»Hat Somerset das gesagt?«, erwiderte Derry mit kalter Stimme. »Wenn er wirklich so ein großartiger Anführer ist, dann sollte er diese Hunde beim Genick packen …«
»Nein, Derry. Ihr seid mein Ratgeber, dem ich wie keinem anderen vertraue, das wisst Ihr. Doch diesmal verlangt Ihr zu viel. Ich trage im Moment Scheuklappen, Derry. Ich sehe nur ein Ziel, nämlich London, und sonst nichts.«
»Dann riecht Ihr also den Rauch nicht und hört nicht die Schreie der Frauen?«, fragte Derry.
Es war unvorsichtig, sie derartig herauszufordern, trotz ihres langjährigen Vertrauensverhältnisses. Er sah, dass sich auf ihren Wangen rote Flecken bildeten, die sich rasch bis zum Hals ausbreiteten, während sie ihm unverwandt in die Augen blickte, als stünden dort die Antworten auf alle ihre Fragen.
»Es ist ein harter Winter, Master Brewer, und er dauert immer noch an. Und wenn ich die Augen vor allem Elend verschließen muss, um meinen Mann und seinen Thron zurückzubekommen, dann werde ich blind und taub sein. Und Ihr werdet stumm sein.«
Derry holte tief Luft.
»Mylady, ich werde alt. Manchmal denke ich, dass ich meine Arbeit einem Jüngeren überlassen sollte.«
»Derry, bitte. Ich wollte Euch nicht beleidigen.«
Der Meisterspion hob die Hand.
»Das habt Ihr nicht, und ich würde Euch auch nicht ohne mein Netz von Informanten zurücklassen, das ich über so viele Jahre geknüpft habe. Mylady, ich bin durch meine Dienste manchmal in großer Gefahr. Das sage ich nicht, um zu prahlen, sondern einfach, weil es so ist. Ich treffe mich mit rauen Gesellen, an finsteren Orten, und das jeden Tag. Falls ich einmal nicht zurückkomme, dann sollt Ihr wissen, dass ich für meinen Nachfolger gesorgt habe.«
Margaret sah ihn mit ihren großen, dunklen Augen an, erschreckt und fasziniert von seinen Worten. Er stand vor ihr wie ein verlegener Junge und verschränkte die Hände.
»Es könnte sein, dass Ihr selbst in Gefahr seid, Mylady, wenn ich gefasst würde. Dann wird jemand anders zu Euch kommen und Euch etwas sagen, woran Ihr ihn erkennen werdet.«
»Wie sieht er denn aus, dieser Mann?«, flüsterte Margaret.
»Das kann ich noch nicht sagen, Mylady. Es sind nämlich drei. Jung und voller Elan und Eurer Hoheit treu ergeben. Aber nur einer von ihnen wird die beiden anderen überleben und die Zügel in die Hand nehmen, wenn ich sie fallen lasse.«
»Sie sollen sich gegenseitig umbringen, damit einer mir beistehen kann?«, fragte Margaret ungläubig.
»Natürlich, Mylady. Nichts ist von Wert, wenn es nicht hart erkämpft wurde.«
»Also gut. Und woran werde ich erkennen, dass ich Eurem Mann vertrauen kann?«
Derry lächelte darüber, wie schnell sie begriffen hatte.
»Ein paar Worte, Mylady, die für mich von Bedeutung sind.«
Er schwieg, es war, als blicke er durch sie hindurch in die Vergangenheit – und in die Zukunft und seinen eigenen Tod. Nachdenklich schüttelte er den Kopf.
»Alice, die Frau von William de la Pole, lebt noch, Mylady. Ihr Großvater war vielleicht Englands erster Gelehrter, obwohl ich nie die Gelegenheit hatte, den alten Chaucer persönlich kennenzulernen. Sie gebrauchte einst, im Zusammenhang mit mir, ein Zitat von ihm. Als ich sie fragte, wie sie das gemeint hatte, sagte sie, es sei nur ein dummer Einfall gewesen, und ich solle mir nichts dabei denken. Aber es blieb mir im Gedächtnis. Sie sagte, ich sei ›der Lächler mit dem Messer im Gewand‹. Ich finde, das ist eine ziemlich genaue Beschreibung meiner Arbeit, Mylady.«
Margaret fröstelte und rieb sich die Arme.
»Euer Zitat macht mir eine Gänsehaut, Derry, aber es sei, wie Ihr gesagt habt. Wenn jemand zu mir kommt und diese Worte spricht, werde ich auf ihn hören.« Ihre Augen glänzten, und ihr Gesicht wurde hart. »Bei Eurer Ehre, Derry Brewer. Ihr habt Euch mein Vertrauen verdient, aber leicht schenke ich es nicht her.«
Derry neigte den Kopf, er dachte zurück an das junge Mädchen, das aus Frankreich über den Kanal gekommen war, um mit König Henry vermählt zu werden. Mit ihren dreißig Jahren war Margaret immer noch schlank und ihre Haut rein, das lange braune Haar war mit einem rotem Band zu einem dicken Zopf geflochten. Da sie nur eine Schwangerschaft hatte durchmachen müssen, war sie kein ausgemergeltes Arbeitspferd geworden, wie so viele Frauen ihres Alters. Sie hatte sich die biegsame Schlankheit ihrer Jugend bewahrt. Für jemanden, der so viele Verluste, so viel Schmerz erfahren hatte, hatte Margaret sich gut gehalten. Doch Derry hatte sechzehn Jahre an ihrer Seite verbracht und nahm die Veränderung wahr. Sie hatte eine gewisse Härte angenommen, und Derry wusste nicht, ob er das bedauern oder darüber froh sein sollte. Der Verlust der Unschuld wog schwer, besonders für eine Frau. Doch danach trugen sie immer einen kostbareren Stoff, trotz der Blutflecken. Derry wusste, dass Frauen jeden Monat diese Dinge vor der Welt verbargen. Vielleicht war das der Schlüssel zu ihrem Wesen. Sie mussten Blut verbergen – und sie verstanden sich darauf.
3
Der gewürzte Wein wärmte Derry Brewer innerlich und linderte seine Schmerzen. Der Ritter, der ihm gegenübersaß, nickte bedeutsam und lehnte sich auf seinem Schemel leicht zurück, er war sich der Wichtigkeit seiner Nachricht voll bewusst. Sie saßen in der Ecke einer lärmigen Schenke, in der sich die Soldaten drängten. Es gab nur noch saures Bier, und selbst beim Bier war man am Bodensatz angekommen, aber noch immer warteten draußen Männer und reckten voller Hoffnung die Hälse.
Derry hatte das öffentliche Wirtshaus für sein Treffen gewählt, weil er wusste, dass die braven Besitzer keine Ahnung von seiner Tätigkeit hatten. Ihnen kam es wahrscheinlich gar nicht in den Sinn, dass ein Angehöriger einer Armee zur feindlichen Gegenseite reiten könnte, um dort lebenswichtige Einzelheiten zu verraten. Derry lehnte sich an die Täfelung aus Eichenholz und betrachtete Sir Arthur Lovelace, der mit Sicherheit sein stolzester Informant war. Der prüfende Blick veranlasste den kleinen Mann, sich den prächtigen Schnurrbart glatt zu streichen, der ihm über die Lippen hing und vermutlich dazu beitrug, dass er mit jedem Bissen eine gehörige Portion Haare in den Mund bekam. Sie hatten sich nach der Schlacht bei Sandal kennengelernt, wo Lovelace einer von den etwa hundert enttäuschten Rittern und Hauptleuten war, die Derry auf die Seite genommen hatte. Denen, die kein Geld mehr hatten, hatte er ein paar Münzen gegeben, dazu ein paar gute Ratschläge für alle, die bereit waren, ihm zuzuhören. Dabei hatte es geholfen, dass der Meisterspion in König Henrys Diensten stand, denn so konnte niemand Brewers Loyalität infrage stellen – genauso wenig wie die Ernsthaftigkeit seines Anliegens, besonders nach diesem Sieg.
Das Ergebnis von Derrys Zuspruch war, dass nicht wenige der Männer bereit waren, sich in Sheffield der Armee der Königin anzuschließen, also eben den Truppen, gegen die sie zuvor gekämpft hatten. Es schien ein Irrsinn, aber die Männer wollten essen und brauchten Geld. Als sie schließlich merkten, dass man sie nicht bezahlte, wurde ihnen klar, dass es tatsächlich Irrsinn war. Und doch hatten dann Hunderte von Männern dieser Armee dabei geholfen, Städte auszuplündern, die loyal zu York gestanden hatten, nur um satt zu werden und ihre eigenen Beutel zu füllen.
Lovelace trug keine Farben, keinen Waffenrock oder Abzeichen, an denen man ihn hätte erkennen und verraten können, als er durchs Lager ging. Er hatte eine Parole bekommen und wusste, dass er nach Derry Brewer fragen sollte. Das hätte ausgereicht, um an den neugierigen Wachen vorbeizukommen, aber tatsächlich war er bis ins Innerste von Königin Margarets Armee vorgedrungen, ohne auch nur ein einziges Mal angehalten zu werden. An jedem anderen Tag wäre Derry Brewer darüber höchst ungehalten gewesen, und er hätte wieder einmal die Hauptleute zu sich rufen lassen, um ihnen klarzumachen, wie wichtig es war, zu verhindern, dass Spione und Attentäter hier unbemerkt Schaden anrichten konnten.
Lovelace beugte sich vor, die Stimme zu einem aufgeregten Flüstern gesenkt. Er schwitzte stark, und Derry konnte seinen Schweiß riechen. Der Ritter war galoppiert, um dem Meisterspion Bericht zu erstatten.
»Was ich Euch erzählt habe, ist von höchster Wichtigkeit, Master Brewer, versteht Ihr? Ich habe Euch Warwick ausgeliefert, fertig gerupft, geölt und verschnürt – bereit für den Drehspieß.«
»Der Seefahrer«, sagte Derry geistesabwesend, während er nachdachte. Warwick war jahrelang Captain von Calais gewesen, und man sagte, dass er das Meer und die Schiffe über alles liebe. Lovelace hatte versprochen, keine Namen zu nennen, aber natürlich vergaß er es immer wieder. In solchen Momenten verhielt Derry sich vorsichtshalber, als stünde sein ärgster Feind direkt hinter ihm, um alles weiterzutragen, was er gehört hatte.
Die Stimmung im Wirtshaus wurde gereizt, als die Getränke jetzt zur Neige gingen. In dem Gedränge und Gezerre strauchelte plötzlich ein rothaariger Fremder und stürzte quer über den kleinen Tisch, an dem Derry und Lovelace saßen, konnte sich aber mit ausgestreckten Armen gerade noch aufrecht halten. Er lachte schallend. Gerade wollte er sich umdrehen und bei dem Mann beschweren, der ihn gestoßen hatte, als er die kalte Klinge spürte, die Derry ihm an den Hals hielt und ihn damit zum Schweigen brachte.
»Sieh dich vor, Junge«, zischte Derry ihm ins Ohr. »Und jetzt verschwinde.«
Er gab dem Soldaten einen Stoß und sah lange hinter ihm her, wie er mit erschrocken aufgerissenen Augen in der Menge verschwand. Also war es nur ein Zufall. Wenn auch keiner dieser »Zufälle«, die tragisch zu enden pflegen. Und es ist natürlich schrecklich traurig, wenn man in eine Klinge fällt, oder wenn die Brewers dieser Welt in die kalte Grube fahren, aber das Leben muss schließlich weitergehen, und man wird gern und voller Liebe an ihn denken …
»Brewer?«, sagte Lovelace und schnippte mit den Fingern. Gereizt sah Derry ihn an.
»Was ist? Ihr habt Eure Nachricht übermittelt, und wenn sie wahr ist, dann ist sie mir sehr nützlich.«
Lovelace beugte sich noch weiter vor, und Derry konnte riechen, dass er Zwiebeln gegessen hatte.
»Ich habe den ›Seefahrer‹ nicht umsonst verraten, Master Brewer. Als wir uns in dem Wirtshaus in Sheffield trafen, wart Ihr sehr großzügig mit Silbermünzen und Versprechungen.« Lovelace holte tief Luft, als er voll Hoffnung und mit zitternder Stimme weitersprach. »Ich erinnere mich, dass Ihr von der Grafschaft Kent spracht, die noch immer vakant ist und wo ein loyaler Verwalter fehlt, um Steuern und den Zehnten für den König einzutreiben. Ihr sagtet damals, es sei sogar eine Belohnung dieser Art denkbar für jemanden, der Warwick ausliefere.«
»Aha«, erwiderte Derry. Um den anderen etwas zu ärgern, tat er so, als hätte er nicht richtig verstanden, vor allem auch deshalb, weil der Mann in seiner Gedankenlosigkeit schon wieder Warwicks Namen laut genannt hatte.
»Und genau das habe ich doch getan!«, sagte Lovelace und wurde rot. »Sind Eure Versprechungen denn nichts weiter als leere Worte?«
»Ich hatte Euch gesagt, Ihr solltet ohne Banner, ohne Waffenrock und ohne Schild in dieses Lager kommen, damit sich niemand an Euch erinnert. Ihr seid an zehntausend Menschen vorbeigegangen, als Ihr zu diesem Wirtshaus kamt. Hat einer von denen Euch festgehalten und gefragt, wer Ihr seid?«
Lovelace schüttelte den Kopf, verunsichert von dieser strengen Frage.
Derry fuhr ungerührt fort. »Und, mein guter Herr Ritter, habt Ihr jemals daran gedacht, dass ich, wenn Ihr so leicht zu mir kommen könnt, vielleicht auch ein paar Leute in Eurem Feldlager habe? Dass es dort im Süden ein paar Kerle gibt, die sich vielleicht als Wasserträger betätigen oder Rüstungen polieren – und nichts weiter tun als beobachten, zählen und sich an alles erinnern? Wie denn? Dachtet Ihr etwa, ich bin blind ohne Eure Hilfe?«
Derry sah, wie dem Ritter die Hoffnung schwand und er auf seinem Schemel zusammensackte. Zu einem Earl gemacht zu werden, zu einem Vertrauten des Königs, nun ja, das war für einen gemeinen Soldaten natürlich ein gänzlich unerfüllbarer Wunschtraum. Doch in Kriegszeiten passierten noch ganz andere Dinge. Derry stellte sich vor, dass Lovelace irgendwo Frau und Kinder hatte, deren Schicksal von seinem Einkommen, seinem Verstand und dem bisschen Glück abhing, das er vielleicht haben mochte.
Armut war ein harter Lehrmeister. Derry betrachtete den enttäuschten Ritter etwas genauer und bemerkte, wie abgetragen sein Rock war. Er fragte sich, ob dieser beeindruckende lange Bart nicht vielleicht nur damit zusammenhing, dass er kein Geld für einen Barbier hatte. Derry seufzte leise. Wäre er jung gewesen, dann wäre er jetzt aufgestanden, hätte Lovelace auf die Schulter geklopft und wäre gegangen.
Doch Derry stellte grimmig fest, dass das Alter ihn verweichlicht hatte, und so empfand er auch jetzt so etwas wie Mitleid mit seinem Informanten. Vielleicht war es wirklich Zeit, sich zur Ruhe zu setzen. Seine drei jungen Männer waren bereit, es unter sich auszufechten, wenn er eines Abends nicht mehr nach Hause kommen sollte. Theoretisch wusste keiner von ihnen die Namen der anderen, aber er würde sein letztes Silberstück darauf setzen, dass alle drei es längst herausgefunden hatten. Die beste Art, sich vor einem Angriff zu schützen, ist, den anderen, der die Klinge in der Hand hat, umzubringen. Männer in Derrys Berufszweig wussten, dass es am besten war, ihn umzubringen, noch ehe er überhaupt wusste, dass er einen Feind hatte.
Sein Gesicht verriet nichts von diesen Gedanken, als er Lovelace ansah, der immer noch zu begreifen versuchte, dass er Warwick gerade um den Preis für ein Glas Bier verkauft hatte. Der Meisterspion wagte es nicht, angesichts der vielen Soldaten im Wirtshaus eine Gold- oder Silbermünze auf den Tisch zu legen. Daher ergriff er die Hand von Lovelace und drückte sie, wobei er einen Goldnobel hineingleiten ließ. Er sah, wie der arme Ritter einerseits peinlich berührt, andererseits erleichtert die Augen zusammenkniff, als er die Hand öffnete. Die Münze war klein, aber sie würde für ein Dutzend Mahlzeiten reichen, oder vielleicht für einen neuen Mantel.
»Geht mit Gott, mein Freund«, sagte Derry und stand auf. »Vertraut auf den König, damit könnt Ihr nichts falsch machen.«
Die schmale Neumondsichel war hinter einer Wolke verborgen, doch Edward von York konnte seine Hände im schwachen Licht der Sterne sehen. Er drehte die Linke vor dem Gesicht hin und her und bewegte die Finger, es sah aus wie ein flatternder Vogel. York saß auf einem Felsen in Wales, nach dem Namen des Berges hatte er nicht gefragt. Seine Füße baumelten über der Tiefe, und wenn er einen Stein hinunterwarf, schien er ewig zu fallen, bevor er aufschlug. Unter ihm lag der Abgrund, doch die Dunkelheit war so undurchdringlich, dass sie ihm fast vorkam wie etwas Massives, auf das man treten konnte.
Er grinste trunken bei diesem Gedanken, versuchsweise streckte er den Fuß aus, als suche er im Dunkeln nach einer Brücke über das Tal. Er spürte, wie sich sein Gewicht über den Rand des Abgrunds verlagerte, und ein Gefühl von Panik überkam ihn. Er stieß sich krampfhaft ab, kroch zurück. Aber die Panik verschwand ebenso schnell, wie sie gekommen war. Er wusste, er würde nicht fallen. Zwar hatte er so viel getrunken, dass es einen schmächtigeren Mann umgebracht hätte, aber Gott würde ihn davor bewahren, hier in Wales von diesem Felsen zu stürzen. Nein, hier würde er nicht sterben, dazu hatte er noch zu viel zu tun. Edward nickte. Sein Kopf war so schwer, dass er lange nickte, ehe er wieder aufhören konnte.
Er hörte die Schritte und das Gemurmel zweier seiner Männer, die sich nicht weit von ihm unterhielten. Langsam hob Edward den Kopf, er merkte, dass sie ihn in der Dunkelheit, dort, wo er saß, nicht sehen konnten. Mit seinen weißen Gliedmaßen dachte er, er müsse einem Gespenst ähneln. Wäre er in einer anderen Verfassung gewesen, wäre er mit lautem Geheul aufgesprungen, nur um sie zu erschrecken, aber seine Stimmung war zu düster. Die Nacht um ihn wurde schwarz, sobald sie seine Arme berührte. Zweifellos schien seine Haut deshalb so weiß – weil sie die Dunkelheit anzog und ihn damit anfüllte, bis er aus allen Nähten platzte. Es war eine herrliche Vorstellung, und er saß da und dachte darüber nach, während die Männer hinter ihm redeten.
»Mir gefällt es hier nicht, Bron. Ich mag weder die Berge, noch den Regen noch die verdammten Waliser. So unfreundlich, wie sie aus ihren Hütten immer hinter einem hersehen. Und es sind elende Diebe, die alles mitnehmen, was nicht niet- und nagelfest ist. Der alte Ohnenase vermisst seit zwei Tagen seinen Sattel, und der ist bestimmt nicht von allein weggelaufen. Dies ist kein Ort für uns – und trotzdem sind wir immer noch hier.«
»Na ja, wenn du ein Duke wärst, Kumpel, dann könntest du uns vielleicht nach England zurückbringen. Bis dahin müssen wir halt warten, bis Master York sich dazu entschließt. Ich bin ganz zufrieden damit. Ich sitze lieber hier, als dass ich in England marschieren oder kämpfen muss. Soll der große Junge erst einmal seinen Kummer um Vater und Bruder ertränken. Der alte Duke war ein tüchtiger Mann. Wenn er mein Vater gewesen wäre, würde ich mich jetzt auch besaufen. Entweder er beruhigt sich irgendwann wieder, oder es bricht ihm das Herz. Aber es hat keinen Zweck, sich Gedanken darüber zu machen, was von beidem passieren wird.«
Edward von York schielte nach den beiden. Einer saß gegen einen Fels gelehnt, ein bloßer, schwarzer Schatten. Der andere stand daneben und blickte auf zu den vielen Sternen am Nachthimmel. York gefiel es nicht, dass einfachen Ritter und Soldaten seinen persönlichen Schmerz beschwatzten, als ginge es ums Wetter oder den Brotpreis. Er schickte sich an, aufzustehen und wäre beinahe doch noch über die Felskante gestürzt, doch schließlich stand er schwankend auf den Beinen. Mit seinen sechs Fuß und vier Zoll war York ein Riese, bei Weitem der größte Mann im ganzen Heer, und die beiden Männer erstarrten, als sie die stumme Gestalt sahen, die plötzlich in der Dunkelheit vor ihnen auftauchte, umgeben von Sternen.
»Wer seid ihr, dass ihr es wagt, mir zu sagen, was ich tun und lassen soll? Hä?«, fragte Edward mit schwerer Zunge.
Die Männer wichen erschrocken zurück, sie machten kehrt und verschwanden dann über den Kamm des Hügels und rutschten den Abhang auf der anderen Seite wieder hinunter. Edward brüllte unzusammenhängendes Zeug, stolperte ein paar Schritte hinter ihnen her, stieß gegen einen Felsbrocken und fiel hin. Er erbrach sich, ein Gemisch aus Wein, Schnaps und Magensäure, so scharf, dass es auf seiner verletzten Haut brannte.
»Ich werde euch finden! Ich finde euch, ihr unverschämten Hurensöhne …«
Er rollte auf den Rücken. Er war zu müde, um wieder aufzustehen. Und er wusste nur zu gut, dass er sie nicht wiedererkennen würde. Dann schlief er ein.
York schnarchte laut, unter sich einen walisischen Berg, der ihn auf der Erde verankerte, während über ihm die Sterne kreisten.
Es regnete, als Margarets Lords sich versammelten. Der Regen prasselte auf die Zeltleinwand, und die Pfosten knarrten unter dem Gewicht des nassen Stoffes. Derry Brewer verschränkte die Arme und musterte die Gesichter der obersten Befehlshaber seiner Königin. Henry Percy hatte mehr Verwandte verloren als alle anderen Anwesenden. Der Earl von Northumberland trug das Zeichen seiner Familienzugehörigkeit im Gesicht, man erkannte ihn überall an der wuchtigen Percy-Nase. Der Preis, den die Familie der Percys hatte zahlen müssen, verlieh dem jungen Earl ein gewisses Gewicht unter den Männern. Nach Derrys Meinung hatte der Verlust von Vater und Bruder ihn reifer gemacht, er sprach selten, ohne vorher gründlich nachzudenken. Er trug seine Würde wie einen schweren Mantel um die Schultern. Earl Percy hätte sie leicht gegen Warwick anführen können, aber es war der weniger erfahrene Somerset, der das Kommando hatte. Derry blickte zur Königin, die würdevoll in der Ecke saß, gertenschlank und mit rosigen Wangen. Wenn es stimmte, dass sie sich in den Monaten der geistigen Umnachtung ihres Mannes mit Somerset getröstet hatte, so war sie bemerkenswert diskret dabei vorgegangen. Somerset war mit seinen fünfundzwanzig Jahren immer noch unverheiratet. Das allein war außergewöhnlich genug, um die Augenbrauen in die Höhe fahren zu lassen. Derry wusste, er müsste dem Duke den Rat geben, irgendeine willige junge Zuchtkuh zu heiraten und ein paar Bälger in die Welt zu setzen, ehe die Gerüchte aus dem Ruder liefen.
Ein halbes Dutzend kleinerer Barone waren dem Ruf der Königin gefolgt. Es bereitete Derry eine große Befriedigung, dass Lord Clifford unter ihnen auf den Bänken saß, wo sie hockten wie Schuljungen, die auf den Lehrer warteten. Clifford hatte in Wakefield Yorks Sohn getötet und dann den blutigen Dolch gehässig dem Vater unter die Nase gehalten. Es wäre schwer gewesen, den Mann danach noch sympathisch zu finden, selbst wenn er ein Ausbund an Tugend gewesen wäre. Doch Derry hielt Clifford für einen aufgeblasenen, schwachen Hohlkopf.