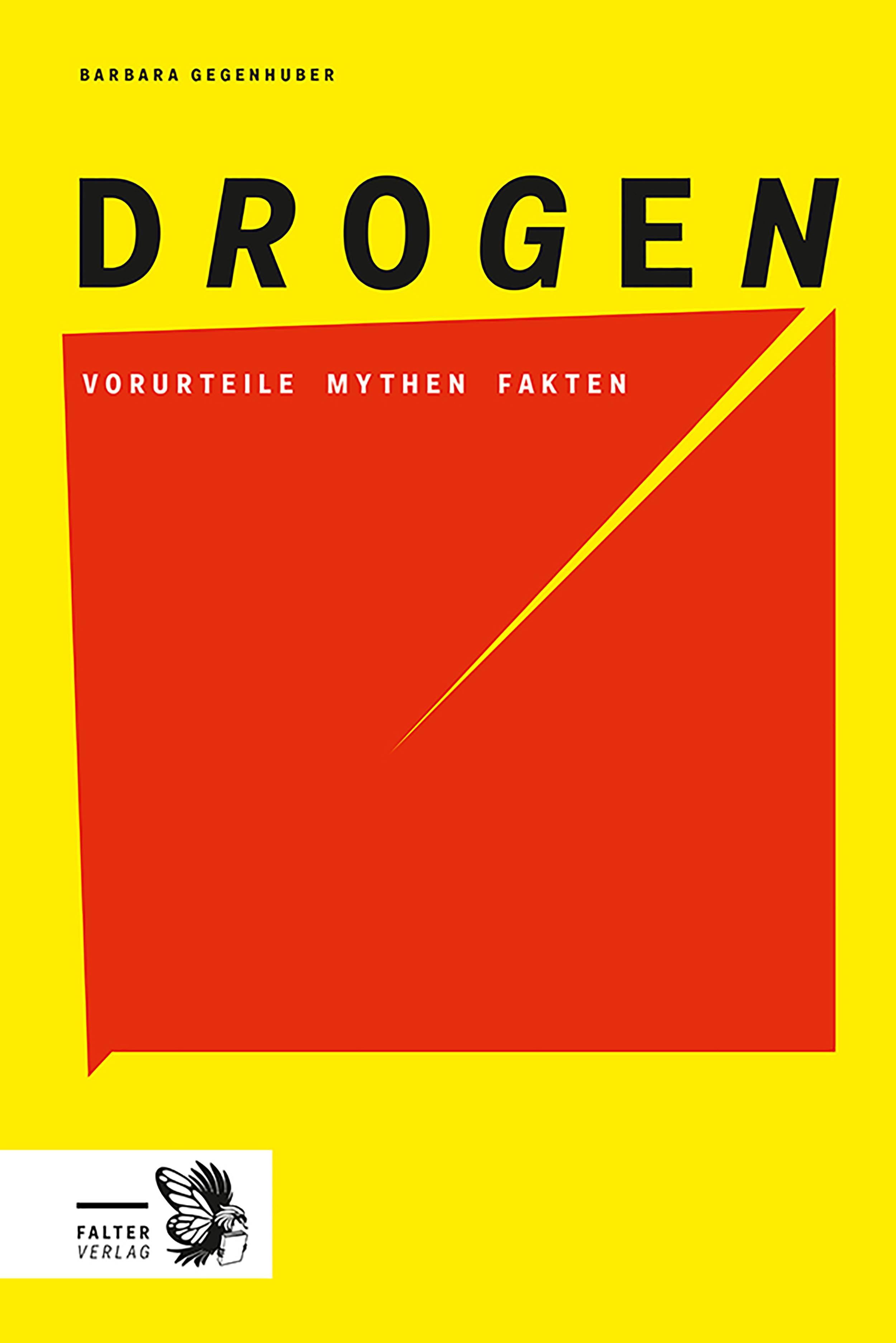
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Falter Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Ansichten und Behauptungen über Drogen und deren KonsumentInnen gibt es reichlich. Dieses Buch hinterfragt sie. Es bietet Betroffenen und deren Angehörigen, aber auch anderen an der Thematik interessierten Personen Informationen, die den Blick auf Abhängigkeit und davon Betroffene schärfen sollen, und stellt essenzielle Fragen: • Wieso werden manche Menschen abhängig und andere nicht? • Was sind die Folgen der Abhängigkeitserkrankung und wie kommt der oder die Abhängige wieder heraus? • Sind Frauen anders süchtig als Männer? • Wie gehe ich mit erkrankten Angehörigen um? • Welche Möglichkeiten gibt es, Kinder und Jugendliche präventiv vor einer Abhängigkeitserkrankung zu schützen? Die Ansicht, dass „der eine Tropfen Alkohol“ unweigerlich wieder in die Abhängigkeit führe oder Cannabis eine Einstiegsdroge sei, wird genauso kritisch hinterfragt wie der Glaube, dass strenge Verbote die Drogenprobleme einer Gesellschaft lösen können. Die Autorin stellt solche und weitere Vorurteile und Mythen auf der Grundlage wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse sowie praktischer Erfahrungen aus ihrer langjährigen Arbeit mit Abhängigkeitserkrankten infrage. Erfahrungen von Betroffenen runden das Bild ab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Ansichten und Behauptungen über Drogen und deren Konsument*innen gibt es reichlich. Dieses Buch hinterfragt sie. Es bietet Betroffenen und deren Angehörigen, aber auch anderen an der Thematik interessierten Personen Informationen, die den Blick auf Abhängigkeit und davon Betroffene schärfen sollen, und stellt essenzielle Fragen:
Wieso werden manche Menschen abhängig und andere nicht? Was sind die Folgen der Abhängigkeitserkrankung und wie kommt der oder die Abhängige wieder heraus? Sind Frauen anders süchtig als Männer? Wie gehe ich mit erkrankten Angehörigen um? Welche Möglichkeiten gibt es, Kinder und Jugendliche präventiv vor einer Abhängigkeitserkrankung zu schützen?
Die Ansicht, dass „der eine Tropfen Alkohol“ unweigerlich wieder in die Abhängigkeit führe oder Cannabis eine Einstiegsdroge sei, wird genauso kritisch hinterfragt wie der Glaube, dass strenge Verbote die Drogenprobleme einer Gesellschaft lösen können. Die Autorin stellt solche und weitere Vorurteile und Mythen auf der Grundlage wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse sowie praktischer Erfahrungen aus ihrer langjährigen Arbeit mit Abhängigkeitserkrankten infrage. Erfahrungen von Betroffenen runden das Bild ab.
BARBARA GEGENHUBER
DROGEN.
VORURTEILE, MYTHEN, FAKTEN.
FALTER VERLAG
© 2019 Falter Verlagsgesellschaft m.b.H.
1011 Wien, Marc-Aurel-Straße 9
T: +43/1/536 60-0, E: [email protected], W: www.falter.at
Alle Rechte vorbehalten. Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub: 978-3-85439-656-7
ISBN Kindle: 978-3-85439-649-9
ISBN Printausgabe: 978-3-85439-636-9
1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2020
INHALT
Cover
Titel
Impressum
VORWORT
DIE POLITIK UND DIE SUCHT
Von Prohibition bis Legalisierung – was wirkt?
Die rechtliche Situation in Österreich
WIE DROGEN WIRKEN
FREIZEITDROGENKONSUM
GEBRAUCH – MISSBRAUCH – ABHÄNGIGKEIT. NICHT NUR DIE DOSIS MACHT DAS GIFT
Gebrauch
Schädlicher Gebrauch
Abhängigkeit
ENTWICKLUNG DER ABHÄNGIGKEIT
Biopsychosoziales Modell
Risiko- und Schutzfaktoren
SIND FRAUEN ANDERS SÜCHTIG? – GENDER-SPEZIFISCHE ASPEKTE VON SUCHTERKRANKUNGEN
DIE FOLGEN DER ABHÄNGIGKEIT
Drogenabhängigkeit und Kriminalität
Soziale Folgewirkungen
Körperliche Folgewirkungen
Psychische Folgewirkungen
DIE WEGE AUS DER SUCHT SIND VERWORREN
Raus aus der Sucht – will ich das wirklich?
Abstinenz oder Akzeptanz – eine ideologische Debatte
Genesungsverläufe und der Umgang mit Rückfällen
RAUS AUS DER SUCHT – ABER WIE?
Opioid-Substitutionstherapie
Entzug
Entwöhnung und Rehabilitation
Kontrollierter Konsum
Selbstgesteuerte Ausstiegsverläufe
Recovery-Orientierung in der Suchthilfe
Selbsthilfe
SCHADENSMINIMIERUNG UND SAFER USE
MYTHOS CO-ABHÄNGIGKEIT
KINDER AUS SUCHTBELASTETEN FAMILIEN
PRÄVENTION BEI KINDERN UND JUGENDLICHEN
KLEINE SUBSTANZKUNDE
Alkohol
Opiate und Opioide – Heroin
Kokain und Crack
Cannabis
Amphetamin – Speed
Methamphetamin – Crystal Meth
MDMA – Ecstasy
LSD
Neue psychoaktive Substanzen
ANHANG
Literaturverzeichnis
Register
Endnoten
Die Autorin
VORWORT
In den USA der 1920er- und frühen 1930er-Jahre blüht der illegale Verkauf und Handel von Alkohol dank der von der Regierung verordneten Alkoholprohibition. Die organisierte Kriminalität mit berühmten Vertretern wie Al Capone oder Lucky Luciano beherrscht den Handel mit der Substanz, die der Staat verboten hat, die Bevölkerung sich aber nicht nehmen lassen will. Nach dem Eingeständnis des Scheiterns der Prohibition im Jahr 1933 gerät eine andere Substanz ins Visier der amerikanischen Behörden. Harry J. Anslinger trieb als Chef des Federal Bureau of Narcotics den Kampf gegen psychoaktive Substanzen voran, vor allem gegen Cannabis und Opiate. Anslinger war ein strenger Verfechter des Drogenkriegs und der festen Überzeugung, dass repressive Maßnahmen gegen den Drogenkonsum wirksam seien.
Nordamerika, Mexiko oder die Philippinen, aber auch viele anderen Staaten der Welt, vertreten viele Jahrzehnte später immer noch die Überzeugung, dass mit kontrollierenden und reglementierenden Maßnahmen dem Drogenproblem beizukommen sei, obwohl alle wissenschaftlichen Erkenntnisse gegen deren Wirksamkeit sprechen. Im Gegenteil, Nordamerika steht derzeit vor der bisher größten Opioid-Krise aller Zeiten, die Gefängnisse sind voll von Menschen, die in den „War on Drugs“ involviert sind, und eine Verbesserung ist nicht in Sicht. Obwohl die Drogenpolitik im westlichen Europa weit fortgeschrittener ist, ist auch hierzulande die Meinung, dass Prohibition, Kriminalisierung und Kontrolle das Drogenproblem lösen könnte, weit verbreitet. Doch Verbote und Ausschluss sind genau das, was Menschen mit einer Suchterkrankung nicht nur nicht hilft, sondern, wie im Fall von anderen marginalisierten Gruppen auch, sogar eher kontraproduktiv ist. Inklusivere Konzepte und Vorgehensweisen brauchen mehr spezifisches Know-how und aktuelles Wissen über die Erkrankung, um bestehenden Vorurteilen entgegenzutreten.
Der „War on Drugs“ ist nur ein Beispiel für die auf Vorurteilen und falsche Annahmen beruhenden Maßnahmen, die rund um das Thema Drogen getroffen werden. Im Zuge meiner langjährigen Arbeit mit Abhängigen war ich in meinem Umfeld immer wieder mit denselben Ängsten, Mythen und Vorurteilen über Suchtkranke konfrontiert. Dieselben Fragen, dieselben falschen Annahmen, dieselben Sorgen und Befürchtungen. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass mit zunehmendem Wissen über die Erkrankung das Verständnis für die Betroffenen steigt, die Auseinandersetzung mit der Thematik hilft Vorurteile abzubauen. Es gibt im Allgemeinen wenig Verständnis für Drogenkranke, zumindest so lange, bis sich jemand näher mit ihnen auseinandersetzt und versucht, die Dinge zu hinterfragen und zu verstehen. Die unter dieser Situation Leidenden sind zuallererst die Abhängigen selbst, die kaum eine Lobby haben und nur sehr selten ein Sprachrohr, um sich Gehör zu verschaffen. Gibt es in den Medien Schlagzeilen über Süchtige, sind diese meist negativ, weil es oft nur um Dealer in U-Bahn-Stationen und Beschaffungsdelikte geht. Selten gibt es Berichte über die Menschen dahinter, selten geht es darum, wer sie sind und wie es ihnen geht.
Dieses Buch soll einige weitverbreitete Annahmen über Drogen und deren Konsument*innen hinterfragen und zurechtrücken sowie Betroffenen und Angehörigen, aber auch anderen an der Thematik interessierten Personen, Informationen bereitstellen, die zu einem anderen Blick auf Sucht und Suchtkranke führen können. Es bietet einen Überblick zu einer breiten Auswahl von Themenbereichen, die mit dem Konsum psychoaktiver Substanzen in Verbindung stehen. Welche unterschiedlichen Formen des Konsums gibt es, wieso werden manche Menschen abhängig und andere nicht, welche Folgen hat die Abhängigkeitserkrankung und wie kommt der oder die Süchtige da wieder heraus? Mythen, wie der eine Tropfen Alkohol, der unweigerlich wieder in die Sucht führt, werden genauso hinterfragt wie die verbreitete Annahme, dass Cannabis eine Einstiegsdroge sei. Dazu werden wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse sowie praktische Erfahrungen aus meiner langjährigen Arbeit mit Suchtkranken innerhalb und außerhalb des Gefängnisses aufbereitet. Ergänzend runden Lebensgeschichten und Erfahrungen von Betroffenen selbst das Bild ab. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei ihnen allen für die Bereitschaft, ihre Erfahrungen mit den Leser*innen dieses Buches zu teilen, bedanken. Ohne sie und all die anderen drogenabhängigen Menschen, die ich in meinem Leben kennen lernen durfte, würde es dieses Buch nicht geben.
DIE POLITIK UND DIE SUCHT
Österreich hat bei der Herstellung und dem Konsum von Alkohol eine lange Tradition, er ist Teil unserer Kultur. Es ist noch gar nicht so lange her, dass es gang und gäbe war, auf Baustellen oder ähnlich herausfordernden Arbeitsplätzen Bier zu trinken, natürlich nur wegen des Flüssigkeitsverlustes und der Elektrolyte. Der Konsum von Alkohol auf den zahlreichen Zelt- und Dorffesten am Land, aber auch in Bars und Lokalen in den Großstädten ist für viele selbstverständlich. Die Weinbauern der steirischen Weinstraßen oder anderer Heurigengegenden sind genauso wenig aus der Landschaft wegzudenken wie die großen Brauereien, die als Sponsoren von Veranstaltungen auftreten oder Werbung in den Medien schalten. Alkohol wird in Österreich mit einer Selbstverständlichkeit konsumiert, wie das nicht in vielen Ländern dieser Welt der Fall ist.
Das heißt aber nicht, dass andere Kulturen nicht auch Substanzen zur Berauschung verwenden. So etwa findet man in den südamerikanischen Anden zahlreiche Coca-Bauern. Das Kauen von Blättern der Coca-Pflanze ist aufgrund ihrer anregenden Wirkung in den hochgelegenen Gegenden von Peru, Chile oder Bolivien weit verbreitet. In der Eisenbahn, die über das peruanische Hochland fährt, wird im Bordrestaurant Coca-Tee als Mittel gegen die Höhenkrankheit verkauft. Die Bevölkerung kaut die Blätter mit ihrer stimulierenden und aktivierenden Wirkung zu vielen Gelegenheiten. In Ländern ohne eine derartige Tradition ist die Coca-Pflanze weitgehend verboten, obwohl man kiloweise Blätter benötigen würde, um eine brauchbare Menge Kokain daraus herzustellen. In einer anderen Ecke der Welt ist der Konsum von Cannabis verbreitet, nicht nur weil die gesetzlichen Regelungen dies erleichtern, sondern auch weil damit ein gewisses Lebensgefühl transportiert wird. Man denke dabei nur an die Rastafarians in Jamaika, bei denen Reggae, Dreadlocks und Cannabiskonsum wohl die bekanntesten Aspekte der Rasta-Religion darstellen.
Es sind also bei weitem nicht die Gefährlichkeit oder das Abhängigkeitspotenzial alleine, die über den Konsum von psychoaktiven Substanzen in einem Land entscheiden, vielmehr sind es die Traditionen und damit verbunden natürlich auch die gesetzlichen Regelungen, die das Ausmaß dieses Konsums in einer Gesellschaft mitbestimmen. Relativ deutlich sieht man dies am sehr unterschiedlichen Umgang mit Cannabis, das in immer mehr Ländern der Welt legalisiert oder zumindest entkriminalisiert wird, während es in anderen noch streng verboten ist. Mit einer rein wissenschaftlich orientierten Einschätzung der Gefährlichkeit einer Substanz hat das nichts zu tun, sonst wären vermutlich Alkohol und Nikotin verboten und Cannabis erlaubt. Es muss demnach andere Gründe für die unterschiedlichen Herangehensweisen und gesetzlichen Regelungen geben.
Um einen Einblick in die Entstehung dieser Zugangsweisen zu bekommen, muss man etwas weiter zurückgehen und einen Blick in die amerikanische Geschichte des frühen 20. Jahrhunderts werfen. Bis zum Jahr 1920 galten in den USA Alkohol und Cannabis als legale Genussmittel, in den Saloons wurde Alkohol getrunken, Kühlgeräte wurden von Brauereien gesponsert. Damit einhergehend wuchs auch das Angebot an Glücksspielen und Prostitution. Diese zunehmende Freizügigkeit und Lustbarkeit gefiel nicht allen in den USA. Puritanische Bewegungen, die vorwiegend von der anglikanischen Oberschicht ausgingen, sahen ihren Einfluss und die christlichen Werte schwinden und setzten sich für ein Verbot des Alkohols ein. Kriminalität und Korruption, soziale Probleme und die große Zahl an Gefängnissen wurden dem „Teufel Alkohol“ angelastet. So kam es, dass immer mehr Bundesstaaten unter dem Druck verschiedener Abstinenzorganisationen, wie etwa der Anti-Saloon League, der Prohibition Party, der Woman’s Christian Temperance Union (Christlicher Frauenbund für Abstinenz) und vieler anderer mehr, lokale Alkoholverbote erließen. Es entstanden Landkarten mit „trockenen Zonen“. Im Jahr 1916 war die Prohibition in 23 Staaten der USA eingeführt. Mit 16. Jänner 1920 trat das sogenannte Volstead-Gesetz in Kraft, das die Erzeugung, den Verkauf sowie Transport alkoholischer Getränke auf amerikanischem Staatsgebiet untersagte. Der Beginn der Ära der Prohibition begann mit der Hoffnung auf eine Verbesserung der Gesundheit und der sozialen Situation der Bürgerinnen und Bürger.
Tatsächlich hatte die Prohibition auch positive Auswirkungen, der Alkoholkonsum ging anfangs zurück und auch die alkoholbezogenen Todesfälle – vorwiegend durch Leberzirrhosen – verringerten sich deutlich. Wer sich aber betrinken wollte, dem gelang das auch damals. Alkohol war zwar nicht mehr auf legalem Weg zu kaufen, dafür blühten Schwarzmarkt, Schmuggel und Schwarzbrennerei. Obwohl Alkohol verboten war, konnte man immer irgendwo welchen erstehen. Es etablierten sich sogenannte „Speakeasys“, illegale Bars, in denen man nach dem „Flüstern“ eines Codewortes Alkohol beziehen konnte. Schwarzbrenner destillierten illegal Whisky, der aufgrund seiner heimlichen Herstellung bei Nacht auch „Moonshine“ genannt wurde.
Doch nicht alle Schwarzbrenner arbeiteten sauber und gewissenhaft, gepanschter Alkohol verursachte Vergiftungen, die zu Hirnschäden und Erblindungen bis hin zum Tod führten. Auch gingen die Konsument*innen dazu über, eher hochprozentige Spirituosen statt Wein oder Bier zu trinken, da diese leichter zu schmuggeln waren. Wer Alkohol trinken wollte, bekam diesen, jedoch war der Konsum in Hinblick auf die gesundheitlichen Folgeschäden und die Kriminalisierung deutlich riskanter. Die Zahl der Verbrechen und damit auch der Inhaftierten stieg massiv an, die Korruption blühte.
Eine weitere wesentliche negative Folge der Prohibition war die Förderung mafiöser Strukturen und organisierter Kriminalität. Kriminelle wie Al Capone oder Johnny Torrio gründeten Vereinigungen, die nicht zuletzt durch den Verkauf von Alkohol und die Kontrolle des Alkoholmarktes vorher nie dagewesene Größe und Einfluss erlangten. Der illegale Handel mit Alkohol war ein großes Geschäft, mafiöse Strukturen blieben weit über das Ende der Prohibition bestehen. Lediglich die Art der gehandelten Waren änderte sich im Lauf der Zeit, weg von Alkohol hin zu Drogen und Waffen.
Aufgrund dieser negativen Folgewirkungen musste man schließlich zur Kenntnis nehmen, dass das schlichte Verbot einer Substanz nicht den gewünschten Erfolg bringt, sondern, im Gegenteil, weit massivere Probleme schafft. Dazu kam, dass die Besteuerung von Alkohol auch eine attraktive Einnahmequelle für das von der Wirtschaftskrise gebeutelte Land darstellte. So wurde am 5. Dezember 1933 das Experiment Prohibition wieder aufgegeben.
Damit war der Kampf gegen den Substanzkonsum jedoch nicht beendet. Es gab nach dem Ende der Prohibition viele Arbeitskräfte, die mit der Kontrolle und Exekution des Volstead-Gesetzes beschäftigt gewesen waren und nun keine Aufgabe mehr hatten. In diesem Zusammenhang spielte Harry J. Anslinger, der damalige Leiter des Federal Bureau of Narcotics, eine wesentliche Rolle. Er war ein entschiedener Gegner von Drogen, jedoch weniger aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse als aufgrund persönlicher Erfahrungen sowie rassistisch geprägter Vorurteile. Er vertrat die Meinung, dass Marihuana die Menschen zu wilden Bestien macht, die Frauen vergewaltigen und töten, und bezog sich dabei auf einen damals großes Aufsehen erregenden Mordfall, ein Einzelereignis, das medial hochstilisiert wurde. Der Zeitungsmagnat William Randolph Hearst sowie ein Chemiekonzern unterstützten Anslingers Kampagne, auf eine wissenschaftliche Überprüfung seiner Thesen wurde kein Wert gelegt. Im Gegenteil, Anslinger führte seinen erbitterten Kampf gegen Marihuana mit autoritären und polemischen Mitteln und verknüpfte diesen mit einer rassistischen Kampagne gegen Schwarze und andere Einwanderer, was in Teilen der Bevölkerung auf regen Zuspruch stieß. Im Jahr 1947 wurde Anslinger in die UN-Drogenkommission berufen, wo er im Jahr 1961 die „Single Convention on Narcotic Drugs1“ durchsetzte, in der Cannabis mit anderen Drogen, wie etwa Heroin, gleichgesetzt wurde. Dieses Einheitsabkommen über Betäubungsmittel unterzeichneten insgesamt 183 Staaten, es ist die bis heute gültige Grundlage gesetzlicher Bestimmungen in zahlreichen Ländern.
Während die USA und andere Staaten nach wie vor einen Drogenkrieg führen, entwickelten sich in Westeuropa gänzlich andere Konzepte. Eine wesentliche Rolle spielten dabei Länder wie die Schweiz, die bis heute einen eher liberalen und unterstützenden Umgang mit Konsument*innen illegalisierter Substanzen pflegt, was allerdings auch mehr der Not als der Tugend geschuldet ist. Ende der 1970er-Jahre etablierte sich in einem Park namens „Platzspitz“ und an anderen Orten in Zürich eine offene Drogenszene, die von der Polizei toleriert wurde und sich bald als Anziehungspunkt für Drogenabhängige aus der gesamten Schweiz entwickelte. Die Konsument*innen lebten in dem Park und gingen dort offen ihrem Konsum, dem Drogenhandel, der Prostitution und anderen sonst gesellschaftlich unerwünschten Verhaltensweisen nach. Die Stadt tolerierte die Szene und überließ sie sich selbst, was nach und nach zur Ghettoisierung und Verelendung der dort wohnhaften Abhängigen führte. Eine kaum mehr zu bewältigende Anzahl an Überdosierungen und Drogentoten war die Folge. Der mittlerweile als „Needle-Park“ bekannte Platzspitz musste Anfang der Neunzigerjahre geschlossen werden, es brauchte andere Konzepte. Ein Mittelweg zwischen Repression und Freigabe, begleitet von Therapie und schadensminimierenden Angeboten, ist seither die Basis der Schweizer Drogenpolitik. Auch progressivere Konzepte wie die Substitutionsbehandlung mit Diamorphin (Heroin) kommen erfolgreich zur Anwendung, etwas, das in vielen anderen Ländern – Österreich eingeschlossen – politisch undenkbar ist.
Neben diesen historischen Aspekten sieht man auch an aktuellen Diskussionen, dass die Drogenpolitik nicht nur vom Interesse an einem ordentlichen Umgang mit Süchtigen getragen ist. Während zum einen weiterhin ein Krieg gegen illegalisierte Substanzen geführt wird, gibt es derzeit auch ganz andere Bestrebungen: Die Legalisierung von Cannabis schreitet voran, die Regelungen in den USA sind in einigen Bundesstaaten mittlerweile wesentlich liberaler als im einstigen „Kifferparadies“ Amsterdam. Auch wenn die Tendenz in den USA recht eindeutig in Richtung eines liberaleren Umgangs mit der Substanz geht, ist ersichtlich, dass dieser nicht rein auf evidenzbasierten Fakten zum Nutzen oder der Schädlichkeit der Substanz basiert: Von den fünfzig Bundesstaaten ist in rund einem Drittel der Konsum weiterhin illegal, knapp ein Fünftel hat den Konsum legalisiert, ein weiteres Fünftel erlaubt Cannabis aus medizinischen Gründen und in einigen wenigen Staaten erfolgte eine Entkriminalisierung, ein Modell, dem beispielsweise auch Portugal sehr erfolgreich nachgeht.
Die Regelungen sind von einer Vielzahl unterschiedlicher, einander zum Teil widersprechender Interessenlagen abhängig. Steuereinnahmen und Qualitätskontrolle sprechen für eine Legalisierung, die potenziell gesundheitsschädliche Wirkung jeder psychoaktiven Substanz ist nicht zu leugnen. Bleibt letztlich die politisch-ideologische Frage, wie viel gesundheitsschädliche Substanzen sich eine Gesellschaft um welchen Preis leisten will und ob man mehr auf Eigenverantwortung oder mehr auf Fremdbestimmung der Konsument*innen setzt.
Wie ideologisch diese Debatte hierzulande geführt wird, sieht man auch daran, dass sie wenig differenziert ist. Die einen warnen vor Cannabis als Einstiegsdroge, während die anderen nicht einsehen, wieso sie im Keller Bier brauen, aber Gras am Balkon nicht züchten dürfen. Über die Hintertür der Verwendung zu medizinischen Zwecken kann etwas weniger emotionalisiert diskutiert werden, wobei genau diese Vermischung der Liberalisierungsdebatte mehr schadet als nützt.
VON PROHIBITION BIS LEGALISIERUNG – WAS WIRKT?
Anhand unterschiedlicher Konzepte von Repression über Entkriminalisierung bis zur Liberalisierung sollen im Folgenden unterschiedliche Zugangsweisen des gesellschaftlichen und politischen Umgangs mit Drogen und deren Konsument*innen thematisiert werden. Zwischen „verboten“ und „erlaubt“ existiert ein breites Spektrum an unterschiedlichen Regulierungsmöglichkeiten, die zur Anwendung kommen können.
Am oberen Ende eines repressiven Umganges mit Drogen steht deren Verbot, dessen Nichtbeachtung mit bedingten oder unbedingten Haftstrafen geahndet wird. Es ist eine weit verbreitete Ansicht, dass ein Verbot von Substanzen zu geringerem Konsum derselben führen würde. Je strenger die Strafen, desto weniger würden die Menschen diese Substanzen konsumieren, so der allgemeine Tenor. Die Regierung der Philippinen und auch anderer asiatischer Länder verfolgt diesen Zugang mit Vehemenz, der Besitz oder Handel von Drogen wird streng geahndet, bis hin zur Todesstrafe. Dass damit Probleme mit dem Substanzkonsum nicht aus der Welt geschafft werden können, sieht man eindrucksvoll. Auf den Philippinen wird unter Präsident Rodrigo Duterte seit 2016 ein erbitterter Kampf gegen Drogen geführt. Anti-Drogen-Operationen der Regierung spüren Händler auf und scheuen auch davor nicht zurück, diese zu töten. Die offizielle Begründung für solche Todesfälle ist, dass die Täter Widerstand bei deren Verhaftung geleistet hätten. Menschenrechtsaktivist*innen sehen das anders, es ginge lediglich darum, die Dealer aus dem Weg zu räumen, um jeden Preis. Es gibt aber nicht nur dokumentierte Tötungen, sondern auch eine Reihe von ungeklärten Fällen. Killer, die nachts auf Motorrädern die Straßen durchkämmen, erschießen Händler und Konsument*innen, ohne Strafe fürchten zu müssen. Duterte selbst soll sogar einmal bei einem Besuch in den Slums vor hunderten Menschen gesagt haben: „Wer einen Junkie kennt, soll losgehen und ihn töten.“
Offizielle Zahlen zu den Getöteten gibt es nicht. Es sind aber laut Schätzungen bereits mehrere Zehntausend Menschen, die auf den Philippinen im Krieg gegen Drogen ums Leben kamen. Dazu kommen übervolle Gefängnisse und die Sorge, dass die repressive Politik die Durchseuchungsrate mit HIV und Hepatitis C steigen lässt. Das Wahlkampfversprechen, die Drogenprobleme auf den Philippinen bis spätestens Dezember 2016 mit diesem erbitterten Kampf gelöst zu haben, wartet hingegen noch immer auf die Einlösung.
Man braucht aber gar nicht auf derartige Extreme zu blicken, um zu erkennen, welche negativen Auswirkungen Drogenverbote haben können. Es reicht ein Blick auf die Drogenpolitik europäischer Länder und deren Umgang mit Cannabis. Vor etwa zehn Jahren wurden vermehrt über das Internet, aber auch in einschlägigen Geschäften, legale Alternativen zu illegalisierten Substanzen angeboten. Shops, in denen man Kräutermischungen als Ersatz für Cannabis oder auch „Badesalze“ als stimulierende Alternative zu Amphetaminen oder MDMA kaufen konnte, schossen wie Pilze aus dem Boden. Die Bezeichnungen „Kräutermischung“, „Badesalz“ oder auch „Pflanzendünger – oft auch noch mit dem Warnhinweis „Nicht zum menschlichen Verzehr geeignet“ versehen, wobei die Konsument*innen genau wussten, wie ernst diese Warnung zu nehmen ist – sollten den eigentlichen Zweck verschleiern: den Konsum zur Berauschung. Einigen Leser*innen wird vielleicht noch die Kräutermischung „Spice“ ein Begriff sein, die im Jahr 2008 in Österreich und anderen europäischen Ländern auftauchte. Verkauft wurde diese Mischung zur Aromatisierung der Raumluft, es war aber bald bekannt, dass sie wie Cannabis geraucht werden konnte. Chemische Analysen ergaben, dass es sich im Wesentlichen um Eibischkraut handelte, dass mit dem synthetischen Cannabinoid JWH-018 angereichert war. Dieses synthetische Cannabinoid stand im Gegensatz zu THC nicht auf der Liste der verbotenen Substanzen im Suchtmittelgesetz, insofern waren auch Vertrieb und Konsum der Substanz legal. Nachdem Letzterer aber, wie sich herausstellte, nicht unproblematisch war, reagierte der Gesetzgeber und verbot mit Dezember 2008 Räuchermischungen, die die chemische Verbindung „Naphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanon/JWH-018“ enthalten. Problem gelöst? Mitnichten. Es tauchten laufend ähnliche Produkte mit geringfügiger Veränderung der Molekularstruktur auf, die zwar dieselbe Wirkung hatten, aber nicht verboten waren. So gab es statt „Naphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanon/JWH-018“ plötzlich „(Naphthalin-1-yl)(2-methyl-1-propyl-1H-indol-3-yl) methanon (JWH-015)“. Für die Konsument*innen kein Unterschied, für die Verfolgungsbehörden schon, diese Struktur war durch die geringfügige chemische Änderung schließlich nicht mehr verboten. Ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel zwischen Produzent*innen und Gesetzgeber.
Darüber hinaus kamen ab 2009 immer neue Substanzen aus unterschiedlichen Wirkungsklassen hinzu. Neben synthetischen Cannabinoiden gab es zunehmend synthetische Drogen aus immer mehr und anderen Klassen – Cathinone, Piperazine und anderes mehr. Eine schier unüberschaubare Anzahl an Substanzen, die in sogenannten „Head-Shops“, aber auch online vertrieben wurden. Im Internet gab es Verkaufsseiten, die durchaus mit großen Versandhändlern für Bücher oder andere Waren vergleichbar waren. Produkte konnten bewertet, verglichen und mit einem Klick in den Warenkorb gelegt werden. Auch die Bezahlung funktionierte analog anderer Versandhändler mit Kreditkarte oder auf Rechnung, die Lieferung erfolgte in den nächsten Tagen frei Haus.
Der Kauf dieser Substanzen war denkbar einfach und nicht verboten, die Problematik für die Konsument*innen jedoch eine ganz andere. Die Legalität der Substanzen und die damit einhergehende Bezeichnung als sogenannte „Legal Highs“ vermittelten den Anschein, dass es sich hierbei um harmlose Substanzen handelt. Die Straffreiheit war für die Konsument*innen ein wesentlicher Anreiz, von bekannten verbotenen Substanzen wie beispielsweise Cannabis auf das unbekanntere, aber legale Spice umzusteigen. Doch die Erwartung der Harmlosigkeit erfüllte sich nicht, das Gegenteil war der Fall. Der Konsum dieser Substanzen war zum Teil wesentlich riskanter als der seines illegalisierten Pendants. Letztlich war das Risikopotenzial weitgehend unerforscht und damit auch für die Konsument*innen nicht erkennbar, sowohl Akut- als auch Langzeitwirkungen sind schwerer kalkulierbar. Betrachtet man die Herstellungsweise dieser Substanzen, ist dies auch nicht weiter verwunderlich. Spice wurde häufig in einfachen Kellerlabors produziert, Utensilien waren eine Eibischkräutermischung, das synthetische Cannabinoid in flüssiger Form und eine handelsübliche Blumen- oder Wäschespritze. Die Kräutermischung wurde auf dem Boden ausgebreitet, die synthetisch hergestellte psychoaktive Substanz mit der Wäschespritze auf die Kräuter aufgesprüht. Jeder, der schon einmal beim Hemdenbügeln Wasser mit der Wäschespritze aufgesprüht hat, weiß, dass das Wasser nicht sonderlich gleichmäßig aus der Spritze herauskommt. Manchmal kommt gar nichts, manchmal gibt es Wasserflecken. So war das auch beim Aufsprühen der chemischen Verbindung auf die Kräuter, was zur Folge hatte, dass es Spice-Packungen mit sehr geringer Wirkstoffmenge und solche mit extrem hoher Wirkstoffmenge gab. Ein risikoarmer und vorsichtig dosierter Konsum war daher nicht möglich, was nicht selten zu Überdosierungen und massiven unerwünschten Nebenwirkungen wie Herz-Kreislauf-Problemen, Krampfanfällen, Panikattacken, Nierenversagen und anderem mehr führte. Häufig traten auch massiv erhöhte Aggressionszustände oder paranoide Wahnvorstellungen auf, die selbst erfahrene Drogenabhängige ängstigten, weshalb ein nicht unerheblicher Teil wieder aufhörte, diese Substanzen zu konsumieren.
Im Jahr 2012 reagierte schließlich die österreichische Gesetzgebung mit der Einführung des Neuen-Psychoaktiven-Substanzen-Gesetzes (NPSG) auf dieses Problem, in dem nicht mehr einzelne Substanzen, sondern erstmals ganze Wirkungsklassen verboten wurden, um dem ständigen Katz-und-Maus-Spiel des Verbietens einzelner Substanzen und der geringfügigen Abänderung von Molekularstrukturen ein Ende zu bereiten.
Am Beispiel der neuen psychoaktiven Substanzen ist gut ersichtlich, dass man mit reinen Verboten keine Probleme löst, sondern sie manchmal sogar verschlimmert oder erst neue generiert. In diesem Fall hat man mit dem NPSG, das auf eine Eindämmung des Angebotes und eine Unterstützung für die Betroffenen abzielt, das Problem ganz gut in den Griff bekommen. Nicht ganz so einfach ist das jedoch bei anderen Substanzen und deren Folgewirkungen. Die Verbreitung von Infektionskrankheiten wie Hepatitis C oder HIV unter Drogenabhängigen sowie eine Vielzahl von medizinischen sowie sozialen Folgewirkungen sind auf die Kriminalisierung der Substanzen zurückzuführen. Drogenabhängige bewegen sich aus Angst, erwischt zu werden, im Verborgenen und finden Mittel und Wege, um an die Substanz zu kommen, die sie brauchen. Der Konsum erfolgt häufig unter unsauberen Bedingungen und in der ständigen Angst vor der Polizei. Dies alles führt zu einem Kreislauf aus Konsum, Kriminalität, gesundheitlichen Folgewirkungen durch unsaubere Substanzen und Inhaftierung. Ein Entkommen aus diesem Kreislauf ist für viele erst möglich, wenn bereits massive Folgewirkungen eingetreten sind.
Dass reine Verbote wirkungslos sind, sieht man also nicht nur im Fall der Philippinen und der USA, auch in Europa erwiesen sich bei Abhängigkeitserkrankungen rein restriktive Modelle nicht als sehr hilfreich. Es stellt sich die Frage nach Alternativen.
Am anderen Ende des Umgangs mit psychoaktiven Substanzen steht deren völlige Legalisierung. Aber ist das das Mittel der Wahl? Die rechtliche Situation den Alkohol betreffend steht diametral zu jener von illegalisierten Drogen wie Opiaten oder Kokain. Er darf – unter Berücksichtigung der Einschränkungen durch Jugendschutzbestimmungen – in Österreich frei verkauft und beworben werden. Die Folgen dieser liberalen Bestimmungen und der kulturellen Einbettung des Alkohols in unserer Gesellschaft sind bekannt. 365.000 Alkoholabhängige in Österreich und weitere 740.000, die einen problematischen Umgang mit Alkohol pflegen [7]. Gegner der Cannabis-Legalisierung argumentieren mit diesen Zahlen: Weshalb sollte man eine weitere Substanz legalisieren, wenn es doch schon mit zwei legalisierten Substanzen – Alkohol und Nikotin – genügend Probleme gibt? Ein berechtigter Einwand. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, wie viel Sinn es macht, Cannabis, eine vermutlich harmlosere Substanz als Alkohol, zu kriminalisieren und dessen Konsument*innen, die genauso ein Bedürfnis nach Berauschung haben wie Alkoholkonsument*innen, ins Eck zu stellen. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es dazu keine vernünftige Begründung.
Doch wie meistens im Leben gibt es auch hier nicht nur Schwarz oder Weiß. Neben dem Verbot und der Legalisierung gibt es weitere Modelle zum Umgang mit psychoaktiven Substanzen. Allen voran die Entkriminalisierung, wie sie beispielsweise in Portugal seit vielen Jahren erfolgreich betrieben wird. Seit dem 1. Juli 2001 gilt dort das „Gesetz 30/2000“, das den Konsum aller Drogen im Land entkriminalisiert. Der Konsum von Cannabis ist seitdem ebenso wenig eine Straftat wie der von Heroin oder Kokain. Das heißt aber nicht, dass in Portugal der Besitz von Drogen zum Eigengebrauch erlaubt ist, er ist schlicht eine Ordnungswidrigkeit wie etwa das Falschparken. Wer mit geringen Mengen zum Eigengebrauch erwischt wird, muss vor die sogenannte Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT), die Kommission für die Abmahnung der Drogensucht, bestehend aus einer/einem Jurist*in, einer/einem Psycholog*in und einer/einem Sozialarbeiter*in. Die Mitglieder der Kommission können Geldbußen verhängen oder die Betroffenen abmahnen, die wichtigste Aufgabe ist jedoch, Menschen zu einer Therapie zu bringen, wenn diese eine benötigen. Es geht also darum, Personen, die keine kriminellen Handlungen begehen, auch nicht zu kriminalisieren, sondern diese dem Hilfesystem zuzuführen, wenn sie es brauchen. Bei Jugendlichen und Erstkonsument*innen spielen auch Prävention und Aufklärung eine wesentliche Rolle. Das Signal ist deutlich: Der Konsum von Drogen ist nicht harmlos, aber auch nichts, was bestraft gehört, es braucht einen anderen Umgang mit diesem komplexen Thema. Das ist auch das wesentliche Merkmal der portugiesischen Politik, denn nicht die Entkriminalisierung alleine ist hilfreich, sondern der dadurch leichter mögliche Zugang zum Hilfesystem. Abhängige müssen keine Strafen mehr befürchten, wenn sie sich als solche zu erkennen geben, der Ausbau von Präventionskampagnen, Sozialarbeiter*innen auf der Straße und die Verbesserung von Therapie- und Substitutionsprogrammen unterstützen die Betroffenen, anstatt sie zu kriminalisieren.
Das heißt aber nicht, dass in Portugal jeglicher Umgang mit Drogen straffrei ist, es gibt eine deutliche Abgrenzung zwischen Konsument*innen und Händler*innen. Die Menge an Substanzen, die man bei sich führen darf, um straffrei zu bleiben, ist klar geregelt und auf einen Konsum von etwa zehn Tagen ausgelegt. Laut Definition sind das bis zu 25 Gramm Marihuana, zwei Gramm Kokain, einem Gramm Heroin oder Crystal Meth oder einem Gramm MDMA (Ecstasy) oder Amphetamin (Speed). Wer mehr bei sich hat, wird als Dealer nach dem Strafrecht bestraft.
Portugal lebt den Zugang der Entkriminalisierung nun schon seit mehr als 15 Jahren, ein Zeitraum, der lange genug ist, um die Folgen dieser Maßnahmen abschätzen zu können. Das Ergebnis dieser liberaleren Drogenpolitik ist ein positives, das Straßenbild hat sich verändert. Mitte der 1990er-Jahre hatte Portugal ein öffentlich sichtbares Drogenproblem, in Lissabon und anderen größeren Städten gab es Bezirke, in denen Süchtige auf offener Straße spritzten und verelendeten, die Anzahl der Heroinabhängigen war hoch. Nach der Entkriminalisierung stieg, entgegen den Befürchtungen der Kritiker*innen, die Anzahl der Drogenkonsumierenden im Land nicht an, im Gegenteil. Der Drogenkonsum unter den problematischen Konsument*innen ging zurück, die Zahl der Drogentoten sowie Neuinfektionen mit ansteckenden Erkrankungen wie HIV und Hepatitis C sanken. Die Zahl der Abhängigen in Behandlung stieg deutlich an. Dass weniger Jugendliche illegalisierte Substanzen konsumierten, ist ebenso ein äußerst wünschenswertes Ergebnis, genauso wie die deutliche Entlastung der ohnehin schon überfüllten Gefängnisse. Weniger Drogenabhängige wurden straffällig, weniger Menschen konsumierten Drogen in Haft. Lediglich die Anzahl der Erwachsener, die Drogen zumindest einmal ausprobierten, stieg geringfügig an, was im Wesentlichen auf den Konsum von Cannabis zurückzuführen ist [108]. Eine Entwicklung, die sich allerdings auch in anderen europäischen Ländern ohne vergleichbare Reformen zeigte. Insgesamt hat Portugal mittlerweile eine im europäischen Durchschnitt vergleichsweise niedrige Drogenkonsumquote. Alles in allem also positive Auswirkungen und das Gegenteil der Befürchtungen der Kritiker*innen, die Anzahl der Süchtigen würde mit einem liberaleren Zugang ansteigen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass aus wissenschaftlicher Sicht und aus den Erfahrungen der Länder mit einer liberaleren Drogenpolitik sehr vieles für eine Entkriminalisierung, verbunden mit einem Ausbau an präventiven und unterstützenden Angeboten, spricht. Letztlich bleibt es also eine rein politische Frage, ob sich eine Regierung dazu durchringt, den „Kampf gegen Drogen“ mit einem weniger restriktiven, mehr regulativen und unterstützenden Zugang zu führen.
DIE RECHTLICHE SITUATION IN ÖSTERREICH
Die österreichische Drogengesetzgebung differenziert zwischen Konsument*innen und Drogenhändler*innen und bietet ein breites Spektrum an unterstützenden und therapeutischen Maßnahmen für Abhängige. Die wesentlichsten gesetzlichen Regelungen finden sich im österreichischen Suchtmittelgesetz (SMG), das im Jahr 1998 das Suchtgiftgesetz ablöste und dem Grundsatz „Therapie statt Strafe“ wesentliche Bedeutung eingeräumt hat. Neben dem SMG existiert seit dem Jahr 2012 zusätzlich das Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetz (NPSG), das den Umgang mit den seit Ende der 2000er-Jahre aufgekommenen, überwiegend synthetischen Drogen regelt. Das NPSG ist in einigen Bereichen liberaler als das SMG, es versucht noch deutlicher die Konsument*innen von den Händler*innen zu unterscheiden und vor allem eine Reduktion auf der Angebotsseite zu erreichen. Das dritte wesentliche Gesetz im Zusammenhang mit Suchtmitteln in Österreich ist die Suchtgiftverordnung, die vorwiegend die ärztliche Verschreibung von Suchtmitteln sowie die Substitutionsbehandlung regelt.
Das Suchtmittelgesetz regelt den Umgang mit Substanzen wie Cannabis, Kokain oder Heroin. Was wenig bekannt zu sein scheint, ist, dass der Konsum von Suchtmitteln in Österreich generell nicht verboten ist, im SMG sind Besitz, Erwerb, Weitergabe, Erzeugung, Handel und ähnlich gelagerte Handlungen untersagt. Die Strafbarkeit des Konsums wird jedoch quasi indirekt über den Besitz geregelt, wer Suchtmittel konsumiert, muss ja schließlich welche haben. Neben den verbotenen Substanzklassen, deren Einordnung auf Basis internationaler Konventionen erfolgt, werden mittels Verordnungen Grenzmengen für verschiedenste Substanzen festgelegt. Dass es sich dabei um die Menge handelt, die man für den „Eigenbedarf“ mit sich führen darf, wie dies häufig angenommen wird, ist ein Irrglaube. Die sogenannte Grenzmenge regelt lediglich jene Menge einer Substanz, bei deren Überschreitung die Strafen strenger werden. Bei Suchtmitteldelikten unterhalb der Grenzmenge spricht man von Vergehenstatbeständen (§ 27 SMG), bei solchen darüber von Verbrechenstatbeständen (§§ 28, 28a SMG). Die Haftstrafen bei Vergehen liegen bei einem beziehungsweise, in schwerwiegenderen Fällen, bei bis zu drei Jahren, die Strafen für Suchtmittelverbrechen können bis zu zwanzig Jahre oder lebenslang betragen. Nur um einen Eindruck von den Mengen zu erhalten: Die aktuell gültige Grenzmenge bei Cannabis beträgt zwanzig Gramm der Reinsubstanz, die von Heroin drei Gramm.
Die wesentlichen Strafbestimmungen im Suchtmittelgesetz sind die §§ 27, 28 und 28a des SMG. Der § 27 SMG regelt die Strafen für den Erwerb, Besitz, Erzeugung, Beförderung, Ein- und Ausfuhr, das Anbieten, Verschaffen oder Überlassen von Suchtmitteln, wobei es Unterscheidungen hinsichtlich des persönlichen Gebrauchs sowie des gewerbsmäßigen Vorgehens gibt. Unter diese Paragrafen fällt der Besitz von Cannabis zum Eigengebrauch genauso wie der Verkauf von Heroin oder anderen Substanzen, jedoch bei § 27 SMG in allen Fällen unterhalb der Grenzmenge. Der Besitz von Cannabis ist nach diesem Gesetz demnach genauso strafbar wie das Herumreichen eines Joints in einer Runde. Im Gesetzesdeutsch handelt es sich bei Letzterem nämlich um Überlassung eines Suchtmittels, die nach § 27 SMG strafbar ist. Die Bestimmungen für den Suchtgifthandel und die Vorbereitungen dazu finden sich in den §§ 28 und 28a SMG und betreffen den Umgang mit Substanzen oberhalb der Grenzmenge.
§ 27, 28, 28a Suchtmittelgesetz (SMG)
§ 27
(1)Wer vorschriftswidrig
1.Suchtgift erwirbt, besitzt, erzeugt, befördert, einführt, ausführt oder einem anderen anbietet, überlässt oder verschafft,
2.Opiummohn, den Kokastrauch oder die Cannabispflanze zum Zweck der Suchtgiftgewinnung anbaut oder
3.psilocin-, psilotin- oder psilocybinhältige Pilze einem anderen anbietet, überlässt, verschafft oder zum Zweck des Suchtgiftmissbrauchs anbaut, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
(2)Wer jedoch die Straftat ausschließlich zum persönlichen Gebrauch begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
(2a)Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ist zu bestrafen, wer vorschriftswidrig in einem öffentlichen Verkehrsmittel, in einer dem öffentlichen Verkehr dienenden Anlage, auf einer öffentlichen Verkehrsfläche, in einem öffentlichen Gebäude oder sonst an einem allgemein zugänglichen Ort öffentlich oder unter Umständen, unter denen sein Verhalten geeignet ist, durch unmittelbare Wahrnehmung berechtigtes Ärgernis zu erregen, Suchtgift einem anderen gegen Entgelt anbietet, überlässt oder verschafft.
(3)Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ist zu bestrafen, wer eine Straftat nach Abs. 1 Z 1, Z 2 oder Abs. 2a gewerbsmäßig begeht.
(4)Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ist zu bestrafen, wer
1.durch eine Straftat nach Abs. 1 Z 1 oder 2 einem Minderjährigen den Gebrauch von Suchtgift ermöglicht und selbst volljährig und mehr als zwei Jahre älter als der Minderjährige ist oder
2.eine solche Straftat als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht.
(5)Wer jedoch an Suchtmittel gewöhnt ist und eine Straftat nach Abs. 3 oder Abs. 4 Z 2 vorwiegend deshalb begeht, um sich für seinen persönlichen Gebrauch Suchtmittel oder Mittel zu deren Erwerb zu verschaffen, ist nur mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen.
Vorbereitung von Suchtgifthandel – § 28
(1)Wer vorschriftswidrig Suchtgift in einer die Grenzmenge (§ 28b) übersteigenden Menge mit dem Vorsatz erwirbt, besitzt oder befördert, dass es in Verkehr gesetzt werde, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. Ebenso ist zu bestrafen, wer die in § 27 Abs. 1 Z 2 genannten Pflanzen zum Zweck der Gewinnung einer solchen Menge Suchtgift mit dem Vorsatz anbaut, dass dieses in Verkehr gesetzt werde.
(2)Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren ist zu bestrafen, wer die Straftat nach Abs. 1 in Bezug auf Suchtgift in einer das Fünfzehnfache der Grenzmenge (§ 28b) übersteigenden Menge (großen Menge) begeht.
(3)Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren ist zu bestrafen, wer die Straftat nach Abs. 1 als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht.
(4)Unter den in § 27 Abs. 5 genannten Voraussetzungen ist der Täter jedoch im Fall des Abs. 1 nur mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, im Fall des Abs. 2 nur mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und im Fall des Abs. 3 nur mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
Suchtgifthandel § 28a
(1)Wer vorschriftswidrig Suchtgift in einer die Grenzmenge (§ 28b) übersteigenden Menge erzeugt, einführt, ausführt oder einem anderen anbietet, überlässt oder verschafft, ist mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
(2)Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren ist zu bestrafen, wer die Straftat nach Abs. 1
1.gewerbsmäßig begeht und schon einmal wegen einer Straftat nach Abs. 1 verurteilt worden ist,
2.als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht oder
3.in Bezug auf Suchtgift in einer das Fünfzehnfache der Grenzmenge übersteigenden Menge (großen Menge) begeht.
(3)Unter den in § 27 Abs. 5 genannten Voraussetzungen ist der Täter jedoch im Fall des Abs. 1 nur mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, im Fall des Abs. 2 nur mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
(4)Mit Freiheitsstrafe von einem bis zu fünfzehn Jahren ist zu bestrafen, wer die Straftat nach Abs. 1
1.als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht und schon einmal wegen einer Straftat nach Abs. 1 verurteilt worden ist,
2.als Mitglied einer Verbindung einer größeren Zahl von Menschen zur Begehung solcher Straftaten begeht oder
3.in Bezug auf Suchtgift in einer das Fünfundzwanzigfache der Grenzmenge übersteigenden Menge begeht.
(5)Mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren oder mit lebenslanger Freiheitsstrafe ist zu bestrafen, wer eine Straftat nach Abs. 1 begeht und in einer Verbindung einer größeren Zahl von Menschen zur Begehung solcher Straftaten führend tätig ist.
Doch was bedeutet das nun in der Praxis? Was geschieht, wenn man in Österreich mit einer geringen Menge Cannabis, Heroin oder Kokain erwischt wird? Schließlich stehen auch zum persönlichen Gebrauch im Gesetzestext bis zu sechs Monate Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen. Werden nun alle, die einmal mit einem Cannabis-Joint erwischt werden, eingesperrt? Nein, denn eine Verurteilung nach dem SMG bedeutet nicht gleichermaßen eine Inhaftierung. Im Jahr 2016 gab es beispielsweise 7351 Verurteilungen nach dem SMG in Österreich, davon 2219 wegen Handels und Vorbereitungen zum Suchtgifthandel und 5095 wegen unerlaubten Umgangs mit Suchtgiften [129]. Diese Kapazität an Haftplätzen gäbe es in Österreich überhaupt nicht und es würde auch nicht viel Sinn machen, alle diese Personen einzusperren. Vor allem bei Delikten im Zusammenhang mit geringen Mengen zum persönlichen Gebrauch kommen zumeist andere Maßnahmen zur Anwendung. Das Prinzip „Therapie statt Strafe“ ist ein fester Bestandteil des österreichischen Suchtmittelrechts.
Für Cannabis gibt es seit dem Jahr 2016 eine eigene Regelung im Suchtmittelgesetz, die zur Entkriminalisierung der Substanz beigetragen hat. Prinzipiell gilt Cannabis in Österreich als illegales Suchtmittel, dessen Erwerb, Besitz und Weitergabe genauso verboten ist wie im Fall von von Heroin oder Kokain. Eine definierte festgesetzte Menge zum Eigengebrauch, welche man besitzen darf, gibt es nicht. Wenn man jedoch mit einer geringen Menge Cannabis (maximal zwanzig Gramm Reinsubstanz THC) für den persönlichen Gebrauch erwischt wird, bekommt man zwar nach wie vor eine Anzeige, es kommt jedoch zu keinem Verfahren bei der Staatsanwaltschaft, sondern einer Meldung bei der Gesundheitsbehörde. Ist dies die erste innerhalb von fünf Jahren, gibt es seitens der Strafverfolgungsbehörden neben einem Eintrag ins Suchtmittelregister keine weiteren straf- oder suchtmittelrechtlichen Konsequenzen. Eine eher milde Reaktion im Vergleich zu den angedrohten Konsequenzen [10]. Bei Wiederholung kann es zu einer Anordnung von Therapie beziehungsweise auch zu Geld- und Haftstrafen kommen.
Eine wesentliche Zielrichtung des SMG ist damit die Differenzierung zwischen Konsument*innen und Händler*innen. Abhängige Personen sollen in geeignete Unterstützungssysteme vermittelt, Händler*innen durch Strafen abgeschreckt werden. Das SMG berücksichtigt die Tatsache, dass bei Drogenabhängigen neben medizinischen, häufig psychische und soziale Probleme im Vordergrund stehen. Unter dem zusammenfassenden Begriff der „gesundheitsbezogenen Maßnahmen“ steht drogenabhängigen Straftäter*innen ein differenzierteres Behandlungsspektrum als Alternative zur Strafverfolgung zur Verfügung. Neben der schon im alten, bis zum Jahr 1998 gültigen Suchgiftgesetz (SGG) verankerten Möglichkeit der ärztlichen Überwachung und Behandlung des Gesundheitszustandes, zählen nunmehr klinisch-psychologische Behandlung, Psychotherapie und psychosoziale Betreuung zu den gesundheitsbezogenen Maßnahmen.
Grundsätzlich sieht das österreichische Rechtssystem eine Art „Stufenleiter“ vor, mit der Drogenkonsument*innen motiviert, genötigt oder gezwungen werden sollen, behandelnde oder betreuende Angebote anzunehmen. Am unteren Ende steht dabei die Intervention der Gesundheitsbehörde, also der regionalen Administration, bei der festgeschrieben wird, dass jeder, der als süchtig und behandlungsbedürftig definiert ist, verpflichtet ist, sich einer Behandlung zu unterziehen. Wenn die Betroffenen den Behandlungsmaßnahmen nachkommen, gibt es keine strafrechtlichen Sanktionen. In der Praxis bedeutet das, dass unter bestimmten Bedingungen kein Gerichtsverfahren eingeleitet (§ 35 SMG) oder ein bereits laufendes Verfahren eingestellt wird (§ 37 SMG). Voraussetzungen hierfür sind der Eigengebrauch, das Unterschreiten der Grenzmenge und eine Begutachtung der Gesundheitsbehörde, bei der festgestellt wird, ob eine gesundheitsbezogene Maßnahme notwendig ist oder nicht. Wird diese als notwendig erachtet und erklärt sich die betroffene Person bereit, die Unterstützungsmaßnahmen anzunehmen, erfolgen keine weiteren straf- oder suchtmittelrechtlichen Maßnahmen. Für Cannabiskonsument*innen gibt es zusätzlich die weiter oben beschriebene Sonderregelung. Diese Bestimmungen führen dazu, dass eine Vielzahl von Fällen diversionell erledigt werden kann. Im Jahr 2016 endeten insgesamt 23.809 Fälle mit einem vorläufigen Rücktritt von der Verfolgung nach § 35 SMG und 1857 Fälle, in denen das Verfahren vom Gericht vorläufig eingestellt wurde (§ 37 SMG) [129]. Damit wird eine Vielzahl von Konsument*innen illegalisierter Substanzen eher dem Gesundheitssystem als dem Strafsystem zugeführt, was durchaus eine sehr sinnvolle Vorgangsweise ist.
Treffen die Voraussetzungen für eine vorläufige Anzeigenzurücklegung oder Verfahrenseinstellung jedoch nicht zu, droht eine unbedingte Haftstrafe. Doch auch hier greift wieder das Prinzip „Therapie statt Strafe“, bei dem die Strafe unter bestimmten Bedingungen bis zu zwei Jahre aufgeschoben werden kann, um dem Verurteilten die Gelegenheit zu geben, sich einer Behandlung der Drogenabhängigkeit zu unterziehen. Wurde diese Behandlung erfolgreich absolviert, wird die unbedingte in eine bedingte Freiheitsstrafe umgewandelt, die Strafe muss unter der Verhängung einer Probezeit nicht im Gefängnis verbüßt werden. Dieser Strafaufschub nach § 39 SMG steht verurteilten Drogenabhängigen bei Strafen, die einen bestimmten Rahmen nicht überschreiten, zur Verfügung, wenn der Betroffene von Suchtmitteln abhängig ist. Darüber hinaus muss sich die Person einverstanden erklären, sich einer notwendigen gesundheitsbezogenen Maßnahme zu unterziehen. Es handelt sich also nicht um eine Zwangsbehandlung, sondern um eine Möglichkeit, die die Betroffenen in Anspruch nehmen können oder auch nicht, wenngleich die Alternative Gefängnis nicht sonderlich attraktiv ist. Demzufolge spricht man in diesem Zusammenhang auch von einer „Quasi-Zwangsbehandlung“, da trotz des Zwangscharakters noch immer eine Wahlfreiheit für die Betroffenen besteht.
Damit gibt es für süchtige und behandlungsbedürftige Täter gewissermaßen eine „rechtliche Privilegierung“ im Sinn von Therapie statt Strafe, die unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit bekommen, anstelle einer Haftstrafe einer Behandlung ihrer Abhängigkeit nachzugehen. Dies stellt selbstverständlich die nachhaltigere Methode im Umgang mit kriminell gewordenen Drogenabhängigen dar, als sie lediglich für einen bestimmten Zeitraum wegzusperren.
Neben dieser Quasi-Zwangsbehandlung gibt es aber noch eine weitere Stufe auf der Leiter der rechtlichen Möglichkeiten, Süchtige in Behandlung zu bringen, nämlich die Einweisung in die vorbeugende Maßnahme nach § 22 StGB. Bei dieser ist eine vom Gericht angeordnete Zwangsbehandlung vorgesehen, die über die Strafzeit hinausgehen kann. In Österreich werden die Behandlungen nach § 22 StGB in der Justizanstalt Favoriten und in Abteilungen anderer Justizanstalten angeboten, dies betrifft aber nur einen verschwindend kleinen Teil der inhaftierten Süchtigen.
Obwohl die Möglichkeiten, straffällig gewordene Abhängige in Behandlung zu bringen, damit im österreichischen SMG ganz gut geregelt sind, gibt es dennoch bei der Umsetzung Probleme. Dies hat auch damit zu tun, dass der Begriff „Therapie statt Strafe“ etwas irreführend ist. Der Gesetzgeber hat bewusst einen sehr offenen Ansatz gewählt und spricht in § 11 SMG von gesundheitsbezogenen Maßnahmen, womit die Behandlung nicht nur auf psychotherapeutische Maßnahmen beschränkt ist, sondern auch medizinische, psychologische sowie psychosoziale Interventionen vorgesehen sind. Die Anwendung methodenvielfältiger Angebote ist nicht nur im Umgang mit straffällig gewordenen Abhängigen mittlerweile State of the Art in der Suchtbehandlung. Diesem Umstand wird jedoch häufig bei der Begutachtung zu einem § 39 SMG zu wenig Beachtung geschenkt. Die vor allem bei einigen psychotherapeutischen Gutachter*innen gängige Methode, lediglich auf die Anwendbarkeit psychotherapeutischer Maßnahmen abzustellen, ist nicht im Sinne des Gesetzgebers und führt dazu, dass eine Reihe von Personen von den Behandlungsmaßnahmen ausgeschlossen ist. Dass nämlich beispielsweise jemandem, der der deutschen Sprache nicht mächtig ist, von vornherein eine Therapie versagt bleibt, macht wenig Sinn, denn um regelmäßig ärztlich verordnete Medikamente einzunehmen, benötigt man noch keine Deutschkenntnisse. Auch Personen, die schon mehrere Therapieversuche hinter sich haben, wird die Therapiefähigkeit häufig aufgrund einer von Gutachter*innen attestierten Aussichtslosigkeit abgesprochen. Wenn man jedoch in Betracht zieht, dass es gerade bei einer chronischen Erkrankung wie der Sucht häufig mehrere Therapieanläufe benötigt, damit diese in einer langfristigen Stabilisierung resultieren, sind derartige Entscheidungen kontraproduktiv. Diese Fehleinschätzungen führen zu einer manchmal recht restriktiven Handhabung des § 39 SMG, was zur Folge hat, dass oftmals die Kränkesten und am schwersten Betroffenen dort bleiben, wo sicher am wenigsten Besserung zu erwarten ist – im Strafvollzug.
Neben diesen Bestimmungen, die straffällig gewordene Abhängige betreffen, gibt es noch eine weitere Ebene, die vorwiegend den sekundärpräventiven Aspekten dienen soll, also jenen Personen Angebote macht, die bereits in Kontakt mit illegalisierten Substanzen gekommen sind. Spezielle Regelungen gibt es in Schulen und beim Bundesheer, die mit einer Art internem Krisenmanagementsystem sicherstellen, dass erstauffällige Konsument*innen möglichst rasch dem Gesundheitssystem zugeführt werden, ohne die Justiz einzuschalten. Fällt in diesen Institutionen jemand bezüglich Drogenmissbrauchs auf, wird der schul- beziehungsweise heeresinterne ärztliche sowie psychologische Dienst verständigt, der abklärt, ob weitere gesundheitsbezogene Maßnahmen notwendig sind. Damit ist sichergestellt, dass erstauffällige Betroffene möglichst rasch und diskret Hilfestellung erhalten.
Die Regelungen bezüglich des Konsums illegalisierter Drogen in Schulen ist in Österreich in § 13 des Suchtmittelgesetzes geregelt, dort heißt es in Absatz 1:
„Ist auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen, daß ein Schüler Suchtgift mißbraucht, so hat ihn der Leiter der Schule einer schulärztlichen Untersuchung zuzuführen. Der schulpsychologische Dienst ist erforderlichenfalls beizuziehen. Ergibt die Untersuchung, daß eine gesundheitsbezogene Maßnahme gemäß § 11 Abs. 2 notwendig ist und ist diese nicht sichergestellt, oder wird vom Schüler, den Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten die schulärztliche Untersuchung oder die Konsultierung des schulpsychologischen Dienstes verweigert, so hat der Leiter der Schule anstelle einer Strafanzeige davon die Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde zu verständigen. Schulen im Sinne dieser Bestimmungen sind die öffentlichen und privaten Schulen gemäß Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, die öffentlichen land- und forstwirtschaftlichen Schulen sowie alle anderen Privatschulen.“
Praktisch bedeutet das, dass Lehrer*innen beim Verdacht auf Drogengebrauch einer Schülerin oder eines Schülers zuerst die Direktion zu verständigen haben, die beim begründeten Verdacht auf Suchtmittelmissbrauch wiederum verpflichtet ist, eine schulärztliche beziehungsweise schulpsychologische Untersuchung zu veranlassen und die Eltern zu verständigen. Wenn der oder die Schüler*in die Untersuchung verweigert, muss die Schulleitung die Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde verständigen, es darf aber keine andere Behörde, also auch nicht die Polizei, verständigt werden. Vor dem Hintergrund der Leitlinie „Helfen statt strafen“ ist dies durchaus sinnvoll. Von den involvierten Vertreter*innen des Gesundheitswesens wird nun in weiterer Folge entschieden, ob und welche gesundheitsbezogenen Maßnahmen notwendig sind. Mit dieser Vorgehensweise versucht der Gesetzgeber, einen möglichst unaufgeregten und nicht stigmatisierenden Umgang mit dem Thema Drogen bei Kindern und Jugendlichen an den Schulen zu verfolgen. Ein Ansatz, der weit sinnvoller ist, als mit Strafen, Schulverweisen oder anderen disziplinierenden Maßnahmen ohnehin schon gefährdete Jugendliche auszugrenzen, ihnen Bildungschancen zu nehmen und damit den Weg in den weiteren Drogenmissbrauch zu fördern.
WIE DROGEN WIRKEN
Wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von Drogen sprechen, was ist der Unterschied zwischen harten und weichen Drogen und wozu zählt der Alkohol? Um diese Fragen zu beantworten, muss man zuerst den Begriff „Droge“ näher beleuchten. Fragt man hundert verschiedene Personen, welche Drogen sie kennen, werden wahrscheinlich Substanzen wie Heroin, Kokain, eventuell noch Cannabis oder LSD genannt. Zu einem hohen Prozentsatz vermutlich jene Substanzen, die gesellschaftlich weniger anerkannt und darüber hinaus verboten sind. Erweitert man diese Befragung hinsichtlich der Gefährlichkeit unterschiedlicher Drogen, stehen ebenfalls schnell die illegalisierten Substanzen ganz weit oben auf der Liste. An den Ergebnissen derartiger Untersuchungen wird auch deutlich, wie wenig Wissen tatsächlich über Drogen und deren Gefahrenpotenzial vorhanden ist. In einer österreichischen Bevölkerungsbefragung schätzten beispielsweise knappe 95 Prozent Drogen wie Heroin oder Kokain als gefährlich ein, aber auch LSD – das ein vergleichsweise niedriges Schadens- und Abhängigkeitspotenzial hat – halten 94 Prozent der Befragten für gefährlich, gleich an zweiter Stelle der risikobehaftetsten Substanzen nach Heroin. Sekt hält gerade einmal jeder Fünfte, Bier jeder Vierte für gefährlich. Drei Viertel glauben, auf Cannabis wird man leicht süchtig, nur ein gutes Drittel glaubt dies hingegen bei Wein oder Bier [100]. Einschätzungen, die in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Schadens- und Suchtpotenzial dieser Substanzen stehen.
Die meisten Menschen haben also ein Bild davon, was Drogen sind, oder zumindest eine vage Vorstellung. Hört man das Wort „Droge“ denkt man an Abhängigkeit, Gefährlichkeit, Risiko, eventuell sogar an Gefängnis oder Tod. Bilder von verwahrlosten Menschen, die in U-Bahn-Stationen oder auf öffentlichen Plätzen herumlungern, machen sich breit, vielleicht auch von Stars oder Mitgliedern der sogenannten High Society, die auf Partys Kokain sniefen. Drogen haben für viele Menschen etwas Abschreckendes, Gefährliches und Fremdes, auf andere wieder üben sie eine Faszination aus. So viele Bilder und Vorstellungen mit dem Begriff der Droge transportiert werden, so ungenau ist die Beschreibung, was er beinhaltet, eine wissenschaftlich exakte Definition des Begriffes gibt es nicht.
Auch die Herkunft des Wortes an sich hilft nicht wesentlich weiter. Der Begriff „Droge“ kommt vom althochdeutschen Wort drög, was so viel wie „trocken“ bedeutet und sich auf getrocknete Pflanzen oder Pflanzenteile zur Herstellung von Gewürzen oder pharmazeutisch wirksamen Arzneimittel bezieht. Folgt man der Begrifflichkeit, wären damit chemische Substanzen wie LSD oder Kokain keine Drogen, da sie nicht aus getrockneten Pflanzen bestehen. Auch im Englischen hat der Begriff drugs eine andere Bedeutung als im Deutschen, in den allseits verbreiteten drug stores kann man in den USA nämlich nicht Heroin und Kokain kaufen, sondern Arzneimittel, es handelt sich um Drogerien.
Der Begriff Droge beschreibt in unserem Sprachgebrauch in der Regel illegalisierte Substanzen und ist mit Mythen, Ängsten und Fantasien behaftet. Die fehlende Neutralität ist gleichzeitig ein Teil des Problems. Der Begriff transportiert immer eine bestimmte Bedeutung, für die meisten Menschen eine negative. So gibt es auf der einen Seite die in der Gesellschaft zumeist geächteten Drogenkonsument*innen, auf der anderen Seite die gesellschaftlich weitgehend anerkannten Alkoholkonsument*innen. Mit einem unterschiedlichen Gefährlichkeitspotenzial hat diese Unterscheidung nichts zu tun, es gibt durchaus einige Substanzen, die gemeinhin unter den Begriff Droge fallen, jedoch gesundheitlich weniger bedenklich sind als der Konsum von Alkohol. Diese Unterteilung in legalisierte und illegalisierte Substanzen zur Gefährlichkeitseinschätzung macht demnach nur bedingt Sinn. Auch Alkohol und Nikotin sind Drogen, nur wesentlich weiter verbreitete als Heroin, Kokain oder Cannabis.
Die exaktere sowie weniger moralisierende Bezeichnung ist psychoaktive oder psychotrope Substanzen. Darunter versteht man Stoffe, die in der Lage sind, die Wahrnehmung, das Verhalten, die Befindlichkeit oder Denkprozesse zu beeinflussen. Sie wirken auf das zentrale Nervensystem und lösen dort etwas aus. Sie regen an, beruhigen, verursachen Halluzinationen, führen zu Enthemmung, mehr Selbstvertrauen und vielem anderen mehr.
Nicht jede psychoaktive Substanz wirkt gleich, man kann sie grob in drei verschiedene Gruppen einteilen: betäubende Substanzen, halluzinogene Substanzen und stimulierende, aufputschende Substanzen, wobei es bei vielen von ihnen Überlappungen betreffend die Wirkungsbereiche gibt. Zu den betäubenden Substanzen zählen neben Heroin und Schlafmitteln der Alkohol, zu den stimulierenden neben Kokain das Nikotin. Der Begriff der psychoaktiven Substanzen unterscheidet also nicht zwischen legalen, gesellschaftlich anerkannten Drogen und solchen, die kriminalisiert und weniger verbreitet sind, sondern umfasst alle Substanzen, die in der Lage sind, unser Erleben, Befinden und unsere Wahrnehmung zu beeinflussen.
Ein weiterer Begriff, der in den Sprachgebrauch eingezogen ist, aber aus wissenschaftlicher Sicht wenig Sinn macht, ist die Unterscheidung zwischen „harten“ und „weichen“ Drogen. Diese Einteilung ist ein Versuch, Substanzen anhand ihres Gefährdungspotenzials zu differenzieren, und stammt ursprünglich aus der niederländischen Gesetzgebung. Der Besitz bestimmter „weicher“ Substanzen führt dort unter bestimmten Umständen nicht zur Strafverfolgung. Wo es in den „Coffee Shops“ einen toleranten Umgang mit Cannabis gibt, braucht es eine Abgrenzung zu anderen Substanzen, die als gefährlicher eingeschätzt werden und deren Besitz streng verboten ist. Zu den weichen Drogen zählen in der Regel Cannabis, zu den harten Kokain und Heroin. Doch der „Drogenmarkt“ ist noch viel größer und eine eindeutige treffgenaue Einteilung in eine der beiden Kategorien ist nicht möglich.
Manchmal verläuft die Trennlinie zwischen harten und weichen Drogen auch entlang der Art des Abhängigkeitspotenzials, bei weichen Drogen geht man landläufig davon aus, dass sie „nur“ psychisch abhängig machen, harte Drogen auch körperlich. Nichtsdestotrotz zählt Kokain zu den harten Drogen, obwohl es nur eine psychische und keine körperliche Abhängigkeit auslöst. Diese Trennung suggeriert, dass eine psychische Abhängigkeit weniger gravierend ist als eine körperliche. Die Realität ist aber, dass es sehr schwierig ist, eine rein psychische Abhängigkeit zu überwinden, eine körperliche ist zumindest mit medizinischer Unterstützung vergleichsweise einfacher zu lösen. Die meisten Betroffenen bekommen eine körperliche Abhängigkeit wesentlich schneller in den Griff als eine psychische. Die körperliche Abhängigkeit bei Opiaten wie etwa Heroin kann man mit einem Entzug, der in der Regel in ein paar Tagen vorbei ist, oder mit der Behandlung mit Drogenersatzstoffen bewältigen. Sie ist auf einer medizinischen Ebene relativ gut behandelbar, auf dem Weg der Genesung aber noch nicht einmal die halbe Miete. Die psychische Entwöhnung ist in der Regel wesentlich intensiver und langwieriger.
Dazu kommt, dass es eine Reihe von Substanzen gibt, die allgemein ein geringes Abhängigkeitspotenzial haben. Diese mit einer Klassifizierung als weiche Droge auf dieselbe Stufe zu stellen wie andere, vor allem neuere psychoaktive Substanzen, die zum Teil ein erhebliches psychisches Abhängigkeitspotenzial haben, wäre nicht gerechtfertigt. Aus diesen Gründen ist die Unterteilung in harte und weiche Drogen überholt und wird in der Wissenschaft nicht mehr verwendet, obwohl sie im Sprachgebrauch vieler Menschen noch vorhanden ist. Von der von ihr ausgehenden Dramatisierung oder Verharmlosung von bestimmten Substanzen, sollte man sich nicht verwirren lassen.
Welche Substanzen sind denn nun mehr, welche weniger gefährlich? Und was bedeutet „gefährlich“ überhaupt? Ist eine Substanz erst gefährlich, wenn dabei x Menschen pro Jahr an ihrer Toxizität sterben? Mit einer derartigen Definition wären nicht-substanzgebundene Süchte wie etwa die Spielsucht völlig ungefährlich. Menschen, die wegen hoher Spielschulden all ihr Hab und Gut verlieren und in die Beschaffungskriminalität abgleiten, werden vermutlich nicht bestätigen, dass Spielsucht ungefährlich ist. Es braucht demnach andere Indikatoren für die Beurteilung von Gefährlichkeit.
In einer Arbeit des britischen Psychiaters David Nutt [80], Professor für Neuropsychopharmakologie am Imperial College London, wurde die Gefährlichkeit verschiedener psychoaktiver Substanzen anhand einer Vielzahl von Merkmalen untersucht: Schäden, die der Konsum einer Substanz bei den Konsument*innen selbst verursacht, sowie Schäden bei anderen. Körperliche Folgeschäden wie drogenbezogene Todesfälle spielten genauso eine Rolle wie Folgeerkrankungen, seien dies Infektionen mit HIV oder Hepatitis C oder auch Krebserkrankungen durch Rauchen. Auch psychische und soziale Folgeschäden wie der Verlust von Beziehungen und Besitz wurden in der Untersuchung miteinbezogen. Auf der gesellschaftlichen Ebene wurde die Kriminalität, die der Konsum einer Substanz verursacht, ebenso berücksichtigt wie wirtschaftliche Folgeschäden. Es handelt sich dabei also um ein sehr vielschichtiges Modell, das die Gefährlichkeit von psychoaktiven Substanzen auf mehreren Ebenen untersucht. Etwas, das der Realität mit Sicherheit näher kommt als die Einteilung in harte und weiche Drogen.
Die Gefährlichkeit von zwanzig verschiedenen Substanzen wurde auf diese Weise von einem Expert*innenkomitee eingeschätzt, es zeigte sich ein wenig überraschendes Bild. Die insgesamt gefährlichste Substanz, zählt man die Schäden für die Konsument*innen selbst und die Schäden für andere zusammen, ist der Alkohol. An der zweiten, dritten und vierten Stelle stehen Heroin, Crack und Methamphetamin (Crystal Meth), Nikotin ist auf Platz sechs. Damit sind unter den sechs gefährlichsten Drogen zwei Substanzen, die nicht verboten sind: Alkohol und Nikotin. Cannabis steht bei dieser Reihung auf Platz acht, LSD auf Platz 18. Betrachtet man nur das Schadenspotenzial für die Konsument*innen selbst, sind drei illegalisierte Substanzen vorne: Heroin, Crack und Methamphetamin. An oberster Stelle für den Schaden bei anderen steht jedoch der Alkohol [80, 81





























