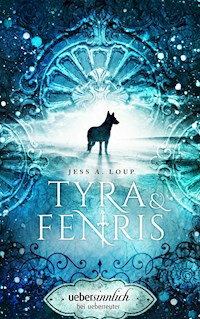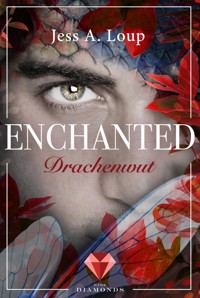5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Besiege den Feind und rette deine Liebe** Der einst so gefestigte Frieden der magischen Königreiche droht zerstört zu werden. Im Kampf verletzt findet sich Fiona, eine dunkle Sidhe, ausgerechnet in der Obhut von Connark wieder. Dabei ist er der Wilde von den Batari-Inseln, der sie einst entführt hat. Nur ihren Fähigkeiten als Heilerin und seinem unerwarteten Verantwortungsgefühl verdankt sie ihr Leben. Doch es gilt einen Krieg zu gewinnen, denn das mysteriöse Phantom ist noch immer nicht besiegt. Gemeinsam mit den Soldaten der Lichten Sidhe machen die beiden sich auf, um den Frieden aller Königreiche zu bewahren und die tragischen Ereignisse um Rhona und Lyksan zu rächen. Mit ihrer Reihe »Mysterious« entführt Jess A. Loup ihre Leser in eine zauberhafte High-Fantasy-Welt, die man bereits aus ihrer Bestseller-Trilogie »Enchanted« kennt und die nun mit einer neuen Generation eine ganz neue, wunderbar romantische Geschichte zu erzählen hat. Die »Mysterious«-Trilogie kann separat gelesen werden und benötigt keinerlei Vorwissen. //Dies ist ein Roman aus dem Carlsen-Imprint Dark Diamonds. Jeder Roman ein Juwel.// //Alle Bände der zauberhaften »Mysterious«-Trilogie: -- Mysterious 1: Zwergenerbe -- Mysterious 2: Druidenkraft -- Mysterious 3: Hexensturm// Die »Mysterious«-Reihe ist abgeschlossen. //Alle Bände der magischen »Enchanted«-Trilogie: -- Enchanted 1: Elfenspiel -- Enchanted 2: Prinzenfluch -- Enchanted 3: Drachenwut// Die »Enchanted«-Trilogie ist abgeschlossen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Dark Diamonds
Jeder Roman ein Juwel.
Das digitale Imprint »Dark Diamonds« ist ein E-Book-Label des Carlsen Verlags und publiziert New Adult Fantasy.
Wer nach einer hochwertig geschliffenen Geschichte voller dunkler Romantik sucht, ist bei uns genau richtig. Im Mittelpunkt unserer Romane stehen starke weibliche Heldinnen, die ihre Teenagerjahre bereits hinter sich gelassen haben, aber noch nicht ganz in ihrer Zukunft angekommen sind. Mit viel Gefühl, einer Prise Gefahr und einem Hauch von Sinnlichkeit entführen sie uns in die grenzenlosen Weiten fantastischer Welten – genau dorthin, wo man die Realität vollkommen vergisst und sich selbst wiederfindet.
Das Dark-Diamonds-Programm wurde vom Lektorat des erfolgreichen Carlsen-Labels Impress handverlesen und enthält nur wahre Juwelen der romantischen Fantasyliteratur für junge Erwachsene.
Jess A. Loup
Druidenkraft (Mysterious 2)
**Besiege den Feind und rette deine Liebe** Der einst so gefestigte Frieden der magischen Königreiche droht zerstört zu werden. Im Kampf verletzt findet sich Fiona, eine dunkle Sidhe, ausgerechnet in der Obhut von Connark wieder. Dabei ist er der Wilde von den Batari-Inseln, der sie einst entführt hat. Nur ihren Fähigkeiten als Heilerin und seinem unerwarteten Verantwortungsgefühl verdankt sie ihr Leben. Doch es gilt einen Krieg zu gewinnen, denn das mysteriöse Phantom ist noch immer nicht besiegt. Gemeinsam mit den Soldaten der Lichten Sidhe machen die beiden sich auf, um den Frieden aller Königreiche zu bewahren und die tragischen Ereignisse um Rhona und Lyksan zu rächen.
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Danksagung
Das könnte dir auch gefallen
© privat
Jess A. Loup versteht Deutsch, obwohl sie in Bayern lebt. Wenn sie nicht im Kopf mit imaginären Leuten spricht (oder über sie schreibt), ist sie auf dem Bogenparcours zu finden, lässt sich von ihren Katzen terrorisieren oder fotografiert wilde Tiere in Afrika. Solange der Brief aus Hogwarts verschollen bleibt, erschafft sie ihre eigenen magischen Welten.
Für Amire, deren Begeisterung für meine Bücher noch immer ungebrochen ist und mich jedes Mal freudig überrascht.
Prolog
Der Sturm hatte die ganze Nacht lang getobt, jedoch zum Morgen nachgelassen. Als der kleine Junge den schmalen, steinigen Strandstreifen erreichte, zerzauste der Wind ihm die langen Haare, kühlte sein vom Rennen verschwitztes Gesicht und sang ihm das Lied der Wellen vor, das ihn begleitete, seit er denken konnte. Er löste den kurzen Lendenschurz von der Hüfte und warf sich in das Wasser. Wie immer durchfuhr ihn bei der beißenden Kälte ein kurzer Schauer, bevor sich sein Körper daran gewöhnte. Seine schmächtigen Arme teilten das Nass mit erstaunlich kräftigen Zügen, und schon bald hatte er das Ufer hinter sich gelassen und befand sich kurz vor dem offenen Meer. Die Bucht verjüngte sich und er wusste, dass sich an dieser Stelle einige gefährliche Strudel befanden, aber auch, wie sie zu überwinden waren. Auf Suatie hatten weder Feiglinge noch Dummköpfe einen Platz und jeder, der des Schwimmens mächtig und gesundheitlich in der Lage war, stellte sich täglich diesem Kampf mit dem Meer. Allein schon wegen des jährlichen Rennens, einem Wettbewerb, bei dem alle Kinder und Jugendlichen der Insel gegeneinander antraten, schwamm er jeden Tag. Als Sohn des Häuptlings käme es einer Schmach gleich, nicht zu den Besten zu gehören.
Als der Sog ihn erfasste, wehrte sich der Junge nicht, sondern ließ sich mitziehen, hinunterreißen, bis er den steinigen Grund erreichte, vorbei an rauen und bösartig spitzen Felsen, an denen man sich leicht verletzen konnte. Erst hier ließ das heftige Ziehen nach, und wenige Schwimmzüge später konnte er sich vom Boden abstoßen und wie ein Fisch durch das Wasser schießen, bis er schließlich auf der anderen Seite der Bucht die Meeresoberfläche durchbrach. Er rang nach Atem; nur weil er dieselbe Strecke jeden Tag schwamm, bedeutete das nicht, dass sie jeden Tag gleich lange dauerte. An stürmischen Tagen waren die Wellenbewegungen heftiger und man brauchte viel mehr Kraft, um an den Strudeln vorbeizukommen.
Langsam beruhigte sich sein Herzschlag, während er den Blick schweifen ließ. Nie durfte man in seiner Aufmerksamkeit nachlassen, hatte ihm sein Vater erklärt. Nicht nur Raubfische konnten ihn leicht mit einem ihrer bevorzugten Beutetiere verwechseln, auch die riesigen Rokhs mit ihren gewaltigen Schwingen und armlangen, eisenharten Schnäbeln wussten selten einen Menschen von einer Robbe oder einem jungen Delfin zu unterscheiden. Er hatte bis jetzt erst ein einziges Mal einen von Weitem gesehen; sie waren seltener geworden, hatte die Vatersmutter berichtet. Doch damals – und er war noch so jung, dass ihm jeder Zeitraum, der länger als ein paar Tage dauerte, ewig vorkam – war er gleichzeitig zutiefst erschrocken und fasziniert gewesen.
»Wenn ich groß bin, werde ich einen fangen und auf ihm zu den fremden Ländern fliegen«, hatte er gesagt und war empört über das Gelächter der Erwachsenen gewesen. Was wussten die schon? Er würde es ihnen zeigen!
Der Junge schüttelte sich die Tropfen aus dem Gesicht und war soeben im Begriff, umzudrehen und zurückzuschwimmen, als die Morgensonne etwas in der Ferne reflektierte. Was war das? Manchmal näherten sich Wale oder Riesenschildkröten der Insel, und allein bei dem Gedanken daran lief ihm das Wasser im Mund zusammen, während sein leerer Bauch freudig grummelte. Er kniff die Augen zusammen, um im Gegenlicht besser sehen zu können, während er sachte Schwimmbewegungen machte, um nicht abzudriften. Das Grummeln in seinem Magen wurde zu einem Klumpen, noch bevor sein Verstand begriff, was er dort sah: Langboote. Drei, vier, fünf … Nicht die rundlichen, robusten Schiffe der Fischer, wie sie auf der Nordseite Suaties lagen: Dort, wo auch die Meereswächter permanent Ausschau hielten nach Feinden von den anderen Inseln. Nein, das hier waren Kampfboote, leicht, wendig, schnell! Das Aufblitzen, das ihn auf sie aufmerksam gemacht hatte, stammte von den metallenen Beschlägen der kleinen, runden Schilde, welche diese Krieger an der Reling befestigt hatten.
Wie ein Hai warf sich der Junge herum und tauchte ab, tief, tief in das Meer. Er musste schneller als der geflügelte Seeaal sein, um sein Dorf und seine Familie zu warnen. Niemand erwartete einen Angriff von dieser Seite, man glaubte sich durch die Bucht und die Gefährlichkeit der Durchfahrt sicher, doch der Junge wusste, dass es für zu allem entschlossene Seefahrer und Krieger nicht unmöglich war, die Meerenge zu überwinden. Der Strudel riss ihn mit sich, doch in seiner Panik hatte er nicht aufgepasst und den falschen Winkel des Eintauchens erwischt. Mit atemberaubender Brutalität schabte er über die mitleidslosen Felsen, welche die Bucht einrahmten; vor Schreck schluckte er Wasser. Die Luft wurde ihm knapp, die Schmerzen drohten, sein Bewusstsein schwinden zu lassen, doch er gab nicht auf, kämpfte sich zurück an die Wasseroberfläche, riss den Mund auf, hustete und keuchte. Der Blick über die Schulter ließ ihn beinahe erstarren – das erste Boot schoss kraftvoll über die heftigen Turbulenzen, schrammte am Felsen entlang und schwankte stark, stand kurz davor zu kentern. Doch die erfahrenen Seemänner mit ihren grauenvoll schwarz bemalten Gesichtern brachten mit kurzen, kontrollierten Ruderstößen das Boot durch, hin in das ruhigere Gewässer der Bucht. Dorthin, wo der Junge das Rennen seines Lebens schwamm. Er fegte durch das Meer, als wären ihm Flossen gewachsen, so wie es erzählt wurde über Nuralgar, den Fischgott, der einst auch ein gewöhnlicher Sterblicher war, bevor er wundersame Fähigkeiten entwickelte. Und wäre es um den reinen Wettbewerb gegangen, hätte der Junge es dieses Mal tatsächlich mit den Besten der Besten aufnehmen können, so schnell war er.
Doch hinter ihm ertönten bereits Rufe, rau und grob wie die Männer, die sie ausstießen. Sie hatten ihn gesehen und wussten, dass er nicht entkommen durfte. Er tauchte unter, arbeitete mit heftigen Bein- und Armschlägen, blieb so lange unter Wasser, bis ihm die Lunge brannte und es vor seinen Augen zuckte. Rechts und links von ihm prasselte etwas ins Meer, und er wusste, dass sie mit Kurzspeeren und Rajtas nach ihm warfen. Sie durften ihn nicht erwischen – nein, sie würden ihn nicht erwischen!
Noch im selben Moment, als er mit verbissener Entschlossenheit diesen Gedanken zuließ, traf ihn etwas an der Seite. Die Spitze eines dreizackigen, mit einer langen Wurfleine versehenen Speeres schlug eine tiefe, reißende Wunde in seine Hüfte und an seinem Bein entlang. Für einen entsetzlichen Moment dachte er, nicht einen Schwimmzug mehr machen zu können. Dann rollte er sich zur Seite, bevor der Krieger, der ihn getroffen hatte, durch einen geschickten Ruck die Spitze direkt in seinem Fleisch verankern und ihn wie einen wehrlosen Fisch aus dem Wasser reißen konnte. Im selben Augenblick erreichte er den flachen Bereich der Bucht, schabte mit den Knien über den körnigen Sand und sprang auf, hechtete in Richtung seines Dorfes. Wasser spritzte auf, als er ohne Rücksicht auf scharfe Muscheln und spitze Steine unter seinen Füßen losstürmte. Seine rechte Seite brannte, als hätte ihm jemand den Schürstock des Ewigen Feuers hineingestoßen, und einmal gab sein Bein unter ihm nach, sodass er stürzte und sich mehrmals überschlug. Doch er hörte auch den Rumpf des Bootes über den Sand schaben und wusste, ohne sich umzusehen, dass die anderen Boote folgen würden.
Er schrie, während er rannte. Es waren keine Worte, jedenfalls keine, die man verstehen konnte, die Hauptsache war nur, dass ihn jemand hörte, dass sein Dorf, seine Familie, sein Volk aufmerksam wurden und nicht hinterrücks überfallen werden konnten. Das gehässige Zischen von Rajtas ertönte, und er schlug Haken wie die mageren Feldhasen, die gelegentlich in den Dünen auftauchten, rannte Zickzack, ohne sich von seinem Kurs abbringen zu lassen. Endlich, endlich!
Die Spitze des Wehrturmes tauchte vor ihm auf, und er mobilisierte seine letzten Kräfte, warf sich regelrecht dem Schutz der Wächter entgegen. Noch einmal brüllte er aus vollen Lungen, spürte, wie ihm die Stimme brach, hörte seine Verfolger den Ton ändern; jetzt nicht mehr ärgerlich wegen des Jungen, der ihnen entkommen war, wurden sie tiefer, dumpfer, grollender. Kriegsgeheul, so alt wie die Welt, so grausam wie die Beben, die vor allem im Winter Suatie packten und schüttelten.
Schnüre wickelten sich um die Beine des Jungen, ließen ihn haltlos stürzen. Noch im Fallen warf er sich herum, starrte den fremden Kriegern entgegen. Der Aufprall nahm ihm die restliche Luft, und er schluchzte lautlos auf. Seine Finger krampften sich in den Boden, suchten nach einer Waffe und fanden doch nur karge, salzige Erde. Die ersten Verfolger setzten einfach über ihn hinweg, als wäre er lediglich ein Hindernis auf dem Weg zu ihrem eigentlichen Ziel. Kaum einer von ihnen schenkte ihm einen Blick, ihre kräftigen Beine wirbelten Staub und Dreck auf, als sie über ihn sprangen oder an ihm vorbeihetzten; ihre Augen starr nach vorn auf das Dorf gerichtet, ihre Finger so um ihre Waffen geklammert, dass der Junge ihre weiß verfärbten Knöchel erkannte. Sie rannten an ihm vorbei, als wäre er weniger als nichts, nicht einmal ihrer Beachtung wert, kein Feind, kein ernst zu nehmender Gegner, nur ein Kind.
Bis der letzte Krieger kam. Trotz der dicken schwarzen Streifen auf seinen Wangen sah der Junge, dass er schon alt war, mit tiefen Runzeln und Falten, die sich in seine von Wind und Wetter gegerbte Haut gegraben hatten. Dieser Mann blieb stehen, nahm ihn wahr. Einen Moment lang sahen sich der Junge und der alte Mann in die Augen, und in den braunen Tiefen des fremden Kriegers tauchte etwas auf, das Mitleid oder gar Bedauern sein mochte, als er seinen kurzen Speer hob und für zwei oder drei Herzschläge über dem Jungen verharrte.
Dieser Augenblick blieb unvergessen: der übermächtige, gewaltige Schatten des feindlichen Insulaners, der zögerte, das Kind eines fremden Stammes zu töten. Dann schnellte der Junge trotz seiner gefesselten Beine zur Seite und schleuderte dem alten Krieger Sand ins Gesicht. Der Mann brüllte auf und der Speer fuhr an die Stelle, an welcher der Junge soeben noch gelegen hatte. Hektisch wischte sich der Fremde über die Wangen, während ihm unwillkürlich Tränen aus den Augen strömten, sie dadurch aber auch von dem Dreck befreiten, der in sie eingedrungen war. Flink wie eine Eidechse kroch der Junge von ihm fort, wohl wissend, sein Leben war verwirkt, sobald sich der Alte wieder fing.
Im nächsten Moment hörte er dessen Aufschrei und wusste, er hatte seinen Speer erneut ergriffen. Er wälzte sich herum – der gegnerische Insulaner sollte sehen, dass er sich vor dem Tod nicht fürchtete.
Und Lerulgar, der Gott des Todes, so erzählten sie es ihm später, beschloss, an diesem Tag ein anderes Opfer auszuwählen. Als der Junge, nahezu keuchend vor Entsetzen, aufsah, schlug mit alles entscheidender Endgültigkeit ein schwarz-rot gefärbter Speer in die Brust des Mannes ein, fuhr mitten durch die Rippen hindurch, sodass die Spitze auf der anderen Seite wieder herausragte.
»Nicht meinen Sohn, du feiger Überrest eines stinkenden Walkadavers!«, brüllte eine Stimme, die so gewaltig war, dass sie wahrscheinlich auch Berge zum Einsturz bringen konnte, vorausgesetzt, auf Suatie hätte es Berge gegeben. Bevor ihm vor Schmerzen und Blutverlust die Sinne schwanden, sah der Junge die kraftvolle Gestalt des Häuptlings auf sich zurennen.
Der Name des Jungen war Connark arl Nevyar und er war sieben Jahre alt. An diesem Tag erhielt er die ersten Verletzungen, die Narben zurückließen, und seine erste Tätowierung.
Fiona
15 Jahre später
Die Sterne über ihr zwinkerten und drehten sich und der Mond pustete sein dickes Gesicht noch mehr auf, bevor er heller wurde und sich verzog. Das fand sie schade, denn er hatte so freundlich auf sie herabgesehen und sie die Kälte vergessen lassen, die ihr in die Glieder kroch. Ihre Hände waren kalt und klamm und die Arme überzog ein Schweißfilm. Fiona fror. Immer wieder driftete sie weg, doch wenn sie ihr Bewusstsein wiedererlangte, hatte sich nichts geändert außer dem Himmel. Vorhin hatte er so hell gewirkt, doch jetzt hüllten graue Schlieren die Sterne ein und ließen die Nacht dunkler wirken. Oder befanden sich die Schleier vor ihren Augen? Sie versuchte, vernünftig nachzudenken, praktisch zu handeln, doch sobald sie sich bewegte, zerriss sie der Schmerz an der Stelle, in der die lange, scharfe Scherbe steckte. Sie hatte rein instinktiv gehandelt, als der »Heilige« sie mit seinem widerlichen Grinsen angesehen und ihr angedroht hatte, bei ihr zu liegen. Sie wollte nicht sterben, nicht so, nicht indem sie zuließ, dass sich ihr ein Mörder und Intrigant aufzwängte. Und sie hatte auch keinen Schmerz ‒ die scharfe Spitze schnitt durch ihren Körper, als würde sie ein zartes Stück Rehlende zerteilen. Der Triumph, ihm den seinen verwehrt zu haben, spülte alle Gedanken und Empfindungen weg. Selbst als er ihr noch den Stiefel in die Brust rammte, in dem Moment, als sie schon vornübergesunken auf der Seite lag und Schwärze an den Rändern ihres Geistes drohte, nicht einmal da spürte sie etwas. Den Tritt nicht, seinen Hass nicht, gar nichts. Er schrie sie wutentbrannt an, sein Speichel flog ihr ins Gesicht, und plötzlich stürmte er davon, schneller, als jemand mit seinen Gebrechen in der Lage sein sollte. Fiona lag ruhig da, lauschte seinem Abgang, hörte vereinzelte Vogelrufe und das Rauschen des Windes, der kühl über ihre Haut strich. Und dann …
Dann brandete ein scharfer Schmerz in ihr auf, schneller und höher als eine Flutwelle, tobte und wütete, und sie konnte nur mühsam ein Schluchzen unterdrücken. Der zwergwüchsige Attentäter war nicht einmal auf die Idee gekommen, ihren Puls zu fühlen, und sie hatte das Gefühl gehabt, dass er sich vor dem Blut ekelte – selbst als er sie trat, hatte er sich vorgesehen, sie dort zu treffen, wohin sich das Blut noch nicht verteilt hatte. Doch wenn er sie vernahm, würde er vielleicht umkehren und sie endgültig töten.
Sie versuchte zu kriechen, von der Stelle zu kommen, an der sie lag, doch jede einzelne, die winzigste Bewegung löste ein entsetzliches Feuer in ihren Gliedmaßen aus, das sogar den Brand in ihrer Kindheit an Grausamkeit übertraf. Tränen rannen ihr über das Gesicht.
Einatmen. Ausatmen.
Nicht einmal das ging unwillkürlich, sie musste sich regelrecht darauf konzentrieren. Wenn sie nur nicht so frieren würde!
Die Einsamkeit quälte sie. Sie wollte nicht allein sein, sehnte sich nach der Geborgenheit, die sie bei den Soldaten gefühlt hatte. Die Soldaten! Bitte, flehte sie zu den Geistern des Waldes. Lass es ihnen gut gehen! Lass alle gesund sein und unverletzt, selbst …
Ja. Selbst Connark arl Nevyar. Noch vor einer Woche hatte sie ihm den Tod gewünscht oder hätte ihn in Kauf genommen, Hauptsache, sie wäre frei. Doch jetzt wünschte sie sich so sehr, dass alle ihre Gefährten überlebt hatten.
Vor ihren Augen verschwammen die Sterne, stattdessen sah sie das ernste, stille Gesicht von Ciaran vor sich, den polternden, aber herzlichen Lennox, Caitlyn, die sich wie eine Schlingpflanze um den jungen Menschen Lyksan wand, Hauptmann Rhona, die entschlossen ihr Kinn nach vorn schob, und den Barbaren, der sie so oft unter gesenkten Lidern beobachtete. Wahrscheinlich glaubte er, dass sie das nicht bemerkte, doch natürlich … natürlich hatte sie es gefühlt. Und ihr war nicht entgangen, wie weich sein Gesichtsausdruck wurde, sobald sie sich ihm zuwandte.
Doch sie erinnerte sich auch an die Flammen, den Krach einer Explosion, die sie vernommen hatte, als der Mann, der sie in diese Falle gelockt hatte, sie mit sich riss. Vielleicht waren sie alle tot und sie würde nie wieder die höfische Freundlichkeit des Novizen erleben, das Necken der Soldaten nicht mehr beobachten können und …
»Wildes Mädchen.«
Nein, auch das würde sie nicht mehr hören. Nie wieder. Sie weinte jetzt um die Sidhe und Menschen, die so nahe dran gewesen waren, von ihr Freunde genannt zu werden, und wieder drohte sie, das Bewusstsein zu verlieren.
»Wildes Mädchen, schschsch …«
Hatte sich ihr Geist bereits von den irdischen Gefilden verabschiedet und näherte sich den Ewigen Wäldern? Sie glaubte, laut und deutlich die Stimme des Wilden zu hören, ganz nahe bei ihr. Doch hatte sie nicht soeben vor sich selbst zugegeben, dass er tot war? Wie die anderen auch?
Sie lächelte. Ach, sie war manchmal so dumm. Es war nur logisch, seine Stimme zu hören, wenn er gestorben war und bereits in den Ewigen Wäldern auf sie wartete. Moment. Konnte das überhaupt sein? Ein Mensch, selbst ein Barbar, konnte doch nicht zu den Vorfahren der Sidhe gehen, wenn er starb? Und vor allem: Wollte sie das?
Sie wollte jedenfalls eines nicht: allein sein. Nicht jetzt. Nicht so.
Aber sie spürte ganz deutlich eine Hand an der Wange und riss die Augen auf. Wann waren sie ihr zugefallen? War sie tot? Oder lebte sie noch? Als Connark sie behutsam zu drehen versuchte, schrie sie gequält auf und er ließ sofort von ihr ab.
Dann schob sich sein kantiges Gesicht über das ihre und ihr wurde klar, dass niemand in den Ewigen Wäldern so aussehen würde. Blutig. Zerschunden. Die von Lennox geborgten Sachen hingen in Fetzen an ihm herunter, seine dunklen Augen lagen tief in den Höhlen. Er sah so zu Tode erschöpft und resigniert aus, wie sie sich fühlte.
»Wildes Mädchen«, flüsterte er ein drittes Mal. Sein warmer Atem glitt über ihr Gesicht und sie hätte am liebsten die Hände ausgestreckt und ihn festgehalten, wenn sie nicht so verkrampft gewesen wäre, dass sie die Finger nicht mehr rühren konnte. »Was ist passiert? Was kann ich tun?«
Nichts, dachte sie. Wie sollte ihr ein Wilder von den Batari-Inseln helfen können? Er zog scharf den Atem ein, als er bemerkte, worum sich ihre Hände verkrampften, doch er machte keine Anstalten, sie von der Scherbe zu lösen, wofür Fiona ihm geradezu dankbar war. Stattdessen stand er auf und entfernte sich von ihr, und sie wollte erleichtert sein, dass sie ihn los war, für immer diesmal, denn er würde keinen zweiten Blick an eine sterbende Frau mit einem verunstalteten Gesicht verschwenden. Trotzdem schnürte es ihr die Kehle zu und beinahe hätte sie sich dazu hinreißen lassen, ihn zurückzurufen.
Alles, nein, jeder war besser, als allein dem Tod ins Auge zu blicken. Sie schloss die Augen und wartete. Nach einer Weile, die ihr wie eine Ewigkeit vorkam, verließ sie ihre Angst – so lautlos und unverhofft wie Connark.
Nur dass dieser sie gar nicht verlassen hatte. Er kniete neben ihr nieder, streichelte mit federweichen Bewegungen über ihr Haar und die Wange, und als sie aufsah, bemerkte sie, dass er ihr ein zu einer Trinkschale gebogenes Blatt an den Mund hielt. Instinktiv trank sie und der bittere Geschmack der Flüssigkeit, die tröpfelnd in ihre Kehle rann, erinnerte sie an das Schmerzmittel, das Connark ihr vor einer gefühlten Ewigkeit gegeben hatte.
»Ich weiß, du bist müde«, sagte er rau, als sie das wenige Wasser, das er wahrscheinlich aus einer Pfütze besorgt hatte, ausgetrunken hatte. »Aber du darfst nicht schlafen, Fiona. Du musst mir sagen, was ich tun soll. Ich bin nur ein dummer Krieger, kein Heiler, und ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann.«
Sie wollte ihm widersprechen, ihm sagen, dass er nicht dumm sei, dass er nur zu dummen Handlungen neigte, wenn man bedachte, dass er sie entführt hatte. Aber das Krächzen, das aus ihrem Hals drang, war unverständlicher als das, was Connark von sich gab, wenn er aufgeregt war und schnell sprach und mit ihrer Muttersprache dann nicht mehr zurechtkam. Also ließ sie es und versuchte es wieder mit Ein- und Ausatmen.
Es ging besser. Ein bisschen. Die Sterne über ihr verglühten langsam, winkten ihr ein letztes Mal zu, und plötzlich fürchtete Fiona, sie nie wieder sehen zu können.
»Die Scherbe«, wisperte sie heiser. »Sie darf nicht bewegt werden. Nicht …«
»Nicht?« Er war ihr ganz nahe, das kupferfarbene Gesicht schwebte in stiller Konzentration über ihr.
»Allein.«
»Ich darf sie nicht allein entfernen?«
»Nein.«
Einatmen. Ausatmen. Der Schmerz nahm sich ein Beispiel an den Sternen und verblasste zu einem dumpfen schimmernden Pochen in ihrem Leib.
»Willst du … mich wirklich retten?«
»Ich würde mein Leben für dich geben!«, beteuerte er, was nach Fionas Meinung keine geeignete Antwort war, doch sie hatte keine Kraft, weiter nachzufragen oder zu diskutieren.
»Die anderen …«
Ein Schatten flog über sein Gesicht und ein schwerer Stein wuchs in ihrem Inneren, wie bei einem kleinen Gewässer, in das ein riesiges Ungeheuer einen Felsen geworfen hatte und damit alles unter sich begrub.
»Sie sind tot?«, fragte sie dennoch und versuchte, weder Entsetzen noch Hoffnung Raum zu geben.
Er schüttelte den Kopf, strich behutsam mit seiner großen, rauen Hand über ihre Stirn. »Lauf nicht weg, wildes Mädchen«, raunte er. »Gib nicht auf. Ich helfe dir. Wir helfen dir. Ich verspreche es. Du musst nur glauben.«
Sie wagte es nicht, den Kopf zu schütteln, aber sie konnte es auch nicht so stehen lassen. »Dein Windgott ist nicht …«
»Nicht an Arolgar«, unterbrach er sie schnell. »Glaub an dich. Du schaffst das, wildes Mädchen. Du bist stark. Und ich werde bald zurück sein.«
Wieder glitt er in die anbrechende Dämmerung davon, genauso wie ihr Bewusstsein. Doch ein winziger Teil ihres Geistes bemühte sich, nicht einzuschlafen, klammerte sich an seine Worte. War sie stark? Er hatte es schon einmal behauptet, doch bis jetzt war sie ihm den Beweis dafür schuldig geblieben. Mit erschreckender Leichtigkeit hatte er ihr wieder und wieder gezeigt, wie unterlegen sie ihm war. Doch jetzt würde sie sich seines Glaubens an sie als würdig erweisen. Nicht für ihn, natürlich nicht. Connark arl Nevyar bedeutete ihr nichts und sie war ihm nichts schuldig. Aber sie würde am Leben bleiben, schon allein deshalb, weil ein Wunsch in ihr erblüht war. Es war kein schöner Wunsch und einer Heilerin nicht würdig, aber es war etwas, woran sie sich festhalten und stärken konnte. Sirus musste das Handwerk gelegt werden. Was auch immer seine Pläne waren, Fiona hatte die Absicht, sie herauszufinden und zu durchkreuzen. Sie würde ihn – notfalls mit ihren eigenen Händen – vor das Tribunal schleifen, damit Recht über ihn gesprochen wurde. Das alles wollte sie sehen und erleben und sie malte es sich wieder und wieder in Gedanken aus, bis es nahezu einem Traum glich, den sie mühelos vor ihrem inneren Auge abrufen konnte.
War sie in einen richtigen Traum geglitten? Sie wusste es nicht, aber als Stimmen um sie her aufbrandeten, erwachte ihr träger Geist und mit ihm ein Teil ihrer Sinne. Der metallene Geruch ihres eigenen langsam trocknenden Blutes stieg ihr in die Nase und sie musste würgen. Der Ekel, der schaudernd durch ihren Körper raste, ließ das Feuer in ihr wieder auflodern.
»Fiona!« Das war Caitlyn, die neben ihr auf die Knie fiel, nur um sofort von Connark weggeschoben zu werden.
»Wildes Mädchen! Sag uns, was genau wir tun müssen, um dir zu helfen!« Seine Stimme klang so grob, der Akzent schwerer denn je, doch sie verstand ihn mühelos. Zumindest fast ein bisschen leichter als Caitlyn, die sich anhörte, als würde sie an all ihren Emotionen ersticken. Was war ihnen nur passiert? Fiona versuchte, die anderen auszumachen, konnte jedoch nicht an den beiden vorbeisehen. Bei den Sumpffeen, sie musste sich konzentrieren, doch das war schwer, wenn der eigene Geist ständig auf Wanderschaft gehen wollte!
Einatmen. Ausatmen.
»Nicht einschlafen!« Wieder Connark. Er sollte den Mund halten, doch gleichzeitig wünschte sie sich, er würde nie wieder aufhören zu reden. Solange er sprach, weilte sie noch in dieser Welt.
»Die Scherbe …«, stieß sie hervor. »Ich habe … versucht …« Sie rang nach Luft. Musste das Sprechen wirklich so schwerfallen? »… versucht, sie zwischen Hüfte und Nieren zu stoßen …« Sie biss sich auf die Unterlippe, ließ eine erneut aufwallende Schmerzenswelle über sich hinwegbranden, atmete durch sie hindurch.
»Einer muss … sie hinausziehen. Im selben Winkel wie … eingedrungen.«
Einatmen, ausatmen.
»Der andere muss … sofort … die Wunde verschließen. Tücher, Kleidung, irgendetwas. Bevorzugt … sauber. Und … sie muss genäht werden.«
»Genäht?« Im ersten Moment begriff sie nicht einmal, dass dieser panische Ausruf von Connark kam, so hoch hatte er geklungen.
»Ja … wie ich es bei … bei dir getan habe. An meinem Gürtel … in dem kleinen Beutel … findest du die Nadel und … Darmfäden.« Sie erinnerte sich gut daran, einige notwendige medizinische Kleinigkeiten nachgekauft zu haben in einem der kleinen Orte, die auf ihrem Weg nach Biligit lagen. Jetzt war sie froh darüber, denn das Wenige, das sie bei sich gehabt hatte, war alles für Connark verbraucht worden.
»Das kann ich nicht. Ich würde nie … ich könnte nie …« Was war mit dem Barbaren los? Er stotterte wie ein erschrockenes Kleinkind.
»Oh, bei den Bergfeen, Hohlkopf! Fällst du etwa auch um, wenn du Blut siehst? Nein? Gut! Du ziehst die Scherbe raus, wie es Fiona gesagt hat, verstanden?« Fiona hörte, wie etwas riss, und nahm an, dass Caitlyn aus einigen ihrer Sachen Verbände herstellte. Dann stieß die rothaarige Soldatin den Insulaner fort und beugte sich über sie. »Hab keine Angst, ja? Der große Mann hier und ich – wir schaffen das. Wir kriegen dich wieder hin. Hab schon öfter Wunden genäht, das ist gar nichts. Vertrau mir!«
Caitlyn war erschreckend blass, wie Fiona in der langsam aufziehenden Helligkeit bemerkte. Noch war die Sonne nicht aufgegangen, doch das würde nicht mehr lange dauern. War die Soldatin vielleicht selbst verletzt? Sie spürte ihre Hände behutsam an ihrem Leib, dann nestelte sie den kleinen Lederbeutel von ihrem Gürtel und zog sich wieder zurück.
Der Insulaner flößte ihr ein weiteres Mal ein wenig des bitteren Schmerzmittels ein, wobei er in seiner Sprache etwas murmelte, das gleichzeitig rau und beruhigend klang. Fiona begriff, dass er entweder etwas deklamierte oder sogar sang, und vermutete, dass er seinen geliebten Gott Arolgar um Beistand anflehte.
Er strich ihr mit seiner warmen, schwieligen Hand über die Haare, legte seine Finger dann über ihren Mund. Bevor sie sich fragen konnte, was er da tat, zuckte ein so grausamer Schmerz durch ihre Wunde, dass sie aufschrie – ein gedämpfter Laut wie der eines schläfrigen Nachtvogels, der verklang, kaum dass ihn jemand vernommen haben konnte. Fiona bäumte sich unbewusst auf, wurde jedoch von Connarks langen, muskulösen Armen umschlungen. Der Insulaner hatte die Plätze mit Caitlyn getauscht; er kniete jetzt direkt hinter ihr, hielt sie fest und sorgte dafür, dass Fiona stillhielt, während die Soldatin zuerst einen dicken Stoff auf ihre Wunde presste, das Blut, das sofort wieder herausströmte, abtupfte und dann mit erstaunlicher Kaltblütigkeit begann, die Wunde zu vernähen.
Fiona wollte schreien, doch sie warf nur den Kopf zurück und biss die Zähne zusammen. Connark drückte seine Stirn an die ihre, flüsterte und sang in einem so tiefen Tonfall, dass sie es mehr spürte als hörte, und beinahe konnte sie sich in eine Art Trance fallen lassen, ihre Wunde vergessen, den gestrigen Abend vergessen, die Schrecken, den Schock, das Blut und all die Gewalt … Wieso war ihr nie zuvor aufgefallen, was für eine wunderbar tiefe und dunkle Stimme der Barbar hatte?
Sie träumte. Sie musste halluzinieren, anders war ihr plötzlicher Gedanke nicht zu erklären. Es gab nichts an Connark arl Nevyar, das ihr gefiel, also konnte es auch nicht seine Stimme sein. Oder seine warmen Finger, die sich auf ihrer klammen Haut so gut anfühlten. Und warum …
»So, fertig«, sagte Caitlyn, hockte sich auf die Fersen, atmete tief durch und wischte sich den Schweiß von der Stirn, der trotz der nächtlichen Kühle darauf zu sehen war. Während sich Fiona von Connark hatte einlullen lassen, hatte sie mit schnellen Stichen die Wunde vernäht und Tücher darauf ausgebreitet. Jetzt wies sie den Insulaner an, Fiona behutsam anzuheben, und als er ihr Folge leistete, wickelte sie schnell und geschickt einen Verband um ihre Körpermitte.
Fiona wusste nicht, ob es an dem Schmerzmittel, an ihrer schwachen körperlichen Verfassung oder an etwas anderem lag, doch sie befand sich jetzt in einer Art dumpfer Erstarrung, in der Schmerzen und Angst keinen Platz mehr fanden. Sie erschrak nicht einmal, als sie wiederum Stimmen hörte, doch da weder Connark noch die Soldatin Anzeichen von Unruhe zeigten, nahm sie an, dass auch sie keine Panik zu empfinden brauchte.
Wenig später trafen Ciaran und Lennox ein, doch obwohl sie fieberhaft nach Rhona und Lyksan Ausschau hielt, konnte sie keinen der beiden entdecken. Dafür bemerkte sie etwas, das sie in wenigen, seltenen Momenten, wenn ihr altgediente Veteranen begegnet waren, schon gesehen hatte: eine Distanz in der Art, wie sie sich bewegten, wie ihre Augen einen glasigen Schimmer in sich trugen, im hohlen Klang der Stimme, die sie auch bei Caitlyn und dem Barbaren gehört hatte. Und dann begriff Fiona. Sie brauchte nicht mehr zu fragen, nicht mehr zu warten, dass der Novize oder Hauptmann Rhona auftauchten. Sie waren nicht mehr irgendwo unterwegs, um Spuren zu suchen oder um sie vor weiteren Feinden zu bewahren, sie bewachten keine Gefangenen und würden auch nicht mehr nachkommen. Sie waren tot.
Connark
Er drückte das wilde Mädchen an sich, froh darüber, im Moment nicht selbst denken zu müssen. Caitlyn hatte mit der Nadel und dem Stück Darm hantiert, als würde sie das jede Woche praktizieren, und was wusste er schon? Vielleicht stimmte es, was die Soldaten behaupteten: dass sie schon oft gegen Männer wie ihn, die Insulaner, gekämpft hatten. Und sollte das der Fall sein, würden sie natürlich auch verletzt werden, denn leichte Gegner waren sie nicht.
Als Fiona leise schmerzerfüllt aufstöhnte und den Kopf zurückwarf, beugte er sich vor, berührte ihre Stirn und sang ein Hilfegesuch an Arolgar. Er bat ihn darum, das Mädchen, welches er ihm bestimmt hatte, nicht noch mehr leiden und vor allem nicht sterben zu lassen; sicherheitshalber schickte er ein weiteres Gebet an Nuralgar. Kurz bevor Caitlyn fertig war, wandte er sich dem Totengott Lerulgar zu, doch dieses Mal flehte er nicht, im Gegenteil. »Wenn du sie mir nimmst«, drohte er innerlich grollend, »komme ich persönlich in dein Reich und entreiße sie dir. Und dich verbrenne ich, Stück für Stück. Ich hacke dir die Arme ab, die Beine, dann erst den Kopf und lasse all das in Feuer aufgehen.« Es war ihm ernst damit. Connark wusste, dass er sich selbst in große Gefahr brachte – die Götter der Batari-Inseln mochten nicht so allmächtig sein wie die der Menschen in ihren großen Städten und Dörfern oder so dramatisch wie die Geister der Sidhe, aber sie waren nachtragend. Und wenn Lerulgar irgendwann beschloss, sich für diese Drohung zu rächen, konnte es gefährlich für ihn werden. Connark störte das nicht. Er würde jeden Kampf aufnehmen, notfalls gegen alle Götter aller Völker gleichzeitig, wenn es sein musste, um Fiona vom Clan Oglivair zu retten.
»Wir haben das Kloster durchsucht«, sagte Lennox dumpf, der soeben mit Ciaran aufgetaucht war.
»Und?« Caitlyns Frage war eigentlich keine. Hätten die Soldaten etwas gefunden, hätten sie es gleich gesagt.
Ciaran schüttelte den Kopf. Lennox seufzte. »Er ist weg und ansonsten existiert niemand weiter hier. Keine Seele. Nicht mal Geister. Nichts. Er hat sich aus dem Staub gemacht, als wir kamen. Aber wir haben eine Unterkunft gefunden, die trocken und sicher wirkt.« Er machte Anstalten, Fiona aufzuheben, doch Connark knurrte ihn an wie einer der mageren Hunde von Windtost.
Der Soldat starrte ihn eine scheinbare Ewigkeit an, suchte in seinem Gesicht nach etwas, von dem Connark nicht wusste, ob er es finden würde. Trotzdem war er nicht bereit, das wilde Mädchen los- und aus seiner Obhut zu entlassen. »Du weißt, dass sie Angst vor dir hat, Insulaner?«, fragte Lennox mit überraschender Milde. Was auch immer er in ihm erkannt hatte, es störte ihn nicht. Andererseits hatte Lennox in dieser Nacht zu viel erlebt und gesehen, um sich von einem Mann beunruhigen zu lassen, der an seiner Seite gekämpft hatte, vermutete Connark.
»Nein«, sagte er stur wie ein kleiner Junge. »Jetzt nicht mehr. Nie mehr.«
»Da wäre ich mir nicht so sicher«, murmelte Caitlyn, die aufstand. Anscheinend hatte sie sich zu schnell bewegt, denn sie stolperte kurz, bevor sie sich wieder fing.
Lennox hielt sie am Arm fest. »Dann komm«, sagte er zu Connark, wandte sich um und ging mit schweren Schritten voraus. Noch nie hatte er einen Sidhe, die sich normalerweise durch ihre Eleganz auszeichneten, sich so schleppend bewegen sehen. Der Tod ihres Hauptmanns und des jungen Häuptlings musste sie hart getroffen haben, doch Connark fand zu seiner Verblüffung, dass selbst er davon nicht unberührt geblieben war. Der Fuchsling hätte ihn beinahe getötet, warum also tat der Gedanke daran, dass er nicht mehr lebte, so weh?
Er schüttelte den Kopf, darüber konnte er sich ein anderes Mal Gedanken machen. »Vielleicht wird es schmerzen, wildes Mädchen«, flüsterte er Fiona zärtlich zu. »Ich bringe dich jetzt an einen Ort, an dem du schlafen und dich erholen kannst. Irgendwohin, wo es warm ist, ich verspreche es.« Notfalls würde er aus dem Kloster selbst Holz herausschlagen, um ihr ein kleines, behagliches Lager zu schaffen.
Doch das musste er nicht, stellte er fest. Den Hauptteil des Klosters hatte es schwer getroffen, es war so eingefallen, dass man es nicht mehr benutzen konnte. Anscheinend war die Katastrophe, worum auch immer es sich dabei handelte, direkt vom Zentrum ausgegangen, denn das Mittelschiff sah aus, als wäre es von innen aufgebrochen worden. Starr ragten geborstene Holzträger wie verbrannte Knochenfinger in die Luft. Der Osten des Plateaus war jedoch nahezu unversehrt und hier hatten Ciaran und Lennox einen kleinen Anbau entdeckt, der offensichtlich bis vor Kurzem noch genutzt worden war. Als Connark mit Fiona auf dem Arm eintrat – er musste sich bücken, um unter den niedrigen Türstock zu passen –, fand er sich in einem schmalen Flur wieder, der rechter Hand in ein Büro führte. Ein Schreibtisch mit offenen Schubladen deutete darauf hin, dass jemand ihn in aller Eile geleert hatte, und Connark nahm den Geruch verbrannten Pergaments wahr. Kurz erspähte er beim Vorbeigehen einen Kamin in der Ecke, bevor er Lennox folgte, der ihn zu dem Zimmer auf der gegenüberliegenden Seite winkte. Ein Schlafzimmer mit einem schmalen, kurzen Bett, doch es würde reichen. Auch hier hatte sich jemand zerstörerisch betätigt. Die Schranktüren standen offen, Kleidung, die sich darin befunden hatte, war achtlos auf den Boden geworfen worden, zusammengeknülltes Bettzeug brachte Connark für einen Moment ins Stolpern, bevor er sich wieder fing.
Wieso hatte der zwergwüchsige Mörder so eine Hast an den Tag gelegt und war geflohen? Musste er nicht davon ausgehen, dass sie alle in der Explosion seiner Wurfgeschosse oder dem daraufhin ausbrechenden Feuer umgekommen waren? Doch er sagte nichts, nicht jetzt. Fiona brauchte Ruhe und Wärme, und auch wenn es sich sehr wahrscheinlich um das Bett des stinkenden, kleinen Hundsfotts handelte, würde sie sie hier finden. Wut schäumte in ihm auf, als er an den Mann namens Sirus dachte. Er musste für seine Tat büßen, denn so sicher, wie Arolgar den Wind kontrollierte, würde sich Connark auf die Suche nach ihm begeben und ihn für das, was er Fiona angetan hatte, zerreißen.
Er unterdrückte seine Emotionen, um das wilde Mädchen behutsam auf dem erstaunlich weichen Lager abzulegen, die Decken über sie zu breiten und sie anzusehen. Sie war bei Bewusstsein, zumindest so halb. Ihre Augen lagen auf halbmast und waren unfokussiert, was auch vom Schmerzmittel seiner Muttersmutter herrühren konnte; man neigte nach seiner Einnahme dazu einzuschlafen. Connark löste sich von ihrem Anblick, um nach einer Sitzgelegenheit zu suchen, doch bevor er fündig wurde, legte sich Lennox’ schwere Hand auf seine Schulter.
»Lass sie für den Moment allein«, sagte der Soldat leise und heiser. »Wir müssen uns besprechen und du sollst dabei sein.«
Hin- und hergerissen zwischen dem Bedürfnis, Fiona nie wieder aus den Augen zu lassen und zu erfahren, was die Soldaten herausgefunden hatten, blickte er zwischen der Heilerin und Lennox hin und her.
»Wir lassen die Tür auf. Niemand kommt an sie heran und sie wird jetzt ohnehin schlafen«, versicherte der Sidhe. In seinen Augen stand ein Ausdruck, den Connark nicht ganz deuten konnte – Mitleid? Der Soldat bemitleidete ihn? Warum sollte er? Nein, das musste falsch sein, seine Gefühle bezogen sich lediglich auf die eigenen Verluste und das verletzte Mädchen auf dem Bett.
Schweigend betraten sie das Arbeitszimmer. Caitlyn und Ciaran saßen eng nebeneinander auf dem Boden, die Köpfe an die Wand gelehnt. Lennox ließ sich auf der Ecke des robusten Schreibtisches nieder, also blieb für Connark der edle, lederne Stuhl hinter dem Tisch. Er setzte sich und wartete. Genau betrachtet war er noch immer ein Gefangener der Sidhe, obwohl sie zusammen gekämpft hatten. Auf Suatie würde das bedeuten, dass sie Waffenbrüder waren, durch Blut, Tod und Verlust für immer miteinander verbunden. Doch er befand sich weit weg von seiner Heimat und kannte die Gebräuche der Sidhe nicht gut genug, um einzuschätzen, was sie jetzt mit ihm vorhatten.
Es dauerte eine Weile, bis Lennox wieder das Wort ergriff. »Wir – Ciaran und ich, aber Caitlyn hat sich uns angeschlossen – haben beschlossen, dich freizugeben, Connark arl Nevyar. Du hast dich eines schweren Verbrechens schuldig gemacht, Fiona wäre die Erste, die dem zustimmen würde. Aber du hast auch an unserer Seite gestanden, als wir gegen einen Feind kämpften, der weitaus schlimmer ist als du. Es ist nicht so, als würden wir dir vergeben, das können wir nicht. Aber wir wollen dich weder verurteilen noch hinrichten, also haben wir entschieden, dich zu verbannen. Kehre zurück in deine Heimat und betritt nie wieder den Boden der Sidhe-Reiche, denn wenn du dann einer Patrouille in die Hände fällst, wirst du dem Recht des Tribunals nicht mehr entkommen.«
Connark musterte den Soldaten. Noch immer stand in seinen Zügen dieses seltsame Mitleid, und plötzlich begriff er. Lennox, der immer großspurige, anderen gegenüber scheinbar unaufmerksame Mann, bedauerte ihn tatsächlich – weil er annahm, er, Connark, würde Fiona nie wiedersehen. Vielleicht wusste der Sidhe, wie es war, unerwiderte Liebe zu fühlen? Es spielte keine Rolle. Connark würde nicht nach Suatie zurückkehren, nicht jetzt jedenfalls. So wie er die Sache einschätzte, war die Gefahr, dass seine Heimatinsel im Moment angegriffen wurde, relativ gering, denn anscheinend hatte der mörderische Wicht einige Häuptlingssöhne in seiner Gewalt – wenn es denn tatsächlich nur die wenigen Nachfolger der Anführer waren und nicht die Hälfte aller jungen Männer, wie er es von Connark gefordert hatte.
»Connark?«
Er sah auf, war so in seine Gedanken versunken gewesen, dass er vergessen hatte zu antworten. Es war Caitlyn, die ihn ansprach; sie beobachtete ihn unter ihren gesenkten Lidern hervor, während ihr Bruder die Augen geschlossen hielt, doch Connark ließ sich nicht täuschen. Der Soldat war mit Sicherheit nicht so schläfrig, wie er tat, und bereit, jederzeit aufzuspringen und zu reagieren, falls etwas passieren sollte.
Falls ich passieren sollte, dachte Connark müde. »Ich möchte euch meine Gedanken dazu mitteilen und bitte darum, dass ihr mich nicht unterbrecht, bis ich fertig bin«, sagte er. »Könnt ihr das tun?« Er hatte heute mehr Schwierigkeiten, Sidhe zu sprechen, als sonst, als unterdrückte die Erschöpfung auch seine Fähigkeit, die Worte zu formulieren.
»Ich gebe nicht mein Wort, bin aber gespannt«, murmelte Caitlyn. Sie brauchten alle Ruhe, stellte er fest, doch nicht, bevor sie grundsätzlich geklärt hatten, wo sie standen. Lennox nickte zustimmend, Ciaran reagierte wie üblich lediglich durch ein kaum wahrnehmbares Neigen des Kopfes.
»Ich kehre nicht zurück nach Suatie«, sagte Connark langsam und wählte seine Worte mit Bedacht. Lennox stieß ein leises Knurren aus, unterbrach ihn jedoch nicht, wofür Connark ihm dankbar war. »Nicht, weil ich euch unterschätze oder nicht ernst nehme. Aber ich kann nicht tun, was ihr verlangt. Es gibt etwas, das wichtiger ist als die Strafe, die mich bei euch erwartet, zumal wir uns hier auch in keinem der beiden Sidhe-Reiche befinden.«
Jetzt mischte sich doch Caitlyn ein. »Geht es um Fiona? Du kannst sie nicht haben, egal was du denkst. Wenn du dich ihr wieder aufdrängst, töten wir dich. Darauf gebe ich dir mein Wort. Kein Mann wird eine Sidhe zu der seinen machen, die das nicht will.«
Connark dachte nach. Ging es um das wilde Mädchen? In gewisser Weise schon, aber nicht so, wie es Caitlyn vermutete.
»Ich werde nicht lügen und behaupten, dass ich sie aufgebe«, antwortete er und beobachtete, wie die Hand der Soldatin zum Griff ihres Schwertes fuhr. »Aber ich kann euch versprechen, dass ich Fiona vom Clan Oglivair niemals wieder einfangen und sie nicht gegen ihren Willen auf meine Insel bringen werde. Sie darf nie wieder in Gefahr geraten, und damit hat meine Entscheidung zum größten Teil zu tun. Ich kehre nicht nach Suatie zurück, weil ich den Mann, der sich Sirus nennt, jagen und töten will. Wohin auch immer er geflohen ist, ich finde ihn. Er kann sich nicht sein ganzes Leben lang vor mir verstecken.« Ihm fiel seine Frage von vorhin ein, also stellte er sie. »Warum ist er eigentlich geflohen – und wie? Ich habe hier nirgends Spuren von Pferdehufen gesehen.«
Lennox unterdrückte ganz offensichtlich ein Gähnen. »Er besitzt ein Fluggerät. Einen Korb mit aufgeblasenem Stoff darüber. Irgendwie muss er bemerkt haben, dass wir überlebt haben – wahrscheinlich, als wir den Weg hinaufrannten, um Fiona zu suchen. Ciaran und ich haben ihn davonfliegen sehen, als wir anfingen, das Kloster zu durchsuchen. Das muss zu dem Zeitpunkt gewesen sein, als ihr Fiona gefunden habt.«
Fast hätte er gelacht. Ein Fluggerät? Was für ein Unsinn – nur Arolgar beherrschte den Wind, kein anderes Wesen würde je in der Lage sein, es ihm nachzutun. Doch Connark hielt inne. Würde das nicht erklären, wie der angebliche Heilige auf ihre Inseln gelangt war? Er hatte immer behauptet, ein Nachfolger des Fischgottes Nuralgar zu sein, und sie waren mehr als bereit gewesen, ihm zu glauben. Sein Aussehen und die Tatsache, dass er überhaupt die Inseln erreichte, ohne an den vielen Untiefen und verborgenen Riffen zu kentern, sprachen dafür. Nur Batari-Insulaner wuchsen mit dem Wissen über all die gefährlichen Strudel auf, die ihr Archipel umgab, niemals zuvor war es einem Fremden gelungen, sie zu erreichen. Doch der mörderische Wicht hatte sie nicht nur einmal besucht, er war öfter da gewesen, jedes Mal ohne dass jemand mitbekommen hatte, wie er ihre Insel betrat. Also war es vielleicht doch möglich? Connark versuchte, sich ein Fluggerät vorzustellen, wie es Lennox beschrieben hatte, scheiterte jedoch. Trotzdem …
»Das ist schlecht.« Er dachte eher laut, als dass er wirklich mit den Soldaten redete. »Ich weiß nicht, wie man Spuren in der Luft verfolgen kann.«
»Wir auch nicht!«, blaffte Caitlyn ihn an. Zornige Röte stieg in ihre Wangen. »Und du kannst nicht einfach beschließen, unseren Bann zu ignorieren, Insulaner!«
»Rechtlich gesehen – er kann«, warf da zum ersten Mal ihr Bruder ein. »Die Verbannung gilt nur für unsere Völker, nicht für Menschen und andere Rassen.«
Stur schob die Soldatin ihr Kinn vor. »Er würde uns höchstens in die Quere kommen!«
Natürlich! Auch die Sidhe würden darauf brennen, den Mörder ihrer Angehörigen und Freunde zu stellen! Connark hob die Hand. »Bitte.« Er neigte nicht oft dazu, jemanden um etwas zu bitten. Als Sohn des Häuptlings hielt er es für sein Recht, Forderungen zu stellen. Doch er sah ein, dass er damit hier nicht weiterkommen würde, und er musste sicher sein, tun zu können, was er sich vorgenommen hatte. Nicht nur, dass er den Verrat an seinem Volk – und nichts anderes war es, was Sirus an ihm und selbst den Männern der anderen Inseln verbrochen hatte – rächen wollte. Möglicherweise konnte sich das als seine Chance erweisen, Fiona zu zeigen, dass er ihrer doch würdig war. »Ich denke, wir haben dasselbe Ziel und wir könnten uns gemeinsam auf die Jagd machen. Mittlerweile bin ich nicht mehr gänzlich nutzlos, auch wenn mein Körper noch immer nicht ganz so funktioniert, wie ich es von ihm gewohnt bin. Wir könnten ein weiteres Mal Seite an Seite kämpfen und ich verspreche euch, euer Leben so zu verteidigen und zu schützen, als wäre es mein eigenes. Mein Blut ist euer Blut, ich vergieße nicht das Blut der Familie.«
Es war das höchste Versprechen, das ein Waffenbruder auf Suatie dem anderen machen konnte, doch er erwartete nicht, dass die Sidhe das verstanden.
Ausgerechnet Caitlyn überraschte ihn. »Als ob ich mich von einem Menschen beschützen lassen würde«, schnaubte sie, doch dann glitt ein winziges Lächeln in ihre Mundwinkel, auch wenn es ihre Augen nicht erreichte. »Aber wir denken über deine Worte nach. Vielleicht könnten wir dich jedes Mal vorschicken, wenn uns jemand mit einer Armbrust oder Bogen bedroht. Groß genug als Ziel bist du ja.«
Lennox stand auf. »Gut. Belassen wir es für den Augenblick dabei. In diesem Haus gibt es mehrere Schlafplätze. Legt euch hin und ruht euch aus, ich übernehme die erste Wache.«
Er war schon an der Tür, als er sich noch einmal umdrehte. »Oh, und Connark: Halte dich von Fiona fern. Caitlyn wird auf sie aufpassen.«
Unter dem Schreibtisch ballte Connark die Fäuste, bezähmte jedoch den Ärger, der in ihm überzubrodeln drohte wie die heiße Quelle im Westen Suaties. Er musste das Vertrauen der Soldaten erringen, nur dann würde es ihm möglich sein, wieder in die Nähe des wilden Mädchens zu gelangen. Widerwillig nickte er, erhob sich und schlüpfte aus dem Zimmer. Auf dem Weg in das obere Stockwerk konnte er einen kurzen Blick auf Fiona erhaschen, bevor ihn Caitlyn aus dem Weg schob. »Geh, großer Mann. Ich werde dich sofort rufen, sollte sie erwachen und das Verlangen nach deiner Gesellschaft verspüren.«
Zum ersten Mal erfuhr Connark, dass Spott mehr schmerzen konnte als die tiefste Wunde.
Fiona
Sie war wieder zurück in dem brennenden Haus und überall um sie herum prasselten die Flammen, Hitzezungen leckten über ihre Haut und rauchende Trümmer stürzten auf ihren Körper. Sie musste Rory hier rausbringen, musste ihn schützen, er war noch so klein, und jetzt weinte er und …
Sie schrak hoch, rang nach Luft, dachte: Das ist nicht die Wirklichkeit, nur ein Albtraum! Und dann raste das Feuer im wachen Zustand durch ihren Leib und sie keuchte auf, presste die Hand an ihre Seite.
»Ganz ruhig«, sagte jemand und sie wandte den Kopf. Zu ihrer Linken saß Caitlyn auf einem harten Holzstuhl, der aussah, als würde er jeden Moment unter ihrem geringen Gewicht nachgeben. Er ächzte, als sich die Soldatin nach vorn beugte und Fionas Hand ergriff. »Ihr seid in Sicherheit, es ist gut«, fuhr Caitlyn fort. Ihre Finger waren warm und fast so rau wie die des Barbaren, fand Fiona. Der Vergleich ließ ihren Puls in die Höhe schnellen, denn sowohl Caitlyn als auch Connark hatten ihr Leben mit Kämpfen verbracht, kein Wunder, dass sie ähnliche körperliche Merkmale aufwiesen. Und doch sollte das kein Grund sein, sich zu erschrecken.
Einatmen, ausatmen.
Sie musste sich beruhigen, durfte nicht aus Angst oder Panik anfangen, sich hektisch zu bewegen und die Wunde wieder aufzureißen. Caitlyn gab ihr die Zeit dazu, tat sogar so, als müsste sie ihr Schwert inspizieren, obwohl selbst Fiona sah, dass es makellos sauber und gereinigt war.
Schließlich traute sie ihrer Stimme wieder. »Erzählt Ihr mir, was passiert ist, nachdem … als ich weg war?«
Die Ruhe und Gelassenheit, die Caitlyn ausgestrahlt hatte, war nur eine Maske gewesen, erkannte sie, als sich das Gesicht der Soldatin verzog und sie leise seufzte. »Ich hätte mir gewünscht, niemals wieder darüber reden zu müssen«, erwiderte sie leise und ihr Blick suchte den Fionas. »Aber irgendwann muss ich ohnehin unseren Vorgesetzten und dem hohen Lord Tyric berichten, also kann ich mich genauso gut jetzt schon wappnen und darauf vorbereiten.« Sie holte tief Luft, fast ein wenig, wie Fiona es als Ritual tat. »Als der Sauhund Euch in seinen Klauen hatte, warf er etwas zu Boden, das eine Explosion und Feuer auslöste. Ciaran, der Barbar, Lennox und ich befanden uns zu dem Zeitpunkt eher zufällig direkt an den Wänden des Hauses, sodass uns weder die Explosion erwischte noch die Flammen erreichten. Doch Rhona …« Sie schluckte kurz, fasste sich jedoch schnell wieder, auch wenn ihre Stimme flacher wurde. »Der Chief und unser Fuchsling standen in der Mitte des Schankraumes. Etwas … ich verstehe es immer noch nicht. Etwas Seltsames passierte, und ich bin nicht sicher, ob es dieser mörderische Heilige geplant hatte. Der Boden öffnete sich unter ihnen und Lyksan stürzte hinunter – oder fast, denn Rhona schaffte es irgendwie, ihn abzufangen. Und dann hingen sie über einem Abgrund – Fiona, das könnt Ihr Euch nicht vorstellen! Unter dem Haus befand sich ein Abgrund! Wie kann so etwas sein? Die Geister und Feen der Sümpfe müssen sich doch dabei was gedacht haben, etwas so Unnatürliches zu erschaffen? Wie kann es unter einem Haus auf Höhe des Meeres einen Abgrund geben, der so tief ist, dass kein Ende abzusehen ist?«
Caitlyn starrte blicklos ins Leere, für einen Moment wieder zurückversetzt in die vergangene Nacht.
Fiona wartete, fand keine Worte. »Eine Heilerin«, hatte ihre Professorin an der Universität der Freien Stadt Antochtnar immer gesagt, »muss nicht nur mit den körperlichen und seelischen Gebrechen umgehen können, sie muss auch Einfühlungsvermögen beweisen.« Fiona fühlte viel zu viel auf einmal, um auch nur ansatzweise tröstende Worte zu finden. Und welchen Trost sollte es auch für den Verlust von Freunden und Kameraden geben? Nein, sie schwieg lieber, als an dem Kloß in ihrem Hals vorbei nichtssagende, sinnlose Äußerungen von sich zu geben, die niemandem halfen. Sie fand auch keine Antwort auf die Frage der Soldatin, und ihre Hilflosigkeit machte sie stumm.
»Rhona hatte nur noch Halt auf einem Balken«, flüsterte Caitlyn. »Wir kamen nicht an sie heran, also versuchten wir, die Zügel und Seile von den Pferden zusammenzubinden, um sie hinüberzuwerfen.« Sie knirschte mit den Zähnen. »Wir waren zu langsam. Ich … ich war ihnen am nächsten, aber auch ich erreichte sie nicht. Und ich hörte, was der Fuchsling zum Chief sagte.«
Fiona schluckte. Sie konnte es sich vorstellen. Auch wenn sie erst so wenig Zeit mit diesen Leuten verbracht hatte, hatte sie das Gefühl, sie besser zu kennen als die Leute ihrer Stadt.
»Er sagte … er sagte, sie solle ihn loslassen … dass sie sich retten sollte.« Caitlyn verbarg den Kopf in den Händen, ihre Stimme klang nur noch dumpf unter ihnen hervor. »Bei den Geistern, sie hätte es schaffen können, doch sie dachte keinen Wimpernschlag lang darüber nach, hat ihn stur gehalten und dann …«
»Hat er wahrscheinlich etwas getan, das unglaublich mutig und ehrbar war. Losgelassen oder sich ihr entwunden?« In Fionas Augen traten Tränen.
Caitlyns Atemholen klang wie ein unterdrücktes Schluchzen. »Etwas in der Art«, bestätigte sie rau. »Ich konnte es nicht genau sehen. Er rief, dass er sie liebte, aber ich hörte, dass er bereits fiel. Und Rhona brüllte, schrie … um ihn.«
»Hat sie …?«, fragte Fiona entsetzt.
Die Soldatin schüttelte den Kopf. »Nein, sie hat sich nicht hinterhergestürzt, das hätte Lyksan auch nicht mehr gerettet. Der Balken gab unter ihr nach, nur Sekunden, bevor wir das Seil endlich fertig hatten.«
Natürlich hatte Fiona bereits Ähnliches vermutet, und doch schockte sie dieser Bericht zutiefst. »Habt Ihr ihre Körper gefunden, damit die Seelen in die Ewigen Wälder eingehen können?«
»Das ist das Schlimmste überhaupt!«, stieß Caitlyn hervor. »Ich habe mich an dem Seil herabgelassen, beinahe sechzig Fuß tief. Und ich kam noch immer nicht bis zum Grund, konnte nicht einmal ein Ende der Tiefe erkennen. Ich warf eine Fackel hinunter, doch sie verlosch in der Dunkelheit, bevor sie irgendwo auftraf. Es ist wie ein unendlicher Schlund, ohne ein Ende, und ich bete zu den Geistern, dass ich mich irre, dass sie nicht bis ans Ende aller Tage ins Dunkle stürzen und nie die Ewigen Wälder erreichen.«