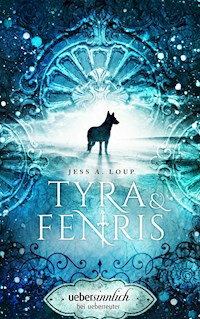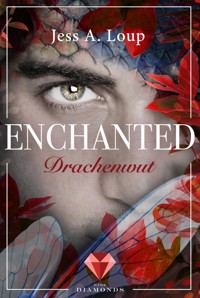5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Suche den Elfenfeind und bewahre die Königreiche** Selten hat zwischen den Elfen, Hexen, Drachen und Menschen der magischen Königreiche so lange Frieden geherrscht wie jetzt. Dass nun ausgerechnet die Barbaren der benachbarten Batariinseln und die damit einhergehenden mysteriösen Vorkommnisse ihn zerstören sollen, erschüttert die sonst so furchtlose Kriegerin Rhona zutiefst. Entschlossen macht sich die heimliche Tochter des Elfenkönigs der Lichten Sidhe daran, den mörderischen Spuren eines geheimnisvollen Phantoms zu folgen und muss dafür eine lange Reise antreten. Ihr zur Seite gestellt wird Lyksan, ein Druidengehilfe der Dunklen Sidhe, der als Menschenwaise von Zwergen herangezogen wurde. Ein ungewöhnliches Paar für eine ungewöhnliche Suche, von deren Ausgang die Zukunft aller abhängt… Mit ihrer Reihe »Mysterious« entführt Jess A. Loup ihre Leser in eine zauberhafte High-Fantasy-Welt, die man bereits aus ihrer Bestseller-Trilogie »Enchanted« kennt und die nun mit einer neuen Generation eine ganz neue, wunderbar romantische Geschichte zu erzählen hat. Die »Mysterious«-Trilogie kann separat gelesen werden und benötigt keinerlei Vorwissen. //Dies ist ein Roman aus dem Carlsen-Imprint Dark Diamonds. Jeder Roman ein Juwel.// //Alle Bände der zauberhaften »Mysterious«-Trilogie: -- Mysterious 1: Zwergenerbe -- Mysterious 2: Druidenkraft -- Mysterious 3: Hexensturm// Die »Mysterious«-Reihe ist abgeschlossen. //Alle Bände der magischen »Enchanted«-Trilogie: -- Enchanted 1: Elfenspiel -- Enchanted 2: Prinzenfluch -- Enchanted 3: Drachenwut// Die »Enchanted«-Trilogie ist abgeschlossen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Dark Diamonds
Jeder Roman ein Juwel.
Das digitale Imprint »Dark Diamonds« ist ein E-Book-Label des Carlsen Verlags und publiziert New Adult Fantasy.
Wer nach einer hochwertig geschliffenen Geschichte voller dunkler Romantik sucht, ist bei uns genau richtig. Im Mittelpunkt unserer Romane stehen starke weibliche Heldinnen, die ihre Teenagerjahre bereits hinter sich gelassen haben, aber noch nicht ganz in ihrer Zukunft angekommen sind. Mit viel Gefühl, einer Prise Gefahr und einem Hauch von Sinnlichkeit entführen sie uns in die grenzenlosen Weiten fantastischer Welten – genau dorthin, wo man die Realität vollkommen vergisst und sich selbst wiederfindet.
Das Dark-Diamonds-Programm wurde vom Lektorat des erfolgreichen Carlsen-Labels Impress handverlesen und enthält nur wahre Juwelen der romantischen Fantasyliteratur für junge Erwachsene.
Jess A. Loup
Zwergenerbe (Mysterious 1)
**Suche den Elfenfeind und bewahre die Königreiche** Selten hat zwischen den Elfen, Hexen, Drachen und Menschen der magischen Königreiche so lange Frieden geherrscht wie jetzt. Dass nun ausgerechnet die Barbaren der benachbarten Batariinseln und die damit einhergehenden mysteriösen Vorkommnisse ihn zerstören sollen, erschüttert die sonst so furchtlose Kriegerin Rhona zutiefst. Entschlossen macht sich die heimliche Tochter des Elfenkönigs der Lichten Sidhe daran, den mörderischen Spuren eines geheimnisvollen Phantoms zu folgen und muss dafür eine lange Reise antreten. Ihr zur Seite gestellt wird Lyksan, ein Druidengehilfe der Dunklen Sidhe, der als Menschenwaise von Zwergen herangezogen wurde. Ein ungewöhnliches Paar für einen ungewöhnlichen Fall, von dessen Aufklärung die Zukunft aller abhängt …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Danksagung
Das könnte dir auch gefallen
© privat
Jess A. Loup versteht Deutsch, obwohl sie in Bayern lebt. Wenn sie nicht im Kopf mit imaginären Leuten spricht (oder über sie schreibt), ist sie auf dem Bogenparcours zu finden, lässt sich von ihren Katzen terrorisieren oder fotografiert wilde Tiere in Afrika. Solange der Brief aus Hogwarts verschollen bleibt, erschafft sie ihre eigenen magischen Welten.
Natalie gewidmet,
die mir jederzeit im stürmischen Meer der deutschen Sprache mit souveräner Gelassenheit den Rettungsring zuwirft.
Prolog
Diesen Teil der Mine hatte Keirie einige Zeit nicht mehr betreten; bis vor wenigen Monaten hatten sie hier Silber abgebaut, doch mittlerweile war der Stollen frei von allen Schätzen, die man der Erde abtrotzen konnte. Ihm war auch nicht ganz klar, was ihn überhaupt hierhergezogen hatte. Wahrscheinlich hatte er am Abend zuvor einfach zu viel des guten Weins genossen, den der junge Fürst zum fünften Jahrestag seines Handfastings mit Lord Heliarkos hatte springen lassen. Das erklärte zwar nicht seinen Drang, sich in einer Ecke des Bergwerks herumzutreiben, in dem sich außer Bruch und Steinbrocken nichts mehr befand, aber wie sonst hätte er es rechtfertigen sollen?
Seine Laterne flackerte, kein gutes Zeichen. Die Luft wurde dünner. Manchmal, wenn sie einen Gang so tief in die Felsen getrieben hatten, dass sie einen Teil der Erde selbst zerstörten, geschah etwas Schlimmes. Keirie und seinen Leuten war zum Glück noch nie etwas widerfahren, doch er hatte davon gehört. Etwas Dunkles trat dann aus dem verletzten Gestein, etwas, das giftig war wie der Atem der Todesfeen und genauso schnell das Leben eines jeden Unterweltlers beendete.
Ein Wimmern ertönte, und der alte Zwerg erstarrte. War es das? Eine Todesfee? Riefen ihn die Banshees zu sich? Sicher, er war nicht mehr der Jüngste, und die Geister wussten, dass er verdammt viel dummes Zeug angestellt hatte, doch er hatte versucht, es wiedergutzumachen, oder? Konnte es sein, dass alles, was er in den letzten Jahren getan und aufgebaut hatte, nichts wert war? Keirie wollte nicht sterben, nicht zu diesem Zeitpunkt und, wenn es irgendwie möglich war, auch nicht in den nächsten Jahren. Für sein Alter war er stark und wendig, und die Spitzhacke und das Beil schwang er wie ein junger Zwergling. Kein Mensch hatte ihm kräftemäßig etwas entgegenzusetzen, also warum sollte er ausgerechnet jetzt vor seine Ahnen treten? Schweiß brach ihm am ganzen Körper aus, als er daran dachte, wie er seinen in die Ewigkeit vorausgegangenen Vorfahren erklären sollte, dass es allein seine Schuld war, den Namen Dunkelbrock befleckt zu haben. Dafür war die ganze Familie ausgestoßen worden aus dem Stamm der stolzen und angesehenen Zwerge des nördlichen Toharischgebirges. Aber er hatte in den letzten Jahren doch alles getan, um zu sühnen, oder etwa nicht? Hatte er nicht Fürst Rupard und Lord Heliarkos geholfen, das Fürstentum nach ihren Vorstellungen zu gestalten? War es nicht seinem Fürspruch zu verdanken, dass das Wissen über Magie und Zauber, welches seine Familie besaß, weitergegeben wurde? Unterstützte er etwa nicht die Armen, die manchmal an seine Tür klopften und um etwas zu essen und eine Unterkunft für eine Nacht baten?
O doch, das tat er! Und die Geister und Feen sollten verflucht sein, wenn sie ihm nicht mehr Zeit gaben, die Fehler seiner Vergangenheit gutzumachen!
Er straffte sich, und obwohl die Laterne in seiner Hand ein wenig zitterte … ach was. Die zitterte nicht! Es lag nur an dem schummrigen Licht und dem schlechten Untergrund, auf dem er nicht gerade laufen konnte, dass die Schatten über die feuchten Wände tanzten! Ein Zwerg fürchtete sich nicht, niemals, und schon gar nicht vor dem Tod. Keirie schnaubte verächtlich.
In diesem Moment hörte er es wieder. Ein Winseln, leise, aber für seine geschärften Sinne mehr als vernehmbar. Wenn er es richtig bedachte, klang es eher nach einem verletzten Tier als nach einer Todesfee. Außer natürlich, eine solche hätte sich wehgetan. Konnten die sich überhaupt wehtun? Und sollte das wirklich etwas sein, worüber er jetzt grübeln musste? Vielleicht war es eine Falle, doch wer sollte es auf einen alten Stollendachs wie ihn abgesehen haben?
Ich wüsste da den einen oder anderen, wisperte ein spöttisches Stimmchen, das er schon vor langer Zeit als sein Gewissen erkannt hatte.
Er ignorierte es, presste die wulstigen Lippen aufeinander und schob sich vorsichtig weiter. Dass er die Wurfaxt aus dem Gürtel zog, war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Vorsicht hatte schließlich überhaupt nichts mit Furcht zu tun. Am Ende des Stollens bewegte sich etwas, duckte sich hinter kopfgroßen Steinen, Überbleibseln vergangener Arbeit.
»Komm raus!«, knurrte Keirie mit plötzlich aufwallendem Zorn. »Komm raus, verdammt, oder ich schlage dir den Schädel ein wie einer Sumpfratte!«
Nichts geschah. Doch er glaubte, hektisches Atmen zu hören, und dann schoss etwas an ihm vorbei, so unvermittelt, dass er fast nicht schnell genug reagiert hätte. Im letzten Moment gelang es ihm, die Hand, mit welcher er die Axt hielt, gegen die Stollenwand zu treiben, und nur aufgrund der Enge des Ganges prallte, wer oder was auch immer dort gerade fliehen wollte, gegen seinen mächtigen, baumdicken Arm und sackte benommen zu Boden.
Keirie leuchtete mit der Laterne und hatte das Gefühl, seine Augen würden gleich aus dem Kopf fallen. Vor ihm lag ein Mensch – nein, nicht einmal das. Ein Menschenkind in abgerissenen Lumpen, winzig, mit kurzen Füßen, dünnen Ärmchen, struppigen, von allen Seiten abstehenden Haaren von der Farbe eines Fuchses, das Gesicht unter dem Dreck und von Blut verschmiert kaum erkennbar. Lange, dunkle Wimpern an zitternden Lidern hoben sich und helle blaue Augen sahen Keirie an. Tränen quollen hervor, dick, langsam, fast träge, zogen helle Schlieren durch die Schwärze des Schmutzes auf den Wangen.
Ein kleiner Junge, höchstens drei Jahre alt, schätzte Keirie, der mit offenem Mund dasaß und starrte. Seine starken, spitzen Zähne taten sicherlich nichts, um das Kind zu beruhigen, das unter seinem Blick nur noch heftiger zitterte. Hastig verstaute er die Axt wieder im Gürtel, hockte sich hin und hob den kleinen Kerl behutsam mit einer Hand auf.
»Nu, nu«, brummte er mit einer ihn selbst überraschenden Sanftheit, während seine Gedanken rasten. Wie kam der Menschling hierher? Was war ihm zugestoßen? Und wo waren seine Eltern, verdammt noch mal? »Nu, nu«, wiederholte er, weil er keine Ahnung hatte, was er tun sollte. Das rothaarige Bürschlein hing schlaff in seinem Griff und machte keine Anstalten mehr zu fliehen oder sich zu wehren.
»Wo kommst du her? Bist wohl kaum unter einem Stein hervorgekrochen, was?«
Natürlich erwartete er keine Antwort, erhielt auch keine. Stattdessen streckte der Junge die Arme nach vorn, auf denen Keirie blutige Kratzer entdeckte. Unschlüssig kaute er auf einer seiner Bartsträhnen herum und entschied sich schließlich dafür, der Aufforderung zu folgen. Er zog das Menschenkind an sich, hielt es fest und stand mit knackenden Knien auf. Ein leises Seufzen entfuhr dem Kleinen, der seinen Kopf an Keiries breiten Hals schmiegte und die winzigen Fäuste in dessen zotteligen Haaren vergrub, die dem Zwerg bis auf die Schultern fielen.
Er würde ihn wohl mitnehmen müssen, etwas anderes blieb ihm kaum übrig. Doch zuerst sollte er sichergehen, dass ihm kein Balggnomkind angedreht wurde. O ja. Auch diese Geschichten kannte er. In so einem zarten Alter sahen die Balggnome noch menschlich aus und diese widerlichen Wesen schoben sie gern unbedarften Leuten unter, die dann des Nachts lernen mussten, dass das vermeintlich unschuldige Kind ihnen plötzlich an der Kehle hing und ihr Blut aussaugte. Mit einem dicken, nicht sonderlich sauberen Finger schob Keirie den Mund des Kleinen auf und kontrollierte das Gebiss. Balggnome besaßen scharfe Reißzähne, die sich auf Druck aus dem Kiefer schoben. Erleichtert atmete er auf. Der Junge stieß einen leisen Protestlaut aus, als er gegen seinen Mund drückte, doch abgesehen von seinen erstaunlich weiß glänzenden Zähnchen war nichts an ihm ungewöhnlich. Er war, was er zu sein schien, ein einsames Menschenkind.
Beruhigend presste Keirie den Kleinen gegen seinen mächtigen Brustkorb. »Na komm, Menschling«, sagte er. »Wirst sehen, wenn du gewaschen, gefüttert und ausgeschlafen bist, sieht die Welt wieder ganz anders aus. Bestimmt haben wir morgen schon deine Eltern gefunden, du bist zurück in ihren Armen und brauchst dich nicht mehr von so einem alten Zwerg wie mir herumschleppen zu lassen. Was meinst du?«
Der Junge meinte gar nichts. Er hatte seine Wange an den rauen Stoff von Keiries Bergmannskutte geschmiegt und war eingeschlafen.
Rhona
15 Jahre später
»Chief.« Ennis sah auf, als Rhona den Trainingssaal betrat. Er hockte auf den Fersen, unweit der Ursache, warum er sie hatte rufen lassen. Sie stählte sich innerlich und schluckte Galle hinunter. Bei den Sumpfgeistern, sie hatte schon gegen die Seelenlosen gekämpft, die in den letzten Jahren immer wieder wie aus dem Nichts auftauchten, um kurze, heftige Überfälle auf die Städte und Dörfer in den Außenbezirken und Grenzgebieten des Sidhereiches zu unternehmen. Sie hatte auf Leben und Tod gekämpft, ihre Soldaten fallen sehen und war umgeben gewesen von Blut, Dreck, Schlamm, Eingeweiden und lautlos agierenden Kreaturen, deren leere schwarze Augen umso erschreckender in ihrer Gleichartigkeit wirkten. Gleich bösartig. Sie hatte sich gegen zwei Bergtrolle zur selben Zeit gewehrt, war von Schwertern und Pfeilen verletzt worden und dem Tode öfter näher gewesen, als ihr lieb sein konnte.
Doch das hier … war etwas anderes.
Rhona kniete sich neben ihren Adjutanten und musterte die Leiche des Mannes, die seltsam verdreht halb auf der Seite, halb auf dem Rücken lag. Die Trauer überrumpelte sie so plötzlich, dass es ihr die Luft wegriss. Jemand hatte den Unzerstörbaren gefällt. Ermordet. Kaltblütig. Ganz sicher nicht in einem fairen Kampf, denn solange Rhona denken konnte, war Craigen unbesiegt gewesen, und das, obwohl er einer der ältesten Soldaten der kämpfenden Truppe gewesen war. Einer ihrer Männer. Der mächtige Körper des größten und stärksten Sidhe, den es je gegeben hatte, lag still, in dem wie aus Stein gemeißelten Gesicht rührte sich kein Funken Leben. Die blauen Augen hatten sich eingetrübt, als sähe Craigen nach innen, und Rhona hoffte, dass er bereits die Ewigen Wälder erreicht hatte. Ihre Hände und Arme bewegten sich von selbst, baten die Geister, ihrem Untergebenen den Weg zu ebnen und seine leuchtende Seele wohlwollend aufzunehmen. Ennis schloss sich ihr an und schwieg auch, als sie das Ritual beendet hatten.
»Was ist passiert? Wer hat ihn gefunden?«
Ihr Adjutant musterte scharf den Raum und vergewisserte sich, dass sie noch immer allein waren. »Das war ich, Chief. Das Biest und ich hatten vereinbart, uns hier zur Mittagsstunde für eine Runde Doppelschwert zu treffen. Ich kam zu spät, weil …« Er brach ab und starrte zu Boden, und als käme ihm erst jetzt zu Bewusstsein, was wirklich passiert war, verlor sein Gesicht sämtliche Farbe.
Normalerweise hätte Rhona ihn zurechtgewiesen. Craigens Name sollte mit Hochachtung ausgesprochen werden, ihn mit seinem Schlachtnamen »Biest« zu benennen, schien ihr pietätlos. Genauso wenig war sie ein »Chief«, und sie würde auch nie einer sein. Clanführer von ihres Vaters Seite ohnehin nicht, doch auch der Clan ihrer Mutter würde sie nie als Anführerin akzeptieren. Sie war Hauptmann der beweglichen Grenztruppen, und dass sich ihre Einheit gerade bei Hofe aufhielt, nur dem Urlaub geschuldet, der ihnen alle halbe Jahre zustand.
»Du hast ein Mädchen getroffen und die Zeit vergessen«, stellte sie fest. Ihr Blick verweilte auf Craigen und sie ballte die Faust. »Es hätte keine Rolle gespielt«, murmelte sie. »Wer Craigen umgebracht hat, benutzte weder Schwert noch eine Waffe, gegen die man sich wehren kann.« Behutsam und mit ein wenig Mühe hob sie den toten Soldaten an. »Siehst du? Keine sichtbaren Verletzungen. Außer … dachte ich’s mir doch!«, stieß sie zwischen den Zähnen hervor, als sie das lange Haar des Toten zur Seite schob und einen winzigen Pfeil in Craigens Fleisch entdeckte.
Ennis nickte und suchte ihren Blick. »Ich war gestern Abend zu Gast bei der edlen Lady Liadan und ich habe beunruhigende Neuigkeiten gehört. Das ist der Grund, warum ich nur Euch allein benachrichtigt habe. Ich weiß nicht, wer hinter dem Tod von Craigen steckt, aber ich weiß, dass es nicht der Erste unserer Leute ist – und wenn es die verdammten Darkener waren, gibt es schnell welche, die nach einem Gegenschlag schreien.«
»Waren sie nicht«, unterbrach ihn Rhona scharf. »Ich war letzte Nacht auch eingeladen.« Sie erwähnte nicht, bei wem, ihre Herkunft war schließlich ein streng gehütetes Geheimnis – mit anderen Worten: Jeder Soldat wusste darüber Bescheid. Deshalb nickte Ennis nur bestätigend, doch bevor er wieder den Mund öffnete, kam ihm Rhona zuvor. »Du hast gut mitgedacht, wenn auch aus den falschen Gründen. Es waren nicht die Darkener, denn bei ihnen ist der Killer auch am Werk.«
»Sagen sie?«
»Sagt Lord Sullivan.«
Das unterband jeden Zweifel sofort. Sullivan vom Ardale-Clan, der »Bastard«, war eine lebende Legende. Obwohl am Lichten Hof aufgewachsen, lebte er als Berater und Botschafter bei den Dunklen Sidhe. Ihm und seiner Gefährtin Audra war es zum größten Teil zu verdanken, dass es seit zwei Jahrzehnten keine Konflikte mehr zwischen den beiden Völkern gegeben hatte, die nicht auf diplomatischem Wege ausgeräumt werden konnten. Der Mann war dafür bekannt, nie ein Blatt vor den Mund zu nehmen und niemals zu lügen. Wenn er dem hohen Lord Tyric berichtet hatte, dass im Reich der Darkener mysteriöse Todesfälle passiert seien, wurden selbst die größten Zweifler zum Schweigen gebracht.
Ennis fuhr sich über das Gesicht – eine Geste der Unsicherheit. »Nur … wer könnte ein Interesse daran haben, unsere Leute zu ermorden? Warum? Und warum ausgerechnet Craigen? Wenn ich doch nur pünktlich gekommen wäre!« Er hieb mit der Faust so heftig gegen den steinernen Boden, dass seine Haut aufplatzte. Dunkles Blut quoll hervor.
»Wahrscheinlich wärest du jetzt ebenfalls tot.« Rhona stand geschmeidig auf und sah sich um. Es war eine Stunde nach Mittag, die Sonne hatte den höchsten Stand des Zenits erreicht und überschritten. »Wie lange hast du gebraucht, um zu verstehen, dass Craigen nicht einfach an der Schwäche des Herzens oder einer anderen Krankheit gestorben ist, und mir einen Boten geschickt?«
Ihr Adjutant errötete, was seinem guten Aussehen keinen Abbruch tat. Er besaß so ebenmäßige und perfekte Gesichtszüge, dass er selbst für einen Sidhe als außergewöhnlich schön galt. »Ich stand noch so unter dem Eindruck dessen, was Lady Liadan gestern erzählte, dass ich nicht eine Sekunde lang darüber nachdachte, ob Craigen etwas anderes getroffen haben könnte«, gab er zu. »Aber ich meine: Wir sprechen hier über das Biest! Natürlich konnte er nicht einfach an etwas so Banalem wie einem schwachen Herzen sterben! Ich bin also sofort wieder rausgestürmt und habe eines der Kinder zu mir bestellt. Zum Glück spielten in der Nähe gleich welche – ich habe sie alle weggeschickt, damit sie nicht möglicherweise in Gefahr gerieten.«
Einerseits wahr, dachte Rhona, die systematisch anfing, den Saal zu untersuchen. Craigen, der an einer Krankheit starb? Unmöglich. Andererseits ist Mord in seiner grausamen Plötzlichkeit banal genug. Sie dachte nach. Craigen war bereits tot gewesen, als Ennis eintraf, und da er selbst noch unter den Lebenden weilte, durfte man davon ausgehen, dass der Mörder den Ort seiner hinterhältigen Tat bereits verlassen hatte. Dass er sich hier versteckt hielt, bezweifelte sie – nicht nur, weil er dann wahrscheinlich ein zweites Mal getötet hätte, sondern auch aus der simplen Überlegung heraus, dass man sich in diesem Trainingsraum nicht verbergen konnte. Er mochte zwar lang sein und mit Trainingspuppen hier und da besetzt, aber nicht einmal jemand, der gerade unter Schock stand, weil er einen seiner Kameraden tot aufgefunden hatte, konnte einen Meuchelmörder übersehen. Es gab keine anderen Eingänge außer dem, durch welchen sie gekommen war, und nur einen weiteren Raum, die Waffenkammer.
»Hast du dort nachgesehen?« Sie deutete auf die schmale Holztür.
Seine aufgerissenen Augen bewiesen, dass er das nicht getan hatte. Doch sein Schreck war unnötig. Als sie die Kammer vorsichtig betraten, waren sie allein, und keine Spuren deuteten auf einen Eindringling. Sie kehrten in die Halle zurück.
Die Fenster befanden sich zwanzig Fuß über ihnen; nur reine Oberlichter, durch die sich höchstens ein Kind hätte zwängen können, bestimmt kein Assassine mit einem Blasrohr. So wie die kleinen, runden Fenster angeordnet waren, hätte niemand vom Dach aus den tödlichen Schuss abgeben können.
Das Blasrohr machte ihr Sorgen. Natürlich war es möglich, dass auch andere Rassen Blasrohre einsetzten, doch im Prinzip war es eine reine Sidhe-Waffe. Sollte der Täter also einer von ihnen sein oder wollte es sie jemand glauben machen? Man musste kein großartiger Schütze sein, um Craigen zu treffen, aber es hatte vor dem Soldaten schon drei andere Opfer gegeben. Zumindest aufseiten der Lichten Sidhe, die Darkener beklagten bereits fünf. Der König selbst hatte ihr alles erzählt, was er wusste – und vom edlen Lord Sullivan erfahren hatte –, und ihr aufgetragen, sich umzuhören und sich auf die Spur desjenigen zu begeben, der kaltblütig seine Leute abschlachtete.
Sie sollte sich stolz schätzen, Tyrics Vertrauen zu genießen, doch im Moment war dieses Vertrauen eine Last, die ihr die Schultern niederzudrücken drohte. Sie war Soldatin, bei den Geistern, kein Untersuchungsrichter, wie es sie bei den Menschen gab.
Als sie Tyric in weitaus höflicheren Worten ihre Bedenken zu verstehen gab, hatte sie der König grübelnd angesehen. »Du hast recht, Rhona«, hatte er eingeräumt, während sein Blick zu der anderen Person wanderte, die sich mit ihnen in dem kleinen, gemütlichen Privatzimmer befand.
Die dunkelhaarige Frau erhob sich daraufhin und hockte sich zwischen ihnen nieder, wobei sie eine Hand auf seinem Knie und die andere auf Rhonas Unterarm ruhen ließ. Rhona hatte sie als Kind kennengelernt, und obwohl Faye eine menschliche Hexe war, bewunderte sie die hohe Lady des Lichten Reiches für die ruhige Selbstsicherheit, die sie jederzeit ausstrahlte. »Dann sollten wir uns Unterstützung bei denen suchen, die Erfahrungen mit solcherart Untersuchungen haben«, sagte sie ernst. »Soll ich eine Nachricht nach Kopays schicken?«
Tyric hatte ihre Hand von seinem Bein genommen, sie umgedreht und einen Kuss an die Stelle gedrückt, an der sich ihr Puls befand. Ein blaues Flämmchen hatte über die Haut des Herrscherpaares gezüngelt, etwas, das Rhona schon unzählige Male beobachtet hatte und doch nicht müde wurde, immer wieder zu sehen.
Mit einem Ruck kehrte Rhona wieder in die Gegenwart zurück. Sie drehte sich zu Ennis um. »Reite zum Hof und benachrichtige Tyric über das, was hier passiert ist. Falls jemand anderes etwas wissen will, sag ihm, es habe einen Todesfall gegeben. Die Wahrheit ist nur für den hohen Lord selbst oder die hohe Lady bestimmt. Sie werden entscheiden, wie es weitergeht. Ich bleibe hier und versuche herauszufinden, wie sich der Täter Zutritt verschafft hat und auf welchem Wege er entkommen ist.«
Ennis schüttelte den Kopf, bis seine hellbraunen, seidigen Locken flogen. »Glaubt Ihr, es ist vernünftig, wenn Ihr Euch allein hier aufhaltet, Chief? Solltet Ihr nicht besser warten, bis ich wieder mit Verstärkung zurück bin?«
»Ich glaube nicht, dass mir noch Gefahr droht. Wer Gift benutzt, ist ein schleichendes, feiges Kriechtier, er oder sie wird sich nicht einmal mehr in der Nähe aufhalten. Und jetzt los, eil dich!«
Was sie an Ennis so schätzte, war seine Fähigkeit zu erkennen, wann weiterer Protest überflüssig war. Ihr Adjutant hetzte los, und sie wusste, es würde nicht mehr lange dauern, bis sich jemand angemessen um Craigen kümmern konnte. »Wer hat dir das angetan, alter Freund?«, flüsterte sie und beugte sich vor, um ihn ein letztes Mal zu betrachten. Sie stutzte. Sein rechter Zeigefinger ruhte in einem seltsamen Winkel auf dem Boden, als ob …
Sie beugte sich so hastig vor, dass sie fast das Gleichgewicht verloren hätte. Der Boden war natürlich nicht gerade sauber, da wieder und wieder Soldatenstiefel über ihn hinwegtrampelten. In dem Schmutz befanden sich Linien … oder sollten das Worte sein? Hatte Craigen mit seinem letzten Atemzug versucht, den Namen seines Mörders zu schreiben?
Lyksan
»Wir sind da.« Sein Meister zügelte den knochigen Schimmel, der so sehr zu ihm passte, und wandte ihm sein schmales, gebräuntes Gesicht zu, aus dem die hellen, fast weißen Augen hervorleuchteten. Die meisten Leute erschraken, wenn sie ihn das erste Mal erblickten, so unheimlich wirkte Dorchadas, und noch mehr erschraken sie, wenn sie hörten, wen sie vor sich hatten. Den Vollstrecker und obersten Richter des Fürsten.
Endlich, dachte Lyksan.
Fast ein halbes Jahr war vergangen, seit sie zum letzten Mal auf Schloss Rupard gewesen waren. Die Herzogtümer von Kopays hatten selbstverständlich eigene Gerichte und eine eigene Rechtsprechung, nur eines war ihnen auf Befehl des Fürsten verwehrt worden: selbst hinzurichten. Wenn sie der Meinung waren, jemand habe so stark gegen das Gesetz verstoßen, dass ihm das Henkersbeil drohte, mussten sie auf Dorchadas warten, der schließlich über Leben und Tod entschied. Und der rollte jeden Fall von vorne auf, beleuchtete alle Aspekte und entschied erst nach sorgfältiger Betrachtung der Sachlage. Der oberste Richter war auch die einzige Person, die dieses Urteil vollstrecken durfte. Anwalt, Richter und Henker in einer Person.
Lyksan richtete sich in den Steigbügeln auf, schirmte das Gesicht mit der Hand ab und spähte zum Schloss hinüber, das stolz in den Strahlen der tief stehenden Sonne aufleuchtete. Zu seiner Linken wiegten sich die hohen Blätter der Maisfelder, rechts von ihm erkannte er das emsige Treiben des festen Marktes, der sich direkt vor dem Burggraben des Schlosses befand. Er hoffte, das verräterisch goldglänzende Haar seiner besten Freundin zu sehen, aber bei dem Gewimmel und aus der Entfernung blieb es ein fruchtloser Versuch.
Aus den Augenwinkeln schielte er zu Dorchadas hinüber. Der Gesichtsausdruck seines Meisters war wie üblich unbewegt, das langsame Streichen durch den Spitzbart deutete Nachdenklichkeit an. Ob es etwas mit dem Botenvogel zu tun hatte, den er vor einer Woche erhalten hatte? Dorchadas hatte sie seitdem zur Eile angetrieben, doch davon war im Moment nichts zu spüren.
»Du kannst gehen, Novize. Bis zum Abend kannst du tun und lassen, was du möchtest, solange du es schaffst, dich zu baden, dich um Haare, Hände und sonstiges Äußeres zu kümmern. Wenn das Spätgeläut verklungen ist, erwarte ich dich im Empfangssaal des Ostflügels.« Dorchadas’ Mundwinkel hob sich um eine Winzigkeit. »Aufs Rasieren kannst du verzichten, was dir immerhin ein paar freie Minuten mehr einbringen sollte.«
»Danke, Meister.« Obwohl er innerlich seufzte, nickte er dem obersten Richter respektvoll zu und trieb seinen Schecken an, die letzte halbe Meile zurückzulegen. Drei Stunden! Er war endlich zurück und bekam drei jämmerliche Stunden, von denen er mit Sicherheit mindestens eine zur Pflege seiner Sachen und seiner Person opfern musste. Es kam ihm ungerecht vor – warum bestand der Meister darauf, dass er heute beim Schlussbericht mit dem Fürsten dabei war? Schon drei Jahre lang begleitete er mittlerweile den Vollstrecker, assistierte ihm bei seinen Aufgaben, lernte alles über Gesetze und studierte das Recht des Fürstentums. Andere wären nach so langer Zeit bereits zum Gesellen des Meisters ernannt worden, doch nicht er, Lyksan. Ihn nannte Dorchadas noch immer Novize, als wäre er ein blutiger Anfänger und Lehrling in einem bürgerlichen Beruf. Er hegte den Verdacht, dass es an zwei Sachen lag.
Zuerst einmal: Dorchadas hatte nie einen Novizen gewollt. Der Fürst persönlich hatte ihn beauftragt, Lyksan unter seine Fittiche zu nehmen. Rupard von Kopays war ein freundlicher, gerechter Fürst, der von den Bewohnern seines Reiches gemocht wurde, aber schließlich und endlich war er der Herrscher. Wenn er um etwas bat, schlug ihm niemand eine Bitte ab. Lyksan erinnerte sich noch genau an das versteinerte Gesicht seines jetzigen Meisters, als er sich mit ruhiger Gelassenheit zu ihm umgewandt, ihn eine unendlich erscheinende Zeit gemustert und sich dann schließlich vor dem Fürsten verneigt hatte. »Wie Ihr wünscht, Lord Rupard.«
Nie hatte er ihn »mein Fürst« nennen gehört, wie es alle anderen taten, was mit Dorchadas’ Herkunft zu tun haben mochte. Die war mindestens so seltsam wie Lyksans eigene. Während er nur ein ausgesetzter oder verwaister Menschenjunge war, den ein Zwerg in seine Familie aufgenommen hatte, stammte der oberste Scharfrichter von den dunklen Druiden-Sidhe ab, den Dridhars. Die Götter wussten, dass die Sidhe an und für sich schon ein seltsames Volk waren, sowohl die Lichten als auch die Dunklen. Nicht dass Lyksan jemals großartig mit ihnen zu schaffen gehabt hätte, aber man hörte ja einiges, wenn man so viel unterwegs war wie er. Die Dridhars mussten noch zweimal mehr eine Bande eigenwilliger Burschen sein, was Meister Dorchadas eindeutig bewies. Der war …
Seine Gedanken wurden unterbrochen, als jemand seinen Namen rief. »Lyk! Lyk Fuchswelpe!«
Ohne sein Zutun breitete sich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus. Nur ein Mensch durfte ihn bei diesem Spitznamen nennen und erwarten, damit ungeschoren davonzukommen. Er hatte den Eingang zum Markt nahezu erreicht, sprang von seinem Pferd und befestigte die Zügel an einem der vielen Pfosten, die zu diesem Zweck vor den Buden und Ständen der Markttreibenden errichtet worden waren. Noch bevor er fertig war und sich umdrehen konnte, schlangen sich zwei Arme um seine Taille.
»Verdammt, warst du lange fort! Ich dachte schon, du hättest eine Sidheprinzessin kennengelernt und wärest mit ihr durchgebrannt.«
Er wandte sich um und erwiderte die Umarmung des Mädchens, packte sie unter den Achseln, hob sie hoch und wirbelte mit ihr herum. Ihre langen goldblonden Haare flogen, und sie lachte hellauf.
Esava Keeser sah aus wie ein Engel, doch sie hatte eine bezaubernd teuflische Ader. Mit niemandem hatte Lyksan so viele Streiche aushecken und durchziehen können wie mit ihr, und für ihn würde sie immer die Schwester sein, die er nie gehabt hatte.
»Esa!«, begrüßte er sie, als er sie wieder abstellte und sie ihn mit geröteten Wangen atemlos anlachte. »Wie gehen die Geschäfte?«
»Wie gehen die Geschäfte, wie gehen die Geschäfte?«, ahmte sie ihn überraschend genau nach und hieb ihm spielerisch vor die Brust. »Du bist ein halbes Leben lang weg und dann benimmst du dich wie ein Höfling und fragst nach den Geschäften?« Sie drehte sich im Kreis, raffte den Saum ihres Rockes ein wenig an und knickste. »Vielen Dank, edler Lord, dass Ihr Euch so freundlich nach mir erkundigt. Die Schneiderei meiner verehrten Mutter und mir läuft ganz prächtig, und möchtest du auch wissen warum?«
Lyksan presste seine Hand an die Brust und ließ die Augen groß werden. »Ich bin ganz aufgeregt! Kaum bin ich eine Minute zurück, schon erhalte ich die wichtigsten Neuigkeiten!«
»Ja, jetzt lachst du noch!«, beschied sie ihn, obwohl er das gerade nicht tat, sondern sich um eine zutiefst ernsthafte Miene bemühte. »Aber ich wette, du weißt noch nichts über das großartige Ereignis, das in drei Monaten ansteht!«
Was konnte das schon sein? Erntedank war in drei Monaten bereits vorbei, die Handfastingsfeiern des Fürsten fanden immer im Frühsommer statt und das neue Jahr … nun ja. Wurde eben dann begrüßt. Nicht irgendwann am Anfang des Winters. Lyksans Augen wanderten unablässig über die Stände und Läden, er registrierte die schreienden Händler, die interessierten Besucher, die gründlich zwischen den ausgestellten Waren herumwühlten, bis sein Blick auf eine schreiend bunte Bekanntmachung fiel. Er kniff die Augen zusammen, um es auf diese Entfernung lesen zu können.
Esa hämmerte ihm die kleine, jedoch nicht gerade schwächliche Faust gegen den Oberarm. Ah! Das würde einen blauen Fleck geben, so viel stand fest!
»Interessiert es dich überhaupt?« Fast erwartete er, dass sie mit dem Fuß aufstampfte, wie sie es früher immer getan hatte, doch er wurde überrascht. Anscheinend war sie aus derlei kindischen Anwandlungen herausgewachsen. Er sah sie genauer an – oha! Anscheinend war sie aus allerlei kindischen … Eigenschaften herausgewachsen. Schnell hob er den Kopf und blickte genau in ihre wissenden, lachenden Augen.
»Gefällt dir, was du siehst, Lyk Fuchswelpe?«
Grimmig verschränkte er die Arme über der Brust und versuchte auszusehen wie Major Keeser, der Großvater seiner Freundin. »Du meinst, ob mir der Nationenball gefällt?«, brummte er mit der tiefen Offizierstimme, die dieser immer einsetzte, wenn er der Meinung war, in seinem Haushalt liege etwas im Argen. Was bei dem alten Soldaten eigentlich immer der Fall war, schließlich lief dort viel zu viel Weibsvolk herum, wie er es auszudrücken pflegte. Als Kinder hatten sich Lyksan und Esa einen Spaß daraus gemacht, sämtliche seiner Launen und Sprüche vorherzuahnen und nachzumachen.
Seine Freundin starrte ihn stirnrunzelnd an. »Ich dachte, ich hätte den blutigen Vollstrecker und dich gerade erst ankommen sehen – woher weißt du dann …?« Sie brach ab und drehte sich herum, ließ den Blick schweifen. »Aha!« Sie lachte, als sie die Ankündigung auf dem vernagelten Brett in der Mitte des Marktes entdeckte. »Immerhin gut mitgedacht, edler Lord!« Sie knickste wieder.
Lyksan verbeugte sich tief vor ihr. »Ihr seid zu gütig, edle Lady.«
»Schluss jetzt mit den Albernheiten!« Sie legte ihre Hand in seine Armbeuge und zog ihn mit sich. »Ich wette, das ist alles, was du weißt. Aber ich werde großzügig sein – ich erzähle dir alles, während ich gleichzeitig dafür sorge, dass du wieder anständig eingekleidet bist.«
Bedauernd strich Lyksan über sein ledernes Wams, das vor Staub starrte und seine Geschmeidigkeit verloren hatte. »Ich habe leider nicht viel Zeit«, gab er zu. »Zum Spätgeläut muss ich mich im Schloss einfinden, und bis dahin muss ich mich auch waschen und putzen, als ginge ich auf Brautschau. Außerdem würde ich gern noch Keirie aufsuchen.«
»Ach was!« Sie winkte leichtfertig ab. »Ich schicke Silla zu dem brummigen Grimmbart hinüber; sie wird ihm sagen, dass du wieder zurück bist und nach der Audienz beim Fürsten nach Hause kommst wie ein braver kleiner Zwergling. Den Badezuber kannst du bei uns benutzen, der ist größer als in euren niedrigen Höhlen. Und rasieren brauchst du dich ohnehin nicht.« Grinsend tätschelte sie seine glatte Wange.
Sie also auch noch. Er unterdrückte ein Augenrollen und rang sich ein Lächeln ab. »Hast du jetzt unterwegs eine Elfenprinzessin getroffen, mit der du abhauen konntest?«
»Nicht eine einzige«, sagte er und legte so viel Bedauern in seine Stimme, wie es mit dem Grinsen, das an seinen Mundzipfeln zupfte, möglich war.
»Der knurrige Henker hält dich wohl an einer kurzen Leine!«
Tat er das? Lyksan dachte darüber nach, während er sich von Esava über den Markt und durch schmale Gänge zerren ließ. Der alte Dridhar forderte stets viel von ihm, allerdings war er sich selbst gegenüber immer genauso gnadenlos, wenn nicht härter. Wenn sie einen Fall untersuchten, verlangte er von ihm höchste Aufmerksamkeit und größte Zurückhaltung. Letzteres fiel Lyksan nicht schwer, meistens wurde er ohnehin übersehen. Die Präsenz seines Meisters war allumfassend genug, um das zu garantieren. Doch ununterbrochen alles im Auge zu behalten, konnte unglaublich anstrengend werden, und manches Mal hatte er den Vollstrecker enttäuscht, wenn er auf dessen Nachfragen seine Beobachtungen nicht so genau wiedergeben konnte, wie es Dorchadas erwartet hatte. Wenn er ehrlich war, musste Lyksan zugeben, dass ihm das Leben an der Seite seines Meisters gefiel – lediglich, wenn dieser dazu schritt, jemanden tatsächlich zu töten, wurde ihm übel. Nicht nur einmal waren ihm nahezu die Sinne geschwunden, wenn der Kopf eines Verbrechers vom Block rollte, und doch bestand der Dridhar darauf, dass er zusah und lernte.
»Was ist? Bist du eingeschlafen?« So war Esa. Sie ließ es nicht zu, dass er ins Grübeln geriet und zu viel nachdachte.
»Irgendwann wird dir vor lauter Überlegen der Kopf platzen«, hatte sie einmal behauptet. Und auch wenn er daran zweifelte, mochte er es doch, dass sie ihn von all den Gedanken ablenkte, die ihn stets und ständig beschäftigten.
»Müde bin ich schon«, gab er zu. »Aber ich bin auch froh, wieder zu Hause zu sein.«
Sie drückte seinen Arm. »Das solltest du besser auch. Immerhin befindest du dich in der Gesellschaft des hübschesten und klügsten Mädchens von ganz Kopays.«
»Und des bescheidensten, eindeutig«, murmelte er und verzog nur leicht den Mund, als sie ihn in den Bizeps kniff.
»Für diese Impertinenz wirst du mir alles erzählen, was ihr unterwegs erlebt und getan habt«, verkündete sie, als sie schließlich die Nähstube ihrer Mutter betraten. »Auch und ganz besonders die blutigen und gruseligen Details!«
»Wirklich?«, fragte er entsetzt. Sollte ein Mädchen tatsächlich an solchen Dingen interessiert sein?
»Auf jeden Fall!«, bestätigte sie. Bevor er weiter diskutieren konnte, stürmte ihre Mutter auf ihn zu, um ihn an ihren riesigen Busen zu drücken und mit ihren weichen, dicken Armen nahezu zu erwürgen. Er ließ es sich gern gefallen, denn Rativa Keeser hatte ihn schon immer eher wie eines ihrer eigenen Kinder behandelt, nicht wie den kleinen, schmutzigen Waisenjungen, der er gewesen war, als er Esa das erste Mal getroffen hatte. Sie roch vertraut nach Pflanzen und Blüten, mit denen sie Stoffe färbte, nach Essen, nach mütterlicher Wärme, vermischt mit einem leichten Schweißgeruch.
»Wurde ja Zeit, dass du endlich mal wieder heimkommst, mein Junge!«, rief sie so laut, als wollte sie mehrere Kunden davon überzeugen, dass es bei ihr die schönsten und besten Kleider gab. Was in der Tat so war. »Und vor allem wird es Zeit, dass du dich entschließt, einem anständigen Gewerbe nachzugehen. Auf Dauer kann es nicht gut für einen Burschen deines Alters sein, ständig mit Mordsgesindel zu tun zu haben.«
»Ich bin kein Junge mehr«, murmelte er, doch seine Worte wurden noch immer durch die Fülle von Rativas Massen gedämpft.
»Und selbstverständlich musst du langsam anfangen, dich nach einem netten Mädchen umzusehen«, erklärte Rativa, als hätte er nichts gesagt.
O nein. Nicht das schon wieder. Seit etwa einem Jahr machte Esas Mutter mehr oder weniger – ganz sicher weniger!, wie Lyksan dachte – verschleierte Andeutungen, dass er und Esava sesshaft werden sollten. Miteinander.
Er schaffte es, sich aus ihrer Umarmung zu lösen. »Ähm …«, gab er äußerst eloquent von sich und warf einen Hilfe suchenden Blick zu seiner Freundin, die jedoch peinlich berührt zur Seite sah. Ihr Gesicht war hochrot, und er nahm an, dass ihr die Vorstellung, sie beide könnten zusammen einen Hausstand gründen, genauso unangenehm war wie ihm. Schließlich waren sie fast wie Geschwister aufgewachsen, wie sollte er da etwas anderes als brüderliche Zuneigung empfinden?
Rativa umfasste seine Wangen und musterte ihn wohlwollend. »Du bist noch ein Stück gewachsen, mein Lieber. Hübsch breite Schultern hast du bekommen – und um den Bart mach dir mal keine Sorgen. Der wächst schon noch von ganz allein.« Sie tätschelte seine wild abstehenden Haare, als wäre er wieder der kleine Junge, den ein Zwerg in irgendeiner Mine gefunden hatte.
»Ja!«, krähte die elfjährige Silla, die in diesem Augenblick hereinplatzte. »Spätestens in hundert Jahren hast du einen Bart wie Keiriepaps!«
Lyksan knurrte wie ein hungriger Höhlenwolf und stürzte sich auf Esas Schwester. »Na warte, du kleine Ratte, ich fange dich und dann … fress ich dich auf!« Kreischend und lachend stob sie davon, er hart auf ihren Fersen, erleichtert, für den Moment den Fängen Rativas zu entfliehen.
***
Die Dämmerung war schon hereingebrochen, als er gewaschen und herausgeputzt vor den hohen Türen des Empfangssaales stand. Nervosität machte sich in seinem Magen breit, sorgte dafür, dass seine Hände feucht wurden und sein Herz klopfte. Wieder fragte er sich, warum Dorchadas ihn heute dabeihaben wollte, und er musste sich bewusst davon abhalten, von einem Fuß auf den anderen zu treten. Es gab keinen Grund für Panik; die wenigen Male, die er direkt mit Fürst Rupard zu tun gehabt hatte, war dieser ihm gegenüber wohlwollend und freundlich aufgetreten. Auch der mächtige Gefährte des Fürsten, Lord Heliarkos, hatte sich immer bemüht, ihm keine Angst einzujagen, und einmal, kurz nachdem Keirie ihn bei sich aufgenommen hatte, hatte er ihn sogar hochgehoben und mehrmals in die Luft geworfen, um ihn jedes Mal wieder sicher aufzufangen. Lyksan erinnerte sich an das Gefühl von atemloser Schwerelosigkeit und an gurgelndes Lachen, das aus ihm herausgeplatzt war.
»An diesem Tag hast du das erste Mal etwas gesagt«, hatte Keirie ihm erzählt. »›Höher! Höher!‹, hast du geschrien und da wussten wir, dass du zumindest aus Kopays stammst, denn die hiesige Sprache war dir geläufig.«
Mit dem letzten Schlag des Spätgeläuts glitt sein Meister um die Ecke des Ganges, blieb vor ihm stehen, musterte ihn kurz und nickte. Ohne anzuklopfen, öffnete er die Tür, winkte Lyksan hinter sich her und betrat den Empfangssaal des Fürsten. Der hochgewachsene Herrscher von Kopays und sein noch größerer Gefährte standen am anderen Ende des weitläufigen Raumes direkt unter einem der modernen bunten Fenster, auf denen Heldentaten von berühmten Persönlichkeiten abgebildet waren. Es war jetzt nahezu dunkel, lediglich ein dreiteiliger Leuchter nahe dem Paar erhellte ein wenig die Umgebung. Rupard wandte sich ihnen zu.
»Willkommen zurück, Meister Dorchadas«, sagte er, als Lyksan und der Vollstrecker bei ihnen angekommen waren. Lyksan verbeugte sich ehrerbietig, wie es ihm Keirie beigebracht hatte, während der Dridhar nur den Kopf zur Seite neigte.
Die Zähne von Lord Heliarkos blitzten auf, als er sie angrinste.
»Lasst uns einen etwas gemütlicheren Ort aufsuchen«, schlug er mit seiner tiefen, grollenden Stimme vor. Lyksan wusste, warum der Mann so gewaltig war – es handelte sich bei ihm um einen Drachenwandler, eines jener mythischen Wesen, welche die Gestalt wechseln konnten. Er hatte ihn nie in Drachengestalt gesehen, aber Geschichten darüber gehört, wie der große Mann dem Fürsten geholfen hatte, sein Reich und das der Sidhe zu retten, wobei sich die beiden hoffnungslos ineinander verliebt hatten.
»Es war vom Schicksal vorherbestimmt!«, hatte die alte, fast blinde erste Mamsell des Schlosses, Saldie, ihm und Esa erzählt, als sich die beiden zu ihr in die Küche geschlichen und Küchlein und andere Leckereien erbettelt hatten. Mit angehaltenem Atem hörten sie zu, wenn Saldie von Abenteuern berichtete, von wunderschönen und tödlichen Sidhe, von Verrat, Intrigen und einem Fürsten, der beinahe seinen eigenen Sohn hätte umbringen lassen. Was das alles mit Lord Heliarkos zu tun haben sollte, konnten weder Esa noch Lyksan damals begreifen, es war auch nicht wichtig. »Das, was wirklich zählt«, pflegte Saldie zum Abschluss immer zu sagen, »ist die Liebe. Das müsst ihr euch merken, und wenn sie euch begegnet, die Liebe, müsst ihr sie mit beiden Händen ergreifen und festhalten. Aber nicht zu fest, versteht ihr? Ihr müsst sie auch loslassen können – denn nur, wenn die Liebe frei ist und gehen kann, wohin sie will, erst dann wird sie tatsächlich euch gehören, wenn sie dableibt oder zurückkommt.«
An dieser Stelle hatten sie immer ihr Lachen unterdrücken müssen, es klang einfach zu absurd mit dem Festhalten, Loslassen, Zurückkommen und Gehören. Saldie war ansonsten eine wunderbare Geschichtenerzählerin, also hatten sie sich am Ende jeder Geschichte ihre Weisheit gefallen lassen.
Rupard führte sie stillschweigend in einen Raum, den Lyksan noch nie betreten hatte. Es handelte sich um ein Arbeitszimmer, wie der klobige Schreibtisch, Federn, Tintenfässchen und die vielen auf der Tischfläche verteilten Pergamente bewiesen. Der Fürst lächelte, als er ihnen mit einer Handbewegung bedeutete, Platz in einem der schweren gepolsterten Stühle zu nehmen, die vor dem Kamin gruppiert worden waren, in dem trotz des warmen Abends ein paar Scheite Holz prasselten.
Zu Lyksans Überraschung trat Lord Heliarkos an das Mahagonikabinett an der Seite des Raumes, öffnete eine Tür und entnahm vier Gläser, die er mit einer golden schimmernden Flüssigkeit füllte und vor ihnen abstellte. Seiner Erfahrung nach bedienten edle Herren nicht ihre Untertanen, doch die beiden Herrscher von Kopays behandelten Dorchadas und in der Folge auch ihn wie Gleichberechtigte. Lyksan wartete, bis die anderen ihre Gläser anhoben, den Göttern einen stummen Gruß entboten und den ersten Schluck genommen hatten, bevor er es ihnen gleichtat.
Bei den … Flüssiges Feuer brannte sich durch seine Kehle, trieb ihm Tränen über die Wangen und nahm ihm den Atem. Die Augen weit aufreißend schnappte er nach Luft und konnte durch den Tränenschleier hindurch erkennen, dass Heliarkos lachte.
»Vielleicht hätte ich dich lieber wieder in die Luft werfen sollen, Fuchswelpe?«
Lyksans Wangen brannten vor Scham. Natürlich hatte ihm Keirie den Spitznamen verpasst. Wegen seiner Haare, die sich im Laufe der Jahre von einem dunklen Rotton zu etwas entwickelt hatten, das Bronze recht nahekam. Und er hatte mit Ausnahme von Keirie und Esa mit jedem eine Prügelei begonnen, der nicht aufhören wollte, ihn so zu nennen. Er war kein stinkendes, Gänse und Hühner stehlendes Raubtier! Doch natürlich konnte er sich jetzt schlecht auf den Gefährten des Fürsten stürzen – zumal er bezweifelte, dass er überhaupt eine Chance hatte, ihn zu überwältigen.
Es war Rupard, der sich ihm entgegenlehnte und sagte: »Ich weiß, dass du diesen Namen nicht magst, Lyksan. Wir haben dich in den letzten Jahren beobachtet und sind sehr erfreut über die Entwicklung, die du durchgemacht hast.«
Was? WAS? Hatte ihn dieser eine Schluck schon so betrunken gemacht, dass er halluzinierte? Lyksan verstand im Moment überhaupt nichts, also senkte er den Blick, stellte das Glas auf dem Tisch ab und wartete, was weiter passieren würde.
»Ach komm schon, Junge. Warum siehst du in Füchsen immer nur das Negative? Du weißt selbst, dass du weder schmutzig bist noch fürchterlich stinkst – und glaub mir, ich rieche alles …« Lord Heliarkos tippte sich an die Nase, anscheinend um anzudeuten, dass Drachenwandler über einen besseren Geruchssinn als Menschen verfügten. »Was Füchse allerdings wirklich sind, Junge …«
Konnte der mächtige Lord vielleicht mal aufhören, ihn »Junge« zu nennen? Er war achtzehn … nun, jedenfalls vermutlich. Und damit ein Mann, bei den Göttern! Zornig starrte Lyksan den zweiten Herrscher von Kopays an, doch weder dessen Grinsen noch das leichte Lächeln, das Rupards Lippen zierte, schwanden.
»Füchse sind schlau«, sagte Dorchadas beiläufig und nippte an seinem … was auch immer in diesem Glas war.
Die feinen Härchen auf Lyksans Armen stellten sich auf. Wenn er sich nicht täuschte, hatten ihm gerade drei der wichtigsten Personen dieses Reiches ein Kompliment gemacht – und er sich zu einem kompletten Narren.
Oha. Das war ein feiner Einstieg in die Gesellschaft echter Männer. Er seufzte, dieses Mal nicht lautlos. »Ich bitte um Entschuldigung, edle Herren«, murmelte er.
»Denk nicht weiter drüber nach«, antwortete der Drachenwandler. »Wir waren alle mal jung – einige sind es immer noch.« Er sah Rupard mit einem Gesichtsausdruck an, aus dem alle Härte des kantigen Gesichts verschwunden war. In seinen goldenen Augen loderte ein Feuer, von dem Lyksan annahm, dass es wohl diese viel beschworene schicksalhafte Liebe war. Es hätte kitschig wirken müssen, tat es aber nicht, und mit einem Mal erfasste ihn ein Gefühl, das er erst mit einiger Verzögerung erkannte: Neid. Wenn es je eine Person geben würde, die ihn so ansah … wie musste sich das anfühlen? Was stellte es mit einem an?
Der Fürst tat so, als hätte er die kleine Spitze nicht gehört, obwohl sich die Lachfältchen an seinen Augen kräuselten. Er stellte sein Glas ab. »Nun gut. Der Grund, warum wir euch hergebeten hatten, ist delikat, um das behutsam auszudrücken.« Er lehnte sich zurück und schloss kurz die Augen. »Euch, Dorchadas, ist bekannt, dass Heliarkos und ich gute Beziehungen zu den nächsten Höfen der Lichten und Dunklen Sidhe haben, doch für dich ist es wahrscheinlich neu, Lyksan.«
Das war es, aber was hatte das mit ihm zu tun? Er neigte den Kopf, um Zustimmung und Interesse zu signalisieren.
»Seit einigen Wochen haben sich sowohl an König Tyrics Hof als auch an dem von König Rian seltsame Todesfälle ereignet. Es erinnert unangenehm an Ereignisse, die sich vor zwanzig Jahren zugetragen haben, nur mit dem Unterschied, dass derjenige, der damals verantwortlich war, tot ist.«
»Seid Ihr Euch da sicher?« Es platzte aus Lyksan heraus und im selben Moment hätte er sich am liebsten die Zunge abgebissen.
»Ganz sicher.« Der Drachenwandler schnaubte, und in Lyksans Ohren klang es amüsiert. »Wir waren dabei, als ein verdammt guter Mann ihm den Kopf abgeschlagen und dann ein prächtiges Feuer auf ihm entzündet hat.«
»Genau. Damals hat sich jemand einer schwarzen, gefährlichen Magie bedient, um ganze Völker in einen Krieg zu treiben, aber dieses Mal ist es anders.« Lyksan rutschte bis zur Kante seines Stuhls, verbiss sich jedoch jeden Kommentar. »Es ist anders, weil es nicht den Hauch von dunkler Magie gibt, und trotzdem dasselbe Vorgehen wie damals gewählt wurde. Jemand bringt nicht nur bei den Dunklen, sondern auch bei den Lichten Sidhe Leute um. Das Verhältnis zwischen den beiden Völkern hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten massiv verbessert, trotzdem fürchten wir, dass eine Zeit kommen wird, in der sich die Sidhe wieder gegenseitig bekriegen. Ihr fragt euch, warum wir uns darum Sorgen machen sollen? Nun, ich habe einen Maskenball ausgerufen, am Tage der Sternenwanderung in drei Monaten findet er statt. Eingeladen sind natürlich Vertreter der Herzogtümer, aber auch der Sidhe, aller Wandler, die uns bekannt sind, sowie Angehörige der Freien Städte und natürlich der Zwerge und Leprechauns. Die Masken verbergen die Gesichter und sollen eine gewisse Gleichheit untereinander schaffen, denn ich … wir … wollen den Frieden, den wir zusammen erreicht haben, nicht gefährden. Wenn alle gleich sind, wird sich niemand über- oder unterlegen fühlen, doch ich fürchte auch, dass die Masken böswillige Absichten verbergen könnten. Es ist unsere Verpflichtung, den Attentäter, der für Bosheit und Mord unter den Sidhe sorgt, zu finden und zu verurteilen, und zwar schnell. Und das ist der Punkt, an dem ihr beide ins Spiel kommt. Ich möchte, dass Ihr Euch morgen so schnell wie möglich auf den Weg ins Reich der Lichten Sidhe macht und dort Untersuchungen anstellt. Findet denjenigen, der uns – uns allen! – schaden will und bringt ihn zur Strecke! Und vor allem: Findet ihn schnell!«