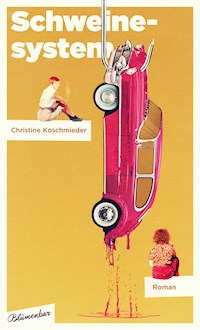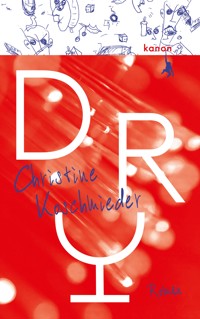
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kanon Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
»Dry« handelt vom Trinken und wie es ein Leben bestimmt. Und es handelt vom Aufhören. Wie sich eine Frau aus der Abhängigkeit ins Schreiben begibt. Klar tritt sie eine Reise in die Kindheit, zum früh verstorbenen Mann, zu den eigenen Rollen als Mutter, Geliebte, Tochter an.Christine Koschmieder scheint immer alles geschafft zu haben: Sie hat den Tod ihres Mannes verarbeitet, drei Kinder großgezogen, Karriere im Kulturbetrieb gemacht. Heimlich geholfen hat ihr dabei der Alkohol. Doch mit Ende 40 weiß sie nicht mehr weiter und liefert sich in eine Suchtklinik ein. Dort begibt sie sich auf Spurensuche. Ist der Krebstod ihres Mannes wirklich der Grund für ihre Abhängigkeit, oder liegen die Wurzeln nicht viel tiefer? Christine Koschmieder hat einen mutigen autofiktionalen Roman geschrieben, der unter die Haut geht. Radikal ehrlich und mit literarischer Meisterschaft erzählt sie von sich und von uns. Dieses Buch ist eine Mutprobe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dry ist meine Geschichte, aber es ist nicht unbedingt die Geschichte derer, die darin vorkommen. Oder zumindest nicht die, die sie erzählt hätten. Meine Kinder heißen nicht Oleg, Tillie und Karl, und doch haben die Menschen, die hier vorkommen, reale Vorbilder. Aber Dry ist ein Roman, kein Memoir und kein Sachbuch.
ISBN 978-3-98568-042-9
eISBN 978-3-98568-043-6
1. Auflage 2022
© Kanon Verlag Berlin GmbH, 2022
© Christine Koschmieder, 2022
Umschlaggestaltung: Anke Fesel / bobsairport
Unter Verwendung einer Illustration von Chris Keller
Herstellung: Daniel Klotz / Die Lettertypen
Satz: Marco Stölk
Druck und Bindung: Pustet, Regensburg
Printed in Germany
www.kanon-verlag.de
Christine Koschmieder
Dry
Für Karenin, Lotta und Mattis.
Ein paar mehr Antworten. Ein paar mehr Fragen.
Lebenslinie (Tag 9)
I.Versuch, eine Sonnenfinsternis zu fotografieren
Heller (1993–1999)
Im Land der Kohleöfen (1993)
Am Bahnhof (1996)
Die junge Mutter und ihr erstes Kind (1996)
Zorn (1997)
Iowa, revisited (1997/1998)
Vergleichbare Verhältnisse (1998)
Dunkler (1999–2004)
Im wunderschönen Monat Mai (1999)
Totale Sonnenfinsternis (1999)
Trudna sam (2000)
Krokodilchen oder was nicht im Untersuchungsheft steht (2001)
Onkel Otto die Beine abschneiden (2001)
Frühling in Leipzig (2002)
Intimität (2002)
Flüssige Inseln (2002)
Magical Thinking (2003)
Der Tod ist kein verdammter Yogi-Prozess (2003)
Du hast jeden Raum mit Sonne geflutet (2003)
Grauzone (2004–2014)
Auf Wiedersehen, Papa (2004)
Mantenga la Limpieza de la Playa (2004)
Elastigirl geht die Puste aus (2004)
Mama don’t take my Kodachrome away (2004)
Fast Forward (2005–2012)
Der betrunkene Bär (2014)
II.My Fair Lady
Kindheit (1982–1986)
Hausführung (1982)
Gerade klare Menschen (1984)
Zigarettengeld (1985)
Der Rollladen (1985)
Jump (1985)
In der Sonne (1986)
Aufbruch (1986–1993)
Ne sono un Frigorifero (1989)
How was your Day (1989)
Gisela, Jutta und die anderen (1986–1993)
Vater, Mutter, Kind (2007–2016)
Summer Time (2007)
Wiedersehen mit der Frau, die meine Mutter ist (2013)
Sentimental Journey (2016)
Extensionshüllen (2016)
Some Girls Mothers are bigger than other Girls Mothers (2016)
III. Dry
Der gelbe Strickpulli (2020)
Aufnahme (Tag 1)
Schilder und Gebote (Tag 2)
Bomberjackenwut (Tag 7)
Tischwechsel (Tag 11)
Nackt und nüchtern am Fuße des Eisbergs (Tag 13)
Erzählen Sie doch mal (Tag 25)
Fette Dackel (Tag 31)
Stellvertreterfeinde (Tag 42)
Eine Bank für mich (Tag 46)
Wir sind hier alle wie Kinder (Tag 51)
Sendersuchlauf (Tag 56)
Every Table is a Family Table (Tag 70)
You are so profoundly sad (Tag 74)
Im Gummiboot in den Sonnenuntergang (Tag 94)
Reject the Idea that there is a right Way to be a Survivor (Tag 105)
Lebenslinie (Tag 9)
Haus D, 1 Zi., Szczepański / Koschmieder
Alex schüttelt ihr Kissen im frischen Kopfkissenbezug zurecht. Wir sind gerade mal eine Woche hier, und sie wechselt schon ihre Bettwäsche. Immerhin hat sie auch neues Klopapier mitgebracht, die vier Rollen, die auf der Ablage über der Spülung standen, haben nicht lange gehalten.
Dienstags und donnerstags zwischen sieben und neun hat die Wäscheausgabe in der Hauswirtschaft geöffnet, immer dienstags und donnerstags zwischen sieben und neun wechseln hellgelbe Bettwäsche und weiße Frotteehandtücher zwischen Haus D und dem Hauswirtschaftsgebäude hin und her, schmutzig und zusammengeknüllt auf dem Hinweg, zu ordentlichen Quadraten gefaltet auf dem Rückweg, obenauf zwei Rollen Klopapier, denn die gibt’s auch in der Hauswirtschaft.
Alex wirft sich auf ihr frisch bezogenes Bett und schaltet eine Mittags-Talkshow ein. Ich sitze unter meinem Kopfhörer am Schreibtisch und starre abwechselnd auf den Baum vor dem Fenster und das Blatt Papier mit den beiden Achsen, eine horizontal, eine vertikal. 1986, 1996, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2013, 2016 habe ich unter die horizontale Achse geschrieben und darüber eine Wellenlinie gezeichnet, die 1986 beginnt und ansonsten aussieht wie die Schlange beim Kleinen Prinzen, die einen Elefanten verschluckt hat. Bloß, dass meine Linie sehr viele Elefanten verschluckt hat. Und unterschiedlich große noch dazu.
Der Baum hat immer noch keine Blätter. Ich weiß gar nicht, warum ich mich jetzt schon mit meiner Lebenslinie herumquäle, Sara aus meiner Bezugsgruppe stellt ihre Lebenslinie am Montag erst vor, drei Tage vor ihrer Entlassung. Man kann das also auch erst ganz zum Schluss machen, nicht gleich nach der ersten Woche. »Ich geb Ihnen schon mal die Vorlage, dann haben Sie Zeit, sich damit auseinanderzusetzen«, hat Herr Juckert, mein Bezugsgruppentherapeut, in unserem ersten Einzelgespräch gesagt. »An der horizontalen Achse vermerken Sie bitte alle Ereignisse, die in Ihrem Leben eine Bedeutung für Sie hatten, mit den entsprechenden Jahreszahlen, und oberhalb der Achse markieren Sie Ihren jeweiligen Alkoholkonsum zu dem Zeitpunkt. Und dann verbinden Sie die Punkte zu einem Diagramm.« Das tue ich gerade. Das sind die verschluckten Elefanten. Er hat mir die Vorlage rübergeschoben und dann leider noch den entscheidenden Satz hinterhergeschickt: »Welche Ereignisse Sie wählen, bleibt Ihnen überlassen, da gibt es keine Vorgaben. Das können ja nur Sie einschätzen, was jeweils bedeutsame Erlebnisse für Sie waren.«
Keine Vorgaben. Bedeutsame Ereignisse, die mit einer Linie verbunden werden sollen. Ich hätte ihm sagen sollen, dass genau das so ungefähr die unlösbarste Aufgabe ist, die man mir stellen kann. Eine Aufgabe, an der ich verzweifle, seit ich ungefähr acht Jahre alt bin. Erschrocken greife ich nach meinen Haaren, ob ich plötzlich wieder eine Ponyfrisur habe, und taste meine Zunge nach abgeplatzten Lackpartikeln ab. Unwissentlich hat Herr Juckert die Rewind-Taste gedrückt und mich damit an den Familienesstisch meiner Kindheit zurückversetzt, an dem ich, verzweifelt auf einem Bleistiftende herumkauend, unter meinem viel zu kurz geschnittenen Pony neun Punkte fixiere, die im Quadrat auf einem Stück Papier angeordnet sind. »Die Lösung findest du nur, wenn du über die Aufgabe hinausdenkst.« Die Aufgabe lautet, die neun Punkte mit vier geraden Linien zu verbinden, ohne den Stift abzusetzen. Neun im Quadrat angeordnete Punkte starren mich an. Ich starre die Punkte an.
Längst lasse ich mir von niemandem mehr den Pony zu kurz schneiden und habe aufgehört, den Lack von Bleistiftenden abzukauen. Aber seitdem habe ich nie mehr aufgehört, das Leben als eine Anordnung von Punkten zu sehen, die ich verbinden soll.
Ich starre die Jahreszahlen an. Die Notizen, die ich daruntergekritzelt habe. Scheidung Mama Papa, Umzug Leipzig, USA, Tod 1, 2 und 3, Auszug Micha, die auf unterschiedlicher Höhe über den Jahreszahlen eingezeichneten Kreuzchen. Neben mir liegt mein aufgeschlagenes Notizbuch mit einem Zitat von Margarete Willers. »Der Aufforderungscharakter der Dinge führt zur richtigen Wahl von Material und Technik.« Margarete Willers hat am Bauhaus Wandbehänge und Teppiche gewebt. Ich will keinen Teppich weben, ich will mein Leben verstehen.
Mein Leben, das ich bisher als griechische Tragödie mit hohem Hollywoodanteil gelesen habe, so eine, in der die Götter ständig im Drehbuch rumpfuschen. Ein Drehbuch, das die Heldin auf die Reise geschickt hat, ohne ihr einen Auftrag mitzugeben. Also zumindest keinen, den sie verstanden hätte, wenn man von einem Blatt Papier mit neun zu verbindenden Punkten absieht. Was mich ja nicht daran gehindert hat, aufzubrechen. Mein Leben besteht eigentlich aus nichts anderem.
Ich nehme die Kopfhörer ab. Ich habe Durst. Alex fläzt auf ihrem Bett, im Fernseher kreischt sich ein Paar an, Alex schiebt sich Schokoladenkekse in den Mund und scrollt sich durch Insta-Stories. »Hättste mal auch deine Handtücher gewechselt, dann hättste auch zwei Rollen Klopapier gekriegt. Wird knapp so.« Zwei Rollen Klopapier pro Person, mir hätte das gereicht. Aber wir markieren unsere Rollen natürlich nicht mit S für Szczepański und K für Koschmieder. Ich hab keine Lust, am Sonntag plötzlich ohne Klopapier dazusitzen, und Leitungswasser mag ich auch nicht. Nagellackentferner, Instantkaffee, Mineralwasser, Klopapier, tippe ich in mein Handy. Und bin eigentlich ganz froh, dass ich jetzt einen Ruf habe, dem ich folgen kann.
Ich folge ja gern jeder Stimme, die mich ruft.
I.
Versuch, eine Sonnenfinsternis zu fotografieren
Heller
(1993–1999)
Im Land der Kohleöfen (1993)
Ungerstraße, 2 Zi., mit Thomas
Leipzig hat ein Wunder. Ein blaues. Eine blaugraue Fußgängerüberführung, die von der Horten-Filiale mit der Blechfassade über die mehrspurige Kreuzung am Ring führt. Auf die Seite, auf der eine gelbe Telefonzelle steht. Ich kenne jetzt schon ziemlich viel von Leipzig. Den Kopfbahnhof mit dem Kuppelgewölbe, an dem ich heute angekommen bin. Die Jugendherberge in der Käthe-Kollwitz-Straße, die ich mir nicht leisten kann, weil ich weder einen Jugendherbergsausweis besitze noch Bettwäsche eingepackt habe. Das Seminargebäude der Universität, die den Karl Marx aus ihrem Namen gestrichen, sein überlebensgroßes Relief aber weiter an der Fassade hängen hat. Die Säule mit den Aushängen im Hörsaalgebäude, von der ich den handgeschriebenen Zettel abgerissen habe. Und jetzt auch den Münzfernsprecher auf der anderen Seite der blauen Fußgängerbrücke, in den ich zwei Zehnpfennigstücke einwerfe und die Leipziger Nummer wähle, die mir eine Freundin mitgegeben hat, eine entfernte Bekannte von ihr, die in Leipzig wohnt. Geht nur leider nicht dran, die entfernte Bekannte. Und auf dem Zettel in krakeliger Schrift, den ich von der Säule im Hörsaalgebäude abgerissen habe, steht keine Telefonnummer. Da steht nur WG-Zimmer in 2er-WG, ab sofort, EG, Kohleofen, Dusche, Ungerstraße 7, Reudnitz.
»Zwei Fragen: Von wann ist der Aushang, und ist das Zimmer noch zu haben, und falls ja, kann ich heute gleich hier übernachten?«
»Den hab ich heute erst aufgehängt. Und hier schlafen ist auch kein Ding. Aber es soll ziemlich kalt werden heute Nacht, und ich hab keine Kohlen mehr, du müsstest also irgendwoher Kohlen besorgen.«
Und dann erklärt mir der Junge mit den roten Haaren unter der Schiebermütze ungefähr den Weg zum nächsten Kohlenhändler, und schon nach dem dritten Haus muss ich einen Mann nach dem Weg fragen, und der Mann erkennt sofort, dass mir das hier alles noch zu ungefähr ist und ich generell keine Orientierung habe in dieser Welt, deren graubraune Fassaden nur wegen der Straßenbeleuchtung so südländisch wirken. Er schippt mir kurzerhand einen Emaileimer mit Holzgriff mit Kohlen voll und bittet, den Eimer später wieder vorbeizubringen. Weil ich kein Geld für Kohlen ausgeben musste, bringe ich stattdessen zwei Flaschen Rotwein mit, und die haben wir dann auch getrunken, und zumindest erklärt Thomas mir das mit der Kohlenmonoxidvergiftung noch am selben Abend und auch, wie die Pumpdusche funktioniert und dass ich leider nicht offiziell in den Mietvertrag kann, weil er selber nur halb legal zur Untermiete wohnt. Ich weiß nicht einmal, ob ich mir die Wohnung vollständig angeguckt habe, als mich Thomas, den ich telefonisch nicht erreichen kann, weil die Wohnung kein Telefon hat, am nächsten Morgen bittet, in zwei Wochen besser erst gegen Abend mit dem Hänger mit meinen Möbeln in Leipzig aufzuschlagen, damit nicht gleich jeder sieht, dass da jemand einzieht. Schriftlich habe ich nichts.
»Guck, dass es keine Erdgeschosswohnung ist und dass es in der Bude Heizung und Bad gibt«, hat Papa mir mit auf den Weg gegeben. Mein Zimmer liegt im Hochparterre und geht zur Straße raus, die Wohnung hat Kohleöfen und eine Pumpdusche, die mitten in der Küche steht. Ich wechsle von einem improvisierten Leben ins nächste, das kann ich gut. »Ohne was Schriftliches? Ohne Mietvertrag?«, würde Papa jetzt vermutlich ergänzen, aber Papa sagt nichts, denn Papa ist gar nicht da, als ich ausziehe, und so verstaue ich meine Sachen in allen verfügbaren Taschen, Koffern und Körben, wer hat schon Geld für Umzugskartons, und hänge am Morgen, bevor ich auf den Beifahrersitz des Autos mit dem zweirädrigen Hänger steige, das mich nach Leipzig bringen wird, einen Zettel an die Tür.
Lieber Papa, wie du siehst, bin ich aufgrund widriger Umstände – Transportfahrzeugbeschaffung – erst heute losgekommen, habe gestern Abend noch eine kleine Abschiedstrauerzeremonie veranstaltet, zu der ich Teile deiner Bierbestände geplündert habe. Zudem dürfte auch die Telefonrechnung schwindelnde Höhen erreicht haben, da ich am 5./6. April verzweifelt sämtliche VW-Bus-Besitzer, Anhängerbesitzer, Anhängerkupplungsbesitzer und Autoverleihfirmen abtelefonieren musste. Aber jetzt bin ich endgültig weg vom Fenster. Meine Adresse hängt an der Tür, Wäschekörbe, Einkaufskorb und Getränkekasten kommen Sa. oder So. zurück; falls Post für mich kommt (besonders aus Berlin!!!!!), bitte sofortissimo nachsenden, meine neue Konto-Nr. teile ich dir sobald existent mit, falls möglich sorge doch bitte dafür, dass das Geld zu Monatsanfang überwiesen wird, da ich aufgrund der Umzugskosten etwas in der Bredouille stecke. Ansonsten läuft alles chaotisch, aber gut, die Zuverlässigen bestätigen ihre Zuverlässigkeit einmal mehr.
Deine entflogene Tochter (zahme Vögel singen von Freiheit, wilde Vögel fliegen)
Ich hab dich lieb, Christine
PS Brotmesser ist wieder aufgetaucht!
Die Kabelrolle in meinem Zimmer soll Petra Di. mitbringen!!!
Und dann steige ich auf den kunstledergepolsterten Beifahrersitz und verlasse Wiesloch, in der Hoffnung, dass knapp 500 Kilometer weiter östlich Thomas, der Junge mit der Schiebermütze, von dem ich nichts schriftlich habe, die Tür aufmachen wird. Am Steuer mein Freund Waldmann, auf der Rückbank Koffer, Körbe, mein Kofferplattenspieler. Mit einem zweirädrigen Hänger an der Anhängerkupplung durchqueren wir die alte Bundesrepublik, auf der Ladefläche vier Baupaletten, ein Flohmarktschreibtisch mit grüner Linolbeschichtung, ein Stuhl und ein Getränkekasten, passieren Fulda und Bad Hersfeld, Orte, an denen meine Großmutter mich die Angst vor den Russen, vor den Stacheldrahtzäunen in der Rhön und vor dem körperlosen Grauen auf der anderen Seite zu lehren versucht hat, überqueren den ehemaligen Grenzübergang, ohne dass das irgendein Gefühl in mir auslösen würde, und tuckern in der einsetzenden Dämmerung mit kaum mal 80 km/h im Dunkel über die südliche Zufahrt Richtung Leipzig, rechts und links graubraune Brachflächen, leer geräumte Landschaften, meine neue Stadt liegt zwischen stillgelegten Tagebaugebieten. Wir nähern uns der Stadt wie aufgetragen im Dunkeln, damit unsere Ankunft möglichst wenig Aufsehen erregt, und während der zweirädrige Hänger an den orangefahl angestrahlten Fassaden vorbei über das Kopfsteinpflaster rumpelt, muss ich an Monterosso denken, an Italien, an den Süden. Weniger Wert auf Fassaden legen, mehr Wert auf das, was dahintersteckt. Ich will glauben, dass es so ist, denn das hier soll mein Zuhause werden.
Thomas macht die Tür auf. Nach ein paar Nächten auf den blanken Europaletten inspiziere ich den Dachboden, auf dem liegen geblieben ist, was die vielen, die in den letzten Jahren in diesem Haus gelebt und es wieder verlassen haben, nicht mehr brauchen, und finde eine hellblau gestreifte mit Textilfüllung gestopfte Matratze. Die gelblichen Flecken versuche ich zu ignorieren, mit dem Laken drüber sieht man die ja auch nicht. Es ist April und um acht schon dunkel, aber mit den Wochen wird es heller, wenn ich abends die Ungerstraße runtergehe und die Zweinaundorfer Straße überquere, mich in der Schlange vor der Telefonzelle anstelle, um nach Hause zu telefonieren. Nach acht ist Telefonieren billiger, das weiß nicht nur ich.
Roland kommt mich besuchen. Roland kommt aus Ostberlin, und wir kennen uns aus der Solibrigade auf Kuba, haben zusammen in den Heilpflanzenplantagen von Pinar del Rio Aloe-vera-Setzlinge gepflanzt. Roland gehörte zur Gruppe der Ostberliner aus der zweiten Brigade, in der ersten waren Hardcore-Westlinke, die den Kubanern erklären wollten, was ihre Solidarität mit den Kämpfen der RAF zu tun hat, gab sogar ein paar, die auf Teufel komm raus eine Moncadafahne organisieren wollten, um jeden Morgen dahinter her zum Arbeitseinsatz zu marschieren. Die Ostberliner hatten eine entspanntere Vorstellung von Solidarität, mit der sich gut vereinbaren ließ, abends an der Bar der Ferienanlage, in der die Brigadistas untergebracht waren wie normale Touristen, spottbillige Mojitos in uns reinzuschütten, zu tanzen und Spaß zu haben. Roland ist Schlosser und trägt eine von diesen kleinen runden Brillen mit Metallgestell und will mit mir in die Dreigroschenoper, aber erst mal kommt er mich in meiner Erdgeschosswohnung in der Ungerstraße besuchen und bringt mir eine Schallplatte mit, und seitdem läuft auf meinem Kofferplattenspieler Wenzels Stirb mit mir ein Stück, und das schwarz-weiße Plattencover mit Wenzels traurigem Gesicht und der schwarzen Tränenspur unter dem Auge scheint mir eine Zugehörigkeit zu beglaubigen, die diffus ist, nur dazugehören will ich, und orangefarbene Straßenbeleuchtung, der Geruch von Kohleöfen und Wenzels melancholische Lieder sind da ein guter Einstieg.
Ich habe einen Emaileimer mit Holzgriff und eine Matratze mit Stockflecken und einen Bibliotheksausweis aus gelblichem Karton, von dem der Karl Marx vor der Universität sorgfältig mit Bleistift und Lineal ausgestrichen ist. Ich habe ein eigenes Konto, auf das per Gehaltspfändung der Unterhalt eingeht, den Mama mir schuldet, und eine Telefonzelle, an der sich abends lange Schlangen bilden, denn nicht nur wir haben kein Telefon, sondern überhaupt kaum jemand, und bei uns an der Wohnungstür, die eh immer offen ist, hängen ein Bleistift und ein Block, auf dem man uns Nachrichten hinterlassen kann, und so macht es auch Lotte, mit der ich Theaterwissenschaft studiere, als sie mich eines Morgens nicht antrifft mit ihrer Bäckertüte. »Ich war hier und wollte mit dir frühstücken, und jetzt bist du nicht da, schade, ich hatte extra Pfannkuchen mitgebracht«, schreibt Lotte auf den Zettel, und einmal mehr merke ich, dass ich immer noch desorientiert bin, weil ich Pfannkuchen zum Frühstück ein bisschen komisch finde und mich auch frage, wie sie sie transportiert hat, aber dann dauert es nicht mehr lang, bis auch ich Pfannkuchen zu Berlinern sage und Beutel zu Tüten und Plaste statt Plastik. Und weil hier alles so sozialistisch und antifaschistisch war, dass selbst die Lebensmittel sprachlich nicht an den Feudalismus erinnern durften, weiß ich auch, warum Königsberger Klopse hier Kochklopse heißen und Ragout fin Würzfleisch und auf Toastbrot serviert wird statt in Königinpastetchen. Ketwurst, Grilletta und Krusta krieg ich dann aber nur noch aus Erzählungen mit. Dafür bereue ich es sehr, in einer der gelben Fressbuden auf der Brache gegenüber Karstadt einmal Pferderoster bestellt zu haben, und mache mich zum Affen, als ich es mit der legendären Toten Oma versuchen will, die ich für Brotaufschnitt halte und deswegen drei, vier Scheiben antworte, als ich nach der Menge gefragt werde. Tote Oma ist Blutwurst mit weißen Fettstückchen drin und wird in der Pfanne ausgelassen.
Nichts davon kostet mich Überwindung. Nichts davon ist mir peinlich. Ich liebe alles hier. Am liebsten würde ich mich einhüllen in dieses geborgte Leben, das jemand für mich bereitgehalten zu haben scheint, ein Leben ohne Telefone, ohne Zentralheizung und ohne Badezimmer. Ein Leben, das alles beinhaltet, wovor mich Papa gewarnt hat. Ich liebe den Geruch, den der Kohleofen abgibt, sobald die Kohlen so weit durchgeglüht sind, dass ich die gusseiserne Klappe schließen kann. Ich liebe die eierschalengelblichen Tatra-Straßenbahnen mit den Kunststoffsitzen, die von unten beheizt werden, sodass man sich an manchen Tagen fast den Hintern verbrennt. Ich liebe den Paternoster, der sich hinter dem überlebensgroßen Karl-Marx-Relief am Seminargebäude versteckt und macht, dass man von den Abwärtsfahrenden immer zuerst die Füße sieht und spekulieren kann, ob darüber ein bekannter Oberkörper, ein bekanntes Gesicht zum Vorschein kommt. Nicht weniger lustig ist es, wenn vor den eigenen Füßen plötzlich Köpfe in den Aufwärtskabinen auftauchen.
Ich liebe den Geruch von ausströmendem Gas an unserem Gasherd, bevor ich das Streichholz reinhalte. Ich liebe das gurgelnde Geräusch, das der achtkantigen Espressokanne aus Alublech entweicht, wenn sie spritzend den Kaffee ausspuckt, und den Geruch des Gasflammenkranzes, wenn wir bei geöffneter Backofenklappe in der Küche sitzen, um es warm zu kriegen. Ich verbrenne mir die Finger an der Ofenklappe, wenn ich den heißen Ascheschieber rausziehe, und ich friere mir die Finger ab, wenn ich versuche, den festgefrorenen Deckel von der Mülltonne zu öffnen, um die heiße Asche wegzuschütten. Die Pumpdusche in der Küche pumpt das Wasser nie richtig ab, vor dem Fenster der Erdgeschosswohnung husten die rauchenden Kinder, und in der Straße riecht man, dass wir im Land der Kohleöfen wohnen. Ich bin glücklich. Die Kinder husten auch nachts vor dem Fenster, bis wir eines davon reinholen, ich habe Freunde aus dem Westen zu Besuch, ja, sie kann eine Nacht hier schlafen, ob ich ihr einen Tampon leihen kann, sie ist zutraulich, und wir sind es auch, wir wollen auch adoptiert werden von dieser Stadt, sie ist 14 und viel zu abgeklärt, wir verlangen, dass sie ihrer Mutter wenigstens einen Zettel hinlegt, wo sie ist, damit die sich keine Sorgen macht, macht die eh nicht, sagt sie. Einen Tag müssen wir etwas ohne sie erledigen, sie treibt sich den Tag über herum. Am Abend steht sie wieder vor der Tür mit leuchtenden Augen und einem Riesenteddy im Arm, den ihr ein Freund auf der Kleinmesse geschossen hat. Nach drei Tagen schicken wir sie zurück, sie kann nicht bei uns bleiben, sagen wir ihr.
Die Kohlen, finde ich im Herbst heraus, als ich einen schönen Sessel mit Löwenfüßen und zerschlissenem roten Bezug aus einem Bauschuttcontainer in der Eisenbahnstraße gezogen und in Lottes und meine neue Wohnung im vierten Stock geschleppt habe, die Kohlen werden auf der offenen Ladefläche eines Transporters mit der Aufschrift »Max Sobek« geliefert, und wenn wir sie auf den Bürgersteig kippen lassen und selbst in Eimer schaufeln und Eimer für Eimer runter in den Keller tragen, ist das viel billiger als Lieferung bis Keller. Den Sessel mit den Löwenfüßen beziehe ich mit schwarzem Kunstleder, das ich mit Polsternägeln festhämmere, die Löwenfüße und Armlehnen streiche ich schwarz, und wenn ich nicht gerade mit dem Heißluftbläser Ochsenblut von den Dielen in meinem Zimmer löse oder früh um 7:15 im gemütlichen Ledersessel des Dozenten für Osteuropäische Theatergeschichte wegdämmere, der das Seminar in seinem Büro abhält, proben wir. In den Räumen der Villa e. V. proben wir Brechts Brotladen und auf dem Holzpodest in unserem ungenutzten dritten Zimmer in der Einertstraße proben wir glaubwürdiges Warten, bis in das ungenutzte Holzpodestzimmer Nadine zieht, die aus Berlin kommt und gestreifte Hosen und einen Tweedmantel mit Hahnentrittmuster trägt und wild und mondän ist und an den Wochenenden zu ihrem Freund nach Berlin fährt, der Zwillinge hat, und wenn sie zurückkommt, schwärmt sie von der Volksbühne und vom Berliner Ensemble, sie sagt natürlich nur BE, und unser drittes Zimmer wirkt plötzlich so schäbig, wie es in ihrem Blick aussieht.
»Wie, du kennst Paul und Paula nicht? Das ist ein Kultfilm, den musst du gesehen haben!«
Ich gucke noch mal auf den Zettel, auf den ich mir die Adresse notiert habe, aber die Hausnummer stimmt. Ich stehe vor einer runtergekommenen Gründerzeitfassade, einem Wohnhaus. Im Hausflur weist ein Schild den Weg, zum Kino eine Treppe hoch. Ein Kassenhäuschen oder ein Foyer gibt es nicht, meine Karte kaufe ich beim selben Mann, der dann auch den Absperrpfosten hoch macht, um mich zu den Sitzreihen durchzulassen. Der Raum ist sehr gelb und soll bis vor ein paar Jahren ein SED-Vorführraum gewesen sein, gelb die gepolsterten Sessel mit den Armlehnen aus Holz, die Vorhänge gelb, selbst das Licht ist gelb. Am nächsten Tag ist der ehemalige SED-Vorführraum immer noch gelb, und der Absperrpfosten wird ein zweites Mal hochgeklappt, und ich versinke ein zweites Mal in meinem Sitz und sehe zum zweiten Mal Geschirr aus einem Blecheimer durch ein Ostberliner Hinterhoffenster fliegen und zum zweiten Mal alte Backsteinfassaden in einer Staubwolke zusammenbrechen, Hausfassaden, die gesprengt werden, um Plattenbauten Platz zu machen, und zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden mischen sich meine Tränen mit dem aus gesprengten Trümmern aufsteigenden Staub, während die Puhdys singen, jegliches hat seine Zeit, lieben und sterben und Frieden und Streit.
In den nächsten beiden Jahren lebe ich viel und liebe ich viel, und gestorben wird vorerst nur im Theater, wo ich als Gesche Gottfried in Fassbinders Bremer Freiheit nacheinander meinen Mann, meine Mutter, meine Kinder, meinen Liebhaber, meinen Vater, einen alten Freund, meinen Bruder und meine beste Freundin umbringe. Weil die gesellschaftlichen Missverhältnisse mir keine andere Möglichkeit lassen. Streit kann man das nicht wirklich nennen, Frieden aber auch nicht.
Wir machen Theater. Wir bespielen ein Theater. Wir bespielen ein Leben. Wir bewohnen 150-Quadratmeter-Wohnungen mit Kohleöfen und Dielenböden. Einige von uns versuchen, die Produktionsverhältnisse zu ändern und verstehen nichts. Nichts von Elke, die im Büro die vorbereitende Buchhaltung macht und von der wir nicht wissen, dass sie ein kleines Kind zu versorgen hat. Nichts von Frau Filip mit den angegrauten Haaren, die in ihrem Dederonkittel in der Schneiderei sitzt und unsere Kostüme näht. Nichts von Steffen, der im kleinen Raum neben dem Fördervereinsbüro am PC unsere Plakate und Programmhefte gestaltet. Nichts vom langhaarigen Jörg, der acht Meter über dem Boden zwischen den Traversen rumhangelt und die Scheinwerfer einrichtet und zu viel trinkt. Statt auf die Menschen, mit denen wir arbeiten, und die Bedingungen, unter denen sie arbeiten, und die Bedingungen, derentwegen sie zu ABM-Kräften geworden sind, konzentrieren wir uns auf die Bedingungen, zu denen man uns produzieren lässt. Zu denen wir Geld bewilligt bekommen.
Wir wissen, zu welchem Stichtag die ABM-Abrechnungen beim Kulturamt vorliegen müssen, um förderfähig zu bleiben. Wir kennen das Vereins- und Satzungsrecht und wissen, dass eine nicht fristgemäße Ladung oder eine nicht satzungsgemäß durchgeführte Mitgliederversammlung deren Beschlüsse und Wahlergebnisse ungültig macht. Und wir wissen dieses Wissen einzusetzen, wenn uns daran gelegen ist, die Ergebnisse einer Mitgliederversammlung ungültig zu machen. Wir wissen, wie man ABM verlängert. Wir wissen, dass private Katzenfutterrechnungen nur dann als Verwendungsnachweis eingebracht werden können, wenn sich der Einsatz von Katzenfutter im entsprechenden Projekt nachweisen lässt. Wir sind sehr erfinderisch und sehr engagiert und sehr daran interessiert, unsere Erfahrungen zu machen und zu spüren. An der Wirkung unserer Erfahrungen sind wir vielleicht nicht ganz so sehr interessiert. Dazwischen proben wir. Dazwischen trinken wir. Dazwischen tanzen wir nach den Proben im Beyerhaus und Ranko spielt Klavier, bis wir kein Geld mehr für Bier haben oder rausgeschmissen werden. Dazwischen fahren wir nachts um drei mit der Straßenbahn die Prager Straße entlang zur Endhaltestelle der 15 nach Holzhausen. Dazwischen lieben wir. Erst den einen. Dann den nächsten. Dazwischen trennen wir uns. Dazwischen kriegen wir Kinder. Dazwischen liegen Kinder in Weidenwäschekörben bei Frau Filip in der Schneiderei, während wir auf der Bühne im Scheinwerferlicht stehen.
Von der Wohnung mit dem ungenutzten dritten Zimmer, in dem wir das Warten geprobt haben, und dem Fünf-Liter-Boiler in der Küche, mit dessen Inhalt Lotte und ich eine Plastikwäschewanne befüllt haben, um uns darin zu waschen, ziehe ich 1995 mit meinem Freund in einen winzigen Zwei-Zimmer-Flachdachbungalow mit Fernwärme und Badezimmer und riesigem verwilderten Garten an der Straßenbahnendhaltestelle Holzhausen/Zuckelhausen. Der Sohn der verstorbenen Vorbewohner ist froh, dass sich jemand findet, der das Grundstück übernimmt, wie es ist. Samt Himbeerranken, Apfel- und Pflaumenbäumen, Johannisbeersträuchern, Pfingstrosen, Fliederbüschen, Pumpbrunnen und vollgestopftem Werkzeugschuppen, der nach geteerter Dachpappe und altem Holz riecht und in dem sich weiße Leinenbettwäsche mit Aufdruck des Bezirkskrankenhauses für Psychiatrie Leipzig-Dösen stapelt. Aber weil ich so viel leben und lieben muss, verliebe ich mich in Ranko, der in der Bremer Freiheit meinen Vater spielt und jeden Abend nach den Proben in der Beyerhauskneipe Klavier spielt und singt und sein Esszimmer mit Partituren tapeziert hat. Und auch wenn er sich nicht in mich zurückverliebt, sind meine Gefühle so intensiv und mein Bekenntniszwang so groß, dass ich aus dem Schuhkarton aus- und zusammen mit einer Kommilitonin in einen riesigen Jugendstilaltbau mit Wintergarten ziehe, vor dem im Mai die Magnolien blühen und dessen Küche wir im Winter heizen, indem wir den Gasherd an- und die Backofentür aufmachen.
Als die alte Dame zwei Stockwerke über uns ins Heim kommt, ist ihr Badeofen noch voller Wasser, und ich habe ein Kind im Bauch. Als die Temperaturen unter null fallen, dehnt sich das gefrorene Wasser im Badeofen aus, und ich drücke an meinen Brustwarzen herum, um zu gucken, ob schon Milch kommt. Stattdessen platzt die Fruchtblase. Als die Temperaturen wieder steigen, tauen 50 Liter Wasser durch den Schlitz des geborstenen Badeofens, und in Leipzig sind an vielen verlassenen Altbauten die Eingänge mit Eisenketten versperrt, Vorsicht, Taubenzeckenbefall, nur unser Haus ist bewohnt und wird nicht gesperrt, während ich beim Stillen für meine Zwischenprüfung lerne, aber weil Taubenzecken die Erreger für Hirnhautentzündung übertragen und zwei Stockwerke über uns der Inhalt eines Badeofens durch die Decken taut, beschließt meine Freundin Sina, dass das nicht geht, und quartiert Karl und mich vorübergehend in der großen Altbauetage mit Fernwärme ein, die sie mit ihrer Schwester und ihrer kleinen Tochter bewohnt, und als ich mit dem eng im Tragetuch an meinen Körper gewickelten Karl zur Zwischenprüfung auftauche, fragt mich der Professor, wann es denn so weit ist, weil er die Wölbung unter meinem Mantel für meinen Bauch hält.
Neun Monate Schwangerschaft und das halbe Jahr Stillen zeigen mir, dass es geht. Ohne Trinken. »Wann habe ich eigentlich das letzte Mal einen Abend nur mit mir und ohne Alkohol verbracht? Habe ich solche Angst vor mir und meinen Gedanken oder langweile ich mich mit meinem unaufgeputschten Geist so sehr?«, habe ich in mein Tagebuch geschrieben, kurz bevor ich schwanger geworden bin. Ich sollte mehr Kinder bekommen.
Am Bahnhof (1996)
Schorlemmerstraße, 2 1/2 Zi., mit Nora und Karl
Mit Karls Vater wohne ich nicht zusammen, aber mit Karls Vater stehe ich an einem Dezembertag unter den Glasbögen des Leipziger Bahnhofs am Gleisende und warte auf den IC aus Heidelberg. Der Dezember 1996 ist sehr kalt und der Schnee sogar auf dem Ring liegen geblieben. Ich habe Mama fünfmal gefragt, ob sie auch wirklich kommt, weil Mama immer ankündigt, dass sie irgendetwas tun wird und es dann nicht tut, aber das sieht sie nicht und fühlt sich angegriffen, wenn ich nachfrage, aber ich muss ja nachfragen, denn wir haben ein Hotelzimmer für sie gebucht und stehen am zugigen Bahnsteig, und da stehen nicht nur Karls Vater und ich, sondern in ein Tragetuch eng an meinen Körper gewickelt auch Karl, der sechs Wochen alt ist, aber eigentlich erst drei, weil er drei Wochen zu früh und mit viel zu hohen Bilirubinwerten gekommen ist. Während der sehr langen Geburt haben alle unsere Freunde, mit denen wir für das Wochenende eigentlich zu einem Tangokurs verabredet waren, stundenlang im Gang vor der Entbindungsstation rumgelungert und Karten gespielt und Fotos gemacht und Schnaps getrunken, bis die Hebamme sie um zwei Uhr früh endlich in den Kreißsaal gelassen hat und ihre Sektflasche auch. Und so stehe ich mit dem etwas zu klein geratenen, fest in seinen braunen H&M-Kunstfellanzug mit Kapuze eingepackten Karl am Bahnsteigende, mit diesem kleinen Kind, das ich geboren habe und das ich mit meinem Körper am Leben erhalten kann, das aus meiner Brust trinkt und das Strickwindeln trägt, deren lange Bänder sich in der Waschmaschine verheddern. Über die Strickwindeln ziehe ich ihm gefettete Schafswollüberhosen, was viel aufwendiger ist als Wegwerfwindeln, aber jedes verknotete Bändel, das ich nach dem Waschen entwirre, kommt mir vor wie ein Versprechen, dass wir verbunden bleiben werden, und verbunden sind wir auch jetzt am eiskalten Bahnsteig bei minus acht Grad. Wir warten auf Mama, die nicht aussteigt, als der Zug am Bahnhof eingefahren ist und die Türen aufgehen, die nicht aussteigt, weil sie gar nicht eingestiegen ist.
Sie kommt auch nicht mit dem nächsten Zug, und sie geht auch nicht ans Telefon, als ich sie später anzurufen versuche, nicht am Abend des Ankunftstages, nicht am nächsten Morgen, das ganze Wochenende nicht. Am Montag kommt ein Päckchen von ihr an, und als sie endlich rangeht, am Dienstag, fragt sie als Erstes, als sei nichts gewesen, ob ihr Päckchen schon angekommen sei, und als ich sie frage, wo sie war am Freitagnachmittag, als wir am Bahnhof gestanden und auf sie gewartet haben, sagt sie, dass sie ja mal wieder solche Kopfschmerzen hatte und deswegen nicht kommen konnte, aber das Päckchen, ob ich ihr denn nicht sagen könne, ob ihr Päckchen schon angekommen sei.
Jedes Mal, wenn Großmutter, also Mamas Mutter, mit ihrem VW-Käfer von Bad Hersfeld nach Waldhilsbach gefahren ist, um uns zu besuchen, hatte sie auf der Rückbank einen Korb mit Lebensmitteln, Ahle Worscht, einen Laib Sauerteigbrot, ihren traditionellen Nusskranz. Kann sogar sein, dass da auch Kaffeebohnen dabei waren, ich bilde mir jedenfalls ein, mich an den Kaffeegeruch zu erinnern. Ob das mit der schlechten Versorgungslage in der Nachkriegszeit zu tun hatte oder ob sie der Haushaltsführung ihrer eigenen Tochter misstraut hat, weiß ich nicht. In dem Päckchen, das anders als Mama im Dezember 1996 in Leipzig ankommt, ist die verchromte Servierplatte, die ich noch von früher kenne. Sie ist in mehrere Schichten Frischhaltefolie eingewickelt. Unter der Frischhaltefolie liegen Frikadellen und runzelig gebratene Bratwürste.
Die junge Mutter und ihr erstes Kind (1996)
Schorlemmerstraße, 2 1/2 Zi., mit Nora und Karl
Abend für Abend verbringe ich mit Kind und Gefährten in der heimischen Wohnung, bestückt mit Weihnachtsbaum und einem mit Kunstleder bezogenen Sessel mit Löwenfüßen. Meinen Schreibtisch nutze ich als Ablage für Tassen und Wäsche, ans Theater denke ich nur noch widerwillig, mehr Pflicht als Hingabe, ich schreibe nicht, ich male nicht, ich stehe nicht auf der Bühne, nehme keinen Anteil am gesellschaftlichen Leben. Vielleicht sollte ich froh sein, lieber ehrliche Stagnation als Rechtfertigungsaktivismus, aber so sehr ich Karl auch liebe, vom zufriedenen erfüllten Mutterglück bin ich weit entfernt.
Ich kann nicht sagen, ob ich mich nur in einem ziemlich vorhersehbaren Zustand befinde oder ob ich nach gerade mal sechs Wochen Karl schon wieder an meinen zu hohen Erwartungen verzweifle. Nach der letzten Rolle als sehr dicker Mann mit Karl-Bauch unter dem weißen Männerhemd habe ich nicht mehr auf der Bühne gestanden, am Theater bin ich nur noch für den Förderverein, künstlerische Anerkennung gibt’s nicht für fristgemäß ausgefüllte Abrechnungen und abgeheftete Belege, und, ja, ich weiß, die menschliche sollte mir mehr wert sein, aber allein als Mensch geschätzt zu werden, wie hätte mir das je genügt?
Was könnte ich nicht alles anfangen mit meiner Zeit, was wäre über Schlafen, Fernsehen und Frauenzeitschriften hinaus nicht alles möglich: lesen, Weiterbildung, Lateinamerika, Politik, Geschichte, Literatur, Sprachen, mein Saxofon ausgraben, Briefe schreiben, malen, nähen – all das auszutoben, was ich bisher mit »irgendwann mal« gestempelt und weggeheftet habe. Stattdessen grabe ich mich gerade mal aus dem Bett und entferne mich aus dem Anziehungsbereich des Fernsehers, um Windeln zu waschen und aufzuhängen, Tee zu kochen oder widerwillig und ungeschminkt das Haus zu verlassen, um einkaufen zu gehen. Nur, dass es sich bei mir nicht um die typische Überforderung der jungen Mutter durch den Alltag handelt, mir bleibt ja eher mehr verpflichtungsfreie Zeit als vorher. Meine für nächstes Jahr beantragte und bewilligte Christine-Brückner-Inszenierung gehe ich nur widerwillig an. Hauptsächlich, um mir etwas zu beweisen. Dass das Mutterdasein mich nicht verschlingen wird. Dass nichts auf der Strecke bleibt, dass es Alternativen gibt zum Pärchenmodell mit Zusammenleben, dass Mutterdasein und öffentliche Wirksamkeit einander nicht ausschließen. Dass Dinge anders gehen. Dass die normative Kraft des Faktischen ein gottverdammter ideologischer Vorwand ist. Ja, ich will etwas beweisen. Eigentlich hätte ich es lieber schon bewiesen, denn mit dem inneren Antrieb sieht es gerade eher mau aus. Keine Motivation, kein Erkenntnisinteresse, nichts, was mich triebe außer der Scham. Mein Anspruch, mein enttäuschtes Selbstbild, das nicht zulassen kann, anzuerkennen, was anscheinend in mir schläft: ein träges Wesen, zu faul und desinteressiert, den Geist zu bewegen und seine Erkenntnisse umzusetzen, zu suchen, zu kämpfen, zu schreien, zu verzweifeln, zu streiten.
Kein wildes Leben mehr, keine betrunkenen Straßenbahnfahrten weit nach Mitternacht, keine rauschhaften Gespräche, die die Verzweiflung über die eigene Trägheit und die Unwandelbarkeit der Dinge ins Wanken bringen könnten, die mir einen Rettungsanker in die beschissene Beliebigkeit würfen. Ach, Karl, wach auf und mach, dass das Mutterglück meine Ansprüche wegschwemmt und ich mich vorwurfsfrei mit dir vor den Fernsehfilm der Woche legen kann.
Zorn (1997)
Schorlemmerstraße, 2 1/2 Zi., mit Nora und Karl
»Du verlangst zu viel.«
Die Sonne scheint fast senkrecht auf die Betonplatten vor dem Schulgebäude, in dem wir proben. Oder in dem wir eben gerade nicht proben, weil wir auf den Betonplatten unter der fast senkrecht stehenden Sonne stehen. »Meine Freundin ist schön, ich habe mich in ihren Schatten gelegt«, singen die Puhdys in der Legende von Paul und Paula, und ich frage mich, warum ich zwar jede Menge schöner Freundinnen, aber mir ein Leben eingerichtet habe, in dem ich mich nicht in ihren Schatten legen kann. Stattdessen stehe ich vor ihnen in der Sonne auf den Betonplatten einer Nordhäuser Schule, drei dieser Freundinnen tragen lange Leinenkleider, eine ein blaues, eine ein rotes, eine ein gelbes, unter dem gelben wölbt sich ein Schwangerschaftsbauch und Karl, der nicht mehr in meinem Bauch steckt, hängt auf dem Arm einer weiteren Freundin, die uns unterstützt, damit wir überhaupt weitermachen können. Sie halten Monologe historischer Frauenvorbilder, die Christine Brückner ihnen in den Mund gelegt hat, weil sonst immer nur die Männer sprechen. Drei davon haben wir uns ausgesucht, Christiane Vulpius’ »Ich wär Goethes dickere Hälfte«, Katharina von Boras Tischreden »Bist du sicher, Martinus?« und »Kein Denkmal für Gudrun Ensslin. Rede gegen die Wände der Stammheimer Zelle«. Und jetzt stehen sie vor mir in der Thüringer Mittagssonne, rot Christiane Vulpius, gelb Gudrun Ensslin und blau Katharina von Bora, und improvisieren. Text, den wir nicht aus den Ausdrucken von Christine Brückners Originaltext herausgeschnitten haben. Text, den sie sich selbst ausgedacht haben.
»Wir können das nicht. Du verlangst zu viel von uns. Du bist die Regisseurin. Du musst uns sagen, was du willst.« Was ich will? Ich will mich in den Schatten legen. Ich will eine Welt, in der Schriftstellerinnen keinen zornigen Frauen mehr Reden in den Mund legen müssen, die sie nie gehalten haben, weil in dieser Welt, die ich will, Frauen sagen, was sie wollen, und keine Zustände mehr herrschen, die sie zum Schweigen bringen, und ich will eine Welt, in der die Darstellerinnen dieser Frauen, die Zustände darstellen, wie ich sie nicht mehr will, sich nicht an mich wenden müssen, um ihnen Anweisungen zu geben, und in der nicht die Schwester einer Freundin auf Karl aufpassen muss, damit wir wütenden Frauen proben können, was wütende Frauen gerne gesagt haben würden. Ich will mich in den Schatten einer schönen Freundin legen, unter einen gelben Rocksaum oder einen roten oder einen blauen.
Orgä, hat Max gesagt, das ist altgriechisch und steht für Hunger, für Gier, hat Max gesagt, oder zumindest habe ich es mir so gemerkt, und auch wenn Carsten, der Lichttechniker, das ganz komisch auf der ersten Silbe betont und mir klar ist, dass niemand da draußen mit dem Wort etwas anfangen kann, plakatieren wir ein paar Wochen später Leipzig mit schwarzen Ankündigungsplakaten, auf denen in einem gelben Kreis der Schriftzug Orgä unsere Vorstellung ankündigt. Orgä, wird mir später klar, steht überhaupt nicht für Hunger oder Gier, sondern für Zorn, Wut. Und auch wenn wir die ganzen Proben über immer auf Hunger und Gier hin geprobt haben, stimmt es ja am Ende doch. Ungehaltene Frauen, die sich an einem heißen Sommertag in Thüringen in ein Machofilm-Setting stellen, Showdown in der Mittagssonne, aber in bunten Kleidern und ohne Schusswaffen.
Ich habe die drei Monologe ausgedruckt, und dann haben wir zusammen Schlüsselsätze und Schlüsseleigenschaften ausgesucht, Katharina von Bora als die Fürsorgende, die für den Haushalt, die Struktur, die Versorgung zuständig ist, den Überblick wahrt, ordnet, sortiert, wiegt, misst, zählt. Christiane Vulpius als sinnliche Gegenspielerin der Charlotte von Stein, lüstern, üppig, gierig, die Formen und Maßstäbe sprengend, auf die Ratio scheißend. Gudrun Ensslin, klug, scharf, klar, rigide, konsequent, verweigernd, eingesperrt. Stereotypen haben wir aus den Frauen destilliert. Und versucht, den Widerspruch, das nicht Aushaltbare dieser freigesetzten stereotypen Energie in Szenen zu übersetzen. Christiane Vulpius, der wir einen viel zu engen Armlehnstuhl hinstellen, in den ihr Körper nicht passen kann, an dem sie scheitern muss. Katharina von Bora, die versucht, Ordnung in ein Himmel-und-Hölle-Spiel zu bringen, das sie mit Kreide auf dem Boden fixiert, und sich dabei verrenkt wie auf einer Twister-Plastikfolie. Gudrun Ensslin, die hungerstreikend den Panther zitiert, durch ihren unsichtbaren Käfig stürmt und sich gierig Dinge in den Mund stopft. Um die Sätze zu finden, mit denen sie sich identifizieren sollen, haben wir die Monologe in Streifen geschnitten, auf jedem Streifen ein Satz.
Unter der senkrecht stehenden Sonne von Nordhausen haben sie plötzlich alle denselben Satz. »Du überforderst uns. Wir können das nicht. Du musst uns sagen, was du willst.«
Vom Tag der Premiere gibt es zwei Fotos. Das eine ist in der Beyerhauskneipe entstanden, das gelbe Kleid mit dem schwangeren Bauch ist im Bild und mein Kopf, um den ein grüner Turban gewickelt ist, ich umarme Alex, der in der Bremer-Freiheit-Inszenierung Regie geführt hat. Dieses Bild ist weniger wichtig. Das andere Bild ist in meiner WG-Küche aufgenommen, darauf zu sehen sind drei Männer, die vor einem Schwerlastregal für Autoreifen stehen, das meiner Mitbewohnerin und mir als Geschirrregal dient. Die Männer scheinen Spaß zu haben, sie lachen auf dem Bild, auf dem Tisch vor ihnen stehen Flaschen. Sie haben Karls Vater beim Babysitten Gesellschaft geleistet, während meine drei ungehaltenen Frauen sich auf der Bühne die Seele aus dem Leib getobt und gekotzt haben.
»Meine Freundin ist schön, ich habe mich in ihren Schatten gelegt«, singen die Puhdys in der Legende von Paul und Paula