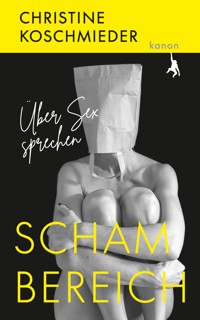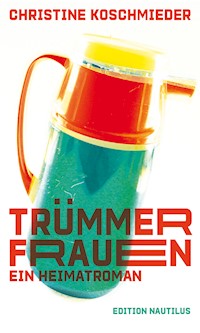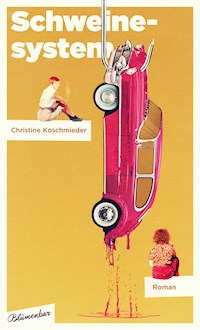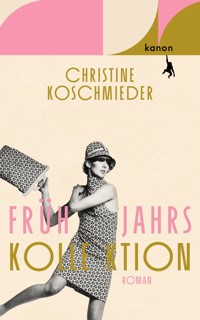
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kanon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Besser kann man die 60er-Jahre nicht zusammenfassen.« Jury, Bachmannpreis 2024 Lilo will den nächsten großen Coup landen: Bademoden für die reife Frau. Das neue elastische Gewebe soll ihr den Swimmingpool hinter dem neuen Bungalow finanzieren. Doch dann steht unerwartet die Vergangenheit in ihrer Kabine. Denn neuerdings interessiert sich die deutsche Justiz für Geschäfte, die damals im besetzten Polen gemacht worden sind. Lilo und Harry sind kein unbescholtenes Paar. Sie verbindet mehr als eine unschuldige Liebe zur Mode. Auch Josef Neckermann, für dessen Versandunternehmen Harry zu arbeiten anfängt, mag lieber nach vorn als zurück blicken. Während Harry für seinen neuen Arbeitgeber auf der Leipziger Messe Verträge aushandelt, erfährt Tochter Reni mehr über die Vergangenheit deutscher Konfektionshäuser, als ihr lieb ist. – Farbig und genau erzählt Frühjahrskollektion von einer Zeit im Wandel und von Frauen, die der Verkleidungen überdrüssig geworden sind. »Wie eine Zeitkapsel: Ich spüre, ich schmecke, ich rieche diese Zeit.« Mithu Sanyal
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Entstehung dieses Werks wurde durch ein Stipendium der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen ermöglicht sowie durch ein Stipendium der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt und der Kloster Bergeschen Stiftung.
ISBN 978-3-98568-159-4
eISBN 978-3-98568-160-0
1. Auflage 2025
© Kanon Verlag Berlin GmbH, 2025
Belziger Straße 35, 10823 Berlin
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Covergestaltung: zero-media.net
Herstellung: Daniel Klotz / Die Lettertypen
Satz: Ingo Neumann / boldfish
Druck und Bindung: Pustet, Regensburg
Printed in Germany
www.kanon-verlag.de
Christine Koschmieder
Frühjahrskollektion
Inhalt
LAUFSTEG (SEPTEMBER 1963 – JULI 1964)
KOWATZ KNIELANG LILO (SEPTEMBER 1963)
AJNGEMAHTEC I HARRY (SEPTEMBER 1963)
POPEYE & POPCORN RENI (SEPTEMBER 1963)
VORERMITTLUNG AUS DER KABINE LILO (APRIL 1964)
TEXTILVEREDELUNG (JUNI/JULI 1964)
PERLON LADY CHARMEUSE HARRY (JUNI 1964)
VORFÜHRDAMEN LILO (JUNI 1964)
DOSENRAVIOLI IN ST. TROPEZ RENI (JUNI 1964)
CHICORÉE & ANDERE ANGELEGENHEITEN HARRY (JULI 1964)
SCHWANENTRETBOOT AUF DEM EDERSEE LILO (JULI 1964)
MATERIALFEHLER (JULI – DEZEMBER 1964)
DIE GELBE TÜR RENI (AUGUST 1964)
AJNGEMAHTEC II ŠLEHTAS KVISN HARRY (AUGUST 1964)
ZUCKERWATTE IN BRIGHTON RENI (AUGUST 1964)
PUSZTAKUCHEN LILO (NOVEMBER 1964)
KRAGENSPIEGELKAVALIERE LILO (JUNI 1943)
LITZER CHIC (DEZEMBER 1964)
BESUCH VOM TÄTERKOMITEE RENI (NOVEMBER 1964)
DIE GRENZEN VON HARRYS UND LILOS VERFORMUNGSBEREITSCHAFT LILO UND HARRY (DEZEMBER 1964)
UNTER EHRENMENSCHEN LILO (DEZEMBER 1964)
AHNENERBE (TWO, THREE, FOUR, TELL THE PEOPLE WHAT SHE WORE) LILO (1943)
SELBSTBEDIENUNG (MÄRZ – AUGUST 1965)
INTERZONENVERKEHR HARRY (MÄRZ 1965)
TEXTILETIKETTEN RENI (MÄRZ 1965)
HÜTER OHNE HAUS HARRY (AUGUST 1965)
LILO’S DINER LILO (AUGUST 1965)
BIG APPLE RENI (AUGUST 1965)
DANK
»I’m totally unconcerned with skirt lengths. They are not the issue. The issue is flying to the moon, killing men in Vietnam, teenagers pouring kerosene over Bowery drifters and setting them on fire. Life isn’t pretty. Clothes can’t be pretty little things.«
»Mit Rocklängen befasse ich mich gar nicht erst. Rocklängen sind nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist, dass wir zum Mond fliegen, Männer in Vietnam töten, und dass irgendwelche Teenager in der Bowery Obdachlose mit Petroleum überschütten und anzünden. Das Leben ist nicht schön. Kleidung kann nicht einfach als schöne Nebensächlichkeit daherkommen.«
Rudi Gernreich
Woman’s World Magazine 1966
TO THE MEMORY OF
1964 erklärt ein Papst einen schwulen jüdischen Modedesigner zum Feind der Kirche. Nicht, weil er schwul und jüdisch ist, sondern weil er einen Badeanzug entworfen hat, der die Brüste freilässt.
1944 füttert ein Papst seinen Kanarienvogel mit Würfelzucker, während er einem Mann eine Audienz gewährt. Der Mann ist ss-Verbindungsoffizier und hat sich hervorgetan bei der Überbrückung von Transportengpässen nach Treblinka.
Der Papst dazwischen vermittelt während der Kubakrise zwischen John F. Kennedy und Nikita Chruschtschow.
Die Geschichte in diesem Buch ließe sich über Päpste erzählen. Aber, um es mit Rudi Gernreich zu sagen: »I realized you could say things with clothes.«
to the memory of rudi gernreich, ida rosenthal, lena himmelstein bryant & fritz bauer
LAUFSTEG(SEPTEMBER 1963 – JULI 1964)
KOWATZ KNIELANGLILO (SEPTEMBER 1963)
Niemand wird den Fußbodenbelag filmen. Oder den Papierkorb. Was für das Kleine Schwarze galt, gilt auch für das Fernsehen. Alles Interessante spielt sich oberhalb der Kniescheibe ab. Lilo trägt Acht-Zentimeter-Absätze, und ihr Lippenstift ist auf ihr fliederfarbenes Kleid abgestimmt. Alles, was das Fernsehen zu interessieren hat, ist gut sichtbar auf Augenhöhe platziert. »Nicht nur der Jugend vorbehalten ist dieses jugendliche Badetrikot aus Nylfrance. Der modische viereckige Ausschnitt, flankiert von schmalen geraden Trägern, die apart in die Seitenteile des Anzugs überlaufen, und der gestreifte Schürzeneinsatz, von einem winzigen Gürtel unterbrochen, lassen selbst stärkere Figuren schmaler erscheinen.« Sie tritt einen Schritt zurück und betrachtet die spargeldünnen Mädchen in den schwarz-weißen Badeanzügen, die sie mit Klebestreifen an der Wand der Umkleidekabine befestigt hat. Sie hat sie aus der »Bunten« ausgeschnitten. Nicht wegen der spargeldünnen Mädchen. Sondern wegen des Materials. Mit der Fußspitze schiebt sie den Papierkorb, in dem die zerschnittenen Reste der Illustrierten liegen, über den abgewetzten Stragula. Für Linoleum hat Harrys Flüchtlingskredit damals nicht gereicht. Zehn Jahre ist das jetzt her, und die Welt besteht nicht mehr aus Witwen, die ihre abgelegte Trauerkleidung zu Kowatz knielang umarbeiten lassen.
»Wir haben jetzt Viskose und Lycra, die Zeit ist reif, das Material den Körpern anzupassen und nicht umgekehrt.« Der Reporter, ein Herr Schneider, tritt unbehaglich von einem Fuß auf den anderen. Er scheint ihrem Blick auszuweichen, so genau kann sie das nicht sagen, seine Augen sind hinter ziemlich dicken Brillengläsern versteckt. Vielleicht hätte sie nicht gleich mit Frauenkörpern einsteigen sollen, vielleicht hat er ein Problem mit Körpern? Bietet man einem Fernsehteam Kaffee an? Lilo bietet ungern Menschen Kaffee an, die ihr nicht in die Augen sehen. Aber vielleicht hat er auch einfach nur einen Silberblick, und dann tut sie ihm unrecht. Für einen Silberblick kann ja niemand etwas. Oder sie hat Lippenstift an den Zähnen.
Viel lieber hätte sie die Fernsehmenschen ja in ihrem frisch bezogenen Hoesch-Bungalow empfangen, wo die Warmluft durch Schächte im Fußboden kommt, direkt von der Gasheizung im Keller, und der Fußboden leuchtet. Sie hatte die Wahl zwischen vier Varianten, Parkettimitat, ein heller Beigeton und ein kräftiges Orange, der Grünton ist von vornherein ausgeschieden, sie will sich ja zu Hause nicht wie im Laden fühlen. Zwei Tage lang ist sie mit dem kleinen Musterfächer auf Knien auf dem Pressholzboden herumgerutscht und hat sich dabei die Nylons ruiniert, bei Tageslicht und bei künstlicher Beleuchtung, tief im Rauminneren und direkt an der verglasten Terrassenfront, es ist ja schon erstaunlich, wie unterschiedlich Farben bei unterschiedlichem Lichteinfall wirken. Sie hat sich dann jedenfalls für das kräftige Orangerot entschieden, das harmoniert mit den Grünpflanzen und den niedrigen Cocktailsesseln, und zwar bei jedem Lichteinfall, vor allem, wenn erst noch der Pool hinter der Terrasse dazukommt, abgesteckt ist er schon, nierenförmig. Alles ihrem Geschäftssinn zu verdanken. Auch wenn ihr seit dem Einzug einmal mehr klargeworden ist, dass man in Hessisch Sibirien von moderner Architektur einfach keine Ahnung hat. Was sie denn mit dem Blechkasten wolle, und ob es für ein richtiges Haus wohl nicht ganz reicht, haben einige ihrer Kundinnen gefragt, keine Ahnung haben die von moderner Wohnraumgestaltung.
Der Kameramann, der ihr höflich die Hand geschüttelt, sein Stativ und eine Lampe aufgebaut hat, weil der Laden doch ein wenig dunkel ist für Filmaufnahmen, hat ohne zu fragen Waren aus den Regalfächern auf dem Zuschneidetisch verteilt. Fragend streckt er ihr seine Thermoskanne entgegen. »Entschuldigen Sie, stört es Sie, oder darf ich?« Sie ist froh, dass sie nicken und ihm eine echte Tasse anbieten und dabei kurz am Spiegel vor der Kabine ihren Lippenstift und ihre Frisur überprüfen kann. Sie hat die Kabine damals nicht umsonst ganz hinten im Laden einbauen lassen. Der Laden ist ein Schlauch, und vorne würde sie in den ohnehin schon schmalen Raum hineinragen. Außerdem sollten die Kundinnen ja vorher an den Auslagen und Ständern vorbeimüssen. Und Tageslicht braucht es an der Kabine schon gar nicht, vor allem, wenn die Sonne scheint, grelles Sonnenlicht im Gesicht, jede Falte ausgeleuchtet, nein, gnädiges Schummerlicht, das durch die gelbliche Elefantenhaut von zwei kleinen Tütenlampen fällt, sie hat extra nur 25-Watt-Glühbirnen reingedreht, und wenn eine Kundin trotzdem zu misstrauisch ihr eigenes Spiegelbild anstarrt, reicht sie ihr Weinbrandbohnen an.
In den ersten Jahren hat sie die Kleider noch direkt an der Kundin festgesteckt, da haben sie die Kabine nur zum Ausziehen genutzt, bevor sie im Mieder und Strumpfhosen wieder rausgekommen sind, aber als ihr Kleines Schwarzes zum Erfolgsmodell avanciert ist, hat sie auf Konfektion umgestellt, wie Hermann Eggeringhaus mit den Inge-Kleidern. Mit den ganzen Heimatvertriebenen ist ja auch das ganze Fachwissen aus den Ostgebieten rübergekommen, sie musste also gar nicht lange suchen, erst hat sie sich die Spezialgrößenfabrik auf dem ehemaligen Militärflughafen von Eschwege angeguckt, weil die schon die modernsten amerikanischen Maschinen hatten, aber leider keine Kontingente für Damenkleider. Sie ist dann in Hünfeld fündig geworden, eine Ungarin mit 60 Mitarbeiterinnen, die macht das schon seit 1953, was die in Paris und Florenz auf den Laufstegen entdeckt, wird 14 Tage später schon in Hünfeld produziert. Seitdem ist ihr Modell dort als Kowatz knielang im Gruppenbuch verzeichnet, Hüfte, Taille, Kragen, Halsweite und Stückzahl, und es hängt in ihrem Laden auf einem eigenen Ständer. Die Tütenlampen schaden trotzdem nicht.
Als sie mit einem Schälchen mit Keksen und einer Büchse Kondensmilch aus dem Hinterzimmer zurückkommt, hat der Reporter sein Jackett an einen Haken gehängt und blättert durch die Illustrierten, aus denen dünne Papierstreifen hervorschauen. Mit ihren Kundinnen macht sie das nicht anders, wenn ein bestimmter Stoff nicht richtig läuft, dann sucht sie in der »Bunten« nach einem Filmstar oder einem Mitglied einer Königsfamilie in einem ähnlich gemusterten Kleid und lässt die Seite aufgeschlagen im Laden liegen. Auch für den Fernsehreporter hat sie ein paar Seiten markiert. Nach seiner irritierten Reaktion auf die Nylfrance-Bilder an der Kabine ist sie froh, dass sie keinen Papierstreifen zwischen die Nackten am Strand von St.Tropez gelegt hat. So selbstbewusst sie ihre Körper zur Schau stellen, Nacktheit ist kein gutes Verkaufsargument, wenn man Badetextilien verkaufen will. Außerdem besteht ihr Kundenstamm aus den Gattinnen nordhessischer Lokalprominenz, die nicht einmal moderne Architektur zu würdigen wissen.
»Hier, wäre das kein guter Einstieg?« Sie schiebt ihm die Seite zu, auf der Romy Schneider, Françoise Hardy und die Baronin Rothschild in langen Hosen bei einer Premiere im Pariser Lido abgedruckt sind, darüber die Schlagzeile »Ab jetzt haben sie die Hosen an«. Sie hat auch noch Jackie Kennedy im Angebot, elegant, modern und emanzipiert, makellos und anmutig, wie aus dem Ei gepellt führt sie die Fernsehnation durchs Weiße Haus, das sie nach ihren Vorstellungen hat umgestalten lassen. Jackie Kennedy ist so viel mehr als eine dekorative Gattin, sie spricht mehrere Sprachen und hilft ihrem Mann bei seinen Reden, und der ist immerhin der Präsident von Amerika. Die Cover mit Farah Dibah hingegen hat Lilo sofort aussortiert, sie hat dem Schah nie verziehen, dass er Soraya abserviert hat, weil sie ihm keinen männlichen Erben geboren hat. Dabei ist ja ganz offensichtlich er es, der keinen gezeugt hat. »All diese Frauen stehen doch für etwas. Das ist genau die Generation Frau, für die ich Badeanzüge entwerfen möchte.« Herr Schneider greift nach einem Keks und guckt ein wenig angestrengt. »Entschuldigen Sie, liebe Frau Lilo, aber wir sind ja hier, um einen Beitrag über Ihre Geschichte zu drehen, über Ihren Erfolg mit dem Kleinen Schwarzen. Was Ihre Bademodenidee angeht, können wir gerne darüber sprechen, wenn es so weit ist.« Er hat jetzt ein Mikrophon in der Hand. Der Kameramann tritt an sie heran und legt ihr die Hand auf die Schulter, »darf ich?«, er dirigiert sie einen Schritt nach vorne, dann wieder einen halben nach hinten, bis sie in der richtigen Position steht, sie kommt sich vor wie eine Topfpflanze.
Und dann schiebt er auch noch ihren Trumpf aus dem Bild, die aufgeschlagene Bildstrecke mit der Fürstenfamilie von Monaco, die kleine Prinzessin Caroline im blau-weiß gestreiften Badeanzug, die mit gebeugten Knien am Beckenrand steht, kurz vor dem Sprung, die quietschgelbe Badekappe wie eine Zitrone auf dem Kopf. Auf dem nächsten Bild krault sie im einwandfreiem Stil durchs Becken, das behauptet zumindest der Begleittext, Lilo hat keine Ahnung von einwandfreiem Kraulstil, aber das rundum von einer Badekappe umschlossene kleine Prinzessinnengesicht über der Wasseroberfläche rührt sie. Prinz Rainier will seine Kinder so oft wie möglich mit bürgerlichen Gleichaltrigen zusammenkommen lassen, weiß die »Bunte«, deswegen besucht die Fürstenfamilie ein öffentliches Schwimmbad, hinter riesigen schwarzen Sonnenbrillengläsern begutachtet die makellose Grace Kelly ihre Tochter unter einem breitkrempigen Sonnenhut hervor, hinter ihr der schöne Rainier im lässigen schwarzen Hemd, an seinem Bein ein kleiner Junge in kurzen Hosen, Albert, Carolines Bruder. Ein Mann, eine Frau, ein Kind. Ein Vater, eine Mutter, ihr Kind. Die Fürstenfamilie von Monaco schlägt Jackie Kennedy, hat Lilo gefunden, außerdem geht es ums Schwimmen.
Herr Schneider lässt die Zeitschrift in der Ablage unter dem Tisch verschwinden, »die brauchen wir nicht im Bild, das lenkt nur unnötig ab«, er guckt jetzt wie ein Fernsehreporter. »Ich weiß, dass Sie das schon ein Dutzend Mal erzählt haben, und ich habe natürlich meine Recherchen zu Ihnen gemacht, aber lassen Sie uns davon ausgehen, dass unsere Zuschauerinnen Ihre Geschichte natürlich nicht kennen. Ich würde also gerne damit einsteigen, wie alles für Sie angefangen hat.« Er streckt ihr das Mikrophon entgegen. Lilo bezweifelt, dass er das wirklich wissen will, denn angefangen hat es für sie damit, dass man der deutschen Frau das französische Mieder ausreden wollte, die deutsche Frau, hieß es, trägt keine französischen Mieder, französische Mieder machen Frauen unfruchtbar, und die deutsche Frau darf nicht unfruchtbar werden. Ein paar Jahre später ist Lilo in Feldgrau, Filz und klobigen Stiefeln in Litzmannstadt einmarschiert, hat sich als Wehrmachtmatratze beschimpfen lassen und ist nicht unfruchtbar geblieben. Sie hat ein Kind produziert und ein Hochzeitsfoto und mit Pferdedecken-Couture und umgearbeiteten Fahnen die Zeit überbrückt, bis sie mit Harrys Flüchtlingskredit den Laden aufmachen konnte. So hat sie angefangen. Alle haben sie so angefangen. Nur hatten manche eben ein bisschen mehr Fantasie und die besseren Bezugsquellen. Das erzählt sie dem jungen Mann natürlich nicht. Sie versucht, sich darauf zu konzentrieren, ihm in beide Augen gleichzeitig zu gucken und zu erzählen, was er hören will. Was die Fernsehzuschauerin hören will. Was er glaubt, was die Fernsehzuschauerin hören will. Er wirkt jung, Anfang dreißig vielleicht, bei Kriegsende war der noch ein halbes Kind. Im schlimmsten Fall haben sie ihm in den letzten Wochen noch eine Waffe in die Hand gedrückt oder einen Spaten, aber lieber stellt sie sich ihn vor, wie er in kurzen Hosen auf Bäume geklettert ist oder für seine Mutter am Feldrand Blumen gepflückt hat, Kornblumen, Mohn oder Margeriten vielleicht. Wahrscheinlicher ist, dass er liegengebliebene Kartoffeln aus Ackerfurchen geklaubt hat.
»Darf ich kurz?« Sie bückt sich, um eine der Schubladen zu öffnen, und lässt ein Briefchen Stopfwolle und ein Briefchen Stopftwist auf den Zuschneidetisch fallen, »für Sie vielleicht eine Selbstverständlichkeit, aber damals gab’s die nur auf Bezugsschein«. Herrn Schneiders Blick ist zu entnehmen, dass Stopfwolle und Stopftwist für ihn keine Selbstverständlichkeit sind, der Kameramann richtet die Kamera auf die beiden Zwirnbriefchen, und Lilo fängt an, ihren Text abzuspulen für Herrn Schneider und für diese ganze junge Generation, die nicht mehr weiß, wie das war mit den rationierten Rohstoffen und den Unterhosen aus aufgeribbelten Jutesäcken, sogar Lehrfilme haben sie damals produziert, wie man Sofabezüge, Pferdedecken und Vorhänge zu Bekleidung umarbeitet, mit Applikationen aus Klaviertastenschonern. Heute wären Wintermäntel aus Pferdedecken wahrscheinlich der letzte Schrei.
Lilo hat oft genug mit der Presse gesprochen, um zu wissen, dass es das ist, was sie wollen. Tapfere, einfallsreiche Frauen, die entbehrungsreichen Zeiten trotzen, bieten genau den Kontrast, den sie brauchen, um ihren Aufstieg zum Kasseler Wirtschaftswunder so richtig schön in Szene zu setzen. Nicht etwa als Lilos Chic und Lilos Wunder, nein, das Patent an ihrem Wunder hat sie offenbar mit Gewährung des Flüchtlingskredits an das Land Hessen abgetreten.
Die Kamera schwenkt zurück auf Lilo, sie neigt den Oberkörper ein wenig nach vorne, sodass die Kamera sie von schräg oben erfasst, sie weiß, dass Hals und Kinn das Alter verraten, genauso gut weiß sie, welcher Winkel vorteilhaft für sie ist, im Rahmen ihrer Möglichkeiten überlässt sie nichts dem Zufall, selbst bei der Wahl des figurbetonten fliederfarbenen Wollkleids hat sie daran gedacht, es mit der Fußbodenfarbe abzustimmen. Sie lächelt in die Kamera. Nachkriegszeit, Stoffmangel, die Todesanzeigen in den Zeitungen, sie hat die Geschichte schon so oft erzählt, wie sie also die Traueranzeigen aus der Zeitung ausgeschnitten und nach Datum sortiert abgeheftet hat, um nach Ablauf des Trauerjahres die Angehörigen anzuschreiben und ihnen einen guten Preis für die Trauerkleidung zu machen. Wie sie all die schwarze Bekleidung im Hinterzimmer gelagert und nach und nach aufgetrennt und daraus nach dem Vorbild von Coco Chanels Kleinem Schwarze Kleider hat schneidern lassen. Die Entwürfe hat sie noch selber gemacht, mit Nesselschnitt, nähen lassen hat sie dann in der Eichhofsiedlung, die waren ja froh um den Zuverdienst, aber irgendwann ging es eben nicht mehr um maßgefertigte Einzelstücke. »Und so bin ich 1958 mit Kowatz knielang in Serienfertigung gegangen, bei einem ungarischen Flüchtlingsbetrieb in Hünfeld. Das Bundesvertriebenengesetz hat ja vielen den wirtschaftlichen Wiedereinstieg ermöglicht.«
Sein leicht erstaunter Gesichtsausdruck entgeht ihr nicht. Sie kann nicht sagen, ob der sich darauf bezieht, dass sie einen Begriff wie »Serienfertigung« verwendet oder das Bundesvertriebenengesetz kennt. Natürlich hat sie sich mit betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen befasst, niemand setzt sich einfach mit der Nähmaschine an den Straßenrand und wartet auf Kundschaft. Das war vielleicht im Getto so, aber doch nicht mehr in der Bundesrepublik. Natürlich erwähnt sie das Getto nicht, genauso wenig wie die Tatsache, dass sie nicht auf die rationierten Stopfwollebriefchen angewiesen war, zum Glück hat er viel zu wenig Ahnung von der Textilfertigung, um sich zu fragen, wo sie all das Garn aufgetan hat, kein Kowatz knielang ohne handgesticktes Etikett, Litzer Chic hat sie ihre Linie genannt, als kleine Verbeugung vor denjenigen, denen sie die Garnrollen aus den Beständen der Litzmannstädter Textillager verdankt. Nein, das erzählt sie Herrn Schneider nicht, aber dass sie eine gewiefte Geschäftsfrau ist, das darf er ruhig wissen, der Jungspund mit dem arroganten Blick hinter seiner dicken Hornbrille, der sich wahrscheinlich für reichlich überlegen hält mit seinem Mikro und seiner Anstellung beim Hessischen Rundfunk. Für ihn ist sie nur eine Frau, die es mit ihrer Nähmaschine zu Erfolg gebracht hat.
Frauen an Nähmaschinen oder Frauen, die über Improvisationstalent verfügen, sind nichts Besonderes, im Krieg nicht und danach nicht, genauso wenig wie Männer mit Geschäftssinn oder Kriegsgewinnler. Was eine Lilo Kowatz aus Kassel von den Frauen mit den Nähmaschinen und dem Improvisationstalent unterscheidet, ist ihr Geschäftssinn. Was eine Lilo Kowatz aus Kassel von den Männern mit Geschäftssinn unterscheidet, ist, dass sie eine Frau ist. Sie hat es vielleicht nicht von der Tellerwäscherin zur Millionärin gebracht, aber immerhin von der Wehrmachtmatratze zum Hoesch-Bungalow mit Stahlschienen an der Decke, von denen an unsichtbaren Perlonfäden die großformatigen Farbaufnahmen von Reni, ihrer Mannequintochter, hängen. Aber gut. Sie wollen das Handwerk. Sie wollen keine Stahlschienen, sie wollen Kleidergondeln, also bietet sie ihnen die Kulisse, die sie brauchen, und befestigt die Bilder, die sie braucht, mit Tesafilm an einer Schleiflackumkleidekabine.
Trotzdem ärgert sie sich über diesen Jungen, der ohne Hut und Sachkenntnis in ihrem Laden auftaucht und wie alle anderen ein Bild bestätigt bekommen will, das noch nie gestimmt hat. »Lassen Sie mich auch noch den weniger bekannten Teil der Geschichte erzählen. Erinnern Sie sich, wie sich Scarlett O’Hara in ›Vom Winde verweht‹ ein Abendkleid aus Vorhängen schneidern lässt, weil sie kein Geld für ein neues Kleid hat?« Er kann sich weigern, mit ihr über Bademoden und Frauenkörper zu sprechen. Er kann verwundert die Brauen hochziehen, wenn sie sich zu ökonomischen Rahmenbedingungen äußert. Er kann ihre Zeitschriften aus dem Bild wischen. Aber in die Kamera sagen kann sie, was sie will. Es ist ihre Geschichte. Er muss ihr zuhören. »Die deutsche Scarlett O’Hara heißt Margarethe Klimt. Margarethe Klimt hat damals das Frankfurter Modeamt geleitet, auch im Krieg noch. Baumwolle gab es längst nicht mehr, die gesamte Textilproduktion hatte auf Zellfaser umgestellt. Und was macht die Klimt? Sie erschafft unglaubliche Kreationen, aus Vistra, Zellfaserstoffen und Waschseiden, Regenmäntel aus Fallschirmseide, Ballkleider aus Gardinentüll. Und wussten Sie, woraus die Frontscheiben von Flugzeugen gemacht sind? Plexiglas. Margarethe Klimt hat Plexiglas aus der Flugzeugproduktion verarbeitet. Zu Knöpfen und Schuhabsätzen. Und wir reden hier von 1937.« Drei Mal hat er angehoben, eine Zwischenfrage zu stellen, aber sie hat sich nicht unterbrechen lassen. Reni hat ihr Fotos aus England gezeigt, junge Dinger in hohen weißen Stiefeln mit Kunststoffabsatz, der letzte Schrei, hat Reni geschwärmt, dabei hat Margarethe Klimt in Deutschland schon vor fast dreißig Jahren den Cinderella-Absatz aus Plexiglas entworfen.
»Das sind in der Tat für unsere Zuschauerinnen sehr faszinierende Informationen. Aber wenn Sie jetzt vielleicht doch den Bogen zu Ihrer eigenen Geschichte spannen könnten? Am besten, Sie erzählen weiter, während wir eine Runde durch Ihren Laden drehen, ich stelle mir das in etwa so vor: Sie in Großaufnahme in der Ladentür, Sie winken die Kamera in den Laden, kurzer Schwenk über Sortiment und Innenausstattung, Auftritt die interessierte Kundin, Schwenk auf einen Knopf, den Sie dann in die Kamera halten, am besten zwischen Daumen und Zeigefinger, damit man die Oberflächenstruktur gut erkennen kann, Sie erläutern der Kundin die Unterschiede, vielleicht können Sie dabei auch ein bisschen Ihre Verbundenheit mit den Materialien betonen, wie wichtig es ist, bei der Auswahl die Seele des Materials zu berücksichtigen oder so in die Richtung, und zum Abschluss drehen wir noch ein paar atmosphärische Bilder?«
Ob sie ihm sagen soll, dass er mit beiden Füßen schon mitten in ihrer Geschichte steht, auf ihrem grüngrauen Stragula mit dem kaum mehr sichtbaren Blumenaufdruck, nur dass sie ihren Fußbodenbelag schlecht zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und in die Kamera halten kann? Der Kameramann schraubt die Verschlüsse von den Knopfröhrchen und verteilt ihren Inhalt auf dem Zuschneidetisch, seine Augen fangen an zu glänzen, als er sie mit den Händen durcheinanderbringt, es gibt überhaupt keinen Grund dafür, Knöpfe auf dem Tisch anzuhäufen, als wären sie Münzen aus einem Piratenschatz, jeder, der Ahnung vom Metier hat, wird das sofort erkennen, aber gut, sie schwenkt zu den späten Fünfzigern, ihr Mann ist aus der Kriegsgefangenschaft zurück, mit seinem Flüchtlingskredit können sie den Laden eröffnen, sie fängt bescheiden an, mit Stoffresten und Cameliabinden, Strümpfen und Kurzwaren, Lilo tritt an eine der mehrstufigen Gondeln, greift zwei Paar Stricksocken heraus und erzählt der Kamera, wie sie 1953 das Sortiment um Pullover und Strickwaren erweitert hat. Steigt auf den Hocker und streckt sich nach einem Fach in den deckenhohen Wandregalen, in denen die Stoffballen lagern, anfangs hat sie die Stoffe abgeholt, wo auch immer jemand welche vorrätig hatte, seit zwei Jahren bezieht sie alle Stoffe von einem Händler an der niederländischen Grenze, alle paar Monate fährt sie mit Harry dorthin, und sie beladen den Kofferraum seines Opel Rekord.
In die Garage führt sie das Filmteam aber nicht, und auch die kleine Reni, die immer auf der Stoffrestekiste unter dem Schaufenster sitzt, fällt als Motiv aus, denn Reni sitzt nicht mehr auf der Restekiste, Reni ist zwanzig und tourt nach Anfängen als Kaufhausmannequin inzwischen mit der Norddeutschen Modenschaugesellschaft, natürlich können sie Fotos von ihr abfilmen, Reni im Wintermantel mit russischer Pelzmütze, Reni im paillettenbesetzten Abendkleid mit hinreißendem Diadem in den hochgesteckten Haaren, Reni im weißen Sportdress, auf ihren Tennisschläger gestützt am Netz, die ganze Wand neben der Kasse ist zugepflastert mit Reni-Motiven, Lilo hat darauf geachtet, dass auch das Logo und der Schriftzug von Freds Modeschaugesellschaft gut zu erkennen sind.
»Wenn wir jetzt dann noch das Verkaufsgespräch filmen könnten, also mit einer Kundin?« Lilo kostet den Moment aus. »Nehmen Sie sich ruhig einen«, fordert sie den Kameramann auf, der fasziniert mit seiner Kamera das Glas mit den roten Himbeerlollis auf der Theke umrundet, Verkaufsförderung, um quengelige Kinder gnädig zu stimmen. Es wird keine Kundin den Laden betreten, solange da ein Fernsehteam mit Scheinwerferlicht und Kamera zugange ist, das müsste er doch längst gemerkt haben. Wenn er Kundschaft filmen will, wird er Kundschaft mimen müssen. Während er sein Jackett vom Haken nimmt, sucht sie ihm einen Hut aus, damit er sich mehr wie ein Kunde fühlt. Sie entscheidet sich für ein Hahnentritthütchen, das sich mit dem Tweedmuster seines Jacketts beißt. Der Kameramann feixt mit dem Lolli im Mundwinkel. Lächelnd greift sie einen kamelfarbenen Knebelknopf aus dem Haufen und hält ihn zwischen Daumen und Zeigefinger in die Kamera, während sie dem interessierten Kunden, den die Kamera von hinten filmt, sodass nur die Krempe des Hahnentritthütchens und ein Stück Nase erkennbar sind, die Unterschiede zwischen Rohlingen aus Perlmutt, Hirschhorn, Büffelhorn oder Edelhölzern erklärt. Nur den Satz mit der Seele, die jeder Knopf hat, den sagt sie nicht. Am besten noch jede Gummilitze mit eigenem Schicksal.
»Entschuldigung, können wir die Eingangsszene noch mal drehen?« Der Kameramann streckt ihr die Maßbandrolle entgegen, die er unter der Ladentheke gefunden haben muss, als er das Lolliglas aus allen Perspektiven gefilmt hat. »Damit weiß der Zuschauer sofort, worum es geht, noch bevor überhaupt das erste Wort gefallen ist. Also wenn Sie das um den Hals hängen haben, wenn Sie da in der Tür stehen und das Fernsehteam hereinbitten. Und damit natürlich auch das Publikum an den Bildschirmen.« Er ist begeistert von seiner Idee, klackernd wandert die Zuckermasse an seinen Zähnen entlang, als er den Lutscher in den anderen Mundwinkel schiebt. Lilo ist klar, dass ein hingerissenes Fernsehpublikum nicht unerheblich für ihren Erfolg ist, und wenn das erfordert, dass sie sich ein Maßband um den Hals hängt und die romantische Knopfhändlerin gibt, dann stellt sie sich jetzt eben in ihren Acht-Zentimeter-Absatz-Schuhen in die Tür. Und lächelt. Nach dem Krieg hat sie für die Amerikaner gearbeitet, und einmal hat ein GI sie mit ins Kino genommen, »Endstation Sehnsucht« hieß der Film, und die Hauptfigur hat einen entscheidenden Satz gesagt: »I don’t want realism. I want magic!« Magie, hat Lilo da verstanden, ist eine Währung. So let the Maßband do its magic.
Nach einem Blick auf die Uhr gibt Herr Schneider dem Kameramann ein Zeichen, sie haben genug Material, aber ob sie vielleicht noch ein Foto aus ihrer Anfangszeit für ihn hat, am besten aus den schweren Zeiten, also aus dem Krieg oder kurz danach, wegen der Bezugsscheine und der Rationierung, das könne man dann gut einblenden. Während der Kameramann die Ausrüstung zusammenpackt, studiert er ausgiebig das Kalbslederschweißband im Innern des Hahnentritthütchens. Über Bademoden will er ganz offensichtlich nicht mit ihr sprechen. Für Bademoden sind die spargeldünnen Mädchen zuständig. Junge Frauen wie Reni, mit Körpern, die für die Oberfläche taugen. Frauen wie sie sind nur noch Köpfe unter genopptem Gummi, mit Blüten oder Rüschen, rot, gelb, blau, wie wasserdichte Bonbons. Sie wird sich eine andere Strategie überlegen müssen. Mit zum Abschied erhobener Hand bleibt sie hinter der Schaufensterscheibe stehen, bis das Auto aus ihrem Blickfeld verschwunden ist, dann kickt sie die hohen Schuhe von den Füßen, zieht die Papierstreifen aus den Illustrierten und sortiert die Knöpfe zurück in ihre Röhrchen. Sie hat Herrn Schneider nicht einmal nach dem Sendetermin gefragt. Auf das Hahnentritthütchen hat sie ihm trotzdem zehn Prozent Rabatt gewährt und dem Kameramann noch drei Lutscher in die Hemdtasche gesteckt. »So einen Fußboden hatten wir in der alten Heimat auch in der Küche«, er ist sogar kurz in die Knie gegangen und hat zärtlich über das abgewetzte Blütenmuster gestreichelt, »Breslau«.
AJNGEMAHTEC IHARRY (SEPTEMBER 1963)
»Die hot a Švips!«
Harrys Oberkörper versteift sich unter ihrem Gewicht, er muss sich zusammenreißen, den schweren Körper an seiner Brust nicht von sich zu stoßen und aufzuspringen, die weichen Arme, die sich mit unerwarteter Kraft in seinem Nacken festklammern, die geschliffenen bunten Glassteinchen ihrer Schmetterlingsbrosche, die sich durch sein Hemd drücken. Die schwitzende, schwere Frau, die wie ein Sandsack an seiner Brust hängt, hat mehr als nur einen Schwips. Sie riecht nach Calvados und Bénédictine-Likör, ihre Achselhöhlen sind viel zu dicht an seinem Gesicht, und die Gablonzer Modeschmuckbrosche an ihrem Diolenkleid wird ein Loch in sein Oberhemd reißen, wenn er nicht aufpasst. Er hat es kommen sehen und extra gewartet, bis sie sich alle an den reservierten Tischen in der Auberge niedergelassen hatten, und sich dann mit dem Rücken zu ihr an einen anderen Tisch gesetzt, für ihren Reiseleiter rücken sie gern ein bisschen auseinander. Völlig nutzloses Manöver bei einer von diesem Format. Zumal er es ja hat kommen sehen. Es ist immer eine dabei. Nur den Namen weiß man vorher nicht.
☑Anderlitschka, Elisabeth
□Bergmann, Helga
☑Borufka, Emmy
☑Brentano, Edelgard
☑Bravnitschek, Elisabeth
☑Csokor, Lida
☑Dittmann, Therese
☑Eberle, Veronika
☑Feidenhengst, Anna
☑Gelinek, Heiderose
☑Gertitschke, Ingeborg
☑Hafenbradl, Gertrud
☑Hajak, Elfriede
☑Jarosch, Renate
☑Johne, Irma
☑Jurenka, Elli
☑Kittel, Olga
☑Kolepke, Hilda
☑Loewe, Erika
☑Meergans, Viola
☑Musch, Charlotte
☑Novak, Marie
☑Ochsenhalter, Emma
☑Petrik, Johanna
☑Rindt, Maria
☑Sackl-Walden, Clara
☑Urban, Hedwig
☑Wanka, Edith
☑Zeleny, Martha
Sie steigen natürlich nicht alphabetisch ein, wenn sie morgens ab halb acht am Sammelpunkt in Kehl eintreffen und er beim Einstieg die Namen abgleicht, aber ein paar Anhaltspunkte bietet die Teilnehmerliste schon, Adressen und Geburtsjahrgänge, den Familienstand sowie das Verwandtschaftsverhältnis zu ihrem jeweiligen Toten. Anderlitschka, Borufka, Bravnitschek, Csokor, Feidenhengst, Gelinek, Hafenbradl, Hajak, Jarosch, Kittel, Kolepke, Loewe, Novak, Ochsenhalter, Petrik, Wanka und Zeleny haben zusätzlich den Vermerk »Sudetendeutsche Landsmannschaft«, Johne, Meergans und Urban den Vermerk »Ostzone«, und Bergmann war auch um zwanzig nach acht noch nicht am Sammelpunkt, das muss er der Geschäftsstelle melden, es besteigen also nur 28 Frauen den Bus. Die meisten von ihnen sind mit der Bahn angereist, als Eltern, Ehegatten, Geschwister und Kinder der gefallenen deutschen Kriegsteilnehmer haben sie beim Besuch von Kriegsgräbern Anspruch auf Fahrpreisermäßigung. Und auf jeder Fahrt gibt es eine Emmy Borufka. Eine, die schon beim Einsteigen, wenn er ihre Namen abfragt, um sie auf seiner Liste abzuhaken, stehenbleibt, ihren Blick auf seinen Jackettaufschlag mit dem Namensschild senkt, um ihm dann vertraulich die Hand auf den Arm zu legen. »Ich bitte Sie, lieber Harry – ich darf doch Harry sagen? –, ab jetzt bitte nur noch Emmy, keinen Widerspruch«, und das sagt sie so laut und so nachdrücklich und bleibt dabei so demonstrativ im engen Gang vor ihm stehen, dass auch die hinter ihr einsteigenden Frauen mitkriegen müssen, dass Harry sie jetzt nicht mehr mit Frau Borufka ansprechen kann, ohne dass sie es als Zurückweisung auffassen muss. Er lächelt sie an und bittet sie, durchzutreten und sich einen Platz auszusuchen.
Er hat es hauptsächlich mit Frauen zu tun, anfangs Witwen und Mütter, seit ein paar Jahren melden sich auch immer mehr Töchter an, die die Gräber ihrer Brüder und Väter besuchen wollen. Seit 1956 arbeitet er als Reisebetreuer für die Volksbund-Geschäftsstelle in Kassel. Er beantwortet ihre Anfragen und teilt ihnen mit, wenn die Suchkartei einen Treffer ergeben hat. Er tippt die Zwischenaufenthalte in die Anmeldungsformulare (Andilly ab Kehl über Strasbourg – Zabern – Saarburg – Toul – Nancy – Andilly – zurück über den Donon – Schirmeck), korrespondiert mit Reisebüros und Busunternehmen, stempelt Quartiervermittlungsscheine, bearbeitet Anträge auf Fahrpreisermäßigung sowie Sonderwünsche und Grabschmuckaufträge. Manchmal muss er sich Beschwerden über die zugeteilten Zimmer anhören, fast immer über die dünnen, am Fußende unter der Matratze festgestopften Laken, er hat sich daran gewöhnt, aber für viele, die erstmals an einer Kriegsgräberfahrt nach Frankreich teilnehmen, sind die französischen Betten eine Zumutung, als wollten die Franzosen die Deutschen noch im Schlaf demütigen, und das Croissant, das sie dann morgens in der Pension statt eines ordentlichen Frühstücks zum Kaffee gereicht kriegen, macht es natürlich nicht viel besser. Auch über die französischen Autobahnraststätten und ihre Toiletten mit den im Boden eingelassenen Löchern darf er sich oft Beschwerden anhören. Aber spätestens nach dem Besuch der Gräberstätten geht es dann um die Ehre und das Ansehen der Toten. Sind ja immer auch 131er dabei oder Witwen von 131ern. Und mindestens eine Emmy Borufka ist auch bei jeder Fahrt dabei, Gräberschatten nennen sie solche Kaliber in der Zentrale unter der Hand.
Am Anreisetag sind sie meistens praktisch gekleidet, aber wenn sie am zweiten Tag den Bus vor dem Hotel zum zweiten Friedhofsbesuch besteigen, haben sie sich oft feingemacht, dann riecht der ganze Bus nach Haarspray und Kölnisch Wasser, und er sieht Perlenketten und Hirschkopfbroschen an ihren Blusen und Pullovern und Jackenkragen, viel Trachtenfilz und Loden, die meisten haben vernünftiges Schuhwerk gewählt, die Wege auf dem Friedhof sind nicht gepflastert, und die Grabkreuze stehen in endlosen Reihen auf der Wiese, es gibt keine Wege, sie müssen über den unebenen Boden laufen. Emmy Borufka trägt keine Lodenjacke. Emmy Borufka trägt ein senfgelbes Etuikleid aus Diolen mit passendem Jäckchen, am Revers eine auffällige Brosche in Schmetterlingsform.
»Nein, ist das etwa Gablonzer Bijouterie?« Gertrud Hafenbradl, stellt sich heraus, kommt nicht nur aus Gablonz, dem einstigen Mittelpunkt der nordböhmischen Schmuckwarenindustrie, sondern gehörte auch zum Heer der jungen Frauen, die an langen Tischen in einer der 4.000 Gablonzer Bijouterie-Manufakturen mit einer Pinzette winzige geschliffene Facettensteine auf kleinen Ziervögeln befestigt haben. Neben dem beliebten Christbaumschmuck war die Schmetterlingsbrosche an Emmy Borufkas Revers einer der Gablonzer Verkaufsschlager, aber auch die mit Glassteinchen beklebten Ziervögel, von denen sie erzählt, kennt Harry. Nach der Vertreibung ist Gertrud Hafenbradl dem Unternehmen nach Neugablonz hinterhergezogen, aber es war dann nicht mehr dasselbe, und außerdem wollte ihr Mann nicht, dass sie weiter arbeitet. Zärtlich betrachtet sie die leuchtend violetten und strahlendgelben Steine, und auch in Harry rufen die polierten Glassteine eine warme Erinnerung wach, die dunkelviolette Oberfläche erinnert ihn an die Fruchtdrops mit Johannisbeergeschmack im Handschuhfach von Lilos VW-Käfer, die Vorstellung lenkt ihn lange genug ab, um den Anschluss zu verpassen, sodass er nicht weiß, wie Emmy Borufka das Gespräch so schnell von einem nordböhmischen Schmetterling in die Vereinigten Staaten von Amerika verlagert hat.
»Stellt euch das mal vor, der Marlboro-Mann mit einem Cowboyhut aus Neutitschein. Hat dann aber doch nicht geklappt.« Emmy Borufka kommt aus dem Kuhländchen und hat vor dem Krieg in Neutitschein für Hückel’s Söhne im Staffiersaal gearbeitet, als Neutitschein noch zu Deutschmähren gehört hat und die Hutindustrie von Neutitschein weltberühmt war. »Bis nach Übersee haben wir geliefert, und unterm Kaiser waren wir sogar k.u.k. Hof-Hutfabrikant.« Unterm Kaiser hat sie natürlich noch nicht im Staffiersaal gearbeitet, aber der Staffiersaal, erklärt sie den anderen Frauen, die nicht so vertraut mit der Hutmacherei sind, ist der Ort, an dem die Garnitur an die Hüte kommt, also Futter, Leder, Einfass- und Bindband. Auch in Belgrad hat man die Haarfilzhüte vom ehemaligen k.u.k. Hof-Hutbarikanten Hückel’s Söhne aus Neutitschein im gehobenen Sortiment der Herrenkonfektion geführt, aber das behält Harry für sich, er wird sich hüten, Emmy Borufka weitere Angriffsfläche zu bieten. »Nach dem Kriege musste der Herr Hückel ja weg aus Neutitschein, ist mit seinen Söhnen ausgewandert und hat versucht, in Kanada die Familientradition fortzusetzen, dort haben die ja auch mit Pelztierfellen gearbeitet, sogar mit der Firma Stetson hat er Kontakt aufgenommen. Das sind die mit den Cowboyhüten, stellt euch das mal vor …«
Und dann schwärmen sie von den schönen Volkstänzen, die sie im Kuhländchen hatten. Heute heißt Gablonz Jablonec nad Nisou und Neutitschein Nový Jičín, und beide liegen in der Tschechoslowakei wie alle ihre Orte, im Egerland, im Kuhland und wo seine sudetendeutschen Kriegerwitwen und Schwestern und Töchter und Mütter von Gefallenen noch herkommen, sie nennen sich Deutschböhmen und Deutschmähren, aber irgendwie sind sie auch Sudetendeutsche, und irgendwie gehört ins Sudetenland Schlesien mit hinein, aber Schlesien ist jetzt Polen, und Böhmen und Mähren liegen in Tschechien und in der Slowakei, und dann gibt es ja auch noch Österreichisch-Schlesien und Tschechisch-Schlesien. Auf den Fahrten, auf denen auch Männer dabei sind, immer ist einer unter ihnen, der ihm das historisch ganz genau erklären kann, wie das war mit Österreich-Ungarn und der Habsburgermonarchie, und dann gibt es ja auch noch die Karpatendeutschen, aber die kommen aus der Slowakei und haben mit Böhmen und Mähren nichts zu tun, dafür haben sie die Hohe Tatra, und ihre Mundart hat auch Eingang ins Sudetendeutsche Wörterbuch gefunden, aber so penibel sie mit der Festlegung sind, auf welcher Wiese und vor welchem Gebirge ihre Kühe und Höfe jetzt gestanden und auf welchem Anger sie ihre traditionellen Tänze getanzt haben, haben sie doch eine Gemeinsamkeit, die sie ausnahmslos betonen: Immer sind es die fleißigen Deutschen, ohne die die ganze Hutmacherindustrie und Glasindustrie und Schmuckindustrie nicht zu der geworden wäre, die sie jetzt ist, und am Ende sitzen sie alle in seinen Bussen, die Angehörigen der aus dem Sudetenland Vertriebenen, und lassen sich in den Westen fahren, zu den Gräbern ihrer böhmischen und mährischen und schlesischen und sudetendeutschen und donauschwäbischen und deutschböhmischen und deutschmährischen Toten, die an der Westfront für die Heimat im Osten gefallen sind und von denen nicht einmal ihre Heimat, nur ihr Handwerk noch geblieben ist. Auf dem Gelände einer ehemaligen Sprengstofffabrik in Kaufbeuren haben sich die Vertriebenen aus Gablonz angesiedelt und den Betrieb wiederaufgenommen. Heute werden von Neugablonz aus sogar die Vereinigten Staaten mit Gablonzer Christbaum- und Modeschmuck beliefert.
Die Sonne blendet durch die Wolkendecke. Genau genommen sind es die gleißend weißen Wolken, die ihn blenden, aber natürlich weiß Harry, dass es nicht die Wolken sind, sondern die Helligkeit der dahinterliegenden Sonne ist, die ihn gerade in die Zwickmühle bringt. Sonne oder Wolken. Mehr Belichtungseinstellungen hat die kleine silberne Instamatic nicht im Angebot, er muss jetzt eine Entscheidung treffen, zumal Frau Jarosch, die ihm das Gerät in die Hand gedrückt hat und im Bildausschnitt vor dem Sucher darauf wartet, dass er auslöst, sich auf dem niedrigen Steinkreuz abstützt, Hüftarthrose, ihr Gehstock soll nicht mit ins Bild, darauf hat sie bestanden. »Sie gucken nur durch und drücken ab, hat meine Tochter mir erklärt.« Sie ist davon ausgegangen, dass das Foto eine Angelegenheit von wenigen Sekunden ist, Sonne oder Wolken, Harry, konzentrier dich, diese Kamera ist entwickelt worden, um die Bedienung durch Laien zu ermöglichen, in diesem Fall die Belichtungseinstellung. Die Sonne brennt ihm in den Nacken, Harry spürt das schmale Rinnsal zwischen seinen Schulterblättern, er kann jetzt nicht den Blazer ausziehen, Sonne, entscheidet er, schiebt den Regler auf das Sonnensymbol und lächelt Frau Jarosch aufmunternd zu. Vor ein, zwei Jahren sind die ersten dieser halbautomatischen Kameras in den Versandhauskatalogen aufgetaucht, letztes Weihnachten hatte er selber eine unter dem Weihnachtsbaum, und inzwischen passiert es ihm auch auf den Kriegsgräberfahrten immer häufiger, dass er eines der kleinen, leichten Geräte aus Alu und Kunststoff in die Hand gedrückt bekommt, meistens eine Instamatic, seltener eine Agfa Rapid. Sie liegen leichter in der Hand, und er muss weder Blende noch Belichtungszeit einstellen, anders als bei den älteren Modellen. Die meisten Fahrten führen ihn ja in die Normandie, da scheint selten die Sonne, aber Fotoapparate haben sie alle dabei, sie treten auf Harry zu, bitten ihn um ein Bild, vor »ihrem« Grab oder am Friedhofseingang, unter dem Schriftzug »Kriegsgräber sind die großen Prediger des Friedens«.
Er wartet, bis Frau Jarosch ihr Gleichgewicht zurück auf den Gehstock verlagert hat. Ihr Sohn liegt hier, einer von drei Namen auf einem Steinkreuz. 46-526. Das ist die Grabnummer, die sie auf dem Anmeldeformular angegeben hat, der Gräberblock, die Reihe und die Grabnummer für das kleine Rasenstück, auf dem sie eine Handvoll Erde verstreut, sie hat sie in einem Marmeladenglas in ihrer Handtasche mitgebracht, und auch wenn man sie auf dem Foto nicht sieht, die Erde, soll sie schon vor dem Grab liegen, wenn der nette Reisebetreuer vom Volksbund sie fotografiert. Schwer auf ihren Stock gestützt, schiebt sie ihren korpulenten Körper in Richtung Hauptweg. Harry versteht nicht, warum sie die Strapaze auf sich nimmt. Er hat das Grab seiner Eltern nie besucht, ein Ort, ein Stein, ein Kreuz, was soll daran tröstlich sein. Aber vielleicht weiß er auch nur zu viel über Steine und Kreuze und Tote, die nicht dort liegen, wo der Stein und das Kreuz und der Schriftzug das verkünden. Im Krieg hat seine Dienststelle ihn manchmal an den Volksdeutschen Selbstschutz ausgeliehen, für das Grabfoto, und dann hat er das Foto gemacht, das die Angehörigen bei der Verlustabteilung der Wehrmacht in Auftrag gegeben hatten, hat die Kränze fotografiert, die der Gauleiter abgelegt hat, während der Volksdeutsche Selbstschutz im Viereck an der Grabstelle Haltung angenommen hat. An der Front war das anders. An der Front war keine Zeit für Formation und Kranzniederlegung, aber eine Dienstanweisung gab es trotzdem, ausschließlich hergerichtete Gräber durften fotografiert werden, geschmückt und gepflegt, und wie ein Einzelgrab musste es aussehen, nicht als eines von hundert schnell aufgeschütteten Gräbern erkennbar, wenigstens auf dem Foto muss der Tod würdevoll aussehen. Und dann haben sie eben immer denselben Blumenschmuck verwendet, von einem Grab zum nächsten getragen fürs Foto, oder einfach gleich immer dasselbe Grab und dasselbe Kreuz fotografiert und nur das Schild mit den Namen ausgetauscht. So ein Bluff wäre heute nicht mehr möglich. Die Angehörigen müssen kein Foto mehr beim Gräberoffizier in Auftrag geben. Sie haben ihre eigenen Fotoapparate dabei, und sie wollen mit ins Bild. Lassen sich wie Frau Jarosch vor einem Grab fotografieren, an dessen Kreuz der Name ihrer Toten steht. Ob auch deren Gebeine darin liegen, wer weiß das schon.
Sie brauchen diese Fotos, um zu wissen, wer sie sind. Und wenn sie nicht selbst dabei sein können, bitten sie andere, Fotos zu machen. Sogar von den Gräbern. Die Fotos sollen ihnen eine Geschichte erzählen, wenn sie selber nicht wissen, welche Geschichte sie sich erzählen sollen. Er muss an Reni denken, aus deren Zeit als Kleinkind es nur ein einziges Foto gibt. Ein Schwarzweißfoto mit eingerissenen Rändern, es ist unterbelichtet, wegen der großen Trauerweide, in deren Schatten die kleine Familie fotografiert wurde, das kleine Mädchen mit der Schleife in den Löckchen und dem Apfel in der Hand auf einer Picknickdecke, das bist du, im Tierpark, haben sie ihr erzählt, erinnern kann sie sich daran natürlich nicht. Für Reni das einzige Foto aus dieser Zeit. Sie hat es verstanden. Wer macht schon im Krieg Familienfotos.
Die Ersten strömen schon wieder dem Ausgangsportal zu, um sich ins Besucherbuch einzutragen oder am Bus noch eine zu rauchen, bevor es zum Mittagessen nach Toul geht. Harry macht einen Schritt hinter eine Hecke und greift hinter seinen Rücken, um den Hemdsaum aus dem Hosenbund zu ziehen und sich Luft an den Rücken zu fächeln. Beim Mittagessen wird er das Jackett ausziehen, Schweißspuren an der Hemdrückseite wären ihm unangenehm. Die Frauen haben Schweißränder unter den Achseln, viele von ihnen tragen Trevira-Blusen oder Kleider aus einer anderen Kunstfaser, er kann das riechen, aber sie dürfen das, sie haben für diese Fahrt bezahlt, deutsche Frauen, die in kleinen Einmachgläsern Erde aus der Heimat mitbringen, um sie ihren Toten aufs Grab zu streuen, wenn der Volksbund ansonsten schon keinen Grabschmuck zulässt, sie haben ihre Männer verloren, sie haben als Angehörige eines Kriegstoten Anspruch auf Fahrpreisermäßigung und als Teilnehmerinnen einer organisierten Kriegsgräberfahrt Anspruch auf das touristische Rahmenprogramm. Sie dürfen nach Schweiß riechen. Er nicht. Er ist noch immer Deutscher zwajter Klasse, Volksdeutscher, er muss immer ein bisschen mehr bieten, um dazugehören zu dürfen, und auch wenn seine Begutachtung bei der Einwandererzentralstelle inzwischen zwanzig Jahre zurückliegt, hat er nie vergessen, was der Volkstumssachverständige ihm klargemacht hat. Er ist Deutscher auf Widerruf. Und dann haben sie ihm zu verstehen gegeben, dass seine Ansatzentscheidung nicht ausschließlich auf volkstumspolitischen und rassehygienischen Gesichtspunkten basiert. Ihre anspruchsvollen Auslesekriterien hatten sie da längst über Bord geworfen, im Herbst 1942 konnten sie nicht mehr wählerisch sein. Und er wollte nicht irgendwo in der Walachei auf einem Bauernhof angesiedelt werden. Er hat in Belgrad für einen Herrenausstatter der gehobenen Gesellschaft Anzüge verkauft. Er ist kein Bauer. Also hat er unterschrieben, und gut war.