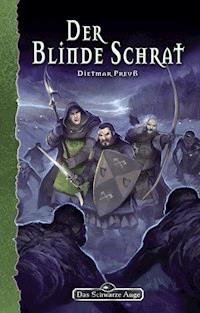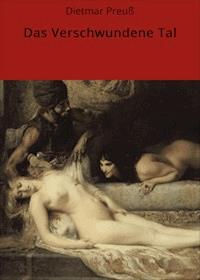Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
Im Jahre 363 v. BF. wächst eine unerwartete Bedrohung im Norden Andergasts heran. Naaba Narga, ein grausames Goblinweib, will an die Macht einer Göttin kommen, die in der Roten Bache geborgen ist. Mit ihrer Hilfe könnte sie alle Goblinsippen des Steineichenwaldes vereinen und Burg Waldsteyn überrennen. Zur gleichen Zeit ist der Wehrsasse von Hohenhag am Rande der Orkschädelsteppe auf der Suche nach seiner Frau. In einer üblen Spelunke namens Wurmschatten trifft er auf eine Überraschung. Und die junge Schankmagd, die er dem schmierigen Wirt entreißt, ist weniger naiv, als es scheint. Ist sie vielleicht sogar mit dem unbekannten Verräter auf der Burg des Freiherrn verbündet?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Biografie
Dietmar Preuß, Jahrgang 1969, veröffentlichte zum ersten Mal im Alter von 13 Jahren ein Gedicht in der örtlichen Tageszeitung für ein Honorar von unwahrscheinlichen DM 5,–. Als er nach Studium, Heirat und Umzug ins schöne Münsterland wieder Zeit zum Schreiben fand, gelangten die ersten Geschichten zur Einsendungsreife.
Er veröffentlichte seit 2003 zahlreiche Fantasy- und Science Fiction-Geschichten in einschlägigen Anthologien und Fanzines (Storyolympiade, Windgeflüster u.a.), außerdem den Kurzroman Die Hexe im Stein über den Rollenspieler Roland Junker.
Bei Fantasy Productions erschienen zuvor von ihm der Roman Hohenhag.
Titel
Dietmar Preuß
Die rote Bache
Ein Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©
Originalausgabe
Impressum
Ulisses SpieleBand 11028EPUB
Titelbild: Karsten SchreursLektorat: Catherine BeckAventurienkarte: Ralph HlawatschBuchgestaltung: Ralf BerszuckE-Book-Gestaltung: Michael Mingers
Copyright ©2013 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems.DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN, DERE, MYRANOR, RIESLAND, THARUN und UTHURIA sind eingetragene Marken der Signifikant GbR. Alle Rechte von Ulisses Spiele GmbH vorbehalten.
Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt.
Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.
Print-ISBN 978-3-89064-227-7E-Book-ISBN 978-3-86889-646-6
Prolog
»Fürchte dich nicht, Naaba Narga!«, flüsterte die alte Goblinfrau ihrer Schülerin zu. »Wenn die Große Mutter Sau es will, wird mein Oloym gleich auf eine Reise gehen.«
Die Schamanin lag auf einem steinernen Altar, über ihr wölbte sich eine rußgeschwärzte Höhlendecke. Die Stalagmiten und Stalaktiten, die sie umgaben, glitzerten dagegen in allen erdenklichen Farben. Der alte Körper Kikelisebils, dessen roter Pelz an vielen Stellen schon abgeschabt war und die gleiche ledrige Haut zeigte wie Gesicht und Hände, wurde langsam steif von dem eingenommenen Gift.
»Gleich werde ich mit Mailam Rekdai sprechen.« Jahrzehnte der Sorge um das Wohlergehen ihres Stammes verdunkelten die roten Augen. »Sie wird mir sagen, wie wir den nächsten Winter überleben können.«
Naaba Narga hielt den Blick gesenkt. Auch ihre Augen waren rot, wie die der meisten Goblins. Dagegen war ihr weißer Pelz mehr als ungewöhnlich. Dass die Große Mutter ihr ein solches Aussehen gegeben hatte, war fünf Jahre zuvor für Kikelisebil ein göttliches Zeichen gewesen. Deshalb hatte sie dieses Kind als Schülerin auserkoren.
»Achte auf meine Augen, Naaba Narga! Wenn sie schwarz werden, träufle das warme Öl in meinen Mund. So wirst du mein Oloym zurückrufen!« Die geflüsterten Worte riefen ein knisterndes Echo hervor.
Das Goblinmädchen blickte zu der kleinen Feuerstelle hinüber, wo eine Tonkruke an einem schmiedeeisernen Haken über den Flammen hing. Der Lichtschein brach sich tausendfach an den geschliffenen Edelsteinen, die die in Äonen gewachsenen Kalksäulen bedeckten. Als die Goblins einst so zahlreich gewesen waren, dass sie weit über das Gebirge der Roten Sichel und die umliegenden Wälder hinaus herrschten, hatten sie Tiefzwerge versklavt und gezwungen, die Ritualhöhle derart verschwenderisch auszustatten. Nun war es Hunderte Generationen her, dass die Stämme der Goblins derartige Schätze besessen und diese zu Ehren der Großen Mutter Mailam Rekdai geopfert hatten. Längst war so manchem Abenteurer in Aventurien bekannt, wo die Narai Tuschas zu finden war. Aber die tief im Berg versteckten, nur über geheime Gänge erreichbaren Ritualkammern kannten noch immer nur die größten Schamaninnen der Goblins.
Naaba Narga hatte die Augen wieder niedergeschlagen und nickte. Als die Meisterin den Blick von ihr abwandte und sich auf die Wanderung ihres Oloym konzentrierte, verzogen sich die Mundwinkel der Schülerin zu einem höhnischen Zucken. Die Flügel ihrer Nase, die genauso breit und flach war wie die eines maraskanischen Riesenaffen, zitterten in Erwartung einer schändlichen Tat.
Begleitet von einem qualvollen Seufzen verließ das Oloym der Schamanin den nun völlig erstarrten Körper. In den Tiefen der Narai Tuschas klang es wie das entfernte Heulen des Sturms, der draußen um die Gipfel der Roten Sichel toste. Die weißen Haare in Naaba Nargas Nacken stellten sich auf, und die junge Adeptin sah sich um. Sie war sicher, dass sich der Geist Kikelisebils irgendwo in diesem Höhlenraum befand. Vielleicht sammelte er sich am höchsten Punkt der zerklüfteten Decke, vielleicht eilte er auch wie eine wild gewordene Harpyie zwischen den höchsten, den amethystfarbenen und rubinroten Stalagmiten hindurch.
Zu sehen war noch nichts. Aber als sich über der reglosen Brust der Meisterin eine in allen Farben des Regenbogens schillernde Kugel bildete, wusste die junge Schülerin, wo sich der Geist der Alten befand. All ihre Macht, all die Erfahrung, das Wissen und ihre Lebenskraft konzentrierten sich dort unter der irisierenden Haut des Oloym, die so verletzlich war wie die einer Wasserblase auf einem Moortümpel.
Die Augen Kikelisebils waren offen, und die junge Schülerin erkannte, dass von der Wurzel der platten Nase ausgehend schwarze Schlieren wie Fäden über die Augäpfel zogen. Der Tod war dabei, sein Werk zu vollenden. Sie wusste, wenn die Augen gänzlich schwarz waren, war es zu spät, das Oloym in den Körper der alten Schamanin zurückzuholen.
Naaba Narga schlängelte sich zwischen zwei niedrigen, smaragdbesetzten Stalagmiten hindurch und nahm die Kruke mit dem Öl vom Haken. Der boshafte Ausdruck, den sie dabei in den Augen trug, strafte ihr kindliches Äußeres Lügen. Zurück am Altar entkorkte sie die Ölkruke mit spitzen Zähnen, von denen zwei über die Oberlippe ragten, verzog den breiten Mund zu einem schadenfrohen Grinsen und trank die warme Flüssigkeit.
Das Tosen des Sturms um die Rote Sichel nahm zu, als beklagten die Elemente der Natur den unaufhaltsamen Tod der alten Schamanin. Naaba Narga sann derweil dem Geschmack des Öls nach. Es war bitter und rußig, etwas darin erinnerte sie an fermentierte Mandragora. Aber wenn das der Geschmack der Macht war, sollte es ihr recht sein. Achtlos ließ die junge Adeptin die Kruke zu Boden fallen.
»Beinahe tut es mir leid, Meisterin«, flüsterte sie in dem Gemisch aus Garethi und Oloarkh, das ihr weit entfernter Stamm im südlichen Steineichenwald sprach. Anders als die Stämme hier in der Roten Sichel beherrschte sie die alte Sprache der Goblins nicht mehr. »Aber nur beinahe.«
Mit der Linken strich sie über die unbehaarte Stirn der Lehrerin, mit der Rechten nahm sie die Ritualkeule, die an ihrer Seite lag. Die Goldstückchen und Seelenbrocken der Ahnen im Innern rasselten leise. Nach einem letzten Blick, in dem nicht die Spur von Bedauern lag, schlug sie die Knochenkeule mit aller Wucht auf den Schädel Kikelisebils. Rote Spritzer landeten auf dem schmutzigweißen Pelz der Adeptin. Von der linken Gesichtshälfte der toten Goblinfrau blieb nichts weiter übrig als ein formloses Gebilde aus Blut, Knochensplittern und grauer Masse. Im rechten Auge war zu erkennen, wie sich die schwarzen Schlieren zurückzogen.
Als das unversehrte Auge der ermordeten Meisterin wieder die typische rote Farbe zeigte, von einem grauen Schleier getrübt, ließ Naaba Narga die Keule los. Die schillernde Kugel des Oloym bewegte sich nun auf sie zu, angelockt von dem wundersamen, warmen Öl, das sich in ihrem Körper verteilt hatte. Aus dem perfekten Rund wuchsen zwei Tentakel heraus, länger und länger. Ihr tastendes Suchen wurde zielstrebiger, bis sie die aufgeblähten Nasenflügel der Verräterin erreichten. Naaba Narga rührte sich nicht, atmete nicht einmal, als die schillernden Tentakel in sie fuhren, das Oloym sich in Schlieren auflöste und gänzlich in ihr verschwand.
Endlich sog die Adeptin mit einem verzweifelten Röcheln die Luft ein und hielt sich die langen, sehnigen Arme vor Brust und Bauch. Ihr Mund öffnete sich zu einem lautlosen Schrei, sie fiel zu Boden, zog die Knie vor den Bauch und wand sich in Krämpfen. Ein konvulsivisches Zucken befiel sie, als das Oloym der Meisterin versuchte, die Herrschaft über ihren jungen Körper zu erlangen. Naaba Nargas Nacken wurde von einer ungeahnten Kraft gebeugt, das Kinn wurde ihr auf die magere Brust gedrückt, aber mit einem Stöhnen riss sie den Kopf wieder hoch. Sie hatte geahnt, was sie erwartete, als sie den Leib der Meisterin sterben ließ. Soviel hatte die Alte sie gelehrt. Dieser Kampf in ihrem Inneren war unvermeidlich, und sie stemmte sich mit aller Macht gegen den Willen Kikelisebils.
Natürlich war Naaba Narga weitaus weniger erfahren, aber ihrem eigenen Oloym war der Körper vertraut. Die andere Wesenheit musste sich erst mit allen Meridianen und Knotenpunkten vertraut machen. Und diese Zeit der Schwäche nutzte die Verräterin. Seit sie von dem Plan ihrer Meisterin erfahren hatte, das Ritual der Freien Seelenfahrt in der Narai Tuschas auszuführen, hatte sie darüber nachgedacht, wie sie die Alte überwinden konnte. Es war bei den Goblinstämmen nicht unüblich, dass die Schülerin die ältere Schamanin umbrachte oder vertrieb, wenn sie ihr an Macht ebenbürtig oder überlegen war. Warum noch länger der Alten dienen, von der nichts mehr zu lernen war, wenn man selbst die Führung des Stammes übernehmen konnte? Dass aber eine so junge Adeptin einen derart starken Willen und ein solches Maß an Hinterhältigkeit aufbrachte, um an die Macht zu gelangen, war selbst unter Goblins ungewöhnlich. Und dass ihre Boshaftigkeit und ihre Geisteskräfte stark genug waren, denen der Meisterin zu widerstehen, war in ihrer nirgends geschriebenen Geschichte einmalig.
Naaba Nargas verzerrtes Gesicht zeugte von der Schlacht, die in ihrem Inneren tobte. Ihre Mundwinkel rissen ein, als sie die Kiefer auseinanderzwang. Unter Aufbietung aller Kräfte hob sie den Kopf wieder. Das Zucken des Körpers ging in ein Zittern über, wurde stärker, immer stärker, bis sich jede Faser des Körpers in Vibration aufzulösen drohte, und endete dann abrupt. Ein hässliches Grinsen erschien in dem nun gealterten Gesicht der Verräterin. Sie streckte Arme und Beine aus, wartete, bis der Schmerz in den verkrampften Muskeln erträglich wurde, und atmete mühsam. Eine Weile war in der glitzernden Ritualkammer tief unter der Roten Sichel nichts anderes zu hören als das Prasseln des Feuers und das Tropfen des Wassers, das durch winzige Ritzen und Poren im Gestein drang.
»Jetzt bin ich die Meisterin, und du wirst mir gehorchen!«, flüsterte die junge Schamanin der zweiten Wesenheit in ihrem Innern zu und öffnete die Augen, die sich tiefschwarz gefärbt hatten. Mit all dem Wissen ihrer toten Meisterin ausgestattet sah sie sich um. Die Alte war in der Jenseitswelt tatsächlich Mailam Rekdai begegnet. Doch warum hatte sie das Oloym der Großen Mutter nicht gesehen? Über der Brust Kikelisebils hatte sich nur eine einzige irisierende Kugel gedreht. Die Antwort fand Naaba Narga sogleich im Wissen der alten Meisterin, das mit dem ihren verschmolz: Die Höhle selbst war angefüllt mit dem Geist der Großen Mutter. Die weisen Ahnen hatten das gewusst und daher die Oberflächen so verschwenderisch mit Edelsteinen in allen Farben ausgestattet! Das Glitzern der Juwelen verbarg das Schillern des mächtigen Oloym vor unwissenden Augen.
Von Ehrfurcht ergriffen fiel die junge Schamanin auf die Knie, befand sie sich doch so nah bei der Göttin, wie es möglich war. Von der Wesenheit der toten Meisterin erfuhr Naaba Narga, dass ein Zwiegespräch mit Mutter Sau allerdings nur in der Jenseitswelt möglich war.
»Dann sag du mir, wie der Stamm den nächsten Winter überleben kann!« Die geflüsterten Worte waren an das Oloym ihrer alten Lehrerin gerichtet, dessen Grenzen sich langsam auflösten und mit ihrer eigenen Wesenheit vermischten. Und nach vielen Stunden des inneren Zwiegesprächs wusste die albinoweiße Schamanin nicht nur, wie der Stamm den Gewalten des Winters trotzen würde, sondern auch, wie das Volk der Goblins seine alte Macht zurückerlangen konnte. Sie musste die Rote Bache finden! Dann würde die Pracht, die Naaba Narga umgab, nicht länger nur ein Abglanz alter Herrlichkeit sein. Sie selbst würde sich eine Höhle wählen und mit Rubinen, Smaragden und Amethysten auskleiden lassen. Und wenn sich jemand ihr und ihrem Stamm entgegenstellte, sei es Mensch, Ork oder Goblin, würden die heiligen Tiere ihres Stammes frisches Fleisch zu fressen bekommen!
Die junge Schamanin erhob sich, schüttelte die langen Arme aus und verzog die blutigen Mundwinkel zu einem triumphierenden Grinsen. Das Gesicht mit der platten Nase, der zerfurchten, fliehenden Stirn und dem harten Zug um den breiten Mund, passte nicht mehr zu ihrem jungen Körper. Es war gealtert, denn es spiegelte die geraubten Erfahrungen der alten Schamanin wieder. Als habe sie Kikelisebil noch nicht genug genommen, hob Naaba Narga die Knochenkeule der alten Lehrmeisterin auf und band sie an die Kordel um ihren Hüften.
Kapitel 1
»Ulmward ist zurück!«, rief die Wache am Tor.
Die Leute, die innerhalb der Wallhecke Hohenhags zu tun hatten, sahen von ihrer Arbeit auf. Ein letztes Mal vor dem langen, kalten Winter hatte der Sasse den ersten Wehrmann im Efferdmonat des Jahres 363 v.BF. nach Anderstein geschickt. Jetzt freuten sich alle auf Nachrichten aus dem etwa fünfzig Meilen entfernten Dorf und auf die dringend benötigten Vorräte, denn fünf Jahre nach dem Wiederaufbau war Hohenhag noch immer nicht in der Lage, sich allein zu versorgen. Dafür lebten zu wenige Männer und Frauen auf dem Wehrhof. Aber von dem Wergeld, dass Nymmir von Waldsteyn für die Sicherung des Grenzlands sandte, konnte fast alles erworben werden, was der Hof nicht selbst erzeugte.
Besonders die Frauen freuten sich auf die Stoffe für die winterlichen Näharbeiten, auch wenn sie es vor den Männern niemals zugegeben hätten. Denn auf den Wehrhöfen leisteten auch sie Waffendienst und gingen Patrouille vor dem Heckenwall, der das nördliche Andergast vor nomadisierenden Orks schützte.
Beolf von Hohenhag, der Wehrsasse, hochgewachsen, braunlockig und nach fünf Sklavenjahren bei den Orks und zahlreichen Kämpfen gegen seine Peiniger breitschultrig und drahtig, stieg auf den Wehrgang neben dem Tor. Nicht, dass er es sich anmerken ließ, aber er genoss es, wie seine Leute ihn beobachteten und auf seine Reaktion warteten. Er wollte sie nicht allzu lange auf die Folter spannen, und so spähte er nur einen kurzen Moment in die Ferne. Dann hob er den sehnigen Arm, grüßte winkend und sprang leichtfüßig vom Wehrgang hinunter.
»Macht auf!«, sagte er zu Malrik und Andraus, den Wachen am Tor, und die beiden Flügel aus dicken Bohlen schwangen auf. »Die Waffenruhe scheint immer noch zu halten«, sagte er zu den Torwachen. »Wenn die Orks hinter unserem guten Ulmward her wären, würde er sich nicht so viel Zeit lassen!« Beolf klang erleichtert, denn er traute den Schwarzpelzen nicht. Und niemand in Andergast, vielleicht sogar in ganz Aventurien, kannte die Schwarzpelze so gut wie er. Abgesehen von seiner Frau Sidra.
Inzwischen hatten sich die meisten Bewohner von Hohenhag, etwa drei Dutzend Männer und Frauen, am Tor versammelt. Sie waren jung, kaum einer zählte mehr als dreißig Winter, Beolf selbst würde im Peraine erst seinen 26. Geburtstag feiern. Und sie alle zeichneten sich durch doppelte Tüchtigkeit aus, denn neben einem nützlichen Handwerk beherrschte jeder von ihnen Schwert, Streitaxt oder Bogen. Nun warteten sie auf den ersten Wehrmann, der neben den dringend benötigten Gütern vor allem Neuigkeiten und Briefe mitbringen würde. Beolfs Blick blieb auf Sidra hängen, seiner Wehrsassin, die zudem die Heilerin des Hofs war. Ihr langes blondes Haar schimmerte im Licht der Nachmittagssonne, ihre grünen Augen leuchteten. Nach den entbehrungsreichen Sklavenjahren bei den Mardyrch und den Jahren voller Arbeit beim Wiederaufbau Hohenhags war sie gertenschlank. Ihr Bauch wölbte sich keinen Fingerbreit vor. Leider!
Sie erwiderte seinen Blick, und sofort war da dieses stillschweigende Einverständnis zwischen ihnen. Es war, als wüsste sie, was Beolf durch den Kopf ging, und sie senkte die Augen.
Mit einem Grinsen ritten Ulmward und zwei weitere Männer auf ihren genügsamen Warunkern durch den verwinkelten Gang in der Hecke. Hinter beiden trotteten je zwei muskelstarke Teshkaler her, die als Packpferde dienten. Die Tiere waren beladen mit Körben, Ballen und prallvollen Ledertaschen. Ein Stimmengewirr hob an, als die Leute von Hohenhag begannen, über deren Inhalt zu spekulieren. Das Geraune erstarb, als sich ein bärtiger Unbekannter auf dem letzten Packpferd aufrichtete und auf den Sattelknauf stützte. Das Gesicht des Mannes war schmutzig, seine braunen Augen sahen wirr in die Runde und blieben einen Moment lang auf dem rothaarigen Arnobar Kerden hängen.
Beolf, der den Warunker seines ersten Wehrmanns am Halfter gepackt hatte, folgte dem Blick und bemerkte, dass der Mann nun die klein gewachsene Birsela anstarrte, die ebenfalls einen roten Schopf hatte. Sie war gerade von der Feldarbeit gekommen. Die Haare hingen ihr wirr ins Gesicht, und mit der verschmutzten Schürze über dem Kleid und den dreckigen Händen sah sie beinahe aus wie eine Zwergin, die aus der Mine kommt. Oder wie eine Goblinfrau in Menschenkleidung.
Irgendetwas stimmt mit diesem Kerl nicht, dachte Beolf und ließ ihn nicht aus den Augen. Ohne sich zu ihr umzudrehen, wusste er, dass auch Sidra den Fremden beobachtete. Gekleidet war der Mann auf dem Packpferd in enge, zu kurze Beinlinge und eine Tunika, deren Ärmel knapp unterhalb der Ellbogen endeten. Die Tunika und die Gugel, der Überwurf mit Kapuze, spannten um die breiten Schultern. Einer von Ulmwards Männern hielt sich nun an seiner Seite, die rechte Hand auffällig nah am Schwertgriff.
»Was ist das für eine Gestalt? Seine Augen machen mir Angst. Ob er ein Waldläufer ist?«, hörte Beolf Andela Wulfen flüstern.
»Nein, ein Holzfäller«, antwortete ebenso leise ihr Gefährte Holwar, der sich mit Erlmann, Alfried und einigen anderen Bauernsöhnen und -töchtern die Arbeit auf den Feldern teilte. Hier oben im Norden Andergasts wurden auch die Bauern an den Waffen ausgebildet und hatten bereits an zahlreichen Kämpfen gegen die Orks teilgenommen. Und weil die Landleute das eine oder andere Mal von den Feldern gerufen wurden, brachten diese nicht so viel Ertrag wie weiter im Süden, an den Ufern der Andra oder des Ingval.
»Seine Kleidung ist viel zu klein«, wunderte sich Andela.
»Nicht zu klein. Lange Beinlinge und weite Säume würden ihn bei der Arbeit im Unterholz nur stören«, erklärte Holwar. Andela war aus Anderstein nach Hohenhag gekommen. Die Holzfäller, die dieses Dorf aufsuchten, pflegten sich vorher zu waschen und zu rasieren, oft das erste Mal seit Wochen, denn was sie dort suchten, waren zweifelhafte Vergnügungen. Dieser Holzfäller hier schien dafür keine Zeit gefunden zu haben. Und so schwach, wie er wirkte, schien er auch keine Lust auf Frauen zu haben. Aber vielleicht gab er das auch nur vor.
»Bei den Zwölfen, habe ich einen Durst!«, rief Ulmward.
Gunahild, die Freundin und Schülerin Sidras, reichte ihm einen Tonbecher mit frisch gebrautem Bier.
»Danke, vielen Dank!«, sagte der Wehrmann, nahm einen tiefen Schluck und grinste in das Rund der erwartungsvoll blickenden Leute. Seine beiden Begleiter hinter ihm ließen sich aus den Sätteln gleiten und umarmten ihre Gefährtinnen.
»Na los, Ulmward! Sonst kann ich Osgar nicht länger zurückhalten«, rief Beolf und grinste breit. »Und erzähl uns, wen du als Gast mitgebracht hast!«
Der Wehrmann griff in die rechte Satteltasche und holte ein Bündel versiegelte Pergamente heraus. »Ich kann es mir nicht erklären, aber du hast bei deinem letzten Besuch offenbar Eindruck hinterlassen, mein Freund.« Damit zog er einen Brief aus dem Packen und hielt ihn dem Töpfer des Hofs hin, der von einem Fuß auf den anderen tretend dastand und schief grinste. Als Osgar Krück versuchte, das Siegel zu erbrechen, fiel ihm der Brief aus der Hand.
»Nun beruhige dich, Osgar. Mariana hat mir gesagt, dass sie nach ihrer Lossprechung zum Ende des Perainemondes herkommen wird«, sagte Ulmward.
Die anderen grinsten über den Töpfer, aber sie freuten sich auch, dass bald wieder eine Bäckerin auf Hohenhag leben würde. Lilia, die rundliche Köchin, fand neben ihren anderen Aufgaben nicht immer die Zeit, den gemauerten Backofen anzuheizen. Daher gab es an manchen Tagen das Getreide nur als Brei, gewürzt mit Salz und Kräutern.
»Das Schreiben des Ritters von Anderstein für den Wehrsassen«, sagte Ulmward nun und reichte Beolf ein Pergament mit einem viel größeren Siegel.
Die Stimmen der Hohenhager verstummten, während Beolf das Siegel erbrach und die ersten Zeilen studierte. Selbst der Holzfäller mit den verfilzten Haaren, der sich kaum aufrecht halten konnte, schaute hinüber.
Ob die Waffenruhe mit den Orks weiterhin galt, überlegte Beolf. Das wollte er doch hoffen, denn immerhin hatte er ein Gutteil dazu beigetragen, die dreisten Übergriffe der Schwarzpelze zurückzuschlagen. Oder waren die Verhandlungen über Grenzverlauf und Handelswege durch das Orkland gescheitert? In diesem Fall würden die Hohenhager, ebenso wie die Leute von Wallhof und Hagdorn, die Patrouillengänge vor dem mächtigen Heckenwall wieder ausweiten müssen. In den letzten Monaten hatten die Wehrhöfe nur die verwinkelten Gänge durch den bis zu zehn Schritt tiefen Dornenwall bewacht, die in diesem Teil Andergasts die einzigen Verbindungen zur Orklandsteppe waren.
»Goblins?«, rief Beolf aus, und die Neugier in den Gesichtern seiner Leute nahm noch zu, während ein Ruck durch den Holzfäller auf dem Packpferd ging und seine Augen sich weiteten. Sein erschöpfter Körper spannte sich, als wolle er die Zügel des Pferdes greifen, das Tier herumreißen und die Flucht ergreifen.
»Spann uns nicht auf die Folter, Wehrsasse!«, rief Arnobar Kerden, der trotz seines mächtigen Körperbaus ein gewandter Bogenreiter der fast schon legendären Unsichtbaren Rotte war. Alle starrten Beolf gespannt an, denn nie hatte er es anders gehalten, als Neuigkeiten aus Anderstein gleich laut vorzulesen. Diesmal musste Ritter Wolfhard, Statthalter des Freiherrn Nymmir von Waldsteyn, besondere Anweisungen erlassen haben.
»Sidra, wo ist Sidra?«, fragte Beolf leise und sah sich um. Seine Frau kam zu ihm, und er reichte ihr das Pergament. Nach wenigen Sätzen sah sie in gleichmütig an. Keine Spur von Betroffenheit war in ihrem Gesicht zu lesen. Natürlich, dachte Beolf, sie nahm es mal wieder, wie die Zwölfe es gaben.
Mit dem für die beiden typischen stillen Einverständnis ließen sie ihre Leute stehen und gingen zu dem Fachwerkbau mit den lehmgefüllten Gefachen hinüber, der die große Halle und ihre Kammern barg. Die Männer und Frauen sahen sich an, verwundert die einen, erschrocken die anderen. So hatten sich Beolf und Sidra noch nie verhalten.
Gunahild, die von Sidra in der Heilkunst unterrichtet wurde, eilte mit wehenden Haaren zu dem Holzfäller, der im Sattel zusammengesunken war. »Arnobar, komm, hilf mir!«, rief sie, und der hünenhafte Stallmeister hob den besinnungslos gewordenen Mann aus dem Sattel. Obwohl der Holzfäller von beeindruckender Statur war, trug Arnobar ihn mit Leichtigkeit hinter Gunahild her zu einem Anbau neben der Halle, wo Gäste des Hofs unterzukommen pflegten.
Am Abend, nach getaner Arbeit, versammelten sich alle in der Halle des Wehrsassen, die erst vor fünf Jahren errichtet worden war. Die alte Halle, in der zuletzt Beolfs Vater gesessen hatte, war beim Überfall einer Orksippe zerstört worden. Damals waren auch Beolf und Sidra entführt worden und erst nach langjährigem Sklavendasein bei den Mardyrch zurückgekehrt.
Die Wehrmänner, Fechterinnen und Bogenreiter hatten Stunde um Stunde an den Waffen geübt. Sie waren hungrig und durstig, denn sie mussten in der Erntezeit zusätzlich bei der Landarbeit helfen. Kaum weniger galten auf den Wehrhöfen die Bauern und Töpfer, die Schmiede und Stellmacher, die Bäckerinnen, Spinnerinnen und Weber. Auch ihnen war es, anders als in anderen Teilen Aventuriens, gestattet, Waffen zu besitzen. Und ihr Stolz gebot es ihnen, diese Waffen bei sich zu tragen, wann immer die Arbeit es zuließ. An der Grenze zur Orkschädelsteppe, die gleich hinter dem Hohen Hag begann, lagen der Bogen, das Schwert oder die Axt nie weit entfernt.
Endlich trugen die Köchin Lilia und ihr Gehilfe das Essen auf. Die Leute klopften mit ihren Messern auf die dicken Tischplatten, als das Lamm, das an einem Spieß über der Feuerstelle briet, angeschnitten wurde. Die besten Stücke bekam der Tisch, an dem Beolf und Sidra mit dem ersten Wehrmann und einigen anderen Männern und Frauen saßen.
»Danke sehr!«, sagte Beolf zu Lilia, als sie ihm die Platte mit den knusprigsten Stücken reichte, und stach mit dem Dolch in ein dickes Stück, von dem das Fett tropfte. Mit großer Geste, als sei er am Hofe Wendolyns des Prunksüchtigen, hielt er die Platte Sidra hin, die ihn missbilligend ansah.
»Ach komm, Sidra, mach nicht so ein Gesicht, heute ist ein guter Tag für ein Festmahl«, sagte er.
»Das ist es nicht«, murmelte sie so leise, dass nur er sie hören konnte. »Aber ein wenig Bescheidenheit stünde dir gut an.«
Als auch sie sich ein Stück genommen hatte, gab er die Platte an Ulmward weiter. »Jetzt ihr, greift zu!«, rief er und sah mit einem zufriedenen Ausdruck in die Runde. Ein solches Festmahl gab es im armen und kalten Norden selten. Umso stolzer war er darauf, dass er und seine Leute es geschafft hatten, den Hof in nur fünf Jahren so weit aufzubauen, dass sie die glückliche Heimkehr Ulmwards und der anderen Männer üppig feiern konnten. Seine Hochstimmung wurde ein wenig getrübt, als er hörte, wie Sidra ein kurzes Dankesgebet an Peraisumu murmelte, die Göttin, der sie die die gute Ernte zu verdanken hatten. Ach was, tat er sein schlechtes Gewissen ab, als Heilerin muss Sidra ein gutes Verhältnis zu Peraisumu pflegen.
Dennoch war es erstaunlich, was für eine Wandlung sie in den letzten Jahren vollzogen hatte. Von der rachsüchtigen Orkschlächterin, die für ihre Vergeltung sogar bereit gewesen war, auf ihn zu verzichten, war sie zu einer Heilkundigen geworden, die in allen Belangen des Wachsens, Gedeihens und Heilens auf die wohlwollende Macht der Göttin vertraute.
»Warum sollen wir bescheiden sein?«, fragte er seine Frau. »Schließlich sind wir die Wehrsassen dieses Hofs. Was hier auf den Tafeln steht, haben wir mit eigener Hände Arbeit geschaffen.«
»Geschaffen mit dem Segen Peraisumus und Ingerimms, verteidigt mit der Hilfe Rondras«, ergänzte Sidra.
Erst wollte Beolf eine passende Antwort geben, aber dann schloss er den Mund und nickte mit zusammengepressten Lippen. Er wusste, sie hatte recht, auch wenn er sich manchmal wünschte, sie würde sich wie früher weniger auf den Willen der Zwölfgötter verlassen und die Dinge selbst in die Hand nehmen. Kurz darauf zeigte er wieder das Lächeln, mit dem er Sidra in den Jahren der Orksklaverei so oft Mut gemacht hatte.
Der Neuankömmling saß am Tisch der Handwerker. Die Fürsorge Gunahilds, eine heiße Brühe und ein tüchtiger Schluck Brombeerwein hatten seine Erschöpfung gelindert. Und der Kräutertrunk aus Gulmond und Hollbeere, den Sidra ihm später verabreicht hatte, hatte ihn so schnell wieder auf die Beine gebracht, dass es an ein Wunder grenzte.
Vielleicht war es auch die Ausstrahlung der grünäugigen Sidra mit ihrer aufrechten Gestalt, dem ernsten Blick und der sanften, aber festen Stimme, in deren Nähe selbst die wildesten Kerle leiser wurden und sich auf ihre Kinderstube besannen. Vor dieser hohen Frau hatte der Mann aus den Wäldern wohl keine Schwäche zeigen wollen.
Rasiert und mit geschorenem Haar sah er auch schon viel manierlicher aus als bei seiner Ankunft. Seine Augen schweiften durch den Saal, der Blick blieb immer wieder an der Pforte hängen, die in das Hallentor eingelassen war.
Erwartete er weiteren Besuch oder fürchtete er sich vielleicht vor dem, was durch diese Tür kommen könnte, überlegte Beolf, der ihn unauffällig beobachtete.
Die mächtigen Schultern, die hornigen Hände und die breite, gebogene Klinge an seinem Gürtel, mit der Äste von Baumstämmen genau so abgeschlagen werden konnten wie Gliedmaßen vom Rumpf, gaben von seinem Beruf Zeugnis. Wortlos saß er zwischen den Handwerkern, bis ihm hin und wieder jemand eine Frage stellte. Er antwortete nur kurz, nahm dankend aus den dampfenden Schüsseln, die man ihm reichte, gab aber sonst kein Wort von sich. In sich gekehrt aß er das knusprige Brot und die würzigen Fleischstücke. Als Beolf zu sprechen begann, hielt er wie alle anderen inne.
»Jetzt, nachdem der erste Hunger gestillt ist, möchte ich unseren Gast begrüßen. Ihr kennt noch nicht seinen Namen: Kasimir Varnyth. Unverkennbar ein Nostrianer, möchte ich meinen«, fügte Beolf mit einem Grinsen hinzu. »Was wir ihm natürlich nicht übel nehmen wollen!«
Ein paar Leute lachten, aber es klang gezwungen, denn Andergast stand seit Generationen im Krieg mit dem Nachbarn Nostria. Und der Krieg der Tränen, der nun schon seit über einhundert Praiosläufen anhielt, war bereits der vierte, so weit man sich zurückbesinnen konnte.
Beolf sah die zu seiner Rechten sitzenden Sidra an, als suche er in diesem peinlichen Moment Hilfe bei ihr. Sie legte ihre Hand mit den schmalen, langen Fingern auf die seine und zuckte ganz leicht mit den Schultern. Als er weitersprach, war seine Stimme fest. »Ihr kennt meine Meinung zu diesem unseligen Bruderkrieg. Es ist dieselbe, die auch schon mein Vater vertreten hat. Unser wahrer Feind sitzt im Norden, was wir auf den Wehrhöfen am besten wissen.« Bei den nächsten Worten wandte er sich Kasimir Varnyth zu. »Hier auf den Wehrhöfen sind wir von der Kriegspflicht gegen dein Land befreit, denn es gilt in erster Linie, die Grenzen zu schützen. Uns interessiert: Was hat dich hergeführt? Willst du uns deine Geschichte erzählen?«
Wieder klopften die Männer und Frauen mit ihren Messern auf die Tischplatten. Auch in den Augen der Kinder, die sich in die Schatten unter den Drempeln verkrochen hatten, um nicht in die Betten geschickt zu werden, leuchtete Zustimmung. Eine gute Geschichte, eine neue Geschichte brachte Abwechslung und machte aus solch einem Abend ein Fest. Beolf hatte sich wieder gesetzt und warf seiner Frau einen Blick zu, in dem sich seine tiefe Liebe widerspiegelte. Sidra lehnte ihren Kopf an seine Schulter, während der Gast erzählte.
»Im Steineichenwald … galt schon immer zu… zuerst das Überleben«, begann Kasimir Varnyth. Er stand auf, sah in die Runde und schien nicht zu wissen, ob er stehen oder sitzen sollte. Arnobar, der neben ihm saß, zog ihn am Ärmel. Bei der Berührung des rothaarigen Mannes zuckte der Holzfäller zusammen und zog den Arm fort.
»Bleib sitzen, wir sind hier nicht bei Hofe«, murmelte der Stallmeister.
»Ja, äh, danke!«, sagte der Mann. Als er weitersprach, wurde seine Stimme sicherer. Sein Bass klang volltönend und angenehm. Hier und da spießten die Leute Reste des Essens auf und knabberten an einem Stück Fleisch oder Brot, während sie dem Gast zuhörten.
»In meiner Talschaft leben Andergaster und Nostrianer. Einer der Hirten ist ein Halbork, ein paar Bergbauern sind aus, nun, äh, aus bestimmten Gründen aus den Bornlanden gekommen. Unser Aldermann stammt aus Eichhafen, also aus Andergast, und keiner der Nostrianer kam auf die Idee, sein Wort anzuzweifeln«, begann er. »Soviel zum Zwist unserer beiden Völker.«
»Dann kommst du aus dem Keiltal, im Grenzgebiet zu Nostria, nicht wahr? Ich habe von dieser Talschaft gehört. Ein weiter Weg bis hierher«, warf Beolf ein.
»So ist es!«, bestätigte der Holzfäller.
»Du sagtest, niemand kam auf die Idee zu zweifeln. Warum hast du in der Vergangenheitsform gesprochen?«
Nach einem tiefen Zug Bier, das mit herbem Met gewürzt war, machte Kasimir Varnyth den Mund auf und gleich wieder zu. Er senkte den Kopf, unfähig, weiterzusprechen. Noch einmal hob er den Krug aus Steingut an die Lippen. Als er ihn absetzte, lag ein Schleier über seinen Augen.
»Weil sie alle tot sind«, sagte er leise.
Nach diesen Worten herrschte Stille im Saal, nur das Feuer knisterte, hier und da wurde hörbar ein Krug abgestellt. Alle starrten sie den Mann aus den Wäldern an.
»Orks?«, fragte Beolf.
Kasimir Varnyth schüttelte den Kopf.
»Soldaten aus Nostria? Oder aus Andergast?«, warf Ulmward ein, der zur Linken Beolfs saß.
Wieder schüttelte der Gast den Kopf. »Ich will es euch erzählen, auch wenn ihr mir nicht glauben werdet.«
Alle Hohenhager beugten sich vor, schienen näher an den Gast heranzurücken, um kein Wort zu verpassen.
»Vor ein paar Tagen trafen alle Leute der Talschaft, alle Bergbauern, Hirten und Holzfäller, auf dem Hof des Jochbauern ein. Die bewaldeten Spitzen der Hörner von Nittah ragen dort, am Ende des Keiltals, empor. Unterhalb des Jochs zwischen den beiden Gipfeln führt das Nittahloch ein paar Dutzend Schritt tief in den Berg und bildet dort eine natürliche Halle. An ihren Wänden finden sich Schriftzeichen, die, wie man sagt, zu keiner bekannten Sprache gehören. In dieser Halle pflegte sich die Talschaft an jedem ersten Praiostag eines Mondes zu versammeln, um Neuigkeiten zu besprechen, Aufgaben zu verteilen oder einfach den Sorgen und Nöten der Nachbarn zuzuhören.
An diesem Abend gab es viel zu berichten. Die Praiosscheibe war schon lange hinter den Wipfeln der Steineichen untergegangen, aber noch immer berichteten die Holzfällertrupps und Hirten von unheimlichen Überfällen, die ihnen in den vergangenen Wochen zu schaffen gemacht hatten.«
Varnyth hob den Krug an die Lippen, das Honigbier schwappte dabei über, lief neben seinen Mundwinkeln heraus und hinterließ dunkle Flecken auf seiner Gugel. Er trank, als wolle er die Erinnerung tilgen, die ihm in den Knochen saß. Endlich setzte er den Krug ab. Die Flammen des Feuers spiegelten sich in seinen Augen, als seien sie eine Erinnerung an den Fackelschein im Nittahloch.
»Es waren Goblins!«, flüsterte er in die Stille hinein.
Einen weiteren Atemzug lang sagte niemand etwas, dann schüttelten die Leute von Hohenhag die Köpfe oder rissen vor Erstaunen die Augen auf.
»Rotpelze? Diese feigen, kleinen Ratten greifen ganze Holzfällertrupps an?« Beolf sagte, was die meisten dachten.
Varnyth nickte, sprach aber erst weiter, als Lilia seinen Krug gefüllt hatte. »Genauso haben auch die Leute reagiert, die bis dahin verschont geblieben waren«, erzählte Varnyth weiter. »Goblins greifen keine Holzfäller an. Jedenfalls nicht am Ende eines langen Sommers, in dem es keinen Hunger gegeben hat. Orks vielleicht, aber mit denen herrscht ja seit einigen Monaten so etwas wie eine Waffenruhe. Wir lachten über die Leute, die doch alle das Gleiche berichtet hatten. Dabei waren es gestandene Männer, die mit einem Streich ihrer Axt drei Rotpelzen auf einmal den Kopf von den Schultern trennen konnten. Wir fragten sie, ob sie zu sehr dem Rauschkraut zugesprochen oder die Torkelbeeren zu eilig gebrannt hatten, sodass vom falschen Alkohol ihre Hirne weich geworden waren.
Aber sie blieben bei ihrer Meinung. Goblins wären wie aus dem Nichts aufgetaucht und hätten ihre Lager angegriffen. Mit wahnsinnigem Gekreisch seien sie herangestürmt, manche auf riesigen Wildebern sitzend, die so gut abgerichtet waren, dass sie mit einer Hand geführt werden konnten. Mit der freien Hand schleuderten diese Eberreiter ihre kurzen Speere, die mit Spitzen aus Feuerstein genauso tödlich waren wie eiserne Waffen. Die Eberreiter stoben dabei so schnell zwischen den Männern und Frauen hin und her, dass jeder Axthieb sie verfehlte.«
Ein paar der Frauen und Männer von Hohenhag, die nicht an den Zügen der Unsichtbaren Rotte teilgenommen hatten, starrten den Holzfäller mit offenem Mund an. Sie stellten sich vor, wie eine Übermacht brüllender und heulender Goblins auf Wildschweinen reitend unter den Leuten eines Holzfällertrupps getobt haben musste, und schlugen dabei die Hände vor die Münder. Das war starkes Pfeifenkraut: Rotpelze, die lieber im Dreck nach Essbarem wühlten wie die von ihnen geheiligten Schweine, als selbst in Überzahl Menschen oder Orks anzufallen, sollten die Männer und Frauen aus den Wäldern so in Schrecken versetzt haben! Wer oder was hatte sie dazu aufgestachelt?
»Als auch der Letzte der Talschaft ähnliches berichtet hatte, wollte der Aldermann das Wort ergreifen«, fuhr Kasimir Varnyth fort. »Er saß an dem Ende der Tafel, das dem Höhleneingang am nächsten war. Um sich Gehör zu verschaffen, war er aufgestanden und hatte die Arme erhoben. Aber als Ruhe eingetreten war, sagte er kein Wort, sondern starrte uns mit aufgerissenen Augen an. Ein rotes Rinnsal trat aus seinem Mund, da kippte er auch schon nach vorn und blieb mit drei kurzen Speeren im Rücken auf der Tafel liegen. Im gleichen Moment strömte diese rote Pest auch schon in die Höhle. Zuerst Reiter auf Wildschweinen, wie ich sie noch nie gesehen habe. Sie waren so schnell zwischen den Brüdern und Schwestern, dass die Hauer der Eber blutige Ernte hielten. Nach wenigen Augenblicken wälzten sich acht oder zehn Leute meiner Talschaft auf dem Boden. Die Speere mit den Flintsteinspitzen trafen zielsicher, sodass bald nur noch ein gutes Dutzend Holzfäller auf den Beinen war, darunter mein Trupp, denn wir hatten unsere Plätze am anderen Ende der Tafel.
Der Gestank der Rotpelze und ihrer Eber war fürchterlich, aber noch schlimmer war ihr Kriegsgeschrei, dass in der Höhle widerhallte, bis uns die Schädel zu platzen drohten.«
Alle stellten sich diese Orgie aus Speeren, Blut und spitzen Wildschweinhauern vor. Wer rechnete schon mit einem Überfall von Goblins, dazu auf abgerichteten Wildebern reitend? Die Köchin Lilia starrte Varnyth an, eine große Kanne voll gewürztem Bier in der Hand. Dabei bemerkte sie den leeren Humpen nicht, den er ihr entgegenhielt. Er selbst war so tief in Gedanken, dass die beiden sich anstarrten, ohne Notiz voneinander zu nehmen.
»Lilia, schütte unserem Gast doch noch etwas Honigbier ein!«, rief Beolf, um die beiden aus ihrer Erstarrung zu lösen.
Ein Ruck ging durch die Köchin, die den Holzfäller nun anblickte, als sehe sie ihn zum ersten Mal. Varnyth hob seinen Humpen höher, und nach einem großen Schluck des köstlichen Gemischs aus Bier und Met erzählte er weiter.
»Meine Kameraden und ich packten die Äxte, und zusammen mit den anderen noch kampffähigen Leuten unserer Talschaft setzten wir uns zur Wehr. Schnell lagen zwei Dutzend Rotpelze und drei Eber mit gespaltenen Schädeln auf dem Boden der Höhle.« Er macht eine kurze Pause und sah in die Runde. »Die Männer sind alle geübt mit der Axt und ziemlich kräftig, müsst ihr bedenken«, fügte er hinzu, als wolle er den Vorwurf, er würde übertreiben, von vornherein entkräften. Aber niemand kam bei dem Anblick seiner breiten Schultern und dem grimmig verzerrten Gesicht auf die Idee, er trage zu dick auf.
»Wir schafften es, die Goblins aus der Höhle zu treiben. Dort verbarrikadierten wir den Eingang mit Bänken und Tischen und warteten auf den nächsten Angriff. Doch die Rotpelze waren schlau genug zu warten, denn sie wussten genau, dass wir kaum Wasser im Nittahloch hatten.
Zwei Nächte später, als der Durst wie Feuer in uns brannte, waren wir zu allem entschlossen. Wir wagten einen Ausbruch, aber auf dem Platz vor der Höhle stockte uns der Atem. Es müssen wenigstens acht Dutzend bewaffnete Goblins gewesen sein, die dort im Schein der Lagerfeuer auf dem nackten Boden lagerten. Sie riefen so etwas wie ›Nabanaa‹, als sie uns sahen, unaufhörlich und immer lauter. Wie von einem einheitlichen Willen gesteuert erhoben sie sich, packten ihre primitiven, aber dennoch tödlichen Waffen und stellten sich uns entgegen. Wir formierten uns zu einem Keil, hieben mit unseren Waffen auf alles ein, was rot und pelzig war, und versuchten den Waldrand jenseits der Goblinhorden zu erreichen. Aber ihre schiere Zahl war unser Verderben. Mit einer Todesverachtung, die niemand bisher bei ihnen gesehen hatte, drangen sie auf uns ein. Wie eine Flut kleiner, roter Leiber rannte Welle auf Welle gegen uns an. Nach und nach fielen die Kameraden unter den Speeren und Beilen dieser verfluchten Rotpelze.
Einmal aber, als unter den Hieben von acht noch kreisenden Holzfälleräxten gleich zwölf Goblins auf einmal fielen, stockte ihr Angriff, und sie wichen zurück. Im gleichen Augenblick ertönte eine Stimme, eine junge Stimme, nein, eigentlich waren es zwei. Eine junge und eine alte, die miteinander um die Vorherrschaft kämpften. Alle Augen richteten sich auf eine junge Goblinfrau, beinahe noch ein Mädchen, die im Fackelschein mit ausgebreiteten Armen auf einem Felsbrocken stand und alle überragte. Auch wir sahen sie an, denn der Klang dieser doppelten Stimme war unwiderstehlich. ›Tötet die Menschen!‹, rief sie. ›Befreit die heilige Höhle!‹, verstand ich noch, was auch immer das heißen mochte. Und dann sah ich in ihre Augen und verstand, warum die Rotpelze all ihre Feigheit, ihren Überlebenswillen und ihre Kriecherei vor jedem Stärkeren aufgegeben hatten.«
Als Kasimir Varnyth innehielt, um seine Kehle mit Honigbier zu schmieren, wagte kaum einer auch nur zu atmen. Selbst das Feuer schien die Luft anzuhalten, denn nicht einmal ein Prasseln war zu hören. Nach einem schweren Schluck setzte Varnyth den Krug sanft, fast zärtlich wieder ab und sprach weiter. »Ihre Augen waren schwarz, völlig schwarz, schwarz in schwarz. Nicht einmal der Flammenschein der Fackeln spiegelte sich in ihnen. Und ihr Gesicht war das einer alten Goblinfrau. So etwas hatte ich vorher noch nicht gesehen, und mein Wille zum Widerstand erlahmte. Ebenso wie das Licht schienen diese Augen auch meine Selbstbeherrschung aufzusaugen. Ich schüttelte mit einer letzten Kraftanstrengung den Kopf, wandte den Blick von dieser unheimlichen Goblinfrau ab und sah, dass meine sieben noch lebenden Kameraden sie ebenfalls anstarrten. ›Kämpft, Freunde, kämpft!‹, brüllte ich und hieb wieder auf die rotpelzigen Leiber ein. Aber die anderen Männer konnten dem Blick der schwarzen Augen nicht widerstehen. Die Goblinkrieger sprangen auf ihre Rücken, hingen wie Trauben an ihren Armen und brachten sie zu Fall.
Ich selbst schaffte es, mich zum Waldrand durchzuschlagen. Kurz vor der rettenden Dunkelheit drehte ich mich noch einmal um. Trotz meines Entsetzens konnte ich die Augen nicht schließen, als einer der Eberreiter sein Tier über einen gestürzten Kameraden trieb. Die mächtigen Hauer des Ebers schlitzten seinen Bauch auf, wühlten sich in die Weichteile, aber mein Kamerad gab keinen Laut von sich. Die schwarzen Augen hatten eine übermächtige Wirkung gehabt.
Mit letzter Kraft floh ich, lief immer geradeaus, weg vom Schein der Feuer. Ich wurde schneller, als in meinem Rücken ein wahnsinniges, triumphierendes Geheul begann. Denn da wusste ich, dass ich der einzige Überlebende war, der Überlebende eines Goblinangriffs, den der Steineichenwald noch nicht gesehen hatte. Ich lief und lief, zwei Tage lang, ohne zu wissen, wohin. Irgendwann stürzte ich, schlug wohl mit dem Kopf auf eine Wurzel und wurde ohnmächtig. Wo ich in der folgenden Woche war, vermag ich nicht zu sagen. Als ich wieder bei Verstand war, saß ich auf dem Rücken eines Packpferds und war auf dem Weg hierher«, schloss er.
Die Leute zweifelten, ob er wirklich wieder bei Verstand war, und auch Beolf sah das irre Flackern seiner Augen. Während der Mann sich erinnert hatte, war sein Blick wieder unstet geworden. Manch einer der Hohenhager in der Halle mit dem prasselnden Feuer in der Mitte schüttelte ungläubig den Kopf, denn diese Geschichte von mordlustigen, offen angreifenden Goblins schien von einem wirren Kopf erfunden worden zu sein.
Beolf bemerkte, dass Ulmward ihn ansah. Sicher hatte der Wehrmann nicht vergessen, was ihm über die Lippen gekommen war, als er den Brief des Lehnsherrn geöffnet hatte. »Wie alt war diese Anführerin etwa, Holzfäller Varnyth?«, fragte Beolf nun.
Sidra hob den Kopf. Er hatte ihr den Brief des Lehnsherrn natürlich gezeigt, und sie hatte gerade die gleiche Frage stellen wollen.
»Das ist schwer zu schätzen. Diese Rotpelze werden ja selten größer als siebzig Finger, und ihr Gesicht wirkte mit diesen schrecklichen Augen viel älter. Der Größe nach hatte sie vielleicht fünfzehn Winter gesehen«, sagte der Gast nach kurzem Nachdenken.
Dann bestürmten die anderen ihn mit Fragen. Er antwortete anfangs geduldig, aber schon bald wurde er müde, denn die Strapazen der letzten Tage saßen ihm noch in den Knochen. Daran hatte auch Sidras Kräutermedizin nichts ändern können. Er murmelte eine Entschuldigung und verließ die Halle, um seine Bettstatt aufzusuchen. Auch danach ging das Gerede weiter, bis Beolf seine Frau ansah, die Tafel aufhob und man sich nach und nach zur Ruhe begab.
Beolf und Sidra wollten allein sein, denn bald würden sie sich für geraume Zeit trennen müssen. Aber das wussten nur sie selbst. Ulmward sah ihnen beim Verlassen der Halle nach, denn der Wehrsasse hatte kein Wort über das Schreiben des Lehnsherrn verloren.
***
»Eine Woche? Eine Woche lang willst du mich allein lassen? Um die Götter um eine Medizin zu bitten, die es vielleicht nicht einmal gibt! Und was ist mit unseren Leuten? Wenn jemand krank wird oder sich verletzt?« Beolfs Stimme war so laut, dass er durch die Tür aus Eichenbohlen bis in die Halle zu hören war, wo die meisten Wehrmänner und Handwerker bereits auf ihren angestammten Plätzen saßen. Die Männer und Frauen sahen sich an. Seit ihr Wehrsasse vor zwei Wochen den Brief des Ritters von Anderstein bekommen hatte, war er schweigsam und in sich gekehrt gewesen.
»… natürlich gibt es … Gunahild auch … Knochen schienen …« Die leisere, aber nicht weniger entschlossene Stimme gehörte Sidra.
Die Tür zu den Kammern des Wehrsassen und seiner Frau ging auf, und Sidra von Hohenhag kam mit einer ledernen Riementasche über der einen, ihrem Bogen und einem wohlgefüllten Pfeilköcher über der anderen Schulter heraus. Ihren dunkelgrünen Mantel hatte sie zusammengerollt und an die Tasche gebunden. Sie trug die lederne Hose und die dazu gehörige Bluse, die sie während ihrer Gefangenschaft mit eigenen Händen genäht hatte. Die Sachen waren derb und wie dafür geschaffen, tagelang in der Waldwildnis nach seltenen Gewächsen zu suchen. Und tief im Steineichenwald würde sich auch niemand daran stören, dass sie sich als Frau in Hosen zeigte.
In ihren grünen Augen lasen die Hohenhager Zorn und Trauer. Wohin sie auch gehen wollte, sicher fiel es ihr nicht leicht, ihren Mann zu verlassen. Zu lange hatten sie damals aufeinander verzichten müssen. Und das, obwohl sie während ihrer Gefangenschaft fünf Jahre lang die einzigen Menschen unter Orks gewesen waren.
Ihr blondes Haar wehte, als sie mit langen Schritten die Halle durchquerte und das Tor aufstieß. Gunahild, ihre Freundin noch aus den Tagen vor dem Überfall der Orken, stand auf und eilte ihr hinterher.
Als sie nach kurzer Zeitspanne wieder hereinkam und sich setzte, warf sie einen Blick zur Eichentür, hinter der sich die Kammern der Wehrsassen verbargen. Da Beolf nicht herauskam, berichtete sie flüsternd: »Sie sagt, es ist wegen ihrer Kinderlosigkeit. Fünf Jahre lang haben sie vergeblich, also … ihr wisst schon. Sidra hat sich auf den Weg in den Steineichenwald gemacht, um ein Wildkraut zu finden, das ihr helfen soll, endlich ein Kind zu empfangen. Angeblich ist Beolf nicht einverstanden, dass sie eine Woche lang allein durch die Wildnis streift.«
Ein paar nickten aus Mitleid mit den beiden, die so viel hatten ertragen müssen, um endlich zusammenzukommen. Mit unglaublichem Willen hatten sie den Wehrhof wieder aufgebaut, der vor über elf Jahren von Orks zerstörten worden war. Bis auf ein paar Kinder, die Beolf und Sidra im Vorratskeller hatten verbergen können, waren damals fast alle Bewohner hingemetzelt worden. Danach hatten die beiden fünf Jahre lang Sklavenarbeit für einen Rikai-Schamanen leisten müssen. Mit dessen Mardyrch-Sippe waren sie durch die Orklandsteppe und in den Norden bis zur großen Olochthai gezogen, bevor sie hatten fliehen können.
Als der Hof wieder halbwegs Schutz bot, waren sie mit den neuen Bewohnern, jungen Abenteurern von den beiden anderen Höfen, gegen die Orks gezogen. Alles, was sie während ihrer Gefangenschaft über die Art der Orken zu kämpfen gelernt hatten, hatten sie an ihre Anhänger weitergegeben. Die jungen Männer und Frauen waren von Beolf erbarmungslos gedrillt worden, bis sie rennend oder in vollem Galopp vom Pferderücken einen Pfeil in ein dreißig Schritt entferntes Ziel jagen konnten. Mit diesem Wissen hatten sich die Leute von Hohenhag bald einen Namen als Unsichtbare Rotte gemacht. Seither hielten die Orks Abstand vom Heckenwall. Überfälle auf Händler oder Einsiedeleien hatte es in dieser Gegend seit ein paar Jahren nicht mehr gegeben.
»Den Goblin möchte ich sehen, der näher als zehn Schritt an Sidra herankommt, ohne dass ein Pfeil seine Brust kitzelt«, sagte Malrik, ein sehniger, hagerer Wehrmann, der selbst einer der besten Bogenschützen war.
»Genau!«, pflichtete Bogumir ihm bei. »Und Orks trauen sich schon lange nicht mehr in die Nähe.« Seit bei der Schlacht vor Anderstein ein Schwerthieb seinen Hals verletzt hatte, sprach er nur mühsam und krächzend.
»Außerdem halten sie sich angeblich an die Waffenruhe, die der Waldsteyner mit ihnen vereinbart hat«, fügte Lilia hinzu. Mit solchen und ähnlichen Worten versuchten sie sich zu beruhigen. Sie alle schätzten Sidra, die sich als Wehrsassin nicht zu fein war, bei jeder noch so dreckigen Arbeit mit anzufassen. Und abends, wenn andere schon müde waren und den Tag bei einem Krug Bier oder Met in der Halle beschlossen, behandelte sie noch die Blessuren und Krankheiten, die bei dem harten Leben in den Grenzmarken unausweichlich waren.
»Aber warum macht sie sich ohne Pferd auf den Weg?«, fragte jemand am Tisch der Handwerker. »Dafür gibt es doch keinen Grund.«
Ulmward, der erste Wehrmann, der bereits an der hohen Tafel saß, zuckte mit den Schultern. »Gebe Praios, dass sie in einer Woche wohlbehalten zurückkehrt. Mit der Medizin, die ihr so wichtig ist«, murmelte er.
Alle, die sein Gebet gehört hatten, nickten.
***
Eine Woche später war Sidra noch nicht aus der Waldwildnis zurückgekehrt. Am Morgen des achten Tages, dem ersten des Traviamonds, packte Beolf seine Tasche und schlang sich das Schwertgehänge um. Mit dem schlichten Andergaster Schwert und dem Schneidzahn, der Axt mit dem gekrümmten Stiel, sah er so kriegerisch aus, wie es einem Mann seines Standes gemäß war. Immerhin nahm er als Wehrsasse den Rang eines Ritters ein. Das graue Wams und die dunkelgrünen Beinlinge waren zwar schon ein wenig ausgeblichen, aber aus gutem Stoff. Als er die solide gearbeiteten Satteltaschen geschlossen hatte, rief er seinen ersten Wehrmann zu sich in die Kammer.
»Ulmward, sorge dafür, dass die letzten Felder so schnell wie möglich abgeerntet und umgepflügt werden. Und sieh zu, dass der Wachdienst vor dem Hag nicht vernachlässigt wird! Auf keinen Fall weitet ihr die Patrouillen aus, darauf hat Ritter Wolfhard in seinem Brief ausdrücklich hingewiesen.«
Ulmward nickte. »Du bleibst also länger weg, mein Freund?«
Beolf sah seinen Vertrauten an, als habe der ihn bei einer Lüge ertappt. »Wie, äh, wie kommst du darauf?«
»Nun, die Ernte einzubringen, wird noch zwei oder drei Wochen dauern. Du rechnest also nicht mit einer baldigen Wiederkehr. Dabei triffst du Sidra vielleicht schon gleich vor dem Tor. Es gibt hundert Gründe dafür, dass sie einen oder zwei Tage später als angekündigt zurückkommt.«
»Ja, natürlich, aber ich mache mir große Sorgen um sie. Außerdem ist es nicht an dir, meine Entscheidungen in Frage zu stellen«, gab er in derart hochmütigem Ton zurück, dass Ulmward in der engen Kammer einen Schritt zurückwich. Gleich darauf sah Beolf seinen Freund treuherzig an. Schließlich war Ulmward nicht dumm, und er selbst hatte noch nie verbergen können, wenn er nicht die volle Wahrheit sprach.
»Wo willst du sie denn suchen? Und warum willst du zuerst zu Nymmir von Waldsteyn?«, fragte Ulmward, der seinen inneren Kampf richtig gedeutet hatte.
»Du weißt doch, dass der Freiherr befohlen hat, alles zu unterlassen, was die Orks als Bruch der Waffenruhe ansehen könnten«, antwortete Beolf nun ohne Hochmut. »Und der Anführer der Unsichtbaren Rotte auf Spurensuche im Grenzland könnte eine solche Provokation sein. Daher will ich mir seine Erlaubnis holen.«
Auch wenn sein erster Wehrmann vielleicht glaubte, dass das nur ein Vorwand war, verzichtete er darauf, ihn weiter zu bedrängen. Beolf war dankbar, dass er ihn nicht zwang, weitere Ausflüchte zu erfinden.
»Dann lass mich mit dir reiten«, bat Ulmward. »Oder nimm ein oder zwei andere Kämpfer mit. Andraus und Malrik, oder Franka, die ist gut mit der Wurfaxt.«
Mit einem bittenden Ausdruck sah Beolf seinen Freund an. Nur keine weiteren Fragen, die ihn vielleicht zu Notlügen gezwungen hätten. »Nein, ich muss allein gehen. Hier ist genug zu tun, Hohenhag kann keinen weiteren Arm entbehren.«
Der erste Wehrmann sah ihn prüfend an und nickte schließlich. »Und auf diesen Varnyth werde ich ein Auge haben. Diese Geschichte von aufsässigen Rotpelzen scheint mir erfunden zu sein. Weiß Phex, welche Taten er verheimlicht.«
»Ja, äh, richtig. Goblins greifen Holzfäller an, bei den Zwölfen!«, sagte Beolf. »Das gibt es doch gar nicht!«
Ulmward legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Viel Glück! Was auch immer du vorhast«, sagte er.
»Ich danke dir, Ulmward! Und seht zu, dass ihr wenigstens ein paar Handvoll Erdäpfel zusammenbekommt! Der Winter wird lang genug.«
Kapitel 2
Später, nach einem langen Ritt und einem fast ebenso langen Gespräch mit seinem Lehnsherrn, ritt Beolf auf Firio, seinem zuverlässigen Warunker-Hengst, langsam vom Hof der Burg Waldsteyn. Es dämmerte bereits, und er war tief in Gedanken versunken. Gegen die Kälte hatte er sich in einen dicken wollenen Umhang gewickelt. Vor den Wällen der Burg, die etwa sieben Meilen südöstlich von Anderstein lag und die Wege nach Teschkal im Osten und Andrafall im Süden bewachte, stieg der Nebel vom Boden auf. Die feuchte Luft war erfüllt vom Duft frisch geschlagenen Holzes und gerade erst umgepflügter Erde. Es kostete die Leute des Freiherrn erhebliche Mühe, dafür zu sorgen, dass der Wald die gerodeten Flächen rund um Mauern und Gräben nicht zurückeroberte. Denn nur so wurde verhindert, dass sich Angreifer in der Deckung von Bäumen und Gebüsch an das Verteidigungswerk heranschleichen konnten.
Die braunen Locken Beolfs waren schwer von der Feuchtigkeit und hingen ihm auch noch ins Gesicht, als er den Wald längst erreicht hatte und die dunklen Baumstämme den Weg säumten.
»Da werden wir wohl noch einige Zeit länger auf Sidra verzichten müssen, mein Guter«, murmelte er und streichelte den Hals Firios, der die Ohren aufstellte. Wie zum Hohn war es ausgerechnet der Tag der Heimkehr, der erste Tag des Traviamonats, an dem er in aller Frühe aufgebrochen war.
In den Jahren nach ihrer Hochzeit waren er und Sidra keinen einzigen Tag getrennt gewesen. Und davor, vor dem Wiederaufbau von Hohenhag, hatten sie Jahr um Jahr in der engen Hütte des Schamanen und auf seinem Karren ein Lager teilen müssen. Wie er es schaffen sollte, noch länger ohne seine Gefährtin auszukommen, konnte er sich nicht vorstellen.
Firio, der vierjährige Nachkomme der Warunker Firn und Fuchs, die Beolf bei einem Überfall mit den Mardyrch auf eine Goblinsippe erbeutet hatte, folgte dem aufgeweichten Weg. Ein Stück voraus kreuzte die Straße von Anderstein im Norden nach Andrafall im Süden seinen Weg. Beolf hob endlich den Kopf und sah im letzten Licht der Dämmerung, etwa hundert Schritt voraus, eine Gestalt mit einem grauen Umhang auf einem ebenso grauen Pferd. Der Mann, zumindest glaubte Beolf, dass es ein Mann war, ritt geradewegs nach Westen und war bald im Nebel verschwunden.
Der Weg wurde hinter der Kreuzung schmal und holperig. Wurzeln, faserig und knotig wie die Muskelstränge eines uralten Trolls, ragten aus der matschigen Oberfläche hervor. Firio wurde langsamer, setzte die Hufe vorsichtig auf und schnaubte unruhig, als er auf den feuchten Wurzeln ausrutschte. Der Reiter im Nebel vor ihnen musste diese Strecke schon öfter geritten sein, sodass sein Pferd den Weg kannte. Beolf wusste, wohin er führte, denn Nymmir von Waldsteyn hatte ihm die einsame Schänke beschrieben.
Geschlagene vier Stunden hatte Beolf mit dem Freiherrn gesprochen. Seit dem Orkeinfall vor fünf Jahren, bei dem die Unsichtbare Rotte die Straße von Anderstein nach Andrafall gehalten hatte, kannten und schätzten sich die beiden. Und wenn der Waldsteyner auch um einiges älter war als Beolf, so hatte er ihn in den vergangenen Jahren doch mehrfach um seine Meinung gebeten, wenn es um die Sicherung der Grenzmarken ging. Diesmal allerdings nicht.
Etwa fünf Meilen ritt Beolf im Schritttempo durch den dunklen Wald nach Westen. »Immer mit der Ruhe«, murmelte er und streichelte Firios Hals. »Auf keinen Fall wollen wir den Reiter da einholen.« Er musterte das dichte Unterholz, das am Waldrand wuchs und Räubern und Wegelagerern gute Deckung bot. Oder einem Verräter. Dennoch hatte er keine Angst vor einem Überfall. Lange genug war er selbst es gewesen, der in den Ausläufern des südlichen Steineichenwalds mit seinen Leuten auf räubernde Orks gelauert hatte. So schnell würde ihn niemand überraschen, denn wenn sich jemand in den hiesigen Wäldern auskannte, dann war das Beolf von Hohenhag. Und natürlich Sidra, dachte er, und machte sich dennoch große Sorgen um sie.
Von links hörte er das Gurgeln eines Bachs, der im Waldgebirge entsprang. Rund dreihundert Meilen erstreckte sich der Steineichenwald in die Richtung, in die Beolf ritt, bis zum Fluss Bodir. Dort setzte sich das Gebirge in einem Bogen nach Norden und Osten fort, bis es sich nach weiteren dreihundert Meilen mit den Höhen des Thasch vereinigte. Die endlose Steppe zwischen diesen beiden Höhenzügen war Orkland, gleichgültig, welcher Herrscher aus Andergast oder Nostria es für sich beanspruchte.
Links und rechts von Beolfs Weg stiegen die waldreichen Hügel an. Auch wenn er es nicht sehen konnte, so wusste er doch, dass die Kuppen nicht weiter als zwei- oder dreihundert Schritt in die Höhe ragten. Im Westen wurden die Hügel steiler, bis sie sich zu schroffen Spitzen erhoben, auf denen kein Baum mehr wuchs. Er versuchte, etwas hinter der Wand aus Nebel und Dunkelheit zu seiner Rechten zu sehen, was natürlich unmöglich war, aber dennoch stahl sich ein Lächeln in sein Gesicht.
Das Erste, was Beolf vom Wurmschatten sah, waren drei schmutzig-gelb leuchtende Flecken in der Dunkelheit. Als der Weg in eine Lichtung mündete, erkannte er, dass die Schänke aus einem Hauptgebäude aus dicken Blockbohlen und einem niedrigen Schuppen mit einem Dach aus Grassoden bestand. Die drei gelben Flecken waren die Fenster des Schankraums, eine schiefe Holztür unter einem ebenso schiefen Sturz führte hinein. Der Wurmschatten war eine wahrhaft verschwiegene Spelunke, was das Fehlen von Musik oder Gegröle der Zechkumpane bewies. Der Wald war nur wenige Schritte breit um die Schänke herum gerodet. Felsen brachen hier und da durch den feucht glänzenden Boden, aber dennoch machten Firios Hufe kaum ein Geräusch.
Der Mann, dem er nun seit fast einer Stunde gefolgt war, hatte sein Pferd vor dem Schankraum angebunden. Beolf sah noch, wie er mit weit ausgreifenden Schritten um das Nebengebäude herumging. Die Tür befand sich wohl an der Rückseite des Schuppens, denn kurz darauf war durch das einzige Fenster auf der Vorderseite ein schwacher Lichtschein zu sehen.
Ohne die Tür der Spelunke aus den Augen zu lassen, stieg Beolf ab und ging zu dem Fenster hinüber. In dem trüben, pendelnden Lichtschein einer Öllampe sah er eine junge Frau, die mit dem Rücken zum Fenster stand. Es war ein ärmliches Geschöpf mit strähnigen, schmutzigen Haaren, gewandet in ein formloses Kleid aus grauem Leinen. Die Schultern der Frau waren mager und der Hals dünn, die Haut war gerötet und im Nacken schorfig.
Die Hand eines Mannes legte sich um diesen Nacken, und im ersten Moment glaubte Beolf, jemand wolle der Frau Gewalt antun. Dann sah er aber, wie sich ein Kopf an ihre Wange schmiegte. Das Gesicht des Mannes konnte er wegen der grauen Kapuze nicht erkennen, aber er wusste nun mit Sicherheit, dass es der war, der seit Burg Waldsteyn vor ihm hergeritten war.
Mit dem Rücken an die Holzwand gelehnt, blieb Beolf neben dem Fenster stehen und sah sich um. Kein weiterer Gast näherte sich dem Wurmschatten, und niemand verließ die niedrig hingeduckte Spelunke. Als er atemloses Gemurmel durch die dünne Holzwand hörte, schob er sich noch einmal an das Fenster heran. Ob hier doch noch eine Gräueltat verübt wurde? Oder fühlte er sich nur an die heimlichen, sich selbst verbietenden Zärtlichkeiten erinnert, die er mit Sidra während der Zeit bei den Orks ausgetauscht hatte?
Als er an dem Hinterkopf der armseligen jungen Frau vorbeiblickte, konnte er zum ersten Mal das Gesicht des Mannes sehen. Beolf erstarrte. Es war Rudbard von Wasgenstein, ein Offizier und eitler Stutzer im Dienst des Freiherrn, der seine erste Schlacht erst dann schlug, als er aufgrund verwandtschaftlicher Beziehungen bereits Leutnant war. Er trug immer noch den hellen Vollbart, den er sich nach der Schlacht am Vogelforst vor über fünf Jahren hatte stehen lassen.
Endlich löste sich Beolf aus seiner Erstarrung und zog sich von dem schmutzigen Fenster zurück. Der Offizier hatte ihn nicht gesehen. Ein Grinsen stahl sich in Beolfs Gesicht, als er sich an seine erste Begegnung mit dem jungen Wasgenstein erinnerte. Der Stutzer hatte ein Tappert mit auf den Wehrhof gebracht. Diesen eleganten Überwurf, den man bei Hofe trug, um die schäbigen und abgeschabten Uniformteile zu verbergen, hatte Wasgenstein doch tatsächlich angelegt, als er mit der Unsichtbaren Rotte am offenen Lagerfeuer saß. Immerhin hatte er sich bewährt, als sie draußen in der Orkschädelsteppe einer Horde Schwarzpelze eine Falle gestellt hatten. Und auch später, bei der Schlacht am Vogelforst, hatte er angeblich tapfer gekämpft.
Rudbard von Wasgenstein also, dachte Beolf, während er zur Tür des Schankraums hinüberging. Hat es nötig, eine zweifelhafte Schänke wie den Wurmschatten aufzusuchen, um sich dort mit einer Dirne zu treffen. Travia sei Dank hatte er das nicht nötig. Ob Wasgenstein später noch in den Schankraum kam?
Mit zuckenden Mundwinkeln stieß Beolf die Tür zum Schankraum auf. Sogleich verschlug es ihm den Atem, denn in dem Raum mit den niedrigen, schwarz geräucherten Deckenbalken mischten sich die Ausdünstungen von ungewaschenen Holzfällern, verlaustem Gesindel, schmierigen Händlern und sogar der wildherbe Dunst von ein paar Goblins, die sich in einer der Nischen zusammendrängten.
Mit seinem sauberen Umhang, der aufrechten Haltung und dem offenen Blick erschien Beolf wie ein Fremdkörper unter dieser zwielichtigen Versammlung. Der Wirt, ein grobschlächtiger Kerl mit stark behaarten Armen und vorstehendem Unterkiefer, was auf mindestens einen Ork unter den Großeltern schließen ließ, starrte ihn aus zusammengekniffenen Augen an. Mit flinken Händen ließ er einige Holzkästchen und verschnürte Beutel unter der Theke verschwinden. Da Beolf nicht gekommen war, um den Handel mit Zithabar, Purpurmohn oder Sklavenbovist zu unterbinden, sah er nicht hin. Dabei hasste er die Verbrecher, die diesen Pilz anwandten, um freie Menschen zu willfährigen Arbeitssklaven zu machen.
Die Gäste, von denen die meisten ihre Gesichter unter Kapuzen, Tüchern oder Mützen verbargen, beachteten ihn gar nicht, als er sich einen Platz in einer Nische neben dem offenen Feuer suchte. Zumindest taten sie so, denn Beolf konnte die Blicke in seinem Rücken förmlich spüren. Das Gefühl ließ nach, als er seinen wollenen Umhang ablegte und darunter keine Uniform erschien, sondern ein graues, wattiertes Wams und schlichte, grüne Beinlinge.