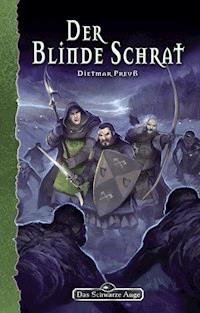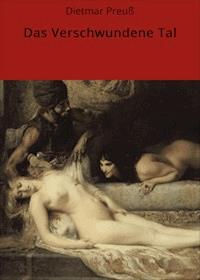Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
Mitten im Winter werden Beolf und Sidra auf die Burg ihres Lehnsherrn eingeladen. Unterwegs machen sie einen grausamen Fund: Ein Wolf hängt an einem Galgen, und die Leute im Dorf berichten von zweibeinigen Werwesen. Auch Sidra findet trotz ihrer Heilkünste kein Mittel, um die zahlreichen Wunden zu heilen. Während Beolf im Auftrag des Freiherrn Nymmir von Waldsteyn gegen die Baronie Aare ziehen muss, die angeblich von einer Hexe regiert wird, versucht Sidra dem Geheimnis auf den Grund zu gehen: Wie kam der Fluch der Lykantrophie nach Waldsteyn?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Biografie
Dietmar Preuß, Jahrgang 1969, veröffentlichte zum ersten Mal im Alter von 13 Jahren ein Gedicht in der örtlichen Tageszeitung für ein Honorar von unwahrscheinlichen DM 5,–. Als er nach Studium, Heirat und Umzug ins schöne Münsterland wieder Zeit zum Schreiben fand, gelangten die ersten Geschichten zur Einsendungsreife.
Er veröffentlichte seit 2003 zahlreiche Fantasy- und Science Fiction-Geschichten in einschlägigen Anthologien und Fanzines (Storyolympiade, Windgeflüster u.a.), außerdem den Kurzroman Die Hexe im Stein über den Rollenspieler Roland Junker.
Bei Fantasy Productions erschienen zuvor von ihm die Romane Hohenhag und Die rote Bache.
Die Paktiererin ist sein dritter Roman in der Welt von Das Schwarze Auge.
Titel
Dietmar Preuß
Die Paktiererin
Ein Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©
Originalausgabe
Impressum
Ulisses SpieleBand 11045EPUB
Titelbild: Arndt DrechslerAventurienkarte: Ralph HlawatschLektorat: Catherine BeckBuchgestaltung: Ralf BerszuckE-Book-Gestaltung: Michael Mingers
Copyright ©2013 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems.DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN, DERE, MYRANOR, RIESLAND, THARUN und UTHURIA sind eingetragene Marken der Signifikant GbR. Alle Rechte von Ulisses Spiele GmbH vorbehalten.
Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt.
Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.
Print-ISBN 978-3-89064-158-4E-Book-ISBN 978-3-86889-647-3
Kapitel 1
Mitte Rahja 351 v.BF. – 8 Tage bis zu Madas Neugeburt
Auf der kahlen Kuppe im westlichsten Zipfel des Herzogtums Weiden, Meilen entfernt von Burg Aare, brannte ein gewaltiges Feuer. Der Wind, der von der Messergrassteppe durch die Nacht gefegt kam, trieb Funken wie einen Schwarm Glühwürmchen auf die Berge des Thasch zu. Zwei Dutzend Frauen standen um die Flammen, nackt und mit hoch erhobenen Armen. Die letzten Worte der Invokation Levthans wurden der obersten Hexe des Zirkels von den Lippen gerissen, als aus dem Wind ein Sturm wurde und die Umrisse des Widderhäuptigen im Feuer erschienen. Die jüngeren Töchter Satuarias schrien auf, dann starrten sie in die Flammen, erfüllt von Hoffnung, aber auch von Angst.
Hatisha, die jüngste der Hexen, wandte für einen Moment den Blick ab. Ihre Augen waren geblendet vom Feuerschein, sie konnte kaum die Gesichter ihrer Schwestern erkennen. Würde es diesmal geschehen? Würde Levthan sie als Buhlin des Sabbats auswählen? Sie hatte Angst davor, denn noch nie hatte ein Mann bei ihr gelegen, geschweige denn ein Gott. Allein vor ihren Schwestern den schlanken, weißen Körper zu entblößen, bereitete ihr Unbehagen, obwohl die Hexen des Zirkels äußerst verschwiegen waren. Aber am meisten fürchtete sie, dass sich die Prophezeiung, die bei ihrer Geburt ausgesprochen worden war, nicht erfüllen würde. Hatisha war vor zweiundzwanzig Jahren in einer fast unversehrten Fruchtblase zur Welt gekommen. Das zähe Gewebe hatte den Säuglingskörper umhüllt wie ein Ei, sodass sich die alte Vettel, die als Hebamme gekommen war, beeilen musste, das Gesicht von der erstickenden Haut zu befreien.
Eine Eigeborene! Ehrfürchtig hatte die Alte die beiden Worte hervorgestoßen. Zu einer mächtigen Dienerin Satuarias würde das Kind heranwachsen, hatte sie prophezeit. Andere Hexen waren gekommen und hatten der Alten widersprochen. Eine wahrhaft Eigeborene kam nicht lebend zur Welt, sondern musste, wie Satuaria selbst, sieben Monate und sieben Tage in harter Schale ausharren. Dennoch hatten die Schwestern des Hexenzirkels beobachtet, wie Hatisha zu einer höchst begabten Satuarienstochter heranwuchs und zudem mit hohen Wangenknochen, vollen Lippen und großen, dunklen Augen eine wahre Schönheit wurde.
Über diesen Gedanken hatte Hatisha den Gesang ihrer Schwestern überhört, als der Widderköpfige aus den Flammen trat. Der Blick Levthans blieb auf ihr hängen. Keine der Hexen besaß eine so anmutige Gestalt und so makellose Haut wie sie. Ihre roten Locken wehten im Wind. Natürlich würde der Mannwidder sie auswählen. Weil sie die Schönste war, und weil sie eine eigeborene Hexe war!
Umso enttäuschter war Hatisha, als seine geschlitzten gelben Augen weiterwanderten und er im Schein des Feuers ausgerechnet Truda bedeutete, zu ihm zu kommen. Die Alte hatte schon über sechzig Sommer gesehen, ihre Brüste hingen wie faltige, leere Taschen bis auf ihren Bauch. Dennoch freute sich Hatisha für ihre Schwester. Sie wusste, dass Truda seit vier Dekaden darauf wartete, von Levthan als Buhle ausgewählt zu werden. Sie holte Luft und stimmte in den Gesang ihrer Schwestern ein.
Am nächsten Morgen erwachte Hatisha mit verquollenen Augen im Bett ihrer Waldhütte. Hatte sie diesen Sabbat leibhaftig miterlebt? Oder hatte sie ihre Schwestern nur im Traum getroffen, angeregt von dem getrockneten Pilz, den sie zu sich genommen hatte?
Es klopfte an die Tür. Stöhnend schwang sie sich aus dem Leinenzeug und warf sich eine Decke aus rauer Wolle über das Nachtgewand. Mit vier Schritten durchmaß sie den einzigen Raum ihres abgeschiedenen Heims und öffnete die Tür. Es war aber keine Mutter mit krankem Kind, und auch keine Hebamme, die nach einem seltenen Kraut fragen wollte.
Fünf Männer in den rostroten Uniformen des Barons von Aare standen vor ihr, angeführt vom Schwarzbären, der ihr beim letzten Krankenbesuch auf der Burg zugewinkt hatte. Der Feldwebel mit dem dichten schwarzen Schopf und den dunklen Augen machte diesem Spitznamen alle Ehre, denn wenn er nicht kämpfte, wirkte er so unbeholfen wie ein Bärenjunges.
Erst vorgestern, als Hatisha zur Burg gekommen war, hatten die Männer vor dem Wachhaus mit nackten Oberkörpern gerungen. Sie selbst hatte wie immer ein weites Kleid aus grobem Wollstoff getragen, das die verführerischen Rundungen ihres Leibs verdeckte. Keiner der rauen Kerle sollte auf üble Ideen kommen, denn sie musste ihre Unberührtheit bewahren. Dennoch hatte sie dem Bären zugelächelt, denn wie immer freute er sich, sie zu sehen. Aus ihrem Lächeln war ein Lachen geworden, als der Hüne den Ringkampf unterbrochen und sein Gegner ihm mit aller Kraft die Schulter in den Leib gerammt hatte. Der Soldat war wie von einer Wand abgeprallt und hatte sich die lädierte Schulter gerieben. Der Schwarzbär hatte ihr zugewinkt und dann seinen Gegner mit einem Griff um den Unterleib in die Höhe gestemmt und zu Boden geworfen.
Der Anlass ihres Besuchs dagegen war ein trauriger gewesen, denn sie war zu der todkranken, jungen Baronin gerufen worden. Nachdem sie der leichenblassen Selinde, die teilnahmslos zur Decke ihres Schlafgemachs geblickt hatte, die Quetschungen an Hals und Handgelenken mit Salbe bestrichen hatte, war sie aus der Kemenate geflüchtet. Auf keinen Fall hatte Hatisha dem Baron begegnen wollen, denn man erzählte sich, dass er jedem Rock hinterherstieg, obwohl er mit seiner feenhaft zarten, weißblonden Frau erst vor wenigen Monaten den Traviabund geschlossen hatte. Angeblich war das arme Ding eine Treppe hinuntergefallen. Dass sie jetzt hier ohne Lebenswillen lag, das fein geschnittene Gesicht ausgezehrt, die Augen stumpf, musste andere Gründe haben.
»Geht es ihr besser?«, hatte Aglaia, die alte Amme der Baronin, flüsternd gefragt.
»Ich fürchte nicht«, hatte Hatisha geantwortet und der Alten die Hände gedrückt. »Ich werde übermorgen wiederkommen«, hatte sie versprochen, war die breiten Stufen der Wendeltruppe hinuntergestiegen und auf das Wachhaus am Burgtor zugegangen.
»Wenn sich Herzogin Waldrada statt um ihren schönen Bogner um ihre Lehnsleute kümmern würde, dann fänden die Klagen von Selindes Vater vielleicht Gehör«, hatte sie den Schwarzbären sagen hören. »Warum sich Selinde das nur gefallen lässt?«
»Ich habe von ihrer Zofe gehört, dass sie Hinrichs Prügel als gerechte Strafe für ihr Streben nach Titel und Reichtum empfindet«, hatte eine andere Stimme geantwortet. »Eines Tages wird der Baron das arme Ding noch totschlagen.
Besuch für dich.«
Ein freudiges Grinsen war im Gesicht des Schwarzbären erschienen, und er hatte nach einem Jutesäckchen auf dem Tisch der Wachstube gegriffen. »Ich habe dir Salz aus der Küche besorgt.«
Belustigt hatte sie festgestellt, dass die Augen des Bären flackerten, als er sie ansah. War er es wohl wert, ihn als ersten Liebhaber auszuwählen? Sie hatte Rahjas Freuden noch nicht kennengelernt, aber bei den vier Hexensabbaten, an denen sie teilgenommen hatte, war sie vom Widderhäuptigen verschmäht worden. Dabei wusste sie, wie sie mit ihren schlanken Gliedern, der schmalen Taille und den großen, festen Brüsten, die sie unter dem formlosen Kleid zu verbergen suchte, auf Männer wirkte.
»Ich danke dir«, hatte sie gesagt, denn seit sich der Baron von Herzogin Waldrada losgesagt hatte, kamen kaum noch Händler in den westlichsten Zipfel des Herzogtums. Hinrich von Aare gab seit der Trauung Waldradas der Schönen mit dem jungen Bogner Galbo vor, dass er die Verbindung als Frevel betrachte. In Wahrheit hielt er die Herzogin nur für zu schwach, ihn zur Räson zu rufen. Und wie immer hatten die kleinen Leute am meisten zu leiden, wenn die Herren nach größerer Macht strebten.
Hatisha hatte die Augen niedergeschlagen, denn der Blick des Schwarzbärenwar brennend vor Verlangen geworden. Nun frag schon, hatte sie gedacht und ihm ein aufmunterndes Lächeln geschenkt.
»Wirst du mich zum Sonnwendfest ins Dorf begleiten? Unter der Linde wird schon der Tanzboden aufgebaut.« Die Worte waren immer schneller aus ihm herausgesprudelt.
Hatisha hatte getan, als müsse sie sein Angebot abwägen. »Ja!«, hatte sie dann gesagt, und es gleich darauf bereut, denn sicher würde der Hüne nach dem Fest die Freuden Rahjas mit ihr teilen wollen.
All das ging Hatisha durch den Kopf, als der Schwarzbär am Morgen nach dem Hexensabbat vor ihrer Tür stand.
»… uns kommen. Befehl des Barons!«
Ein Blick ins Gesicht des Hünen zeigte ihr, dass ihm unwohl dabei war. Er schwitzte, obwohl die Luft am Morgen dieses Frühsommertags noch kühl war.
»Ich komme sofort«, antwortete sie, denn einem Befehl des Barons musste gerade sie nachkommen. Auf keinen Fall durfte jemand erfahren, dass sie mehr als eine Kräuterfrau war, zuallerletzt der streng praiosgläubige Baron. Ob Hinrich die Eingeweide schmerzen, weil er wieder einmal zu sehr dem Bier und Gebrannten zugesprochen hat?, überlegte Hatisha. Warum schickt er dann einen Unteroffizier mit vier Soldaten? Sie schloss die Tür und zog ihr schäbiges Kleid an, dessen ausgefranster Saum über den Boden fegte. Nach einem letzten Zögern trat sie vor die Tür.
Sofort griff einer der Soldaten mit dem Greifenwappen des Barons auf der Brust nach ihrem Arm. Sein fester Griff schmerzte, und er zerrte sie grob auf den Weg, der zum Dorf Aare und bis vor das Burgtor führte.
»Lass sie los, oder ich breche dir deinen verdammten Arm!«, knurrte der Bär und versetzte dem Soldaten einen Tritt ins Hinterteil.
»Es ist schon gut«, sagte Hatisha. »Was will der Baron?«
Sie kannte den Unteroffizier nun lange genug, um zu sehen, dass er mit sich selbst kämpfte, aber schließlich zuckte er nur mit den Schultern. Obwohl ihr nichts Gutes schwante, ging sie folgsam mit.
»Womit kann ich Euch dienen?«, fragte Hatisha, als sie eine Viertelstunde später mit gesenktem Blick im Thronsaal vor dem rotgesichtigen Hinrich von Aare stand. Der Baron trug ebenfalls ein rostrotes Wams. Über seinen mächtigen Bauch spannte sich sein Wappen, der sitzende Greifvogel. Die Luft in der Halle war feucht, und in dem lange nicht gewechselten Stroh auf dem Boden wimmelte es von Ungeziefer. Durch die Fenster, die über Mannshöhe in die dicken Mauern eingelassen waren, damit Angreifer nicht ohne Sturmleitern durch sie eindringen konnten, drang zwar Sonnenschein, doch obwohl nach neuester Mode das kostspielige Bleiglas bunte Reflexe auf die gegenüberliegende Wand zauberte, wirkte die Halle trostlos. Der Schwarzbär hielt sich mit seinen Leuten neben der einzigen Pforte.
Hatisha war nicht sicher, ob sie das beruhigen oder in Angst versetzen sollte.
»Das ist also die schöne Hexe!«, murmelte Hinrich und musterte sie mit vorstehenden Augen.
An seinen roten Wangen erkannte sie, dass er an diesem Morgen bereits reichlich Gebrannten getrunken hatte. »Hexe?«, flüsterte sie.
Hinrich stand auf und schwankte auf sie zu. »Kannst du einem Mann helfen?«, fragte er, näherte sein Gesicht ihrer Halsbeuge und sog tief ihren Duft ein. »Brauchst du dafür deine Gifte und Kräuter?«
Der üble Geruch, der dem Mund mit den braunen, verfaulten Zähnen entwich, nahm ihr den Atem.
»Es gibt Frauen, die können einen Mann verhexen! Auch ohne Medizin. So wie mein teures Weib!«, keuchte der Baron.
So langsam wurde Hatisha klar, woran der Baron litt. Das musste schlimm für einen Mann sein, der trotz seiner fünfundfünfzig Jahre im Zweikampf noch immer kaum zu besiegen war. Wenn selbst die feengleiche Selinde ihn nicht mehr zu reizen vermochte, brauchte es schon eine starke Medizin.
»Ich weiß da ein Mittel, Herr«, beeilte sich Hatisha zu sagen. »Es ist nicht einfach herzustellen, es braucht Eisenhut, und … und … es ist nicht ungefährlich. Bei falscher Dosierung …«, stammelte sie, denn der Baron stand noch immer nahe bei ihr und starrte auf ihre Brüste.
»Ich habe aber keine Lust, lange zu warten«, sagte er heiser und legte ihr die hornigen Hände auf die Schultern.
Sie wollte ihm versichern, dass das Mittel dafür sicher wirkte, da packte Hinrich den Kragen ihres Kleids und riss es samt Untergewand mit einem Ruck nach unten. Als sie völlig entblößt vor dem Baron stand, entwich ihr ein Schreckenslaut.
Die Soldaten schnappten beim Anblick ihres makellosen Körpers nach Luft, nur der Bär begehrte auf: »Herr, das könnt Ihr nicht …!«
»Halt das Maul!«, fuhr der Baron ihn an. »Das hier ist kein Kräuterweib. Und da kein Geweihter da ist, ist es meine Aufgabe, nach dem Hexenmal zu suchen!«
Dem konnte der Bär nicht widersprechen, wollte er nicht Zweifel an seinem eigenen Rechtsglauben hervorrufen. Hinrich von Aare hatte selbst zu Zeiten, als er noch ritterlichen Tugenden folgte, nie einen Zweifel daran gelassen, dass er jede Abweichung vom Glauben an die Zwölfe aufs Schärfste verfolgte. Magie und Hexerei waren ihm stets zuwider gewesen.
Vor Entsetzen reglos stand Hatisha da. Als der Atem des Barons beim Anblick ihres Körpers schneller ging, hielt sie einen Arm vor ihre Brüste, die andere Hand vor ihre Scham.
»Wer hat dir erlaubt, dich zu bedecken?«, brüllte ihr Hinrich ins Ohr, griff er nach ihren Handgelenken und riss sie zu Boden.
Auf den kalten Platten hockend, begann Hatisha um ihre Jungfräulichkeit zu zittern. Dabei waren es weniger die Angst und der Ekel vor dem stinkenden Baron, sondern die Empörung darüber, dass er sich nehmen wollte, was sie für Levthan aufbewahrt hatte.
»Herr, es ist kein Hexenmal zu sehen!«, hörte Hatisha den Bärenrufen.
Die Soldaten lachten gehässig.
»Was fällt dir ein, du Tropf!«, grunzte der Baron und rieb sich den Schritt. »Ihr da, kommt her! Das Hexenmal ist vielleicht nur zu ertasten. Sie soll sich ausstrecken!«
Hatisha schloss die Augen, als schweißige Hände über ihre Haut fuhren, zudrückten, kniffen, ihre Brüste und ihren Schritt berührten. Zorn stieg in ihr hoch. Was bildete sich Hinrich ein, Levthan zu stehlen, was ihm gebührte? Sie riss sich los, schlug um sich und spürte kaum Schmerzen, als ihre Hände eiserne Harnische trafen und sich an den Kettenhemden wund kratzten.
»Ja, sie muss eine Hexe sein«, keuchte Hinrich, »sonst würde sie uns nicht derart reizen. Nicht wahr, Männer?«
Die Soldaten, die ihre Ehrfurcht verloren und nun schmutzige Freude daran hatten, den Alabasterkörper immer und immer wieder zu berühren, nickten. »Ja, Herr, so muss es sein!«
Hinrich machte sich an seinem Hosenlatz zu schaffen.
»Hört sofort auf, sie ist keine Hexe!«, brüllte der Bär und näherte sich mit schweren Schritten. Als sein Blick auf den nackten Körper Hatishas fiel, erstarrte er. Ihre Blicke trafen sich, noch einmal ließ er seine Augen über ihre Rundungen wandern, dann schleuderte er einen Soldaten beiseite.
»Du wagst es, den Befehl zu verweigern? Wir sprechen uns später«, brüllte der Baron und zeigte auf die Doppeltür. »Das ist ein Befehl!«, schrie er, und endlich gehorchte der Unteroffizier. Langsam machte er drei Schritte rückwärts.
Als Hatisha sah, dass auch er sie im Stich ließ, wuchs ihre Verzweiflung ins Unermessliche. Angst, Hass und eine ekelhafte Art von Lust begannen sich in ihrem Innern zu umkreisen wie in einem Wirbelsturm. Was sich daraus bildete, nahm ihr den Atem. Sie wurde getrieben von einer Macht, auf deren Offenbarung ältere Schwestern des Hexenzirkels schon lange warteten. Diese Macht, gepaart mit dem Willen, ihre Reinheit für den Widderhäuptigen zu bewahren, ließ sie Formeln sprechen, die sie niemand gelehrt hatte. Wozu andere Hexen und Magier Jahre brauchten, gelang ihr innerhalb von Augenblicken.
»Madayraeel, du Silberne, ich rufe dich in diese Sphäre!«, murmelte sie.
Der Baron ließ sich vor ihr auf die Knie nieder. Aber nicht aus Ehrfurcht, nicht weil sie den Wahren Namen der Kyrjaka kannte. Vielmehr öffnete er seinen Gürtel.
»Madayraeel, du Prächtige, verlasse die Niederhöllen!«, sprach Hatisha nun schon deutlicher, und die Soldaten sahen ihren Baron an.
»Madayraeel, du Fünfgehörnte, ich biete dir meine Seele. Gehorche und steh mir bei!«, rief Hatisha.
Der Bär, der neben der Tür der Halle stand, sah bei diesen Worten auf. Vor den bunten Fenstern wurde es dunkel, die Luft schien nicht nur feuchter, sondern regelrecht klebrig zu werden.
»Madayraeel, Königin der Wölfe, ich erbitte deine Dienste!«, schrie Hatisha nun in höchster Not, denn der Baron hatte sich entblößt und versuchte, mit seinen Knien ihre Beine auseinanderzuzwingen.
Hinrich von Aare hielt inne, als das Licht schwand. Die Luft in der Halle schien zu knistern.
»Kyrjaka, Herrin der Mannwölfe, vertilge diese Wölfe hier!«, kreischte Hatisha.
Ein schwarzer Blitz erschien in der Mitte des Raums, begleitet von einem dumpfen Grollen. Die Männer starrten die Erscheinung an, die nicht verging, sondern sich vom Boden bis zur Decke erweiterte, sich ausdehnte und als Pforte in den Limbus bestehen blieb. Ein übergroßer Wolfsschädel mit silberfarbenem Fell erschien. Das Maul voller grausamer, schmutziggelber Fangzähne schob sich vor, bis fünf ebenso gelbe Hörner auf dem massigen Schädel zu erkennen waren. Das mittlere bog sich dem kräftigen Nacken entgegen, die anderen ragten über die Schnauze und zu den Seiten.
»Madayraeel!«, flüsterte Hatisha. In ihrer Stimme mischten sich Angst und Ehrfurcht.
Die riesige Wölfin mit dem silbernen Pelz schritt durch den gezackten Riss im Gefüge der Sphären. Als ihre Hinterbeine den Boden des Thronsaals berührten, verschwand die Pforte mit einem dumpfen Ton.
Der Baron erhob sich von den Knien, die Soldaten eilten mit gezogenen Schwertern an seine Seite, während die über mannshohe Dämonin die Männer mit geschlitzten Augen musterte. Hinter ihr drückte sich der Schwarzbär an die Wand. Kaum hoben die Soldaten die Schwerter, ließ Madayraeel ein abgrundtiefes Knurren hören und stürzte sich über die nackte Hatisha hinweg auf die Bewaffneten. Es dauerte nur Augenblicke, und um den Baron lagen die zerrissenen Gliedmaßen der Soldaten. Zu seinen Füßen hatte sich eine stinkende, dampfende Pfütze gebildet. Auch der Bäran der Wand starrte fassungslos auf seine toten Kameraden.
»Nein, warte!«, sagte Hatisha und klang hart, grausam und befehlend, berauscht von der Macht, über die sie nun verfügte. Die Gedanken wirbelten durch ihren Kopf, während sie erst den zitternden Baron und dann die Dämonin ansah. Nur langsam begriff sie, was sie soeben vollbracht hatte. Sie hatte eine fünfgehörnte Dämonin beschworen. Ohne dass man ihr die Invokation oder die günstigste Sphärenkonstellation genannt hätte, ohne die Formeln zu kennen, die bis in die siebte Sphäre zu hören waren, ohne die Donaria, die sie davor schützten, sofort von der Dämonin getötet zu werden. War das die Gabe, auf deren Offenbarung ihre Schwestern all die Jahre gewartet hatten?
Der Machtrausch umnebelte ihre Sinne, als ihr bewusst wurde, was nun alles möglich war. Jetzt konnte sie über den Baron gebieten, der wie ein Häufchen Elend in seiner eigenen Pisse hockte. Und sie musste auch nicht mehr warten, dass sich ihr ein minderer Gott wie Levthan zuwandte.
Sie erhob sich und sah sich nach dem Schwarzbären um. Auch ihn konnte sie nun nehmen, wann sie wollte. Oder ihm Qualen bereiten. Sie fuhr sich mit den Händen über die Brüste, dann wanderte eine Hand über ihren flachen Bauch nach unten, mit der anderen winkte sie ihn zu sich. Die Dämonin schlich auf riesigen Tatzen neben sie.
»Auch du hast mich angestarrt!«, fauchte sie den Schwarzbärenan, als er nur noch zwei Schritt entfernt vor ihr stand.
»Nein!«, flüsterte er.
»Lüg mich nicht an!«, schrie sie, und Madayraeel ließ ein Grollen aus den Tiefen ihres Schlunds hören.
»Nein!«, wiederholte der Unteroffizier, aber es klang wenig überzeugend.
»Es ist gut, ich vergebe dir!«, sagte Hatisha, nachdem sie eine Weile in sein Gesicht gestarrt hatte. Die Angst darin verstärkte noch ihren Machtrausch. Mit einem Ruck drehte sie sich zum Baron um. »Dir aber vergebe ich nicht. Nein, warte!«, befahl sie, als die Silberwölfin zum Sprung ansetzte. »Ich brauche ihn noch. Er wollte mich besitzen, also wird er mich heiraten!« Auf ihren Wink trat die Dämonin vor, bis ihre Reißzähne nur wenige Fingerbreit von seinem Gesicht entfernt waren, ihr heißer Atem in seine Nase stieg und Geifer auf seine Hände tropfte. »Du wirst mich doch heiraten, liebster Hinrich, oder nicht?«
»Nein, wie …«, stammelte der und ließ die Augen nicht von dem klaffenden Maul.
»Nein?« Hatisha tat über alle Maßen erstaunt. »Koste sein Blut!«
Das Grollen Madayraeels klang fast genussvoll, als sie ihre Fangzähne in Hinrichs Schulter grub und er vor Schmerz aufbrüllte.
»Nun, mein Liebster, ich frage dich noch einmal. Wirst du mich heiraten?« Hatishas Stimme war zuckersüß.
»Ja!«, ächzte Hinrich. »Ja, verflucht!«
»Wie redest du mit deiner zukünftigen Gemahlin?«, zischte sie.
»Ja, Liebste!«, stieß der Baron hervor, und Tränen der Hilflosigkeit rannen über seine Wangen.
Mit der Antwort zufrieden, wandte sich die junge Hexe dem Schwarzbären zu. »Hast du dich nun lange genug an meinem Anblick geweidet?« Sie legte die Hände unter ihre Brüste und hob ihm die Pracht entgegen.
Der Schwarzbär konnte die Augen nicht abwenden.
»Ich sollte mich bedecken, bevor du den Verstand verlierst. Geh ins Gemach der Baronin und bringe mir eines ihrer Kleider. Ach, und töte das kranke Ding! Sie hat sowieso nicht mehr lange zu leben.«
Der Unteroffizier starrte sie wortlos an, bis er fähig war zu antworten. »Das kann ich nicht tun.«
»Aber natürlich kannst du das. Madayraeel!«
Der Hüne schrie auf, als sich die Fangzähne heiß in sein Fleisch bohrten.
»Madayraeel wird dich nach oben begleiten und dafür sorgen, dass du meinem Wunsch entsprichst«, sagte Hatisha. »Und bring mir etwas Dunkles mit, keines dieser bunten Mädchenkleider.«
Die Fünfgehörnte öffnete das Maul, und sofort quoll warmes Blut aus der Schulter des Bärenhervor. Sie knurrte und stieß ihn mit den Hörnern, bis er sich widerstrebend auf die Treppe zubewegte. Da hämmerte es an die Pforte zum Hof, und der Schwarzbär blieb stehen. Mit einer Kopfbewegung bedeutete Hatisha ihm nachzusehen.
Als er die feste Tür öffnete, stand Hauptmann Eudo mit zwölf Soldaten auf dem Hof. Der Himmel war noch immer verhangen. »Das Wetter … hat sich plötzlich …«, stammelte Eudo, »… dieses Gebrüll. Ich wollte …« Dann wurde ihm endlich bewusst, was seine Augen sahen. »Oh!«, war das letzte Wort, das er in seinem Leben sprach.
»Nein, ihr Zwölfe, nein!«, brüllte der Bär, musste aber mit ansehen, wie die Hälfte der Kameraden unter schrecklichen Schreien von der Dämonin zerrissen wurde.
»Ich glaube, der Baron, nein, ich brauche einen neuen Hauptmann«, sagte Hatisha, als es vorbei war. »Oder willst du ihnen über das Nirgendmeer folgen? Oder ein anderer von euch?«
Der Schwarzbärdrehte sich zu Hatisha um, die zur Pforte gekommen war. »Nein, Herrin!«, sagte er und ergab sich in sein Schicksal, ebenso wie die überlebenden Kameraden.
Fünf Tage später begehrte eine alte Frau am Tor der Burg Aare Einlass. Die Sonne war schon untergegangen, und der Himmel im Westen flammte in roten und orangefarbenen Tönen. Die Alte mit dem gütigen Gesicht hatte am frühen Morgen ihren winzigen Tempel westlich von Yramis verlassen. Nun taten ihr die Beine weh, die Füße waren voller Blasen, und ihr Magen schien ein harter Knoten zu sein. Das graue Gewand, die orangefarbene Schärpe und das kupferne Medaillon mit den Umrissen einer Gans wiesen sie als Traviageweihte aus.
»Ich wurde zu einer Hochzeit gerufen«, sagte sie dem Wachsoldaten.
Der Mann zeigte nur stumm über die Schulter. Die Geweihte schüttelte den Kopf und ging über den leeren Burghof. Keine Mägde schwatzten, keine Knechte eilten umher, keine Handwerker arbeiteten. Nur der Wind fegte Laub und Unrat über den Boden. Seltsam, dachte die Geweihte, die Wache steht vor der Tür des Wehrturms, als wolle sie verhindern, dass jemand das Bollwerk verlässt. Gerüchte, dass der Baron von Aare ein Wüstling war, hatten auch ihre Klause erreicht. Wollte Hinrich ein junges Ding zur Heirat zwingen? Niemals würde sie einer solchen Verbindung ihren Segen erteilen.
Der Soldat zeigte auf die Holztreppe im Innern der Halle, die zu den Schlafräumen führte. Die Treppe konnte im Falle eines Angriffs nach oben gezogen werden. Als die alte Geweihte die Stufen hochstieg, sah sie im Licht weniger Fackeln, dass zwischen den umgeworfenen Stühlen und Tischen Ratten und Spinnen auf dem Boden der Halle wimmelten.
»Hierher!«, hörte sie die Stimme einer Frau, als sie den oberen Treppenabsatz erreichte.
In der von blakenden Kerzen erleuchteten Kemenate saß ein Mann mit schütterem, fahlen Haar und eingefallenen Wangen auf dem Bett, den Rücken gegen ein paar Kissen gelehnt. Ein Flackern der Augenlider war die einzige Reaktion auf ihr Eintreten. Das weiße Hemd war voller roter und gelber Flecken. War das der stolze Baron von Aare?
»Bist du die Traviageweihte?« Aus dem Schatten neben dem Bett trat eine Frau mit roten Locken, die ganz in wollüstiges Schwarz gekleidet war.
Ein seltsames Hochzeitsgewand, dachte die alte Geweihte. »Ja!«, antwortete sie. »Wer ist der glückliche Bräutigam?«
Die Frau vor ihr zeigte auf den Baron. »Und ich bin Hatisha, Hatisha von Aare in wenigen Minuten.«
»Ich glaube nicht, dass dieser Mann in der Lage ist, den Traviabund einzugehen. Er kann wohl kaum ermessen, was das bedeutet.«
»Er kann.« Hatisha sprach gefährlich leise. »Und du wirst uns verheiraten.«
Wieder so eine ehrgeizige junge Frau, die sich mit einem schwachsinnigen Greis vermählen lassen wollte, um ein reiches Erbe anzutreten. Das war kaum traviagefällig. Die Geweihte drehte sich um und wollte ohne ein weiteres Wort die Kemenate verlassen. Erschrocken blickte sie in ein gehörntes Wolfsgesicht. Das mannshohe, silberpelzige Wesen füllte den Türrahmen ganz aus.
»Du wirst«, wiederholte Hatisha hinter ihr. »Und dann bestätige den Traviabund mit deinem Siegel im Familienbuch meines geliebten Mannes.«
Der Traviageweihten lief es kalt den Rücken herunter. Niederhöllische Kräfte waren hier im Spiel. Dass sie hier einen leibhaftigen Dämon vor sich hatte, war ihr sofort klar geworden.
»Nein!« Noch einmal lehnte sich die Geweihte auf.
»Nein?«, wiederholte die schreckliche Frau in Schwarz. »Madayraeel wird dich zu überzeugen wissen.«
Als ihr die riesige Silberwölfin die Zähne in den Oberarm grub, schrie die Traviageweihte gellend auf. Wie eine Puppe schob die Dämonin die Alte vor das Bett.
Nach der freudlosen Zeremonie sorgte Hatisha dafür, dass die Geweihte keiner Seele von ihrer niederhöllischen Dienerin erzählen konnte. Hinrich saß unverändert auf dem Bett, als sie wiederkam. Ein Speichelfaden hing aus deinem Mundwinkel, Kerzenschein tanzte auf dem fahlgrauen Gesicht.
»Habe ich dir bisher gut gedient?«
Hatisha konnte nicht sagen, ob Madayraeel die Worte sprach oder nur in ihrem Kopf erklingen ließ. »Ja«, flüsterte sie. In ihrer Stimme schwang Furcht mit, denn sie ahnte, was jetzt kommen würde. Nachdem der Rachedurst gestillt war, war sie nicht mehr sicher, ob sie den Preis dafür zu zahlen bereit war. »Was willst du für deine Dienste, Madayraeel?«
Die Silberwölfin bewegte das Maul nicht, als sie antwortete. Wie sollte sie mit den schrecklichen Zähnen auch verständliche Laute artikulieren? »Deine Seele! Wenn es an der Zeit ist, werde ich sie mit in die Niederhöllen nehmen. Ritze die Haut an deinem Unterarm!«
Hatisha tat wie ihr geheißen. Ein dünnes, rotes Rinnsal quoll hervor und lief in die Handfläche, die sie Madayraeel entgegenhielt. Die Dämonin leckte das Blut von der weißen Haut Hatishas.
»Unser Pakt ist besiegelt. Nun wirst du dich nirgends auf Dere vor mir verstecken können.« Die Dämonin machte eine Pause, damit ihre Worte besser wirkten. »Und nun befiehl, wie ich dir dienen kann, Paktiererin!«
»Lass diesen da verschwinden. Weiter weg, als ein Mann auf einem guten Pferd in einer Nacht reiten kann.«
»Ja, Herrin, alles, was du willst«, antwortete Madayraeel, wobei sie dieser Anrede einen süffisanten Klang zu geben vermochte.
Kaum war die fünfgehörnte Dämonin aus dem Zimmer verschwunden, durchfuhr ein heißer Schmerz Hatishas Unterleib und Gesicht. »Was ist das? Beim Namenlosen, was ist das?«, keuchte sie und fiel auf die Knie.
Kapitel 2
8. Hesinde 348 v. BF. – 22 Tage bis zu Madas Neugeburt
»Ein Mann und eine Frau kommen«, murmelte die Paktiererin. Das fahle Licht in der Kammer ging von der Kristallkugel auf dem kleinen Tisch aus. »Die Frau trägt Medizin bei sich – eine Heilerin.« Sie ließ sich von dem fauchenden Atem, der aus der Dunkelheit hinter ihr zu hören war, nicht ablenken. Nur der Schwarzbär, der vor ihr kniete, versuchte etwas von der Dämonin zu sehen, die mehr als die Hälfte seiner Kameraden zerrissen hatte.
»Der Mann ist nur ein Bauer, ein Bauer mit einem Schwert. Er hat schon einmal Männer in den Kampf geführt«, sagte sie leise. »Aber ein Bauer kann dir nicht gefährlich werden.«
Der Bärnickte. In den vergangenen Jahren hatte die Paktiererin oft in ihre Kugel geblickt. So war ihr nicht verborgen geblieben, dass sich ein Freiherr im Westen auf Befehl seines Fürsten die Vorgänge im Aaretal zunutze machen wollte, um seinen Herrschaftsbereich zu vergrößern. Der Plan, den seine Herrin entworfen hatte, um das zu verhindern, war wahnwitzig. Aber die Fünfgehörnte hatte Dinge vollbracht, die an Wunder grenzten. An grausame, unaussprechliche Wunder. Der Schwarzbär hatte längst begriffen, dass die Macht Madayraeels, geleitet von dem Hass und Zorn Hatishas, schier unbegrenzt war.
»Geh!«, befahl sie.
»Ja, Herrin!«, sagte der Bär.
Madayraeel blieb im Dunkeln verborgen. Ihr fauchender Atem steigerte sich mit jedem Herzschlag, den er zögerte, zu einem Grollen.
***
Der Winter war im Norden Andergasts wie immer überraschend gekommen. Am einen Tag war es noch nass und nebelig, am nächsten fegte Schnee über das Orkland heran und brachte Frost mit. Aber der Hesindemonat hatte in diesem Jahr auch einen Brief des Freiherrn von Waldsteyn an die Einödgrenze gebracht.
Beolf und Sidra, die Wehrsassen von Hohenhag, einem der Wehrhöfe, die die Grenze zum Orkland bewachten, hatten für den Winter vorgesorgt. Die Wehrmänner des Hofs, die Handwerker, Knechte, Mägde und Kinder waren gesund. Vorräte lagerten in den Kellern und Scheunen. Bier war gebraut worden, Met und Wein aus Brombeeren blubberten in großen Glasballons. In einem Ungetüm aus Kupfer und Eisen wurde ein Schnaps aus Getreide und Krammetsbeeren gebrannt, wie er von Nostria bis zum Herzogtum Weiden getrunken wurde. Sogar die Orken pflückten die Beeren der zypressenartigen Sträucher. Allerdings soffen die ihr Destillat samt Vor- und Nachlauf, was die häufigen Fälle von Blindheit und Schwachsinn bei manchen Sippen erklärte.
»Und ich hatte mich so sehr auf die Abende mit dem Spielmann gefreut«, sagte Sidra von Hohenhag, als sie ein paar Tage später neben ihrem Mann durch die klare Winterluft ritt. Der Boden war hart gefroren und der Schnee darauf nur einen Spann hoch. So kamen sie auf ihren robusten Warunkern gut durch den Tannenwald voran. Die Hufe der Pferde, Nachkommen von Fuchs und Firn, die sie vor so vielen Jahren als Gefangene der Orks erbeutet hatten, knirschten im Schnee. In diesem Jahr waren zum ersten Mal seit dem Wiederaufbau von Hohenhag ein paar Münzen übrig geblieben. Und die hatten sie verwendet, um einem Spielmann Brot, Bett und Salär zu bieten, der mit seinen Instrumenten, Liedern und Geschichten die langen Winterabende verkürzen sollte.
»Hauptsache, den Leuten wird nicht langweilig«, gab Beolf zurück. Die Leute mussten beschäftigt werden, damit sich keine Langeweile breitmachte – denn Langeweile führte zu Zank unter den Frauen und zu handfestem Streit unter den Männern. Und an der Grenze zu den Orklanden war kein Mann, der ein Schwert führen, und keine Frau, die einen Bogen spannen konnte, entbehrlich.
»Hoffentlich tanzen die Kinder dem guten Ulmward und seiner Freilinde nicht auf dem Kopf herum«, sagte Sidra. Sie hatten die Kinder am Morgen in der Obhut des ersten Wehrmanns und seiner Frau zurückgelassen.
Beolf und Sidra, die als Halbwüchsige von den Orken der Mardyrch entführt worden waren, hatten lange um ihre Liebe kämpfen müssen. Viele Jahre hatten sie damit zugebracht, den niedergebrannten Wehrhof wieder aufzubauen. In dieser Zeit war auch die Legende von der Unsichtbaren Rotte entstanden.
»Ich schätze, wenn wir zurückkommen, schießt Ulfried mit dem Bogen so gut wie Waltram«, lachte Beolf. »Dafür wird Ulmward schon sorgen.«
Die Kinder Beolfs und Sidras waren nach dem Kampf gegen die Goblinhorden Naaba Nargas zur Welt gekommen. Sie waren, wie alle Kinder an der Grenze zu den Orklanden, sehr reif für ihr Alter. Daher hatte es den Eltern auch keine allzu großen Sorgen bereitet, sie für ein paar Wochen in der Obhut des ersten Wehrmanns zu lassen, denn der Brief Nymmirs hatte sie so bald wie möglich zur Burg Waldsteyn gerufen. Der Rat des im Kriegshandwerk erfahrenen Wehrsassen werde erbeten, außerdem seien die Heilkünste Sidras von Nöten. Zwar versetzte es Sidra einen Stich, dass nicht auch sie als Kriegerin geladen worden war, denn sie schoss mit dem Reiterbogen ebenso sicher wie ihr Mann, und auch mit dem Schwert verstand sie sich Respekt zu verschaffen. Doch all das war in Andergast bei Frauen nicht gern gesehen, und es zeugte von der Wertschätzung des Freiherrn gegenüber den jüngeren Wehrsassen, dass er seine Wünsche in Form einer Bitte übermittelte. Außerdem hatte es Sidra in den letzten Jahren mehr Befriedigung verschafft, Wunden zu schließen und Krankheiten zu heilen, als einen Kampf mit der Waffe zu bestehen.
»Hast du deine Medizin dabei?«, fragte Beolf. Er saß aufrecht und leicht im Sattel. Mit seinen vierzig Jahren befand er sich im besten Mannesalter. Sein breites Kreuz und die sehnigen Arme zeugten von Kraft und Ausdauer, das Braun seines lockigen Haares zeigte noch keine grauen Strähnen, das Gesicht mit den ebenfalls braunen Augen und den Grübchen zeugte von Humor und Selbstsicherheit. Er sah über die Schulter und betrachtete seine Frau, die wie er in einfachen, aber haltbaren Kleidern steckte. Auch sie trug Hosen, was für Frauen im sittenstrengen Andergast ungewöhnlich war. Die wattierten Beinkleider waren aus Hirschleder, das bei dieser Kälte zwar am Sattelzeug knirschte, aber nicht brüchig wurde. Auch die Mäntel, die sie über mehreren Schichten von auf Hohenhag gesponnener Wolle trugen, waren von einer Machart, die viele Jahre überstand.
»Hast du mich außerhalb von Hohenhag je ohne meine Tasche gesehen?«, fragte Sidra zurück. Die ersten Lektionen in Heilkunst hatte sie von ihrer alten Amme Helke erhalten, und während der Sklavenzeit hatte sie wertvolles Wissen bei einem Rikai-Schamanen gesammelt. In ihren Satteltaschen befanden sich außerdem Tiegel mit mazerierten Arnikablüten und Beutel mit getrocknetem Beinwurz, Ehrenpreis und Sanguinaria. Sogar zwei getrocknete Arganwurzeln, die ein dunkelhäutiger Händler aus dem Süden als wirksames Wundheilmittel angepriesen hatte, waren dabei. Und natürlich die unentbehrlichen Früchte der vierblättrigen Einbeere. Gedörrt und im Mörser zu Pulver zerrieben, stillte die Medizin Blutungen fast ebenso schnell wie frisch gesammelte Beeren.
In seinem Brief hatte Nymmir angedeutet, dass es auf der Burg und den umliegenden Höfen mehrere Fälle schlecht verheilender Wunden gebe. Insbesondere das Sanguinaria, das gemeinhin als Vogelknöterich bekannt war, hatte sich in solchen Fällen neben der Einbeere bewährt.
Fast gleichzeitig hielten sie ihre Pferde auf dem schmalen Waldweg an, als vor ihnen ein Knacken erklang. Die Pferde hatten die Ohren aufgestellt und nach vorne gerichtet. Innerhalb weniger Herzschläge hatten Beolf und Sidra die Reiterbögen aus den Lederköchern gezogen und die Sehnen eingehakt. Bereit, sofort auf das Ziel anzulegen, hielten sie die Pfeile zwischen Mittel- und Zeigefinger am Nockpunkt der Sehne. Während Sidra nach links spähte, hielt Beolf nach rechts Ausschau.
»Warte hier, ich reite voraus!«, flüsterte er.
Sidra nickte, und Beolf trieb den Rappen Frans nur mit dem Druck seiner Schenkel an, um beide Hände für den Bogen frei zu haben. Aber kein Feind zeigte sich. Vielleicht war es ein Vielfraß gewesen, oder ein Dachs, der von der Morgendämmerung überrascht worden war. Dennoch konnte man nicht vorsichtig genug sein. Die Orksippen, die mit ihren riesigen Karren durch die kaum zwanzig Meilen entfernte Steppe des Orklands zogen, waren zwar schon längst in ihren Winterlagern, aber es konnte sein, dass sich ein paar Yurach, verstoßene Orks, in der Gegend herumtrieben, auf der Suche nach etwas Essbarem.
Beolfs Blick fiel auf eine Eiche, deren Stamm sich nur drei Spann über dem Boden teilte. Er lachte und ritt noch ein kurzes Stück weiter, bis er eine dichte Wand aus Wacholderbüschen umrundete. Zur Rechten sah er, nun schon einige hundert Schritt entfernt, einen Karren, der von einem mächtigen Tralloper nach Anderstein gezogen wurde. In die andere Richtung führte die Straße an Dorf und Burg Waldsteyn vorbei nach Andrafall, und weiter bis nach Andergast, der Hauptstadt des Fürstentums, dessen Herren schon so lange um die Anerkennung ihres Königtums kämpften. Sidra und er waren so in ihr Gespräch vertieft gewesen, dass sie nicht bemerkt hatten, wie nah sie der Straße schon gekommen waren. Beolf drehte sich im Sattel um, steckte zwei Finger in den Mund und pfiff den Lockruf eines Heckenschmätzers. Nur Augenblicke später erschien Sidra auf ihrer Warunkerstute Frea.
Als sie mit jungen Männern und Frauen der Wehrhöfe Hagdorn und Wallhof gegen die immer häufiger einfallenden Orkenbanden gezogen waren, hatten sich Legenden um die Unsichtbare Rotte gebildet. Beolf und Sidra hatten gelernt, wie die Orks kämpften, und durch dieses Wissen war ihnen eine Reihe von Schlägen gelungen, die den Orken für Jahre die Lust auf weitere Überfälle vergällte. Dabei hatten sie sich über ein ausgeklügeltes System von Tierrufen verständigt. Sidra hatte nicht verlernt, was die einzelnen Rufe bedeuteten.
Als er sie nun betrachtete, während sie sich lächelnd näherte, kam Beolf der Gedanke, dass er das viel zu selten tat: seine Frau aus der Ferne zu betrachten. Meist war zwischen ihnen kaum Platz genug für ein Blatt Pergament. Ist das der Grund, warum manchmal andere Frauen begehrenswerter erscheinen?, ging es Beolf durch den Kopf. Denn einer fremden Frau konnte er ja nicht in geziemender Weise so nah kommen, dass er an ihr die Falten und Fehler erkannte, die er im Laufe der Jahre bei seiner eigenen Frau entdeckt hatte. Bei gebührendem Abstand konnte ja nur wirken, was die fremde Frau begehrenswert machte.
Klang das nicht verrückt? Wurde er jetzt vom Krieger zum Philosophen? Der Abstand sollte einem Mann die eigene Frau wieder begehrenswert machen? Bei Sidra war das jedenfalls nicht nötig. Wie schaffte sie es nur, mit vierzig Jahren immer noch so rank und schlank zu erscheinen? Sie saß federleicht im Sattel. Mit ihrem langen, goldblonden Haar, dem schmalen Gesicht, den feinen Zügen und grünen Augen hätte sie auch ein Elfenweib sein können. Die gepunzte Lederkleidung und der lange Bogen aus poliertem Holz mit dem kunstvoll geflochtenen Lederhandstück trugen zu diesem Eindruck bei. Sie schenkte ihm ein unbekümmertes Lachen. Ihre makellosen Zähne, eine Seltenheit an der Grenze zur Einöde, blitzten auf, als sie ihren Bogen verstaute. In diesem Moment wusste er, dass er nie eine andere Frau lieben würde. Zu schade, dass er nicht die Worte fand, ihr das zu sagen.
Eine halbe Stunde später kamen sie an eine Wegkreuzung. Nach rechts führte der Weg zum Steineichenwald, an dessen Ausläufern die Ruinen einer Spelunke namens Wurmschatten lagen. Nach links ging es auf das vor wenigen Jahren entstandene Dorf Waldsteyn zu. Noch jünger war der Galgen, der an der Kreuzung errichtet worden war. Und es war das erste Mal, dass Beolf und Sidra einen Mörder daran baumeln sahen. Als sie näher kamen, erkannten sie zu ihrer Erleichterung, dass dort kein Mensch hing, sondern ein Wolf. Ein grauer Wolf mit einem markanten schwarzen Band um den Hals.
»Wer hängt denn hier einen Wolf hin?«, fragte Beolf mehr sich selbst.
»Auf, nicht hin«, sagte Sidra. Sie hielten die Pferde an. »Dieser Wolf ist gehenkt worden wie ein gemeiner Mörder. Sieh dir die schwarze Zunge an – und die Augen sind aus den Höhlen getreten. Sonst scheint er nicht verletzt zu sein.« Ein Schauer lief über Sidras Rücken, denn in der Abenddämmerung bot der gehenkte Wolf einen grausigen Anblick.
»Doch, am rechten Vorderlauf.« Beolf zeigte auf die Pfote, die auf Augenhöhe vor ihnen baumelte. »Ist wahrscheinlich in ein Eisen geraten. Aber wer ist auf die Idee gekommen, das Tier hier aufzuhängen?«
»Vielleicht kann man uns diese Frage im Dorf beantworten. Lass uns weiterreiten!« Sidra konnte den Anblick der scheinbar grundlos gequälten Kreatur nicht ertragen.
Sie ließen die Ausläufer des endlosen Steineichenwalds, in dem sie in den vergangenen Jahren so manche Gefahr überstanden hatten, hinter sich. Bald kam das neu gegründete Dorf Waldsteyn, zu dem immerhin schon eine Schmiede und eine Eselsmühle gehörten, in Sicht, und sie ritten zwischen umzäunten Viehweiden und Äckern hindurch, deren Furchen vom Schnee geglättet worden waren. Das Land um die Burg war immer weiter gerodet worden, bis sich die Söhne und Töchter von Handwerkern, Händlern und Bauern aus Anderstein und Andrafall entschlossen hatten, hier zu leben.
»Den Zwölfen zum Gruße, Horward!«, rief Sidra, als sie zu der offenen Dorfschmiede ritten.
Mägde und Burschen grüßten Sidra und Beolf, denn jeder kannte eine der Geschichten über den Wehrsassen von Hohenhag und seine Frau, die mit jedem Jahr schöner wurde.
Beolf, der als Halbwüchsiger bei einem Schmied sein Handwerk gelernt hatte, war schon ein paar Mal mit dem bärtigen, untersetzten Mann ins Gespräch gekommen. »Ist Ingerimm deinem Werk gewogen, Horward?«, fragte er.
»Ich glaube schon! Zum Gruße«, erwiderte der Schmied und schob zwei Werkstücke an den Rand der Glut, damit sie nicht zu heiß wurden.
Als das Knirschen der Hufe im Schnee verstummt war, hörten sie Waffengeklirr. Das konnten nur übende Soldaten sein, denn bei einem Angriff Nostrias, mit dem Andergast nun seit über hundert Praiosläufen im Krieg lag, wären die Dorfbewohner wohl kaum so seelenruhig ihrer Arbeit nachgegangen.
»Hat Rittmeister von Wasgenstein seine Leute hochgescheucht, damit sie über den Winter nicht fett werden, Barsina?«, rief Beolf der Frau des Schmieds zu, die gerade mit Wasser vom Brunnen kam.
»Nein, das sind die Söldner aus Weiden«, antwortete die kleingewachsene Frau. »Unter Generalissimus Wulfrab von Bistingen. Nehmt Euch vor ihm in Acht, Wehrsassin, er jagt Schürzen so erfolgreich wie der Fuchs die Hühner im Stall!«
»Danke, ich werde mich vorsehen!«, gab Sidra zurück.
»Ein Generalissimus.« Beolf schob die Unterlippe vor. »Über wie viele Hundertschaften verfügt er denn?«
»Ach was, Hundertschaften!« Der Schmied war hinter seiner Esse hervorgekommen. »Zwölf oder dreizehn Mann, ein Haufen Lumpe und Habenichtse. Aber fechten können sie, besonders dieser Bistinger.«
»Und die lassen sich nach Andergast locken? Im Svelltschen Städtebund lässt sich für Korsjünger doch wohl mehr gutes Gold machen«, sagte Beolf.
»Davon weiß ich nichts«, sagte Horward. »Aber mit dem Generalissimus würde ich mich nicht im Armdrücken messen wollen.«
Unwillkürlich musterten Beolf und Sidra die mächtigen Oberarme des Schmieds, der trotz der Kälte nur seine lederne Schürze vor dem Leib trug.
»Jetzt hast du mich neugierig auf diesen Generalissimus gemacht, Horward«, sagte Beolf und wandte sich Sidra zu. »Ob diese Söldner aus dem gleichen Grund hier sind wie wir? Was meinst du?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Wir werden es bald wissen.« Dann fiel ihr ein, was sie im Dorf in Erfahrung bringen wollten. »Warum wurde an der Wegkreuzung ein Wolf erhängt?«
Der Schmied druckste ein wenig herum. »Also … dieser Wolf schlich schon ein paar Tage um Dorf und Burg herum.«
»Und? Wölfe schießt man mit Pfeil und Bogen, oder man erschlägt sie«, warf Beolf ein.
»Ein paar Leute haben gesehen, wie er erst einen der Söldner – einen schwarzhaarigen Riesen – und dann den Generalissimus angefallen hat«, erzählte der Schmied. »Dabei hat er sich aufgerichtet, als sei er ein Mann. Der Bistinger hat mit dem Wolf gekämpft wie ein Ringer. Als er ihn von sich schleuderte, zog er mit geknickter Rute ab. Einen Tag später ging er dem Sohn des Schultheißen ins Eisen. Und weil die Leute ihn aufrecht kämpfend gesehen haben, sollte er verurteilt werden wie ein Mann.«
»Und das hat Nymmir mitgemacht?« Beolf wusste, dass der Freiherr über solchen Aberglauben lachte.
»Wo denkt ihr hin, Wehrsasse?«, fuhr der Schmied fort. »Zeugen gab es genug, und so haben der Schultheiß und zwei der Ältesten ihn verurteilt. Zum Tod durch Erhängen.« Er sah wohl die Zweifel im Gesicht Beolfs. »Der Wirt des Drachenschweifs hat als Anwalt um Gnade gebeten. Es ist also alles rechtmäßig verlaufen!«
Beolf hielt nichts davon, dass Nymmir die untere Gerichtsbarkeit auf die Schultheißen seiner Dörfer übertragen hatte. Was, wenn Männer wie der Schultheiß, ein tüchtiger Bauer, der aber nicht viel von der Welt gesehen hatte, eine Frau vor Gericht zum Tode verurteilten, nur weil ein Feuermal sie als angebliche Hexe auswies?
»Könntet ihr damit leben, einen Menschen aus Aberglaube getötet zu haben?«, sagte Beolf, der sicher war, dass am Galgen nichts weiter als ein Wolf hing.
»Warum Aberglaube?«, fragte der Schmied. Wie die meisten Leute vom Lande ließ er sich nur ungern seine Überzeugungen ausreden. »In Andrafall stand einmal ein Schwein vor Gericht, das einem Jungen das Genick …«
»Ist schon gut«, sagte Beolf.
»Habt ihr hier im Dorf Verletzte mit schlecht verheilenden Wunden?«, fragte Sidra. »Nymmir von Waldsteyn hat deshalb nach mir geschickt.«
»Aber ja! Der Müller ist von einem riesigen Wolf angefallen worden«, berichtete nun Barsina. »Und seine Wunden schlossen sich selbst dann nicht, als Mutter Nelda sie behandelt hatte. Dabei kommen Wölfe doch nicht so nah an die Dörfer heran.«
»Der Wolf, der da am Galgen hängt, aber schon«, sagte Beolf.
»Jedenfalls hat Nelda ihn in das Hospital geschickt, das Nymmir auf der Burg hat einrichten lassen«, fuhr Barsina fort.
»Ein Hospital?«, entfuhr es Sidra. »Wie viele Verletzte sind denn auf der Burg?«
»Es muss mittlerweile ein Dutzend sein. Dazu kommen noch ein paar Kranke auf den Einsiedelhöfen. Und Mutter Nelda ist nicht mehr die Jüngste.«
»Ein Dutzend!«, rief Sidra.
»Und dabei sind schon ein paar gestorben«, sagte Horward. »Nachdem sie mit Schaum vor dem Mund um sich geschlagen haben, sodass man sie an ihren Lagern festgebunden hat.«
»Und all diese Leute wurden von Wölfen angefallen?«, fragte Beolf.
»Alle, die noch sprechen konnten, haben von einem oder zwei Mannwölfen berichtet«, sagte Horward. »Und deshalb haben wir den Wolf, der am Wegkreuz hängt, ordentlich verurteilt. Für den Fall, dass in seinem Innern ein Mensch wohnt.«
Beolf und Sidra sahen einander an. In diesem Licht betrachtet, war es nur allzu verständlich, was die Dorfbewohner mit dem gefangenen Wolf gemacht hatten.
»Ingerimms Segen für dein Tagwerk, Horward!«, sagte Beolf.
Als sie das Dorf hinter sich gelassen hatten, wurde der Waffenlärm immer lauter. Und kaum hatten sie eine dichte Gruppe von Schlafthujen umrundet, sahen sie die kämpfenden Männer vor sich. Sechs Paare standen in Reih und Glied und hieben gleichzeitig und in genau festgelegter Abfolge aufeinander ein. Die untergehende Sonne blitzte auf den wirbelnden Klingen. Neben der Gruppe stand ein Hüne von zwei Schritt Größe, der sich trotz seines schneeweißen Haars ebenso schnell bewegte. Das musste der Generalissimus sein, von dem der Schmied gesprochen hatte. Wenn auch ohne Gegner, so vollführte er mit seinem Anderthalbhänder die Häue und Legen so schnell wie seine Männer mit ihren Einhändern. Dazu rief er die Namen der einzelnen Häue: »Ochs, Flur, Seit, Pflug, Flegel und wieder Ochs! Wechsel!« Selbst nach dem vierten Durchgang geriet er nicht außer Atem.
Die Fechter in der Defensive antworteten mit den passenden Paraden, wobei sie bei jeder abgewehrten Attacke einen Schritt zurückwichen. Nach sechs Häuen wechselten die Seiten, und die Angreifer von eben wehrten nun die Attacken in ebensolchem Gleichmaß ab. Unter ihren stampfenden Schritten kam die Grasnarbe zum Vorschein.
Sidra und Beolf bewunderten dieses Schauspiel militärischer Präzision. Die Söldner waren tatsächlich in ein buntes Sammelsurium aus verschlissenen und geflickten Leder- und Wollsachen gekleidet. Einer der Männer, schwarzhaarig und wohl über hundert Stein schwer, tat sich bei den Übungen besonders hervor. Sein Gegner, kleiner und hager, stöhnte bei jeder Parade.
»Irgendetwas scheint mir an diesem bunten Haufen nicht zusammenzupassen«, sagte Beolf.
Sidra nickte. »Ich weiß, was du meinst, aber ich kann selbst nicht sagen, was es ist.«
Sie schwiegen eine Weile und versuchten jeder für sich herauszufinden, was ihnen hier ungereimt vorkam.
»Mit dem Generalissimus würde ich mich auch nicht im Armdrücken messen wollen«, sagte Beolf endlich. »Und ebenso wenig mit diesem schwarzhaarigen Söldner. Gleich rammt er seinen Gegner in den Boden.« Er sah zu seiner Frau hinüber. »Pass auf, Sidra!«, rief er und lachte, »sonst bekommt Frea einen Blähbauch.«
Die Stute knabberte an den Zweigen der Schlafthujen. Vor zwei Jahren hatte Freas Mutter von dem duftenden Gewächs nicht lassen können und war danach tagelang so laut furzend über die Weide gelaufen, dass sich die anderen Pferde erschreckt hatten. Sidra beeilte sich, die gescheckte Stute ein paar Schritte von den Büschen fortzutreiben.
Beolfs Warnruf hatte den Söldnerführer auf sie aufmerksam gemacht, und er sah zu ihnen herüber. Dabei stellten sie fest, dass sein Gesicht überraschend jung wirkte und so gar nicht zu dem schlohweißen Haar passte. »Schluss!«, hörten sie ihn rufen, als er sich seinen Leuten zuwandte. Er gab weitere Befehle, und die Reihe der Übenden zog sich auseinander. Der hagere, braunlockige Gegner des kräftigen Söldners trug einen großen Tonkrug herum, aus dem die Männer reihum tranken.
»Und los!«, war das nächste, was sie hörten. Fünf neue Paare begannen aufeinander einzuschlagen und freien Kampf zu üben, wobei ihre Häue natürlich nur den gepolsterten und durch Kettenhemden und Lederbrünnen geschützten Körperteilen galten. Die zwei verbleibenden Söldner, unter ihnen der Hagere, der das Wasser verteilt hatte, stellten sich dem Generalissimus.
»Ein Schaukampf«, sagte Beolf. Nicht selten präsentierten Söldner ihre Fähigkeiten so einem potenziellen Dienstherrn. Der Hüne verstand es hervorragend, die auf ihn einprasselnden Hiebe zu parieren, wobei die Abfolge der Häue natürlich bereits feststand.
»Der hat sein Handwerk gelernt«, musste Sidra zugeben, denn trotz der heftig klirrenden Schläge schaffte er es, die Deckung des größeren Gegners zu durchbrechen und ihm mit dem Ellbogen einen Stoß in die Magengrube zu versetzen. Während der Mann zu Boden ging und sich beide Hände vor den Bauch hielt, täuschte der weißhaarige Bistinger eine Attacke an. Es gelang ihm, die Parierstange des hageren Gegners mit der seinen zu verhaken. Mit Bärenkräften drehte er ihm die Waffe aus der Hand. Der Hüne ließ die Spitze des langen Anderthalbhänders vor die Kehle des Hageren zucken.
»Schluss für heute!«, rief der Generalissimus. Mit langsamen Bewegungen erklärte er dem entwaffneten Gegner die Finte und wie er hätte verhindern können, dass ihm sein Schwert aus der Hand gehebelt wurde. Er nahm den Lederschlauch vom Waffengestell, half dem ersten Gegner, der sich immer noch den Bauch rieb, auf die Beine. Dann machte der Weinschlauch die Runde, und auch der Bistinger schüttete sich den Wein in hohem Bogen in den Mund.
»Scheint kein übler Kerl zu sein«, sagte Sidra.
»Zumindest lässt er seine Leute nicht alleine schwitzen. Aber nun lass uns weiterreiten, es ist gleich dunkel. Der Mann wird dir noch früh genug vorgestellt werden.« Beolf feixte, als sich eine Zornesfalte zwischen Sidras Augenbrauen zeigte.
»Und du kannst es wohl nicht erwarten, mit dieser Truppe aufs Rondrafeld zu ziehen, was?«, hielt sie ihm entgegen, während sie ihre Pferde auf Burg Waldsteyn zugehen ließen.
»Unsinn!« Beolf tat empört, obwohl er wusste, dass er vor Sidra nichts verbergen konnte.
Tatsächlich lag es nun drei Monate zurück, dachte er wehmütig, dass er sein letztes Abenteuer zu bestehen hatte. Er war unterwegs auf einem Jagdausflug mit Sidra, drei Wehrmännern und deren Frauen gewesen, als ihnen fünf Yurach begegneten, die den Wehrhof Hagdorn ausgespäht hatten. Der Kampf war kurz gewesen, denn die verstoßenen Orken hatten seit Tagen nichts in die pelzigen Bäuche bekommen.
»Wehrsassin, Ihr vergesst, dass das zu meinen Pflichten als Hüter der Grenze gehört!« Beolf hatte das Kreuz durchgedrückt, um auf Sidra herabzublicken.
»Eine Pflicht, die du genießt, nicht wahr? Weil du so dein altes Weib und die lärmenden Kinder hinter dir lassen kannst.«
»Nun, wenn du es ja schon weißt …«
Sie grinsten einander an, während hinter ihnen die Sonne am westlichen Himmel rot glühend versank.
»Ob du es glaubst oder nicht«, fuhr Beolf fort, »ich freue mich auf den Besuch bei Nymmir. Gut essen und noch besser trinken werde ich, während du deine Krankenbesuche machst.« Hatte er das gerade wirklich gesagt? War er schon so alt, dass er ein warmes Feuer und einen reichlich gedeckten Tisch einem handfesten Abenteuer vorzog? Auch Sidra blickte ihn ungläubig an.
Das noch mehr als halbvolle Madamal stand zwar schon am Himmel, aber die Praiosscheibe warf dennoch lange Schatten, als sie auf das offen stehende Burgtor zuritten. Keine Seele war auf dem Hof der vor zwei Jahren vergrößerten Burg zu sehen. Der neue Donjon ragte drei Stockwerke höher neben dem alten Wehrturm in die Höhe, verbunden durch einen Palas mit den Räumen Nymmirs und seiner jungen Frau und den Gästeräumen. Die Mauern glühten im Licht der Sonne, die hinter ihnen versank.
Dass der Burghof menschenleer war, machte Sidra und Beolf misstrauisch. Um diese Zeit eilten sonst Handwerker, Knechte, Mägde und Stallburschen zwischen den verschiedenen Gebäuden hin und her. Aber nicht einmal die Hofhunde waren zu sehen.
»Waldsteyner!«, rief Beolf und hielt Frans an.
Eine Remise, die sich unterhalb des Wehrgangs an den nördlichen Burgwall zu ihrer Linken duckte, war mit Strohballen wie mit riesigen Bausteinen zugemauert worden. Ein Vorhang aus Wagenplanen bot einen Durchgang ins Innere. Die gefetteten Lederbahnen teilten sich, und heraus kam eine Gestalt, wie sie sich Beolf und Sidra in ihren schlimmsten Albträumen nicht hätten vorstellen können. Das Wesen ging aufrecht, war gut neun Spann groß und hatte das behaarte Gesicht eines Wolfs. Sein Wams war dunkelrot, als hätte es bereits blutige Taten gesehen. Gleichzeitig zogen sie ihre Schwerter.
Der Wolfsgesichtige blieb stehen und hielt die Nase witternd in die Luft. Ob dieses Ungeheuer dafür gesorgt hat, dass die Burg völlig entvölkert ist?, überlegte Beolf.
Einen Moment lang starrten sie einander an, weiße Atemwolken vor den Gesichtern. In den Augen der Gestalt zeigte sich Erschrecken und Schuld. Dann erkannten sie, dass die Züge des Wesens unter den Haaren durchaus menschlich waren. Es hatte eine überraschend kleine Nase, hohe Wangenknochen und Ohrmuscheln, die beinahe unbehaart waren.
Der lederne Vorhang teilt sich abermals, und zwei kaum weniger bizarre Gestalten kamen hervor. Der Mann, der vielleicht noch ein paar Halbfinger größer war als der Wolfsgesichtige, dafür hager wie eine Bohnenstange, fletschte riesige Zähne und hob einen Arm mit einer abnorm großen Hand. Er hatte schütteres graues Haar und mochte schon mehr als fünfzig Sommer gesehen haben. Mit dem anderen Arm stützte er eine Frau, die sich so eng an ihn hielt, als sei sie mit ihm verwachsen. Sie ging unsicher auf seltsam kleinen Füßen, die in Bundschuhen steckten. Als sie stolperte und einen Arm ausstreckte, sahen Beolf und Sidra, dass sie keine Finger hatte. Die beiden blieben neben dem Wolfsgesichtigen stehen und starrten sie an, bis eine weitere ungewöhnliche Gestalt hinter ihnen erschien.
Es war eine Frau, aber Beolf hätte nicht sagen können, woran er das erkannte, denn ihre Schultern waren so breit wie die eines Holzfällers, ihre Haare kurz geschoren, und das Gesicht mit den hohen Wangenknochen wirkte hart und kantig. Auch sie schien nicht sicher auf den Beinen zu sein. »Is’n hier l…los?«, stieß sie hervor, und eine weitere weibliche Stimme hinter dem Ledervorhang erklang.
»Dylga, so bleib doch, du hast schon wieder deinen Text nicht …« Die Stimme brach resigniert ab, dann teilte sich der Vorhang ein letztes Mal, und eine rothaarige Frau in einem schwarzen Lederkleid kam hinter der Mauer aus Strohballen hervor. Das Kleid war hochgeschlossen, dabei in der Taille so eng geschnürt, dass es zugleich züchtig und aufreizend wirkte.
»Nun erschreckt die Gäste des Freiherrn nicht!«, sagte sie in vorwurfsvollem Ton. »Falber, Linje, geht wieder hinein. Kommt! Dylga, du auch!«
Der hagere Mann, Falber, fletschte noch einmal die Zähne, was man mit gutem Willen auch als Grinsen erkennen konnte, und half dann der Frau ohne Finger und Zehen hinter den Vorhang. Das Mannweib folgte ihnen schwankend.
Die rothaarige Frau kam mit übertriebenem Hüftschwung auf Sidra und Beolf zu, die ihre Schwerter nun wegsteckten. Die bedrohliche Stimmung war verflogen, denn die Torwache war inzwischen vom Abtritt gekommen und auf ihren Posten geeilt. Zwei Stalljungen, die sich gegenseitig die Mützen vom Kopf stießen, überquerten den schneebedeckten Hof.
Die Frau in dem schwarzen Kleid legte dem Wolfsmenschen eine Hand auf die Schulter. »Barl hier ist nichts weiter als eine Laune der Natur«, erklärte sie. Ihre prächtigen Locken fielen ihr bis auf den Rücken. Barl, der Wolfsgesichtige, wand sich aus ihrer Umarmung, und sie kam bis auf zwei Schritt heran. Im schwindenden Licht schien ihr Gesicht unnatürlich weiß zu sein, aber unter der dicken Schicht von Reispuder verbarg sich ein Karomuster aus feinen roten Linien. Eine solche Tätowierung hatten weder Beolf noch Sidra je zuvor gesehen.
»Mein Name ist Gangräne«, stellte sie sich vor. »Und ich gehöre wie der gute Barl«, sie drehte sich zu dem Wolfsgesichtigen um, der nun lächelnd weiße Zähne entblößte, die beinahe so regelmäßig wie die Sidras waren, »wie Linje Glattwasser und Falber Bruchfold zu den Sagenhaften Kreaturen von Wolfsheim. Ebenso Dylga Virago von Erlengrund. Der großmütige Nymmir von Waldsteyn hat uns ein Winterquartier angeboten.« Gangräne verbeugte sich, Barl tat es ihr mit schauspielerischer Übertreibung gleich.
»Den Zwölfen zum Gruße!«, sagte Beolf, der als Erster die Fassung wiedergewann.
»Den Zwölfen zum Gruße!«, sagte Sidra.
»Zum Gruße!«, riefen nun auch der hagere Mann mit den großen Zähnen und die fingerlose Frau, die noch einmal die Köpfe durch den Vorhang gesteckt hatten.
»Zum Gruße, zum Gruße! Verzeiht!«, hörten sie nun vom neuen Donjon her rufen, und sie drehten sich in den Sätteln um. Es war der dicke Gerwin Dobler, der auf sie zueilte. »Euer Ankommen war mir nicht gemeldet worden, ich bin untröstlich!« Von den wenigen Schritten schon außer Atem, blieb der Haushofmeister vor ihnen stehen. »Nymmir lässt sich entschuldigen … ah, ich sehe, Ihr habt die Spielleute schon kennengelernt. Die Sagenhaften Kreaturen sind schon eine bizarre Truppe, aber harmlos. Und nun kommt und wärmt Euch am Feuer!«
Kapitel 3
8. Hesinde 348 v. BF. – 22 Tage bis zu Madas Neugeburt
»Dieser Bauer – unterschätze ihn nicht.« Trotz der Dunkelheit, die erfüllt war vom Fauchen der unsichtbaren Dämonin, konnte der Schwarzbärerkennen, dass die Paktiererin die Stirn runzelte, als sie wieder in ihre Kristallkugel schaute.
»Und er hört auf sein Weib – das ist seltsam. Sie ist in der Lage, hinter die Dinge zu schauen. Dieser Bauer ist schlau genug, ihre Fähigkeit zu nutzen.«
Der Bär überlegte, wie seine Herrin sah, was diese Menschen dachten und warum sie so dachten.
»Du wirst die Freundschaft dieses Bauern erlangen. Und du wirst seinem Weib schöne Augen machen. Sie vermisst seit langem etwas, das der Bauer ihr nicht mehr gibt: Schöne Worte, Komplimente – das sollte dir nicht schwerfallen.«
Tatsächlich hatte der Schwarzbär es nie besonders schwer mit den Mägden und Bauerntöchtern gehabt. Sein einnehmendes Wesen, gepaart mit der Kraft und Sicherheit, die er ausstrahlte, machte die Weiber weich.
»Wirst du das schaffen?«, fragte Hatisha und sah ihn mit gefährlich blitzenden Augen an.
»Herrin, du weißt, ich begehre nur dich. Aber ich werde mich verstellen und dieser Grenzbäuerin den Hof machen«, sagte er.
***
Zwei Knechte nahmen Beolf und Sidra die Pferde ab.
»Die Satteltaschen bringt ihr in das große Gästezimmer«, wies Dobler sie an. »Die beiden Kamine darin brennen schon, und das Fenster hat eine Glasscheibe. Das hält die Kälte besser ab als gefettetes Papier«, sagte er an Beolf und Sidra gewandt. »Ihr habt sogar ein Unaussprechliches mit fließendem Wasser.«
»Das hört sich sehr angenehm an«, sagte Beolf. »Genau das, was ich brauche.« Er zwinkerte Sidra zu, die sich offensichtlich ebenfalls auf ein warmes Bett in einem gut geheizten Zimmer freute. Und fließendes Wasser im Gebäude war auch für sie neu.
In der neuen Halle Nymmirs wartete ein weiteres Wunder, denn der Boden, der nicht mit Stroh oder Flickenteppichen bedeckt war, in denen sich krank machendes Ungeziefer tummelte, strahlte Wärme ab. Als Beolf vor fast zwei Jahren den Bau des Wehrturms besichtigt hatte, waren ihm die zahllosen dünnen Säulen im Fundament aufgefallen. Nymmir hatte ihm die Idee des gelehrten Leonard von Erbstollen erklärt. Auf die Säulen würde eine Schicht aus Steinplatten gelegt werden, sodass ein etwa drei Spann hoher Hohlraum unter dem Fußboden der Halle entstand. Die heiße Abluft des Herdfeuers der angrenzenden Küche sollte das sogenannte Hypokaustum erwärmen.