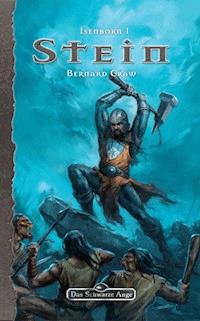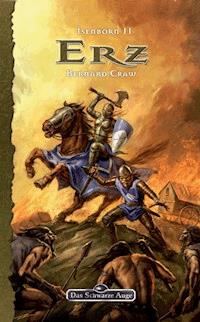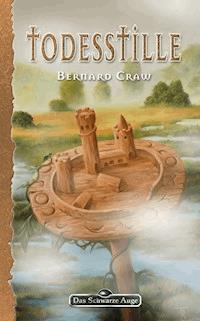
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
Die Rotaugensümpfe sind das verdorbene Herz des Bornlands: Im Winter erbarmungslos, im Sommer tödlich. Wer bei klarem Verstand ist, macht einen Bogen darum. Hier liegt die Ruine der Burg Dornblut, in der einige Geweihte des Totengottes Boron Abgeschiedenheit suchen. Doch die Sümpfe verschlingen nicht nur gierig alles, was die Krallen der Rantzen an sich reißen können, sie bringen auch vieles wieder an die Oberfläche, das besser für immer tot und vergessen wäre. So manifestieren sich auch die finsteren Geheimnisse um die alte Feste der Theaterritter zu jenem Albtraum, der die Leibeigenen schon seit Jahren im Schlaf aufschreien lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 570
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Biografie
Bernard Craw wurde 1972 in Bramsche geboren. Er ist katholisch, ledig und hat als Unternehmensberater und Projektleiter die Welt der internationalen Konzerne kennengelernt. Nach einigen Jahren in Münster und Sindelfingen wohnt er seit 2000 in seiner Wahlheimat Köln.
Craw schreibt vor allem fantastische Literatur. Mit dem Rollenspiel Das Schwarze Auge kam er 1985 in Kontakt, und die geselligen Abende vor Dokumenten der Stärke und Plänen des Schicksals avancierten rasch zur dominierenden Freizeitbeschäftigung.
Mit Todesstille legte er 2009 seinen ersten Roman in der Welt des Schwarzen Auges vor. Viele weitere sollten folgen.
Wer sich über Craws literarische Aktivitäten informieren möchte, kann dies auf www.bernardcraw.net tun.
Titel
Bernard Craw
Todesstille
Ein Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©
Originalausgabe
Impressum
Ulisses SpieleBand 11040EPUB
Titelbild: Tobias BrennerAventurienkarte: Ralph HlawatschLektorat: Catherine BeckBuchgestaltung: Ralf BerszuckE-Book-Gestaltung: Michael Mingers
Copyright ©2012 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN, DERE, MYRANOR, RIESLAND, THARUN und UTHURIA sind eingetragene Marken der Significant GbR. Alle Rechte von Ulisses Spiele GmbH vorbehalten.
Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt.
Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.
Print-ISBN 978-3-89064-246-8E-Book-ISBN 978-3-86889-845-3
Widmung
Für meinen DSA-Kameraden Gerd– in memoriam –Wo es keine Worte gibt,bleibt das Schweigen.
Kapitel 1
In jenem Mond, über den die Göttin Rondra gebietet, die Löwin der Schlachtfelder, Herrin der Schwerter, die den ehrenvollen Kampf schätzt und deren Zorn im Donner über den Himmel rollt.
Die klagenden Geräusche zerrten an Neerjans Nerven. Kalter Schweiß stand auf seiner Stirn. Dieses Jahr meinte es besonders schlimm mit ihm. Kaum hatte das Sternbild des Schwertes die Herrschaft angetreten, stand das Madamal schon in vollem Rad am Nachthimmel. Noch bevor Rondras Zeichen dem Delfin wiche, würde die nächtliche Himmelsscheibe ihren Zyklus durch Helm, tote Mada und Kelch vollenden und nochmals als Rad prangen. Neerjan war kein gebildeter Mann. Das Wenige, was er über die Sterne wusste, hatte er sich mühevoll angeeignet, abgelauscht von Klügeren bei den wenigen Gelegenheiten, zu denen er sich in Elenau aufgehalten hatte. So viel hatte er verstanden: Für ihn hielten die Himmelslichter nur Unglück bereit. Deswegen war er froh, wenn eine Wolkendecke sie verdunkelte. Heute Nacht wurde ihm dieser Gefallen nicht getan. Das bleierne Licht des Madamals legte sich auf Tümpel, trügerische Weiden und Bäume, deren verdrehte Äste wie Arme gebeugt gehender Orks aussahen, die sich anschickten, ihn zu fangen und im Sumpf zu erwürgen. Neerjan schauderte.
Wieder drang ein Heulen durch die Nacht. Die Norbarden, die hier in jedem Jahr einige Monde verbrachten, erzählten von den großen Wölfen des Nordens, deren Rufe schaurig zum Madamal emporstiegen. Neerjan lachte freudlos in das Moor hinaus. Auch hier gab es Wölfe. Wären sie für die Laute verantwortlich gewesen, hätte Neerjan beruhigt geschlafen. Doch kein Wesen aus Fleisch und Blut war Verursacher dessen, was er hörte. Wenn das Madamal voll über Burg Dornblut stand, kniffen sie den Schwanz ein und überließen das nächtliche Konzert anderen.
Furchtsam sah Neerjan zum Schattenriss des Gemäuers hinauf, der sich in etwa einer Meile Entfernung dunkel gegen das Nachtblau abhob. Er schien ihm im Rondramond stets noch schwärzer als sonst. Verlieh die Schwertherrin dem Bronnjarensitz besondere Macht? Neerjan zitterte. Er glaubte jetzt wenigstens zwei Stimmen unterscheiden zu können und wusste, dass sich das Geheul im Laufe der Nacht vom Klagen zum Wüten wandeln würde. So war es meistens.
»Komm herein«, rief seine Frau hinter ihm. »Du holst dir noch den Tod, wenn du die ganze Nacht in der Tür stehst. Wenn du schon nicht schlafen kannst, lass dich von mir wärmen.«
Meskja hatte recht. Er sollte besser hineingehen. Wer wusste, ob sie ihn nicht sehen konnten, wenn er hier stand?
Er fände keine Ruhe in dieser Nacht. Neerjan hörte die Stimmen lauter als die anderen im Dorf. Und vor allem wusste er genau, wem sie gehörten und wonach sie riefen.
***
»Wann stirbt er endlich?«, flüsterte Pjerow von Ebnitzar. Obwohl sie kaum lauter waren als das Prasseln des Kaminfeuers, schien es ihm, als brächten seine Worte die Turmkammer zum Dröhnen.
»Hast du es wirklich so eilig, Graf zu werden?«, fragte seine Schwester mit diesem kalten Klang, den ihre Stimme annahm, wenn sie mit herablassender Verachtung sprach.
»Graf von was?«, fuhr er auf. Er trat den Schemel um, auf dem seine Füße geruht hatten. Der Lederbezug mochte einst edel gewesen sein, jetzt war er abgewetzt und speckig. Zu viele Stiefel hatten Schmutz und schmelzenden Matsch darauf abgeladen, zu viele niedere Mägde ihre tollpatschigen Reinigungskünste daran erprobt. »Von einem Wehrhof, dessen Steine Efferds Hauch keinen Widerstand mehr bieten können?« Wie zur Bestätigung pfiff ein Windzug durch das schlecht verfugte Mauerwerk. »Der oberste Stock unseres Wohnturmes ist vom durchregnenden Wasser so nass, dass er noch nicht einmal für die Dienstboten taugt!«
»Ein Bronnjar kennt wertvollere Schätze als ein warmes Bett.«
»Welche? Deine so oft gerühmte Ehre?« Er spie ihr ein freudloses Lachen entgegen, das eher Verzweiflung in sich trug als den beabsichtigten Hohn. »Was ist er wert, dieser Schatz? Das Privileg, seinen Stammsitz für die edle Sache opfern zu dürfen?«
»Wir haben ihn nicht geopfert.« Rowinja zischte ihre Feststellung zwischen den schmalen Lippen hervor. Immerhin. Alles war besser als diese hochnäsige, enthobene Kühle, die Pjerow das Gefühl gab, nicht er, sondern sie sei die Erbin, die Weise, diejenige, der Wohl und Wehe des Geschlechts anvertraut sein würden. »Uriels Schergen haben ihn uns genommen.«
Pjerow sprang auf. Er breitete seine Arme aus, als wolle er einen Bären zum Ringkampf empfangen. »Ganz meine Meinung, Schwesterherz! Die Ilmensteinerin hat dem Banner mit der Dämonenkrone gute Dienste geleistet!«
»Du vergehst dich, Bruder!« Jetzt war sie beinahe dahin, diese verfluchte Beherrschtheit. Man konnte es an der Falte auf ihrer Stirn erkennen. »Thesia von Ilmenstein hat den Trutzbund des Nordens in den Schlamm getreten! Es ist eine große Ehre für unser Haus, dass unser Schild in ihrem Heerbann zog!«
Er genoss es zuzusehen, wie seine Schwester bebte. Er ließ sich Zeit mit der Antwort. »Die Ehre ist ja auch der einzige Lohn gewesen. Damit müssen wir uns bescheiden. Mutters Blut floss in die Ouve, unser Besitz fiel an einen Getreuen der von Ilmensteins, der den Vorzug hat, sich später als wir seiner Verbundenheit mit den Zwölfgöttern zu erinnern und so den Preis seiner Ehre höher handeln konnte. Wir dagegen dürfen den Pfeffersäcken die Hinterbacken pudern, damit wir uns noch leisten können, dir einen Harnisch schmieden zu lassen.«
»Auch unser Geschlecht hat seinen Teil erhalten.« Es klang nicht überzeugt. Rowinjas Blick wich ihm aus, suchte den Teppich, der an der Wand neben dem Kamin hing und den brüllenden Bären zeigte, das Wappen der von Ebnitzars. Die Bestie stand auf zwei Masken, einer lachenden und einer weinenden. Ein würdiges Zeichen für die Grafen, die wie alle Bronnjaren von den edlen Theaterrittern abstammten, welche einst das Land zwischen Born und Walsach gezähmt hatten. Doch diese Zeiten der Ehre waren seit Jahrhunderten dahin. Die Ritter waren den Inquisitoren der Sonnenkirche zum Opfer gefallen, so wie in der Gegenwart der Stolz der Bronnjaren dem goldenen Funkeln in den Händen fetter Händler ausgeliefert wurde. Des Bornlands Ehre ließ die Brust schwellen. Vor dem Gift der neuen Zeit schützte sie nicht.
Unwillig registrierte Pjerow, dass der Zorn auf seine Schwester verrauchte. Das durfte er nicht zulassen. Auch die anderen Mitglieder der Familie mussten endlich lernen, die Welt so zu sehen, wie sie war. Nicht so, wie sie von den Barden besungen wurde. Ein Ritter, der gegen einen Drachen auszog, kehrte nicht als Held zurück, sondern als verschmortes Fleisch in einer zerbeulten Rüstung. »Wir leben in einem Turm, der kaum einer Ratte ein würdiges Zuhause böte!« Er versuchte zu schreien, aber es war nicht echt. Die Wut war fort. Rowinja merkte es, sie war nicht mehr zu beeindrucken. Pjerow ging die wenigen Schritte zu ihr, stellte sich neben sie, sah aus dem Ostfenster. Es war ein Tag gewesen, der sich genauso wenig zwischen Regen und Sonne hatte entscheiden können, wie ihr Vater sich durchringen konnte, endlich die Reise über das Nirgendmeer anzutreten. Jetzt dunkelte es. In der Ferne leuchteten die Walberge im letzten Licht.
Halblaut sprach Pjerow weiter. »Ein Wehrhof im Festenland, der uns mit kaum mehr versorgt als Brot und Wasser. Eine nutzlose Burg in den Rotaugensümpfen, wo die Moskitos das Blut saugen wie Ugo den Schnappes. Güter im Überwals, von denen noch nicht einmal der Widderorden weiß, wo genau sie liegen. Das ist es, was übrig blieb von Uriels Gefolge und was wertlos genug war, um es an Getreue zu verschenken, die nichts mehr haben. Nichts als ihre Ehre.«
Rowinja sah ihn nicht an, legte aber die Hand auf seinen Oberarm, als er sich schwer auf dem Fenstersims abstützte. Sie sagte nichts.
»Die Zeit der stolzen Klingen ist vorbei, Schwester, wenn es sie denn jemals gegeben hat«, murmelte er. »Vielleicht gab es sie nie. Nur in Geschichten unserer Ammen.«
Rowinja hatte sich auf das Schweigen verlegt. So wie die Gäste, die mit dem Heiler und ihrem jüngeren Bruder nebenan beim Vater ausharrten.
Pjerow nahm einen Scheit vom Stapel neben dem Kamin, kratzte Asche zur Seite und legte das trockene Holz in die Flammen. Begierig züngelten sie daran hoch. Sie würden seine Kraft für flüchtigen Schein und dürftige Wärme opfern. Bald wäre auch dieses Stück bornländischen Wuchses nur noch grauer Staub, den man auf die Felder streute, in der Hoffnung, dass er Nahrung sein könnte für Frischeres, Neues. Wahrscheinlich würde auch das neu Entstehende nur Kohl für die Suppe fauler Leibeigener werden.
Die Tür zum Schlafgemach des Vaters öffnete sich. Mit mäßigem Interesse sah Pjerow, wie Wulfjew hereinkam. Hastig zog sein jüngerer Bruder die Tür hinter sich zu, blickte sich dann scheu im Raum um, als wolle er sichergehen, keinen Fehler zu machen. Wie stets traute er sich nicht, Pjerow direkt ins Gesicht zu sehen. Stattdessen huschten seine nervösen Augen weiter zu Rowinja. Sein pelzbesetztes Seidengewand wirkte an ihm zu groß, wie eigentlich alles in seinem Leben. Die dottergelbe Farbe gab Zeugnis vom kläglichen Trotz, mit dem er der Zukunft entgegensah, die der Vater ihm bestimmt hatte. Doch mit der bunten Pracht wäre bald Schluss, die rabenschwarze Gewandung wartete bereits. Der Dritte nimmt die Kutte, dachte Pjerow. Mit dieser Entscheidung des Alten war er einverstanden. Hätte der Graf doch auch in anderen Dingen die Notwendigkeiten so klar erkannt, die der Lauf der Welt den Sterblichen aufzwang!
»Wie steht es?«, fragte seine Schwester.
Wenn das flackernde Licht Pjerow nicht narrte, war Wulfjew heute noch blasser als sonst. »Meister Rosslan wagt nicht, die Lanzenspitze herauszuschneiden. Er sagt, das würde den Tod noch beschleunigen.«
Pjerow schnaubte. »Das wäre deinen Rabenfreunden doch sicher nur recht!«
Wulfjew zuckte unter seinen Worten, als wären sie Schläge. Er suchte Bestätigung bei Rowinja, aber sie schwieg. Wulfjew schluckte. »Der Herr Boron hat keine Eile. Er duldet es, wenn die Sterbenden ihre Zeit brauchen, um Abschied zu nehmen.« Seine Stimme war dünn wie die eines erkälteten Weibes.
»Ich sehe, du lernst deine Sprüchlein fleißig auswendig. Das wird dir sicher nützlich sein, dort, wo du jetzt hingehst.«
Wulfjew reckte das bartlose Kinn in die Höhe, aber der feuchte Glanz seiner Augen verriet ihn. Er nestelte an seinem Gürtel, dann wandte er sich hastig um und verließ das Zimmer. Pjerow lauschte den Schritten seines Bruders auf der Treppe, um zu hören, ob der verzogene Junge stolperte, wurde aber enttäuscht.
»War das nötig?«, flüsterte Rowinja.
Ärgerlich zuckte Pjerow mit den Schultern. »Es kann nicht schaden, wenn er lernt, dass die Welt nicht gut zu ihm ist, in die die Götter ihn gestellt haben. Auch für dich wäre es von Vorteil, wenn du die Wirklichkeit erkenntest.«
»Welche Wirklichkeit? Deine? In der jeder darauf giert, die reichste Leiche auf dem Boronanger zu werden?« Sie kam zu ihm, legte ihm ihre flache Hand auf die schlecht rasierte Wange.
Er runzelte die Stirn. Solche Gesten war er nicht gewohnt.
»Du tust mir leid, Bruder.«
»Was fällt dir ein?«, fuhr er sie an.
Rowinja ging nicht darauf ein. Normalerweise hätte sie gegengehalten, sie hätten sich gestritten und wären zornig auseinandergegangen. Heute schüttelte sie nur langsam den Kopf. Die Diener des Totengottes schienen tatsächlich ihre Spuren im Gemüt seiner Schwester zu hinterlassen. »Du siehst die Welt als einen Ort, an dem alles einen Wert hat, den man mit Silber und Gold aufwiegen kann. An dem es keine Treue gibt, nur Heuchelei, keinen ehrlichen Handel, nur Betrug. Und weißt du, was das Traurige daran ist, Pjeroscha?« Die Koseform seines Namens hatte sie lange nicht mehr benutzt. Heute verwirrte sie ihn. »Ich habe mit Mütterchen Marboria gesprochen. Eigentlich über Wulfjew, aber was sie mich lehrte, scheint mir nicht nur auf ihn zuzutreffen.«
»Und was hat die Rabenmutter gekrächzt?« Pjerow wunderte sich darüber, dass seine Schwester mit der Anführerin der Diener des Totengottes überhaupt so etwas wie ein Gespräch hatte führen können, war diese doch ein Vorbild in der für ihre Kirche ausgesprochen tugendhaften Verschwiegenheit.
»Sie sagte, die heilige Noiona habe erkannt, dass jeder Mensch in der Welt lebe, die seine Gedanken und Träume ihm schüfen.«
Freudlos lachte Pjerow auf. »Wie praktisch. Da Boron auch der Herr des Traumes ist, hat sie ihrem Gott damit ja eine schöne Macht zugestanden! Die Welt erschaffen! So vermessen sind nicht einmal die Sonnenpfaffen!«
»Du verstehst nicht.« Rowinja schüttelte den Kopf. »Nicht die Götter meinte sie. Jeder Mensch hat die Macht, seine eigene Welt zu erschaffen, aus seinen guten und aus seinen bösen Träumen. Ich glaube, deswegen wirst du in der Welt der Schacherer und Geiferer leben, die du überall vermutest. Ich werde darum beten, dass du eines Tages erkennst, dass nur das Gewicht hat, was man nicht wiegen kann. Aber ich werde nicht darauf warten.«
Pjerow wünschte sich, seine Schwester hätte ihn ins Gesicht geschlagen. Das wäre ihm lieber gewesen als diese fremden Worte. »Wie meinst du das?«
»Verkaufe all das hier, wenn du willst.« Sie zeigte auf den Teppich mit dem Bärenwappen, meinte aber viel mehr. »Werde ein Händler, der jeden Abend einen fetten Braten verspeist in seinem Haus mit vielen Dienern im modernen Festum. Mach mit bei diesem Händlerbund, mit dem sie das Goldreich von Stoerrebrandt beerben wollen. Dein Adelstitel wird dir nützlich sein dabei. Die Pfeffersäcke werden sich freuen, einen weiteren in ihrer Mitte zu haben, dessen Stimme in der Adelsversammlung gezählt wird. Vielleicht findest du sogar so etwas wie Glück darin. Aber für mich bedeutet es etwas anderes, von Ebnitzar zu heißen.«
Er sah ihr in die Augen, denen der Widerschein des Kaminfeuers einen sandfarbenen Ton verlieh, der ihn an das Fell einer Löwin erinnerte. »Du kämest nicht mit mir nach Festum?«
»Ich tauge nicht dazu, Münzen aufeinanderzustapeln. Eine gute Gräfin wäre ich auch nicht, das gebe ich zu. Es ermüdet mich, ein Gut zu verwalten, mich mit Leibeigenen herumzuärgern, mit Bronnjaren zu verhandeln. Ich komme nach meiner Mutter.«
Pjerow wich vor ihrem Lächeln zurück. So überlegen war sie ihm noch nie erschienen.
»Wulfjew mag dich fürchten, Brüderchen, aber über mich hast du keine Macht. Ich begehre nichts, was du mir nehmen oder vorenthalten könntest. Ein Schwert, ein Harnisch, ein Ross und du siehst mich niemals wieder.«
Pjerows Zorn loderte neu auf. »Vaters Hengst gehört zu unserem wertvollsten Besitz! Du hast wohl keine Vorstellung, wie viele Goldbatzen er weggegeben hat, um für das Turnier gewappnet zu sein! Dieses Ross ist gut genug für die Zucht!«
Ihr Lächeln war nicht zu erschüttern. »Mit mir kannst du nicht schachern, Pjeroscha. Gib mir eines von den gewöhnlichen Pferden. Oder raffe auch die an dich, wenn du nicht glaubst, dass es sogar unter den Pfeffersäcken zum Nachteil gereicht, wenn man über dich munkelt, du hättest deiner Schwester das Nötigste verwehrt. Ich habe gesunde Beine. Sie mögen mich nicht so schnell tragen wie die eines Pferdes, aber halten kannst du mich nicht.«
»Du bist genauso ein Eisenschädel wie unsere Mutter!«, schrie er. »Und was hat es ihr gebracht, Rondra nachzueifern? Ihr Blut ist in den Fluss gelaufen, nachdem ein dreckiger Bauer aus dem Gefolge der Schattendiener ihr den Bauch aufgeschnitten hat!«
Ihr Schweigen irritierte ihn. Wie konnte man streiten, wenn einem der Widerstand verwehrt wurde?
»Was es Mutter gebracht hat?« Fest sah sie ihn an. »Einen Tod, der ihres Lebens würdig war. Sobald Vater vor der Waage des Herrn Boron steht, werde ich gehen und ein Leben führen, das ihres Todes würdig sein wird.«
***
Trotz allem war Graf Goljew von Ebnitzar ein stolzer Mann. Der Meskinnes, der ihn mit dem trügerischen Versprechen gelockt hatte, seine Tränen zu trocken, hatte für manch unrühmlichen Auftritt gesorgt. Am schlimmsten vielleicht, als ein paar Bauernlümmel in einem Weiler irgendwo bei Hinterbruch ihn für ihresgleichen gehalten und kräftig verprügelt hatten, nachdem er in trunkenem Übermut einer Magd unter den Rock gegriffen hatte. In einem Schweinepfuhl war er zu sich gekommen, als er seinen Rausch ausgeschlafen gehabt hatte. Solche Ereignisse hatten die letzten zehn Jahre begleitet. Alle Jahre also, an die sich ein Jüngling in Wulfjews Alter bewusst erinnern konnte. Dennoch war sein Vater ein stolzer Mann, denn selbst für dieserlei Taten war der Grund edel.
»Heria«, atmete der Graf den Namen seiner Frau mehr, als dass er ihn sprach. Seine breite Brust bewegte sich nur noch schwach. Wenn der Heiler sie wusch, konnte man die Stelle sehen, an der die Lanze eingedrungen war. Beim Festenländer Gestech wurden Turnierwaffen verwendet, darauf ausgelegt, schnell zu splittern und an Rüstungen abzuprallen, den Gegner aus dem Sattel zu stoßen, statt einen Feind zu zerschmettern. In diesem Jahr hatten die Götter anders entschieden. Unter dem letzten Rippenbogen hatte sich die bronzene Rosette in den Leib gebohrt, der Schaft war geborsten, doch die Wucht hatte ausgereicht, das Metall so tief unter die Haut zu treiben, dass Meister Rosslan es nicht wagte, sie herauszuschneiden. In den letzten Tagen hatte sie ihre Lage im Leib des Vaters ein wenig verändert, war im Fleisch ein paar Finger vor oder zurück gewandert. Außer Schmerzen brachte das nichts.
»Heria«, atmete Wulfjews Vater wieder. Mal hatte er versucht, die Liebe seines Lebens im Meskinnes zu vergessen, dann wieder hatte er in einsamen Nächten schluchzend nach ihr gebrüllt. In Turnierkämpfen hatte er ihr nachgeeifert, um jenseits des Nirgendmeers an Rondras Tafel mit ihr vereint zu werden.
»Soll ich ihm etwas zur Linderung geben?«, fragte Meister Rosslan halblaut.
Pjerow schüttelte den Kopf.
Wulfjew bemühte sich, nicht schlecht von seinem Bruder zu denken, obwohl dieser erst gestern geklagt hatte, wie viel Silber der Heiler jeden Tag nahm. Vielleicht scheute er nicht die Kosten, sondern sah, dass ihr Vater nur noch wenige Stunden hatte und eines klaren Verstandes zur Vorbereitung auf die letzte Reise bedurfte.
Mütterchen Marboria saß am Kopfende des Bettes. Sie führte die Boronis, die den Weg nach Rivilauken eigentlich nicht wegen des Sterbenden gemacht hatten, sondern um Wulfjew in ihre Gemeinschaft aufzunehmen. So war es Graf Goljews Wille.
Inzwischen traute sich Wulfjew, seine künftige Herrin offen zu betrachten. Es schien sie nicht zu stören. Man sagte, es sei ungebührlich, eine Boroni anzusprechen. Gegen Blicke hatten sie nichts einzuwenden.
Deuterin Bishdariels Marboria war eine Frau, deren Alter schwierig zu schätzen war. Die fahle Haut hätte einer Leiche gehören können, in ihren kohlschwarzen Augen stand die Weisheit einer Greisin, aber sie stieg Treppen ohne jede Mühe, und in den seltenen Momenten, in denen sie lächelte, wirkten ihre Lippen mädchenhaft. Das Stickwerk des silbernen Raben auf ihrer fein gewebten, schwarzen Robe war ihr einziger Schmuck, selbst das Haar hatte sie sich vom Haupt geschoren. Offenbar ging sie dabei mit großer Sorgfalt vor. Wulfjew kannte Bauern, die sich ebenfalls des Haares entledigten, oft, um sich der Läuse zu erwehren. Bei jenen zeigten sich zumeist kleine Schnitte in der Kopfhaut, bei Mütterchen Marboria suchte man danach vergebens.
Vater stöhnte, als er mit Mühe die Linke unter den Fellen hervorhob, die sein Lager bedeckten. Sein Blick war jetzt klar. Er suchte seine Kinder.
Wulfjew kniete sich neben das Bett und griff mit beiden Händen die des Sterbenden.
»Wasser«, hörte er.
»Einen Becher! Einen Becher für meinen Vater!«
Wulfjew merkte, dass er selbst zitterte, als er dem alten Mann die Flüssigkeit einflößte. Er schämte sich für die Narben an seinem Unterarm, die von der herunterrutschenden Seide entblößt wurden. Dies waren keine Ruhmeszeichen, sondern Male der Schwäche. Er hätte daran denken sollen, die Ärmel mit Bändern zu befestigen, wie er es manchmal tat, wenn er den Wohnturm verließ.
Graf Goljew hustete schwer. Wie seit zwei Tagen üblich, würgte er dabei eine kleine Menge Blutes hervor. Der Heiler tupfte es mit einem feuchten Lappen fort.
»Mein Sohn«, sagte er. Man sah ihm an, wie schwer ihm das Sprechen fiel. »Ich weiß, dass du es nicht erkennen kannst, aber es wird gut für dich sein, dem Rabenschwarm anzugehören. Dort wirst du den Frieden finden, der überall sonst vor dir flieht. Nur diese hier können das Klagen in deinem Herzen zum Schweigen bringen.«
Wulfjew blinzelte, um seinen Blick zu klären. Seine Wangen erwärmten sich, als Tränen darüber flossen. Er ärgerte sich, dass Pjerow es sah, aber er hatte die Hand seines Vaters wieder ergriffen und wollte sie nicht loslassen, um das Wasser seiner Augen fortzuwischen. »Ich gehorche dir, Vater.«
»Ich weiß«, röchelte der Sterbende. »Du bist ein guter Sohn. Du wirst für mich sprechen bei unserem Herrn Boron, wenn meine Seele gewogen wird. Sei ihm ein guter Diener, damit er milde wird auf deine Fürbitte und mich vereint mit deiner Mutter, auch wenn die Tapferkeit der Löwin nicht immer die meine war. Willst du das tun?«
Wulfjew schluckte. Er fürchtete sich. Manchmal vor dem Leben, oft vor dem Tod, in diesem Augenblick davor, seinen Vater zu enttäuschen. »So gut ich kann«, flüsterte er.
»Ich höre dich nicht, Sohn.«
»Ich werde gehorchen, Vater.«
Wieder hustete Graf Goljew, dieses Mal nicht so schwer. »Du bist ein guter Sohn. Ich wollte dir ein guter Vater sein, doch meine Trauer ließ es nicht immer zu. Es liegt Weisheit in den Lehren Borons, Wulfjew. Viel Weisheit. Wir müssen die Toten vergessen, sonst stirbt das Beste von uns mit ihnen. Sei deinen neuen Meistern ein guter Schüler.«
»Das will ich, Vater.«
»Lasse mich noch eines tun. Nicht, damit du dich meiner erinnerst, denn dies wäre Frevel vor dem Herrn, vor den ich nun trete, sondern um diejenige Waagschale Rethons, die meine Tugend misst, ein paar Unzen schwerer zu machen.« Er mühte sich, lauter zu sprechen. »Ihr alle in diesem Raum sollt Zeugen sein. Mein letzter Wunsch und Wille als Graf von Ebnitzar ist es, dass die Gemeinschaft des hohen Herren Boron, welcher sich mein guter Sohn Wulfjew anschließen wird, Heimstatt nehmen soll in meinem Besitz. Stein, Steg, Land und Leiber seien ihr vermacht von dem Moment an, wo meine Seele ihre Reise über das Nirgendmeer antritt.« Erschöpft sackte der Graf zurück. Seine Hand erschlaffte.
Wulfjew zwinkerte. Er sah sich in der Kammer um. Mütterchen Marboria war nicht anzumerken, ob sie die Worte überhaupt vernommen hatte. Auf den alten Ritter, der der Wächter der Boronis war und hinter ihrem Stuhl stand, machte das Gesagte deutlich mehr Eindruck. Seine Brauen hoben sich in Verwunderung, was das tote linke Auge grau hervorleuchten ließ. Meister Rosslan war aufgesprungen und hatte sich abgewandt. Rowinja legte den Kopf schräg, Unglauben stand in ihrem Gesicht, vielleicht auch eine Spur Belustigung. Pjerows Mund dagegen öffnete sich zu einem stummen Schrei.
Dabei blieb es nicht. »Vater! Das kannst du nicht tun!«, rief er und stürzte zum Bett.
»Er ist tot«, flüsterte Wulfjew.
»Nein«, korrigierte Mütterchen Marboria.
Nun sah auch Wulfjew, dass die Nasenflügel seines Vaters leicht zitterten. Noch wehte der Atem durch einen Leib, der seiner Seele ein brüchiges Zuhause war.
»Er … er sprach wirr!«, rief Pjerow. »Sobald er zu sich kommt, wird er wieder bei Verstand sein! Er kann unseren Besitz unmöglich der Kirche vermachen!«
Wulfjew ballte die Fäuste. Am liebsten hätte er sie seinem Bruder ins Gesicht geschmettert, aber das wäre der Gegenwart seines sterbenden Vaters unwürdig gewesen.
»Meister Rosslan«, stammelte Pjerow und zog den Heiler herum. »Sagt, es ist doch bekannt, dass sich der Geist verwirrt, wenn die Seele ihre Reise antritt! Beides sind doch Schwingen des großen Raben: der Tod und der Wahnsinn!«
Während der Gefragte verlegen schaute, starrte der Krieger aus dem Orden Golgaris Pjerow mit dem gesunden Auge an, doch da seine Herrin noch immer keine Regung zeigte, griff auch er nicht ein.
»So sprecht doch, Meister!«
Der Heiler räusperte sich. Ihm war sichtlich unwohl. »Oft geschieht es, dass der Verstand umnachtet, wenn auch das Leben in die Dämmerung tritt, doch was ich hier hörte, klang deutlich und klar.«
»Das kann nicht Euer Ernst sein!«, brüllte Pjerow. »Sie haben Euch gekauft! Gebt es zu! Ihr habt Gold genommen, an dem noch Rabenfedern kleben! Geschmeide von jenen, die es den Schwarzkutten zugeschoben haben, weil sie vor dem Tode zittern! Schämt Euch!«
»Bruder!«, rief Rowinja. »Mäßige dich! Du redest toll!«
»Ach was! Merkst du denn nicht, dass sie hinter dem Erbe unserer Familie her sind?« Er griff den Meister am Kragen und riss ihn zu sich heran. »Aber nicht mit mir! Was habt Ihr meinem Vater eingeflößt, welche Lügen in seine Ohren geträufelt, dass er sein Blut verrät?«
»Aber Herr, ich habe nichts dergleichen getan! Ich bin ebenso erstaunt wie Ihr! Ich …«
»Schweig!« Pjerow schleuderte ihn von sich, dass er zu Boden stürzte.
»Das ist zu stark, Bruder!«, rief nun auch Wulfjew. Er sah zu seiner Schwester herüber, vergewisserte sich, dass sie an seiner Seite stand. »Wenn du nicht sofort …«
Marboria, Deuterin Bishdariels, tat etwas, das alle im Raum erstarren ließ: Sie erhob sich. Ohne Eile, voller Würde.
Meister Rosslan, der sich gerade vom Boden hochstemmte, verhielt in seiner Bewegung. Wulfjew und Rowinja, die sich auf ihren Bruder stürzen wollten, hielten sich zurück. Pjerow schien einen halben Spann kleiner zu werden und sein Feuer zu verlieren. Nur der Rabenkrieger war noch zu einer Bewegung fähig. Er folgte seiner Herrin zur Tür.
»Wir wollen nun schweigen«, sprach diese und verließ das Zimmer.
***
In einer Scheune in Treie feierten die Bronnjaren der Umgebung. Der junge Pettar von Hahn hatte seinem Schwert erste Ehre verschafft, indem er eine Räuberbande aus dem Wald gescheucht und am Ufer der Ouve zur Strecke gebracht hatte. Ihre Köpfe sahen nun von Staken aus mit schreckgeweiteten Augen in die Nacht, ihre Münder begrüßten mit stummem Schrei die Gäste von den entlegeneren Wehrhöfen, die noch in der Dunkelheit kamen, um an der Feier teilzuhaben. Auch die Kaleschka von Lonnets Herrin bog erst spät auf den Hof, allerdings nicht, weil Xinja von Rotstein einen so weiten Weg gehabt hätte, sondern weil sie alles getan hatte, um so wenig wie möglich vom Triumph des Sohnes ihres größten Widersachers kosten zu müssen. Die Feindschaft zwischen den von Hahns und den von Rotsteins war sprichwörtlich, seit vor zwanzig Jahren die Traviapriesterin Ertzel von Hahns Hand mit der einer anderen verbunden hatte, nicht mit der von Xinja. Man verwies auf diese Geschichte, wenn man sagen wollte, dass der Hass der unerwiderten Liebe oftmals auf dem Fuße folgte.
Lonnet knotete hastig die Zügel fest und sprang vom Kutschbock, um die Tür des Gefährts zu öffnen. Seine Herrin wäre heute alles andere als duldsam. Kalte Luft strich um seinen entblößten Kopf. Er drückte die Mütze vor die Brust, sah zu Boden und versuchte, keine Aufmerksamkeit zu erregen.
Es gelang. Xinja würdigte ihn keines Blickes. Sie wandte die Augen nicht von der Scheune, von wo ihnen der Festlärm entgegenschallte, und schritt mit gerunzelter Stirn darauf zu, als folgten ihre Stiefel einem Taktstock. Unter dem Saum ihres knielangen Pelzmantels blitzte die silberbeschlagene Scheide ihres Säbels.
Lonnet versicherte sich, dass die Knechte das Pferd abspannten und in den Stall brachten, dann folgte er seiner Herrin. Die Luft in der Scheune war geschwängert vom Ruß der Fackeln und Kerzen, deren rotes Licht über die Gesellschaft floss wie alter Wein. Die Bohlentische, auf denen sich die Reste des Gelages stapelten, waren an die Wände geschoben worden, um in der Mitte Platz für die tanzenden Bronnjaren zu schaffen. Lonnet erinnerte sich an den mittelreichischen Lehrer, der Xinja all die komplizierten Figuren beigebracht hatte. Erstaunlich, welche Mühen die Herren des wilden Bornlandes auf sich nahmen, um von Kaiserlichen als ›kultiviert‹ angesehen zu werden, deren Sitten sie bevorzugt als ›dekadent‹ betitelten. Lonnet stellte sich zum Gesinde an den Rand und naschte von dem, was vom Braten übrig geblieben war, während er den Adligen zusah, die sich zu den Klängen von Klamfa und Fiedel beinahe wie in Schlachtreihen bewegten, aufeinander zukamen, sich die Hände reichten, drehten, die Fäuste in die Hüften stemmten, stampften und allerlei Verrenkungen mehr aufführten.
Die Musik verstummte, als Ertzel von Hahn am Geländer der Zwischendecke erschien, auf der das Heu gelagert wurde und die er nun offenbar als seine Bühne zu nutzen gedachte. »Freunde!«, schmetterte er herunter, und alles verstummte. »Welch würdige Tat für den Mond der Leuin hat mein Sohn vollbracht! Das Pack, das frech sein Haupt gegen die von den Göttern gesetzte Ordnung erhob, ist vertilgt! Mit bronnjarischem Zorn schlug mein Sohn zwischen sie drein! Auf, Pettar, tritt vor und lasse dich ehren!«
Unter den zustimmenden Rufen der Versammelten stellte sich der junge von Hahn neben seinen Vater. Sein Gesicht war vom Alkohol gerötet. Kein Verband bedeckte die Wunde, die an seiner Stirn klaffte. Sie war ein Ehrenzeichen der Heldentat.
»Dies ist der Spross meines Hauses!«, brüllte Ertzel und riss die Faust seines Sohnes nach oben. Die Menge grölte ihre Zustimmung. »Er hat den Beweis angetreten, den zu liefern wir jeden Tag aufs Neue gefordert sind: Dass in den Adern der Bronnjaren des Bornlandes das Blut der Theaterritter fließt, jener Helden, die das rotpelzige Gezücht auf seinen Platz verwiesen und das Land zwischen Born und Walsach unter ihren Willen zwangen! Solange wir Söhne hervorbringen wie den meinen, wird die Schwertherrin Rondra uns hold sein!«
Die Bronnjaren zogen ihre Waffen blank und reckten sie jubelnd in die Höhe. Lonnet beobachtete, dass sich auch Xinja der Zustimmung nicht entziehen konnte. Ihr Gesicht zeigte dabei allerdings keine Spur der weinseligen Begeisterung, die die Umstehenden zu lauten Rufen aufstachelte.
Die Leibeigenen blieben ruhig. Auch in solchen Momenten war es angezeigt, nicht die Aufmerksamkeit der Herren zu erregen. Ein unbemerkter Diener war ein glücklicher Diener. Nur eine Stimme hörte Lonnet hinter seinem Rücken zischen: »Wieder ist nur von den hohen Herren die Rede! Ein Dutzend Leibeigene hat Pettar mit sich geführt, zwei liegen noch im Wald verscharrt, keiner blieb ohne Wunde. Von denen spricht niemand!« Lonnet hörte nicht hin. Man musste mit der Ordnung der Welt seinen Frieden machen, sonst wurde auch das kleine Glück unmöglich, das den Leibeigenen zuweilen vergönnt war.
»Doch was ein echter Theaterritter ist«, polterte Ertzel weiter, »der steht nicht nur auf dem Schlachtfeld aufrecht, der zwingt auch das Feuer durch seine Kehle! Wir wollen trinken auf Pettar von Hahn, meinen Sohn, unseren Helden!«
Den Jubel der Menge hörte Lonnet nur gedämpft, als trüge er eine Wintermütze mit dicken Ohrlappen. Auch für Ertzel und Pettar hatte er keinen Blick mehr. Seine ganze Aufmerksamkeit galt dem wundervollen Wesen, das hinter ihnen aus dem Schatten ins Licht trat. Es war eine junge Frau mit hochgesteckten Zöpfen im einfachen Gewand einer Magd, die dem jungen Bronnjaren ein Trinkhorn brachte. Ihre Kleidung war grau und schmucklos. Sie bedurfte auch keiner Spangen und Ringe. Ihre kleinen Augen funkelten heller als Edelsteine unter sanft geschwungenen Brauen. Das schmale Gesicht schien von innen zu leuchten, strahlte eine Reinheit aus wie ein klarer Bach nach der Schneeschmelze.
Erst als seine Brust schmerzte, kam Lonnet der Gedanke, er solle weiteratmen. Das half. Die Magd schien Lonnet noch immer wunderschön, aber nicht mehr übernatürlich. Trotzdem wunderte er sich, dass alle anderen ganz selbstverständlich dem Gerede von Räubern und Helden zuhörten. Wie konnte man seine Gedanken nicht auf diese bescheiden lächelnden Lippen, diese sanften Wangen richten? Die junge Frau hatte die Hände vor dem Schoß gefaltet und schien vor sich hin zu träumen. Vielleicht war sie jetzt ebenso entrückt wie Lonnet, weit weg von zechenden Bronnjaren an einem Ort voll Licht und echter Wärme.
Lonnet bemerkte die Unruhe unter den Gästen erst, als sich ein besorgter Ausdruck auf dem Gesicht der Magd zeigte. Sie sah herunter zu einem buckligen Mann, der sich anscheinend den Zorn der Bronnjaren zugezogen hatte, vor allem den Ertzels, der brüllte: »Was soll das heißen, du Missgeburt? Hast du nicht genügend Schnappes gekauft?«
Lonnets Herzschlag setzte aus, als sich Ertzel wutentbrannt umwandte, aber von Hahn war viel zu aufgebracht, um die Magd auch nur zu bemerken. Er rannte zur Leiter, die er, zwei Sprossen mit einem Schritt nehmend, herunterpolterte. »Dich will ich lehren! Wo bist du mit meinem Silber geblieben, du treuloser Kämmerer?«
»Ich tat, wie Ihr befahlet, Väterchen«, antwortete der Bucklige mit schreckgeweiteten Augen. »Allein die Preise sind gestiegen, und der Beutel, den Ihr mir gabt, wog nicht schwer genug für die Gier des Händlers.«
»Frechling!«, donnerte Ertzel. Einer Bärenpranke gleich hieb seine Linke gegen den Hals des Mannes, der unter der Wucht stürzte. »Wagst du es, die Schuld bei anderen zu suchen? Dich will ich lehren! Wenn es mein Wunsch und Wille ist, dass du das Horn eines jeden Edlen hier bis zum Rande füllen mögest, so sollst du tun, was ich dir sage!«
Ertzels massige Gestalt bebte, die Tonnenbrust hob und senkte sich von gewaltigen Atemzügen unter dem mit dunklen Meskinnesflecken verunzierten, stahlblauen Seidenhemd. Der Bucklige hielt sich den Hals. Er kam unsicher auf die Beine. »Es wird nicht reichen, Väterchen.«
»Noch immer trotzig!«
»Es ist einfach nicht genug, und ich bin kein Zauberer, Väterchen.«
»Willst du mir wohl endlich sagen, womit du meine Schätze verprasst hast? Wie viel Schnappes hast du selbst gesoffen, und wie viel ist mir noch geblieben?«
Als sich der Bucklige umsah, konnte Lonnet die Tränen erkennen, die der Schmerz ihm aus den Augen getrieben hatte. Lonnet fürchtete, es wären nicht die letzten des Abends.
»Väterchen«, wimmerte der Mann, »ein halbes Horn voll mag wohl jeder der edlen Anwesenden noch bekommen.«
Das verschlug seinem Herrn die Sprache. Die Zornesfalte schien in von Hahns Stirn eingebrannt, sogar sein Sohn trug stets dieses Merkmal der Familie. Dazu gesellte sich jetzt so etwas wie Unsicherheit, als der Bronnjar die Menge seinesgleichen beinahe scheu ansah.
»Nun denn!«, rief Xinja von Rotstein. Das Vergnügen strahlte aus den Augen von Lonnets Herrin. »Wenn der Ruhm der von Hahns in ein halbes Horn passt – wohlan, ich will ihn nicht verschmähen und ihnen die Ehre tun!«
Das Gelächter der Versammlung dröhnte dem alten von Hahn entgegen. Dessen Gesicht, zuvor schon vom Alkohol gerötet, nahm nun die violette Farbe von Praios’ Sonnenschild kurz vor Einbruch der Nacht an. »Da siehst du, was du angerichtet hast!«, brüllte er wie ein Stier, dem man die Hoden abgeschnitten hatte. »Man spottet deinem Herren!«
»Väterchen, habt Gnade …«
»Ich war viel zu lange gnädig mit denen, deren Leib mein Eigentum ist!«, bestimmte Ertzel. »Ihr tanzt mir auf der Nase herum und verhurt mein Silber, wenn ich nur ein Augenzwinkern lang nicht hinter euch her bin! Faules Pack! Euch will ich lehren!« Er griff nach dem Ohr des Buckligen und zerrte ihn daran aus der Scheune.
Die Bronnjaren lachten über das lautstarke Jammern des Mannes. Die Menge drängte den beiden nach. Auch die Dienerschaft konnte sich der vom Erschrecken genährten Neugier nicht erwehren und folgte den Edlen in gebührendem Abstand nach draußen.
Die Luft war klar und kalt. Lonnet sah, dass Ertzel tatsächlich ein Lehrstück erteilen würde. Dem Bedauernswerten waren mit einem Lederriemen die Hände gefesselt und an einen Haken gebunden, an dem normalerweise Werkzeug hängen mochte. So stand er gestreckt an einem Pfahl, der ein strohgedecktes Vordach stützte. Ertzel war gerade dabei, das Gewand seines Leibeigenen zu zerreißen, sodass der Rücken mit dem unschönen Buckel freilag. Zwei Diener hielten Fackeln. Einer von ihnen, ein junger Bursche, fühlte sich sichtlich unwohl und schien nicht zu wissen, wohin er schauen sollte. Der andere, älter schon und erfahren darin, die Härten des Lebens zu nehmen, starrte dumpf vor sich in den Schlamm.
Von Hahn sah aus wie ein verwundeter, rasender Bornbär. »Wo bleibt der Bengel?«, rief er. »Wenn er nicht bald da ist, kann er sich gleich neben diesen Lümmel hier stellen!«
Ein Junge kam in den Fackelschein gerannt und brachte ihm einen beinahe zwei Schritt langen Ast von einer Tanne. Ungeduldig riss Ertzel ihn an sich. Er schwang ihn probeweise hin und her. Die benadelten Zweige zischten. Der Bronnjar entschied sich, das Werkzeug für seine Züchtigung beidhändig zu führen.
»Väterchen …«, wimmerte der Bucklige.
»Dich will ich lehren, wer der Bronnjar ist und wer der Leibeigene!«, donnerte Ertzel. Krachend schlug der Ast gegen den missgestalteten Rücken. Der Bucklige schrie.
»Wie oft habe ich euch gesagt, dass ihr meinen Befehlen Folge leisten sollt?« Die Nadeln hinterließen rote Kerben auf der Haut.
»Mich so bloßzustellen!« Ein weiterer Hieb.
»Was hast du Lümmel dir nur dabei gedacht?« Und noch einer.
»Rondra, Travia, vor allem natürlich Praios, sie alle lehren die natürliche Ordnung der Welt! Wie kannst du es wagen, dagegen aufzubegehren?« Unter der Wucht brachen einige Zweige von dem Ast ab und landeten im Schlamm.
»Den Kopf sollte ich dir abschneiden und ihn neben denen der Räuber auf einen Stecken pflanzen!«
Die Schreie des Mannes verstummten. Er hing jetzt schlaff an seiner Fessel.
Die Gesichter der Bronnjaren zeigten versteinerte Mienen, als sie dem Geschehen folgten. Sie wussten, dass Grausamkeit manchmal notwendig war, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Niemand hatte das Recht, einem Bronnjaren hereinzureden, wenn dieser seine Leibeigenen züchtigte. Das hätte gegen die Sitten des Bornlandes verstoßen. Und wer wusste schon zu sagen, was bei den Göttern schwerer wog: das Auspeitschen eines Einzelnen oder das Verlottern des Gesindes?
Ertzel hielt erst inne, als eine fröhliche Stimme rief: »Lass gut sein, Brüderchen! Ich habe schnell nach meinem Hof geschickt und siehe da: Ein paar Fässchen habe ich noch gefunden!« Der Sprecher war ein junger Bronnjar, den Lonnet nicht kannte. Er strahlte durch den Flaum seines Bartes und schien der Frohsinn selbst zu sein, was nicht zu dem dampfenden Blut am Rücken des Gepeinigten passen wollte. »Lass uns wieder hineingehen und endlich auf deinen Sohn trinken, wie er es verdient.«
Ertzel überlegte. Er nickte. »Wohl gesprochen! Diese Nacht soll meinem Sohn gehören. Pettar, dem Helden! Dieser Faulpelz aber soll hier draußen hängen und über seine Vergehen nachsinnen, bis die Sonne ihn küsst!«
Zustimmendes Gemurmel erhob sich. Ertzel wirkte erlöst, als er den Ast fallen ließ und den Bronnjaren zurück in die Scheune folgte.
Lonnet stand noch unentschlossen, ließ den anderen den Vortritt. Wenn der Bucklige, der reglos am Pfahl hing, zum Gefolge von Hahns gehörte, vielleicht war dann auch jemand anderes an ihm interessiert …
In der Tat. Als beinahe alle zurück im Warmen waren, näherte sich unsicher die zierliche Gestalt der Magd. Ihr Haar leuchtete im Sternenlicht. Lonnet hatte sich nicht getäuscht: Sie war wirklich wunderschön. Waren Fackeln und Kerzen nicht eine Beleidigung für diese Erscheinung? Sollte es nicht dem Sternenlicht vorbehalten sein, sie sanft zu umschmeicheln?
Lonnet erschrak. Er verlor sich hier in Träumereien, während die Magd litt. Das Mitleid mit dem Buckligen schien sie überwältigt zu haben. Sie weinte bitterlich.
Händeringend überlegte Lonnet, was er tun konnte. Noch hatte die junge Frau ihn nicht bemerkt. Noch konnte er unbemerkt davongehen, so tun, als sei nichts geschehen. Was war schon vorgefallen, außer dass er den Anblick großer Schönheit genossen hatte?
Lonnet lief in den Stall. Hier dampfte der Atem vor seinem Mund nicht mehr. Viele Pferde standen auf dem Stroh, wärmten die Luft. Der Knecht, der hier Wache hielt, sah ihn missmutig an, erkannte ihn dann aber und zog sich brummelnd zurück. Lonnet lief zum Pferd seiner Herrin und nahm ihm die Decke ab. Der Schweiß war dem Tier ordentlich abgerieben worden. Es würde ohne den Schutz auskommen.
Der Leibeigene rannte zurück in die Nacht, halb hoffend, halb fürchtend, die Magd könne wieder hineingegangen sein. Aber sie stand noch da, wandte ihm den Rücken zu und flüsterte mit dem Gezüchtigten. Je näher er kam, desto zaudernder wurden Lonnets Schritte. Er wollte die Frau nicht erschrecken. Vielleicht tat er genau das, wenn er sich jetzt so anschlich? Er fühlte sich elend. Was sollte er sagen? Was sollten seine ersten Worte sein? Er kam sich tumb vor, unbeholfen und tollpatschig.
Verärgert über sich selbst, weil er sich bei dem Gedanken ertappte, jetzt noch umzukehren und davonzulaufen, trat er den letzten Schritt entschlossen vor. Er presste die Zähne aufeinander, als er die doppelt zusammengelegte Pferdedecke um die Schultern des Buckligen warf, damit sie den zerschundenen Rücken bedeckte.
Die Frau schien ihn tatsächlich nicht gehört zu haben. Sie sah ihn überrascht an. Sie war so schön, dass ihr Anblick schmerzte. »Hast du eine Elfe unter deinen Vorfahren?«, flüsterte Lonnet, bevor ihm bewusst wurde, was er sagte.
»Wie?«
Er räusperte sich. »Ich meinte: Die Decke wird ihn vor der Kälte schützen. Sie lag gerade noch auf dem Pferd meiner Herrin, sie ist noch warm.«
»Ach so. Ja.« Ihre Augenlider flatterten. Sie wandte sich wieder dem Opfer zu, strich dem Ohnmächtigen über die Wangen. »Danke. Du bist mutig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass du eine Decke der von Rotsteins nimmst, um einen Leibeigenen der von Hahns zu retten.«
»Woher weißt du, dass ich Xinja von Rotstein gehöre?«
Mit hochgezogener Braue zeigte die Frau auf das Wappen, das übergroß auf der Pferdedecke prangte und auch im fahlen Sternenlicht nicht zu übersehen war. »Die Götter gaben mir Augen.«
»O ja«, stellte er fest.
»Wie meinst du das?«
Lonnet schluckte. Er fühlte sich wie an den Frühwintertagen, an denen er Xinja auf der Jagd begleitete, wenn man nicht sicher sein konnte, ob das Eis schon trug. »Sie gaben dir ganz besondere Augen.«
»Taten sie das?«
»Sie sind wunderschön.«
Sie lächelte. »Danke, Lonnet.«
Lonnet! »Woher kennst du meinen Namen?«
Huschte da ein Schatten über ihre Wangen? »Ich habe nach dir gefragt, als du hereinkamst. Du bist der Schreiber der von Rotstein, nicht wahr?«
Er nickte. »Wir sind natürlich eigentlich Bauern, und die meiste Zeit helfe ich bei der Feldarbeit. Aber mein Vater hat mir auch das Schreiben beigebracht. Seine Augen sind jetzt schwach, deswegen ruft die Bronnjarin nun mich, wenn es da etwas zu tun gibt. Und ein ganz passabler Schreiner bin ich auch«, plapperte Lonnet. Trotz der nächtlichen Kälte und der traurigen Gesellschaft des gefolterten Mannes hatte er sich noch nie so wohlgefühlt wie in diesem Augenblick. Sie hatte nach ihm gefragt! Er musste ihr aufgefallen sein!
Die Frau kicherte. »Ist die von Rotstein wirklich so eine Hexe, wie man bei uns behauptet?«
»Hexe? Nein, sie kocht keine Seife aus Kinderfett. Sie ist eine gute Herrin. Meistens gerecht. Nur verbittert. Nachdem dein Herr Ertzel sie zurückwies, ist sie zweimal den Traviabund eingegangen. Beide Männer starben schnell, und Kinder hat sie nicht. Nun will sich keiner mehr mit ihr einlassen. Sie sei nicht gut für die Gesundheit ihrer Gatten, sagt man, obwohl der eine von einer vereisten Brücke gestürzt ist und den anderen im Krieg eine Lanze erwischt hat. Außerdem hält man sie für eine vertrocknete Pflaume. Sie ist oft allein.«
Das Scheunentor öffnete sich. »Svetjana!«, rief ein Schattenriss, der im Gegenlicht erschien. »Wo steckst du? Du musst ausschenken! Die Herrschaft ist durstig!«
Offensichtlich bedauernd sah sie zwischen Lonnet und dem Eingang hin und her, dann nickte sie ihm zu und hastete zur Scheune.
Svetjana. Ihr Name war Svetjana.
***
Pjerow hatte sich erstaunlich gut unter Kontrolle, seit der Siegelring der Grafen von Ebnitzar seinen Finger schmückte. Wulfjew glaubte keinen Moment lang, der Grund dafür könne darin liegen, dass sein Bruder sich damit abgefunden habe, unter Brücken zu nächtigen. Pjerow mochte von Zeit zu Zeit der offenen Konfrontation ausweichen, aber er gab niemals auf.
Drei der vier Boronis befanden sich nebenan in der Sterbekammer, wo sie den Leichnam des alten Grafen einbalsamierten: Härmhardt, der Krieger mit der Narbe, die eine Spur über ein totes Auge zog, Imalia, die mit ihrem hüftlangen, flammenfarbenen Haar und den elegant gezupften Augenbrauen so gar nicht zu der Vorstellung passte, die Wulfjew von einer Dienerin des Totengottes hatte, und der alte Raawen, den er in den vergangenen zwei Wochen kein einziges Wort hatte sprechen hören.
Trotzdem war es im Ostzimmer eng, denn es war klein, und der Tisch, den Pjerow hatte hineinbugsieren lassen, beanspruchte nicht unerheblich Platz. Auf der einen Seite saßen Mütterchen Marboria, Wulfjew und Meister Rosslan, der heute abreisen würde, auf der anderen Pjerow zwischen einem fuchsgesichtigen Mann, der sich mit dem Namen Irjan vorgestellt hatte, und seiner Schwester Rowinja, die sich in dieser Gesellschaft nicht wohl zu fühlen schien.
»Wie mir berichtet wurde«, säuselte Irjan, »hat Graf Goljew während seiner letzten Herzschläge, als er schon mit einem Fuße den Nachen auf dem Nirgendmeer betreten hatte, eine Verfügung getroffen, die nicht gänzlich eindeutig war.«
»Was soll denn daran nicht eindeutig gewesen sein?«, brauste Rowinja auf.
Pjerows Ruhe überraschte Wulfjew. Konnte es sein, dass er dämpfende Kräuter genommen hatte, um auch bei einer solchen Attacke noch bedächtig agieren zu können? »Halte dich zurück, Schwester, von Geschäften verstehst du nichts. Wir haben darüber gesprochen.«
Bevor Rowinja etwas entgegnen konnte, setze schon wieder die eklig süße Stimme des Fuchsgesichtigen ein: »Ganz recht, ganz recht. Man darf einem Sterbenden nicht die Bürde auferlegen zu erwarten, er könne seine Worte noch so wählen, wie ein geübter Schreiber sie in einem Vertragswerk setzen würde. Es ist eine hohe Kunst, das Formulieren der Verträge, müsst Ihr wissen. Man kann reich werden in Festum, wenn man sie meistert.«
Pjerow nickte entschlossen, als verstünde er etwas davon. Das Kaminfeuer knackte.
Irjan fuhr fort: »Das Augenmerk ist dabei darauf zu richten, dass genau verstanden wird, was von den Vertragspartnern gemeint ist. Dies gilt insbesondere für Schenkungen, da hier im Nachhinein keinesfalls Streit darüber entstehen darf, welcher Besitz nun wem gehört. Graf Pjerow hat mich gebeten, meine Erfahrung zur Verfügung zu stellen, um die Angelegenheit sauber zu regeln, da der alte Graf unglücklicherweise nicht mehr nach seiner Absicht befragt werden kann.« Er sah so betrübt aus, dass man ihm seine Betroffenheit beinahe hätte glauben mögen.
Meister Rosslan räusperte sich. »Mir ist nicht klar, worin die Ungewissheit bestünde. Graf Goljew vermachte der Kirche des Herrn Boron seinen Besitz.«
»Gewiss, gewiss!« Pjerows Berater nickte beflissen. »Es wäre eine Überraschung für mich, sollte sich in diesem Raume jemand finden, der dies bezweifelte.« Zustimmung heischend sah er sich um. »Doch war das alles, was er sagte? Hier ist äußerste Sorgfalt von Nöten.«
»Nun«, murmelte der Heiler, »er redete von Borons Hallen, seiner verstorbenen Hohen Gemahlin und von dem Leben, welches seinem Sohn Wulfjew zugedacht ist.«
»Nicht wahr? So hat Graf Pjerow es auch mir berichtet. Die Schenkung dient dazu, Wulfjew eine Heimstatt zu geben, ein Horst für die Jünger des Raben. Könntet Ihr dem zustimmen, Meister?«
Der Heiler wand sich auf seinem Stuhl. Er schien eine Falle in den klebrig süßen Worten seines Gegenübers zu vermuten. Dennoch nickte er schließlich.
»Ist dies unser aller Verständnis?«, hakte Irjan nach.
Pjerow bekräftigte seine Zustimmung mit einem Faustschlag auf den Tisch, Wulfjew und Rowinja murmelten verhalten ihr Einverständnis. Mütterchen Marboria schwieg, was Wulfjew als überdeutliche Missbilligung des Schmierenspiels erscheinen wollte.
»Nun, dann ist ja wohl alles klar«, stellte Irjan fest und reichte Pjerow ein Pergament, ehe er sich zurücklehnte.
Der neue Graf von Ebnitzar rollte das Schriftstück auf und schob es der Deuterin Bishdariels zu. »Dem Willen meines Vaters gehorsam gebe ich Euch und den Euren eine Heimstatt, deren Abgeschiedenheit dem Bedürfnis nach Ruhe entgegenkommen wird, welches Eure Kirche auszeichnet. Eine wehrhafte Burg abseits des Treibens der Welt, mitsamt dem umliegenden Land, dem Recht an Weg und Steg und Leibeigenen, die es bewirtschaften. Setzt Euer Siegel darunter, und ich will das meine dem Handel hinzufügen.«
Wulfjew sprang auf. »Das ist es nicht, was Vater wollte! Er sprach nicht von einem Teil des Besitzes, er sprach von … Moment … welche Burg?« Sein Blick huschte über die Urkunde. »Dornblut? Du willst uns mit Dornblut abspeisen? Mütterchen, diese Feste liegt mitten in den Rotaugensümpfen, sie …«
Marboria hob sanft eine Hand, was ausreichte, damit Wulfjew verstummte und sich setzte. Er schämte sich, ohne zu wissen, wofür. Es war doch Pjerow, der auf billigste Weise einen Betrug versuchte, der unter der Würde eines Landstreichers gewesen wäre. Die Deuterin legte die Hand wieder auf dem Tisch ab, neben dem Pergament, das sie noch keines Blickes gewürdigt hatte, und lächelte den Grafen milde an. Wulfjew vermeinte, trotz des freundlichen Gesichtsausdruckes eine nicht greifbare Aura der Dunkelheit um sie herum wahrzunehmen, gegen welche die Flammen des Kaminfeuers vergeblich anleuchteten.
Rowinja brach das Schweigen. »Ihr müsst wissen, Mütterchen, Burg Dornblut liegt in der Tat tief in den Sümpfen. Sie fiel vor zehn Jahren an uns, als …«
»… sie mit ehrlichem Stahl erobert wurde«, unterbrach Pjerow. »Kriegsbeute, Uriels Schergen entrissen, die unglücklicherweise entfernt mit uns verwandt waren. Eine Festung der Theaterritter, wie es scheint, so sorgfältig, wie sie gebaut ist. Und abgelegen, was für manchen ein Nachteil scheint, für die Anhänger Borons jedoch zweifellos wünschenswert ist.«
Rosslan räusperte sich. »Hochwürden, ich halte es für meine Pflicht als Heiler, darauf hinzuweisen, dass die Sümpfe Dämpfe ausscheiden, welche der Gesundheit nicht zuträglich sind. Auch haust dort allerlei Getier, das Krankheiten anzustacheln vermag, von der Gefahr durch Sumpfrantzen ganz zu schweigen. Zudem sind die Wege tückisch im Moor, soweit man hört. Ich selbst war niemals dort und werde, so die Götter ein wenig Mitleid mit mir haben und mir den Ruf eines verfluchten Irrlichts ersparen, niemals meine Schritte dorthin lenken.«
»Aber, aber«, beschwichtigte Irjan. »Wir wollen doch nicht unsere Maßstäbe auf die heilige Kirche übertragen.«
Rowinja knirschte mit den Zähnen.
Rosslan faltete die Hände, sichtlich um seine Selbstbeherrschung ringend. »Noch einmal: Graf Goljew sprach von seinem Besitz. Nicht von einem Teil seines Besitzes.«
»Darf ich fragen, welchen Anteil Ihr eigentlich an diesen Verhandlungen nehmt?«, entgegnete Irjan spitz.
Pjerow räusperte sich. »Wie unser Berater richtig ausführte, müssen wir danach trachten, den Willen meines Vaters hinter dem Nebel seiner letzten Worte zu erkennen. Niemand wird sich vorstellen können, dass Graf Goljew seine Blutlinie ohne Besitzungen zurücklassen wollte. Der Gedanke ist absurd.« Er lachte. Es klang wie der Versuch, einen unangenehmen Gedanken zu vertreiben. »Es liegt klar auf der Hand, dass es nur darum gehen konnte, Wulfjew und den Raben etwas zu schenken, das als Unterkunft taugt. Dies ist mit meinem Angebot erfolgt. Ich kann nur raten, es anzunehmen, bevor mich meine Großzügigkeit reut.«
Wulfjew hielt den Atem an. Jetzt musste Mütterchen Marboria etwas sagen. Eine solche Unverschämtheit durfte sie sich unmöglich bieten lassen!
In der Tat sagte sie etwas: »Wir wollen darüber schlafen.«
Wulfjews Nackenhaare stellten sich auf, als hätte eine leichenkalte Hand darüber gestrichen.
***
»Sage du es ihr«, bat Wulfjew.
Imalia umwickelte weiter seinen Unterarm mit den Leinenbinden, doch konnte Rowinja ihre Neugier spüren. Wäre die Rothaarige allein gekommen, hätte die Bronnjarin sie für eine Schwindlerin gehalten, die nur vortäuschte, eine Borondienerin zu sein. Sie hätte wohl gelacht und das Schauspiel der jungen Frau eher für eine Komödie gehalten denn für einen ernsthaften Versuch, sich den Respekt zu erschleichen, der denen gebührte, die sich dem Dienst an den Zwölfgöttern verschrieben hatten. Abgesehen von der schwarzen Wollkutte mit dem silbernen Boronsrad darauf strahlte alles an ihr eine unbändige Lebensfreude aus. Der Silberstaub, der auf ihren Augenlidern glitzerte, mochte als Hohn auf die Schmucklosigkeit verstanden werden, die man allgemein mit der Geweihtenschaft des Totengottes verband. Es strahlte jedoch auf Imalia aus, dass sie im Gefolge von Mütterchen Marboria und dem Hüter des Raben Raawen zog, deren Zugehörigkeit zur Kirche des Unausweichlichen unbezweifelbar war. Eigentlich war Rowinja sogar froh, dass ihr jüngerer Bruder jemanden in der Nähe hatte, die ein wenig Heiterkeit abgeben konnte.
»Das Madamal steht beinahe voll am Himmel«, erklärte Rowinja und sah zu Wulfjew, um sich seiner Zustimmung zu versichern. Ihr Bruder nickte. »Meist geschieht es in der Nacht, häufig dann, wenn das silbrige Licht besonders kräftig ist. Im Rad, kurz davor oder danach.«
»Seltsame Kräfte gehen vom Mal der Mada aus«, bestätigte die junge Borondienerin. »Es beeinflusst Ebbe und Flut, sagen die Gelehrten in Festum. Es hilft, die Tage des Götterlaufs einzuteilen, und auch auf die Fruchtbarkeit der Frauen wirkt es sich häufig aus. Den Jüngern der heiligen Noiona ist nicht unbekannt, dass auch Geist und Seele der Empfindsamen seinem Zug folgen.«
»Jedenfalls wäre es gut, Wulfjew in den Zeiten, wenn er nicht ganz bei sich ist, von scharfen Klingen fernzuhalten.«
»Wie schlimm ist es?«, fragte Imalia und sah dabei Wulfjew an. Was mochte er für sie sein? Patient? Mitbruder? Oder ein schöner Jüngling? Für Rowinja war er immer der jüngere Bruder, es hatte sie überrascht, als sie bemerkt hatte, dass seine Erscheinung für die jungen Frauen nicht ohne Reiz war. Imalia war ungefähr im gleichen Alter wie er, ein wenig jünger mochte sie vielleicht sein, etwa 16 Jahre.
Wulfjew starrte auf den Verband, antwortete aber nicht. Also tat Rowinja es an seiner Stelle: »Meist müssen die Schnitte noch nicht einmal verbunden werden. So tief wie heute schneidet er nur selten. Aber seht auf seine Hand. Das geschah vor zwei Jahren.«
Freudlos lächelnd streckte Wulfjew ihnen die Rechte entgegen, der Stummel des Mittelfingers war deutlich zu erkennen.
Imalia zuckte mit den Schultern. »Ich habe Schlimmeres gesehen.«
»Manchmal …«, setzte Wulfjew an. »Manchmal bin ich nicht ich selbst. Es ist dann, als sähe ich mir zu bei dem, was ich tue. Mir schaudert davor, aber ich kann nicht aufhören.«
»Gräme dich nicht«, riet Imalia. »Habe Geduld. Zeit und Ruhe sind gute Heilmittel.«
Rowinja sah ihren Bruder an. Manchmal hatte er diesen befriedigten Ausdruck, wenn das Messer sein Werk getan hatte. Als sei etwas zur Ruhe gekommen, schlafe. Sie hoffte, dass es dieses Mal von längerer Dauer wäre. Er wusste nicht, dass Graf Goljew einen Hexer bezahlt hatte, der in den Walbergen hauste und den er zufällig in Elkenacker getroffen hatte. Der Einsiedler hatte bei der Herrin Rondra geschworen, dass kein Dämon den jüngsten von Ebnitzar in den Klauen hielt. Was immer ihn quälte, kam aus seinem Inneren, nicht aus den übersinnlichen Sphären.
»Wir sollten gehen«, sagte Rowinja.
Wulfjew würdigte den ordentlichen Stapel, zu dem er am Vorabend seine Bronnjarenkleidung zusammengelegt hatte, keines Blickes. Ergeben nahm er die schwarze Kutte entgegen, die Imalia mitgebracht hatte. Er wäre ein Novize ohne selbst die niederste Weihe, darum war ihm nicht einmal die Zierde des Boronsrads vergönnt. Ohne Zögern streifte er das einfache Gewand über seine Unterkleidung. »Ich bin bereit.«
Der Rondramond schien ihnen noch einige warme Tage schenken zu wollen, als habe der Totenrabe mit der Seele des Vaters auch ein wenig von der frühen Kälte der letzten Wochen aus der Welt genommen. Der Praiosschild stand schon einen halben Spann hoch, als sie durch den Schlamm des Hofs zum Wirtschaftsgebäude gingen. Die Bauern, die vor dem Eingang warteten, um ihrem verstorbenen Herren die Referenz zu erweisen, bildeten eine Gasse. Sie tuschelten beim Anblick der Kutte, die der Jüngling trug. Natürlich hatten sie es gewusst, der Entschluss des Vaters war kein Geheimnis gewesen, aber etwas selbst zu sehen, verlieh ihm greifbarere Realität. Nicht oft gaben die Bronnjaren ihre Kinder an die Kirche des Raben. Die Schwertherrin Rondra war eher nach dem Geschmack derer, die sich als Erben der Theaterritter sahen. Aber dort waren die willkommen, die ihren Feinden Wunden schlugen, nicht jene, die den eigenen Körper als Ziel wählten.
In der Halle dampften Kräuter neben der Bahre, auf der Graf Goljews sterbliche Hülle lag. Jetzt, jenseits der Schmerzen und der Einsamkeit, trug sein Gesicht einen friedlichen Ausdruck. Die Boronis hatten ihm mit ihren Salben und ihrer Kunstfertigkeit die Würde zurückgegeben, die ihm in den vergangenen Jahren abhanden gekommen war. Der Bart mit den grauen Strähnen lag sorgfältig gekämmt auf seiner Brust, die Hände schlossen sich um den Griff eines Schwerts, das verrostet war, wie Rowinja wusste. Man sah es nicht, da die Waffe in einer einfachen Scheide stak.
Härmhardt hielt die Totenwache. Er war ein Ritter Golgaris und ein wahrer Hüne, aber das Leben hatte ihn mit mehr gezeichnet als nur mit einem verlorenen Auge. Die Muskeln schwollen unter dem Kettenpanzer, doch der Rücken war schon gebeugt, und auch Schwermut war ihm nicht fremd, wie ein Blick in sein Gesicht verriet. Wer mochte wissen, welcher Kummer ihn veranlasst hatte, sein Leben in den Reihen der Golgariten zu beschließen? Die meisten Krieger wollten hinter dem Nirgendmeer an der Tafel Rondras zechen, nicht das Vergessen in Borons Hallen finden.
Rowinja ließ sich zwischen ihren Brüdern auf die Knie nieder. Sie glaubte, dass Pjerow wirklich um ihren Vater trauerte. Trotz des Streits in den letzten Jahren war er ihm ähnlicher gewesen, als viele vermuteten.
Die Geschwister verbrachten eine lange Zeit in demütiger Haltung, während die Leibeigenen hinter ihnen vorbeizogen, die Kappen in den Händen drehend, in den Augen die ständige Sorge, die ihren Stand kennzeichnete. Die Bauern des Bornlandes fürchteten die Dürre und zu viel Regen, hatten Angst vor schlechten Ernten und davor, dass die Preise auf dem Markt von Rivilauken fielen, wenn die Felder zu üppig Ähren trugen. Wie hätten sie der Veränderung gelassen entgegensehen können, die dem Tod ihres Herren folgen musste?
Schließlich trat Mütterchen Marboria vor die Bahre. »Vergessen soll sein, was gewesen, das Gute und das Schlechte, was ihn von euch trennte und was ihn verband. Er ist nicht länger unter uns, er ist gegangen, wohin wir alle ihm folgen werden. Nun jedoch wendet euch ab und kehrt zurück zu den Lebenden.«
Draußen zog Rowinja Wulfjew zur Seite. »Auf ein Wort«, bat sie.
Er sah sie fragend an.
»Hier, an der Leiche unseres Vaters, ist kein Platz für Heuchelei. Ich will dir gestehen, dass Pjerow mich gekauft hat. Ich wusste, dass er dich mit der Burg in den Rotaugensümpfen abspeisen wollte.«
»Mütterchen Marboria scheint es nichts auszumachen. Sie hat das Dokument gesiegelt.«
»Trotzdem will ich, dass du es weißt: Mir ist bewusst, dass du betrogen wurdest.«
»Warum hast du es zugelassen?« Er klang interessiert, nicht verärgert.
»Pjerow und sein neuer Freund haben auf mich eingeredet, bis ich nicht mehr wusste, wo mir der Kopf stand. Es widert mich an zu sehen, was aus unserem Bruder wird. Ich will nicht länger hier sein, ich muss fort. Es war schon schwer genug für mich, dabei zu stehen, als Vater Mond um Mond und Jahr um Jahr mehr von seinem Stolz verlor. Ich kann es nicht mehr ertragen. Die beiden haben damit gedroht, die Bronnjaren zusammenzurufen, um zu verhindern, dass das Erbe an die Kirche fiele. Notfalls hätten sie die Adelsversammlung angerufen. Ich hätte als Zeugin auftreten müssen. Das alles hätte sich ein Jahr hinziehen können, vielleicht länger. So, wie dieser Irjan es hindrehte, erschien es mir, dass sie am Ende ohnehin gewonnen hätten.«
»Es ist nicht schlimm. Mach dir keine Sorgen, Rowinjascha.«
Rowinja lächelte. Es gäbe noch so viel zu sagen. Dass sie darauf bestanden hatte, dass es wenigstens nicht die unbekannten Güter in den Walbergen sein sollten. Dass Pjerow hatte schwören müssen, Wulfjew zumindest so zu verabschieden, wie es eines Bronnjaren würdig war, auch, wenn er ihn in die Öde schickte. Diese kleinen Verdienste kamen ihr jetzt schäbig vor.
Pjerow hatte die beiden gefunden. Er führte Vaters Schlachtross am Zügel. Am Sattel hingen einige Beutel. Er nahm einen zusammengerollten Mantel aus dem Fell eines Schwarzbären herunter, schüttelte ihn auf und legte ihn um Wulfjews Schultern. »Die Farbe deines Gottes.« Pjerows Stimme war so sanft, wie Rowinja sie lange nicht mehr gehört hatte. Vielleicht hatte er vor dem Toten daran gedacht, dass auch seine Seele eines Tages vom Herrn ihres Bruders gewogen werden würde. »Es ist ein guter Mantel.«
»Er wird mich wärmen«, bestätigte Wulfjew. Ihre Brüder wirkten einträchtig wie selten. Keine Scheu bei Wulfjew, keine Verachtung bei Pjerow. Wäre nicht Gewissheit, dass dies ihre letzten gemeinsamen Stunden waren, Rowinja hätte daran glauben wollen, dass eine ungewohnte Harmonie für die Zukunft möglich gewesen wäre.
»Auch dieser Rappe sollte deine Erscheinung nicht trüben.«
Wulfjew nahm die Zügel. Überlegend sah er zum Himmel. Er schüttelte den Kopf und reichte sie an Rowinja weiter. »Ich will, dass du ihn nimmst.«
»Das kann ich nicht annehmen!«, wehrte sie ab.
»Es ist das Ross einer Kämpferin. Mein Blut hat nicht genug Feuer für diesen Hengst.«
Sie sah, dass er recht hatte. Dennoch stiegen Tränen in ihre Augen. Mit einem Mal war sie nicht mehr sicher, dass sie das Richtige tat. Sollten Geschwister nicht beisammen bleiben? War es vielleicht dieser Wunsch, der in Wirklichkeit hinter dem letzten Befehl ihres Vaters stand?