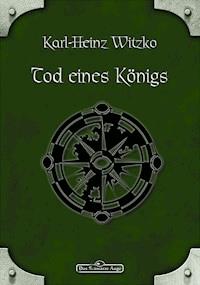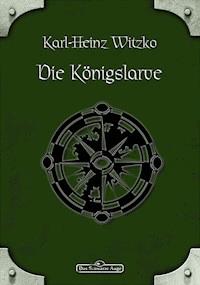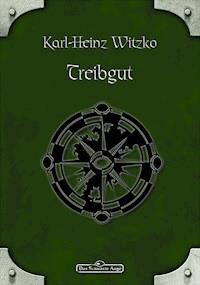
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
Die »Heiligen Rollen« hatten Borbarads Kommen vorhergesagt, sie hatten prophezeit, daß viele Maraskaner ihre Heimat verlassen würden, um an einen Ort zu fliehen, der ihnen Schutz vor Borbarad, dem Dämonenmeister, bieten könnte. Wo aber auf der Welt lag dieser Ort? Die Schriften verschwiegen es, und die Suche nach ihm glich der nach einem Zweiglein im Treibgut des Hira ... Nein, niemand wußte, ob dieser Ort sich finden ließe, nicht einmal, ob er überhaupt existierte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karl-Heinz Witzko
Treibgut
Ein Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©
Originalausgabe
Impressum
Ulisses SpieleBand 11
Kartenentwurf: Ralf Hlawatsch E-Book-Gestaltung: Christian Lonsing & Michael Mingers
Copyright © 2015 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN, DERE,MYRANOR, RIESLAND, THARUN und UTHURIA sind eingetragene Marken der Significant GbR.Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.
Print-ISBN3-453-09496-4(vergriffen) E-Book-ISBN9783957524591
Zitat
Ein geschickter Verteidiger verbirgt sich in den allergeheimsten Winkeln der Welt, ein geschickter Angreifer kommt wie ein Blitz
Zur Trigonometrie von Wasser
Baum sah nichts. Hatte keine Augen. Käfer war beschäftigt. Käfer krabbelte den Stamm hinauf. Käfer krabbelte geschwind über raue Rinde und lange Nadeln. Käfer krabbelte vorsichtig an goldglänzenden Harztropfen vorbei. Käfer war schlau. Harztropfen waren nicht eßbar. Harztropfen waren klebrig. Harztropfen waren sehr gefährlich. Käfer paßte gut auf. Käfers Ziel waren die langen Zapfen mit ihren schmackhaften Samen. Käfer liebte sie sosehr. Käfer war fast glücklich.
Jäh hielt Käfer inne. Käfer spürte ein rhythmisches Beben. Etwas näherte sich. Käfer lauschte. Käfer hob die harten Flügelschalen und pumpte. Käfer fühlte. Käfer ließ die langen Fühler spielen. Käfer las den Wind. Zweibeins! Käfer erstarrte im Schatten einer Rindenfurche. Käfer zahlte. Mehr Zweibeins, als Käfer Beine hatte. Mehr Zweibeins, als zwei Käfer Beine hatten. Fast so viele, wie Käfer und zwei Käfer Beine hatten. Aber nicht ganz! Käfer mochte keine Zweibeins. Zweibeins waren häßlich mißgestaltet. Zweibeins hatten nur zwei Beine. Zweibeins waren nicht vorausfühlbar. Bestimmt lag das an ihren fehlenden Beinen. Käfer hatte es selbst beobachtet. Jawoll!
Ein Zweibein nahm einen Käfer und trug ihn zu gutem Essen.
Ein Zweibein sah einen Käfer und zertrat ihn.
Ein Zweibein erblickte einen Käfer und rannte schreiend weg:
Zweibeins waren sehr seltsam. Zweibeins taten ein mal dies und einmal das. Bestimmt wußten Zweibeins selbst nicht, warum sie etwas taten. Ein Ruck ging durch Käfer. So viele schwierige Dinge hatte er auf einmal gedacht! Käfer würde noch weise werden.
Aber nicht jetzt! Käfer war hungrig! Zweibeins sollten wegkrabbeln! Das war Käfers Baum! Käfer hatte ihn lange gesucht!
Käfer fühlte. Käfer ertastete den Wind. Zweibeins kamen nicht näher zu Käfers Baum. Mutig krabbelte Käfer aus dem Riß hinaus und weiter.
Die Häsin hoppelte durch das hohe Savannengras, schlug plötzlich einen Haken. Sie verharrte, wendete den Kopf, doch der Rammler war ihr nicht gefolgt. Über die braunen Spitzen der gelbgrünen Halme hinweg schaute sie zu der einzelstehenden Zeder hinüber, eigentlich hatte sie mehr von ihm erhofft. Wegen des Rotfelligen mit dem Silberrücken wäre sie um ein Haar mitten in die Menschengruppe gerannt – wo er wohl geblieben war? Das wäre etwas gewesen, mitten in die Menschen hinein! Ihr Herz pochte. Sie stellte die Ohren auf lauschte und zählte mehr als ein Dutzend der lauten Geschöpfe. Wahrscheinlich hatte er diese schon viel früher bemerkt als sie. Er hatte sie bemerkt und war zurückgeblieben, was völlig unnötig war, denn die Menschen hatten Auswüchse am Rücken. Aber selten, wenn sie jagten. Sie hatten diese Auswölbungen, wenn sie die Savanne der Häsin nur durchquerten und weiterzogen – er hätte überhaupt keine Furcht haben müssen! Vielleicht interessierte er sich doch weniger für sie, als sie gedacht hatte und mehr für die Menschen, von denen sich soeben einer ein paar Hopser weit von den anderen entfernte. Sie verwarf diesen Gedanken sofort, denn sie war eine schöne Häsin, immerhin schon dreimal gedeckt seit dem Regen!
Sie sah den einzelnen Menschen etwas aus seinem Auswuchs holen. Die rechte Hälfte ihrer Oberlippe zitterte: Es war eine dieser Holzscheiben, mit denen die Menschen bekanntlich Hasen töten konnten. Hatte sie sich geirrt?
Der Mensch drehte sich mit geschlossenen Augen im Kreis, warf die Scheibe, aber nicht in ihre Richtung, hoffentlich auch nicht in die des Rammlers, schade wäre es um ihn gewesen, denn sicherlich hätten sie einen hübschen Wurf zusammen gehabt! Sie verfolgte die Bewegungen des Menschen, sah ihn zu seinem Wurfholz gehen, es aufheben, dann schnurgerade weiter in die Richtung laufen, in die er es geworfen hatte und die – so stellte sie befriedigt fest – eine gänzlich andere war als jene, wo sich ihre Sasse mit den Jungen befand. Die Häsin legte sich auf den Bauch, knabberte an den Halmen; bestimmt würde sie den Rotfelligen morgen treffen, irgendwo auf ihrer Wiese.
Hoch droben am Himmel zog ein Roter Maran bedächtige Kreise. Er war ein alter Vogel und hatte schon oft das Kommen und Gehen des nassen und des trockenen Windes erlebt. Er schaute hinab auf die Welt unter sich, auf dieses endlose Rund mit seinen gelbgrünen Grasflächen, dunklen Wäldern, ockerfarbenen Bergen, blauen Seen und silbernen, manchmal auch gelben Flüssen. An Tagen wie diesen, wenn die warme Sommersonne auf sein Gefieder brannte, wenn Luftströme ihn ohne Mühe nach oben trugen, neigte er zur Nachdenklichkeit. Er stellte sich dann fast träumend vor, daß nicht er kreiste, sondern die Weltenscheibe unter ihm. Er wußte, daß es sich nicht so verhielt, aber er war sich nicht ganz sicher, denn etwas Seltsames hatte es auf sich mit der Welt: Je höher er stieg, desto kleiner wurde alles tief unten, nur eines nicht: das Weltenrund. Es schien immer gleich groß, und oft genug hatte er sich gefragt, wie hoch er wohl steigen müßte, um den Rand der Scheibe unter sich zu entdecken. Er war sich nicht sicher, daß es einen gab, aber vielleicht würde er es am Ende des Sommers wissen, noch bevor sich das Land verfärbte, noch bevor die Wälder erröteten, das Gras völlig gelb wurde und die Scheibe da unten sich in einen leuchtendroten Teppich mit gelben und schwarzen Sprenkeln verwandelte. Denn dort, wohin der nasse Wind zog, gab es einen Berg, höher als jeder andere, und schon lange hatte der Maran sich vorgenommen, den unfaßbar weiten Weg bis zu der geheimnisvollen weißen Spitze des Berges aufzusteigen – und vielleicht sogar darüber hinaus. Dort oben würde er das Geheimnis der Welt erkennen, er würde zurückkehren und allen Maranen und Wähen erzählen, wo der Rand der Weltenscheibe war. Ohne Bedeutung wäre dabei, daß er höher geflogen war als jeder und jede von ihnen, es würde nur zählen, daß er herausgefunden hatte, ob die Weltenscheibe endete. Und vielleicht würde er dabei auch erfahren, wann ihre Farbe im Herbst sosehr dem haarigen Kleid der Marasken glich.
Er blinzelte zweimal verwirrt. Für einen Augenblick hatte er wirklich geglaubt, daß er still schwebte und die Welt sich statt seiner drehte. Ein verzeihlicher Irrtum und schuld daran war das Gebaren der Menschen bei der einzelstehenden Zeder. Einer nach dem andern löste sich von der Gruppe, ging einige Schritte, wirbelte dann im Kreis, so lange, bis sich aus seiner Hand eine hölzerne Scheibe ebenfalls kreiselnd entfernte. Es war ein rätselhaftes, aber schönes Spiel, und es machte dem alten Vogel Freude, nacheinander mit seiner gesamten Aufmerksamkeit dem Rotieren der Holzscheiben, der Menschen oder der Welt zu folgen. In den Pausen zwischen den einzelnen Würfen rätselte er, warum die Menschen nicht gleichfalls wieder in großen Kreisen zu den Ihrigen zurückkehrten, was dieses Spiel vollkommen gemacht hätte, sondern statt dessen jeder in der Richtung weiterging, wohin seine Scheibe geflogen war, sei’s dorthin, wo die Sonne aufging oder unterging, sei’s dorthin, wo der feuchte Wind herwehte oder hinblies?
Als die Gruppe schon fast auf die Hälfte zusammengeschrumpft war, fand er die Antwort. Es war so einfach: Bestimmt hatten sie dasselbe Ziel wie er, bestimmt suchten sie ebenfalls den Ort, wo die Welt endete. Wie hätte er auch ahnen können, daß das Gegenteil richtig war? Und selbst dann hätte es ihn wahrscheinlich in diesem Augenblick überhaupt nicht mehr interessiert, denn seine scharfen Augen erspähten etwas wesentlich Reizvolleres. Er stürzte sich in steilem Flug hinab.
Xanjida bückte sich und hob den schweren Diskus aus dem kniehohen Gras. Sie fuhr mit der Hand durch das kurze graumelierte und stets wirre Haar, schaute in die Richtung, wohin er geflogen war und somit ihren weiteren Weg festgelegt hatte. Was sie sah, war enttäuschend. Nur um sich zu vergewissern warf Xanjida einen Blick zur Sonne. Die letzten Zweifel verschwanden, ihr Weg würde sie genau nach Tuzak führen, der Stadt, von der sie und die anderen erst vor wenigen Stunden aufgebrochen waren. Also zurück nach Tuzak, seufzte sie, das hätte sie auch einfacher haben können! Jedoch hatten die Hochgeschwister des Tempels diesen Ort hier für den Beginn der Suche bestimmt, also hätte es schon seine Richtigkeit, daß sie hierhergekommen war und wieder zurückkehrte. Wahrscheinlich wäre der Marsch nach Tuzak ohnehin nur eine kleine Etappe auf ihrem Weg. Ein letztes Mal drehte sich die Priesterin zu den restlichen Achten um, um sich zu verabschieden. Allesamt winkten sie zurück. Perjin, der schlaksige Novize, fuchtelte dabei so wild mit beiden Armen, als hätte er gleich vor, wie ein Vogel abzuheben. Gerade noch rechtzeitig sprang seine Nachbarin zur Seite, denn um ein Haar hätte er ihr mit seinem unbändigen Geschlenker einen Nasenstüber versetzt. Lachend blieb die stämmige Brünette in sicherer Entfernung stehen und setzte dann ihrerseits zu einem noch überschwenglicheren Winken an. Nur eine Nachahmung Perjins, mehr nicht, denn Xanjida hatte die Frau erst an diesem Morgen kennengelernt. Eine humorvolle Person, wie es schien, mit weichen Augen, bisweilen etwas hilflos wirkend. Wenn man nicht wußte, was sie war, so käme man gewiß nicht darauf, doch so hatte Rur die Welt geschaffen, und nur weil er bestimmt hatte, daß Marasken und Parder so gefährlich aussahen, wie sie waren, mußte das nicht für alle Kinder seiner Schöpfung gelten. Schwierige Zeiten, dachte die Priesterin, seltsame Zeiten, die eigenartige Weggefährten mit sich brachten. Ein Ruf Perjins riß sie aus ihren Gedanken. Sie verstand nicht, was er gerufen hatte, da seine Worte von dem spitzen Schrei eines Tieres übertönt wurden. Preiset die Schönheit? Vermutlich. »Preiset die Schönheit, Bruderschwestern!« rief Xanjida, die Priesterin der Zwillinge, und wandte sich zum Gehen.
Ein Tropfen fiel auf ihre Wange. Sie wischte ihn ab und schaute nach oben. Kein Wölkchen zog über den sommerlichen Himmel. Statt dessen entdeckte sie nahezu unmittelbar über sich einen großen Vogel, der etwas noch schwach Zappelndes in den Klauen davontrug, irgendein kleines Tier. Xanjida blickte auf ihre Hand, sah die Fingerspitzen rotverfärbt von dem, was ihre Wange getroffen hatte. Blut, ein einzelner blutiger Tropfen. Das war nicht das beste aller Omen für die Suche nach dem Ort, wo Asboran erbaut werden sollte. Wahrlich nicht.
Imeldes und Marnos glückliche Tage
Sachte, so daß Marno, ihr Mann, nicht geweckt wurde, schlug Imelde die Decke zur Seite, schwang die Beine aus dem Bett und schlüpfte in die zierlichen Pantöffelchen aus rotem Samt, die mit kleinen Perlen aus blauem Glas besetzt waren. Vorsichtig drückte sie sich von der Bettkante ab, warf einen leichten Morgenmantel über und trat zur Tür, die auf den Balkon führte. Leise klimperten die Schnüre des Perlvorhangs, als sie sie zur Seite schob und einen halben Schritt ins Freie tat. Es war noch früh am Morgen, noch nicht sonderlich warm, selbst dort, wo die Sonne die Schatten bereits vertrieben hatte. Imelde schaute hinunter auf den Hof, der öde und verlassen dalag, abgesehen von Porquina, die mit ihren Welpen schnüffelnd heimlief, und der Alten, wie hieß sie noch, Shahane oder so ähnlich. Die alte Frau stand neben einem Eimer, der bis zum Rand mit Wasser gefüllt war, die Hände an die Nieren gedrückt, sich leicht zurückbeugend. Sie wird langsam alt, dachte Imelde mit einem leichten Stirnrunzeln. Wir werden uns bald etwas einfallen lassen müssen.
Alt – sie mochte dieses Wort nicht sonderlich, es schien ihr gewöhnlich und unausweichlich mit fettleibigem Verfall und einem muffigen Geruch verbunden, es klang auf eine bedrohliche Weise schamlos, war wie ein Blick auf die Falten von Satinavs Haut. Sie fürchtete sich vor dem Wort, obwohl sie selbst noch keine dreißig Jahre zählte. Entschlossen riß Imelde ihren Blick von der Frau los und ließ ihn über die schwarzen Hänge des Visra und die bunte Vielfalt der Stadt schweifen, über die Terrassen, wo das Leben schon etwas früher begonnen hatte, bis zur Bucht, deren Wasser im Licht der Morgensonne golden glitzerte. Der Tag war klar, wenig Staub lag in der Luft, in der als verführerisches Parfüm ein leichter Blütengeruch schwebte. Es war einer dieser Frühlingstage, an denen Imelde ihre Stadt liebte. Sie dachte dann stets: Gibt es etwas Schöneres als Al’Anfa im späten Frühling? Imelde konnte es sich nicht vorstellen.
Spielerisch wickelte sie sich eine der Perlenschnüre um den Zeigefinger und ließ den Blick weiterwandern zum Palmenpark, den man ganz gut von hier aus sah. Jahre mußten vergangen sein, seit sie zum letzten Mal dort gewesen war, dachte sie mit Bedauern und erinnerte sich zurück an die Zeit vor ihrer Vermählung, als Marno noch um sie geworben hatte. Damals waren sie und ihre Freunde und Freundinnen oft dort gewesen. Sie waren ein lustiger Haufen, ein wilder, manchmal sogar ein sehr wilder, und die Welt stand noch weit und offen. Das hatte sich geändert, als man beschloß, sittsam zu werden. Für Ivonya und Simodo war die Zeit gekommen, ihr Erbe anzutreten, andere waren von ihren Familien genötigt worden, sich für irgendeine leidige Tätigkeit zu entscheiden, oder hatten geheiratet. Torquinio, von dem es niemand erwartet hätte, hatte plötzlich eine religiöse Anwandlung bekommen und war in den Borontempel eingetreten. Schließlich war da noch dieser Krieg, dieser lästige Krieg gegen die unkultivierten Barbaren der Khom, so daß eines Tages, als Imelde sich umschaute, nur noch Marno übriggeblieben war.
Imelde hatte nicht gehört, daß ihr Gemahl aufgestanden war. Er konnte sich sehr leise bewegen, und so bemerkte sie ihn erst, als er hinter ihr stand, ihr das Haar aus dem Nacken strich, sein Gesicht dagegen drückte und ihre Brüste mit den Händen umfaßte.
Es war nicht wahr, daß sie ihn nur deshalb geheiratet hatte, weil es keinen sonst mehr gab – er hatte ihr immer gefallen. Am meisten seine Nase, diese unglaublich edle Nase, und das Verwegene, leicht Piratenhafte, das ihn umgab. Tatsächlich war er alles andere als ein Pirat, nicht einmal ein Al’Anfaner im engeren Sinne, sondern nur der zweite Sohn eines Plantagenbesitzers aus der Gegend von Mirham. Ein Junge vom Land sozusagen, obwohl er sich stets so gegeben hatte, als wäre selbst das große Al’Anfa wenig mehr als ein kleines Dorf für ihn, als hätte er bereits ganz Dere gesehen. Er hatte viele Geschichten zu erzählen gehabt, bunte, lustige, verrückte, und manchmal hatte er seltsame, auch ein wenig erschreckende Einfälle gehabt, besonders in jener Nacht. Ein heißer Schauer überlief Imelde bei dieser Erinnerung. Sie und Marno hatten später nie darüber gesprochen. Es war ungeheuerlich gewesen, selbst für Al’Anfa. All das hatte zu Marno einmal dazugehört, das war das Traurige: hatte. Etwas Wehmut war mittlerweile in Imeldes Herz geschlichen. Wenn sie es sich recht überlegte, so war ihr Leben früher spannender gewesen, und wenn sie es sich ehrlich eingestand, so war es heutzutage eher langweilig. Sie seufzte laut bei diesem Gedanken.
Der braungelockte Mann hinter ihr mißverstand den Seufzer, was ihn veranlaßte, Imeldes Nacken mit kleinen Bissen zu liebkosen und ihre Brüste zu kneten. »Schsch!« sagte Imelde, löste die Hände ihres Gemahls von ihrem Busen, wandte sich um, schaute in die blaßgrauen Augen, in denen noch der Schlaf hing, und küßte ihn kurz auf die Nase, diese unglaublich edle Nase.
Geschrei schallte aus dem Innenhof, eine barsche, vor Wut überschnappende Stimme, unverkennbar die Stimme Nestorios. »Habe ich es dir nicht schon oft genug gesagt? Hab ich das nicht? Ihr glaubt wohl, ihr könnt hinter meinem Rücken… Was? Hinter meinem Rücken, wie?« brüllte er. Neugierig geworden, zog sich Imelde aus den Armen ihres Gemahls und trat ganz hinaus auf den Balkon, der den gesamten Innenhof umlief. Sie stützte die Hände auf das Holzgeländer und beugte sich hinüber. Unten sah sie Nestorio im Streit mit der Alten. Sein Gesicht und der kahle Schädel waren zornrot, kleine Speicheltropfen sprühten beim Schreien aus seinem Mund. Mit seinen kräftigen Händen hatte er die Arme der Alten gepackt und schüttelte sie. Wie ein lebloses Ding hing sie in seinem Griff, ihr Kopf pendelte vor und zurück. Unvermittelt ließ er sie los, und sie fiel vor ihm zu Boden. Ohne mit seinem Geschrei aufzuhören, lief er vor ihr auf und ab, die Fäuste geballt, die Arme leicht angewinkelt. Irgendwie putzig! dachte Imelde amüsiert.
Der Vorhang klimperte kurz, dann stand Marno neben ihr. Das Kinn energisch vorgeschoben, rief er hinunter in den Hof: »Nestorio! Habe ich dir nicht gesagt, daß ich morgens keinen Lärm dulde?«
Der Schreihals verstummte augenblicklich. Den Kopf gesenkt, die Augen zum Boden gerichtet, antwortete er leise, aber deutlich verstehbar: »Verzeih mir, Herr, verzeih!« in dieser Haltung verharrte er, bis Marno mit einem Schlenkern der linken Hand hinzufügte: »Ist ja schon gut« Der Getadelte wandte sich um zu der Alten, die sich inzwischen aufgerappelt hatte, versetzte ihr einen letzten Schlag mit der flachen Hand auf den Hinterkopf und folgte ihr dann unter die Arkaden, über welche die Ranken der Bugawara mit ihren blaugelben Sternblüten wie ein Wasserfall herabhingen. »Das Schreckliche an ihnen ist, daß sie so ganz und gar unzivilisiert sind und keinerlei Lebensart haben«, stellte Marno mit ehrlichem Bedauern fest und kratzte sich dabei an der Wange. Die Bewegung ließ den Ärmel des blauen Seidenmantels am Unterarm hinabrutschen, so daß die lange weiße Narbe auf der braunen Haut sichtbar wurde. Marno hatte seiner Frau nie erzählt, woher die Verwundung stammte, das heißt, er hatte es schon mehrmals getan, aber es war nie dieselbe Geschichte gewesen. Es schien ihm Spaß zu machen, für Imelde jedesmal eine neue zu erfinden. »Was erwartest du, Schatz?« antwortete Imelde. »Sie sind nur Sklaven. Sollen sie sich benehmen wie wir?« Denn natürlich war auch Nestorio nur ein Sklave, wenn auch der oberste, der Bonze. Marno hatte ihn vor zwei Jahren in der Arena gekauft. Ein guter Mann, jedenfalls dann, wenn man ihn bisweilen an seinen Stand erinnerte.
»Natürlich nicht, Liebste«, entgegnete Marno und kehrte zurück ins Schlafzimmer. »Aber müssen sie immer schreien? Können sie sich nicht einfach still verhalten und tun, was man von ihnen erwartet?«
Imelde folgte ihrem Mann nach drinnen. Er hatte den Seidenmantel abgeworfen, stand jetzt völlig nackt da und war eben dabei, seine Garderobe für diesen Tag zu wählen. Er sah immer noch aus wie vor zehn Jahren, als sie ihn das erste Mal getroffen hatte, stellte Imelde fest, immer noch diese kräftige und doch jungenhafte Figur. Daran hatte sich nichts geändert, während sie selbst etwas, nun, fraulicher geworden war. Kurz dachte sie an die Alte und die düsteren Gedanken, die sie bei ihr geweckt hatte. Sie schüttelte unwillig den Kopf. Es gab Wichtigeres: Welche Kleider sollte sie selbst heute tragen?
Kurzentschlossen, wie es seine Art war, hatte sich Marno für die gelbe Hose aus Elfenbausch, die ihm Imelde zu seinem letzten Tsatag geschenkt hatte, und ein besticktes Leinenhemd aus Drôl entschieden. Er sah stattlich darin aus, fand seine Frau. Er kann tragen, was er will, dachte sie ein wenig neidisch. Ganz im Gegensatz zu ihr selbst. Sie setzte sich an das Frisiertischchen, nahm den kleinen Spiegel in die eine Hand, tauchte mit der andern ein Bauschbällchen in ein Tiegelchen und begann sich zu schminken.
Einige Zeit später, für Marnos Geschmack etwas zuviel später, stiegen er und seine Frau die Treppe hinunter und gingen durch den dunkelgetäfelten langen Gang, an dessen Wänden die von Imeldes Großvater Micirio gemalten Bilder hingen. ›Das einfache Leben auf dem Lande‹, ›Die wüsten Bräuche der Waldmenschen‹ oder ›Al’Anfa bringt den Mohas seine Segnungen‹ stand auf kleinen Holztäfelchen darunter. An einem Morgen wie diesem, wenn er besonders lange auf seine Frau warten mußte, fand Marno die Machwerke schier unerträglich. Nicht genug damit, daß Imeldes Ahn offenbar keinerlei Gefühl für Komposition besessen hatte, er schien auch bar jeder Kenntnis der Dinge gewesen zu sein, die er gemalt hatte. Das einfache Leben auf dem Lande! Dieser Geck hatte wahrscheinlich seiner Lebtag keinen Fuß aus Al’Anfa hinausgesetzt, und was die ›wüsten Bräuche der Waldmenschen‹ anbelangte, so hatte Marno schon mit zehn Jahren offenbar mehr darüber gewußt als Micirio mit sechzig. Schließlich die ›Segnungen Al’Anfas‹. Marno war nicht Zyniker genug, um sich nicht einzugestehen, was diese Segnungen wirklich bedeuteten. Er hatte im Alter von dreizehn Jahren einer dieser ›Segnungen‹ beigewohnt, anschließend war er zwei Tage ›unpäßlich‹, das heißt, er hatte sich vor Entsetzen die Seele aus dem Leib gekotzt. Allerdings war er damals noch ein Kind gewesen, das entschuldigte vieles, sagte er sich, und die Welt war nun einmal so, wie sie war. Wäre es nach ihm gegangen, dann wären diese Schinken schon lange abgehängt worden und in einer düsteren Kammer weitab verschwunden, doch Imelde wollte dies nicht gestatten.
Endlich hatten sie das Speisegemach erreicht. Es war ein heller Raum, dessen Wände bis in Hüfthöhe mit gelben Fliesen verblendet waren, auf denen sich in Unauer Blau Tiere und Pflanzen tummelten, umgeben von omamentalen Schlangenlinien in Purpur und Meergrün. Diese Kacheln umrahmten auch Türund Fensterbögen. In einer Ecke des weißgetünchten Raums stand ein Mohakrieger aus dunklem Holz, in der Hand einen Speer und auf dem Kopf eine Krone aus leicht verstaubten weißen Federn. Ernst und regungslos starrte er über den langen Tisch mit den hochlehnigen Stühlen hinweg, zu den halboffenen Fenstern mit den bleigefaßten Rauten aus gelbem Glas. Er hatte schon seit Jahren keine Nase mehr – ein Werk KleinImeldes, ebenso wie die Schriftzeichen auf seiner Brust, die sie dort als Kind eingeritzt hatte. Ein waagrecht an der Wand hängender Sklaventod, darüber ein Kranz Messer und Dolche aus vielen Teilen Deres – Mengbillaner, Borndolche, Waqqifs, nivesische Wolfsmesser, nostrische Rundschäler –, ebenfalls Hinterlassenschaften von Großvater Micirio, vervollständigten die Einrichtung des Raumes.
Marno und Imelde hatten eben an den gegenüberliegenden Enden des Tisches Platz genommen, als die Tür aufgerissen wurde und laut lärmend Diago und Thesares hereinstürmten. »Kinder!« mahnte Marno nachdrücklich und brachte damit den Jungen und dessen kleine Schwester zum Verstummen. »Guten Morgen, Herr Vater und Frau Mutter!« krähte der Achtjährige, während sich seine Schwester wie immer schüchtern hinter ihm verbarg. »Setzt euch!« sagte Imelde, und beide schwangen sich auf die Stühle zu ihren Seiten, die etwas zu hoch für sie waren. Sogleich begannen sie, auf ihre Mutter einzuplappern. Froh, daß sie ihm noch eine Weile seine Ruhe lassen würden, doch schon mit Freude und einem gewissen Stolz, betrachtete Marno die Dreiergruppe am Ende des Tisches. Diago ähnelte sehr seiner Mutter: Er hatte die gleichen schwarzglänzenden Haare mit dem feinen Rotschimmer und ebenfalls die kleine, leicht rundliche Nase, während Thesares mit ihrer braunen Löckchenpracht und der schmalen Nase mehr ihrem Vater glich. Fast als hätte sie seine Gedanken gehört, schaute das Mädchen lächelnd zu ihm herüber. Er zwinkerte ihr zu. Welch schöne Kinder er doch hatte!
Vorsichtig wurde die Tür ein weiteres Mal geöffnet und das Frühstück hereingebracht, reichlich für den Herrn des Hauses, kärglich für dessen Dame und die Kinder. Marno hatte sich nie an das lächerliche alanfanische Frühstück gewöhnen können und zu Imelde, die wie immer an einem Saft nur nippen und lediglich eine halbe, selten eine ganze Perainfrucht zu sich nehmen würde, oft genug gesagt: Es ist ein Erbe meiner Ahnen, daß ich morgens hungrig bin, es ist ihr Blut, das in mir spricht. Doch soweit er sah, sprach dieses Blut weder in Thesares noch Diago. Wahrscheinlich lag es daran, daß sie in der Stadt aufgewachsen waren und nicht wie er am Rande des Dschungels.
Heute war es die Aufgabe der jungen Querinia, den Herrschaften ihre Speise zu bringen. Sie war ein Mädchen von gerade siebzehn Jahren, mit kupferfarbener Haut und flachsblonden Flechten. Ihr Gesicht war eher unscheinbar und ohne markante Linien, wurde aber beherrscht von einem Paar faszinierender brauner Augen, deren Leuchten heftig gegen die sonstige Durchschnittlichkeit ihres Antlitzes rebellierte. Wegen dieser braunen Augen überlegte Marno seit mehreren Wochen, ob er nicht einmal zu der Sklavin gehen sollte. Für gewöhnlich interessierte er sich nicht für so junge Frauen, doch Querinia wirkte älter auf ihn, als sie war.Überdies war sie von üppigen Formen, soweit man es unter der derben Sklavinnenkleidung erahnen konnte. Andererseits liebte es Marno, anschließend zu reden, und was sollte man mit einer Sklavin schon groß reden? Vermutlich würde es sich als schaler Genuß erweisen. Sicher, er hatte Freunde, denen es gleichgültig war, ob sie mit einer Frau oder einer Sklavin das Lager teilten, aber dieser Ansicht war Marno nicht. Und so ein dummes Ding, wer wußte schon, wie sie sich anstellte?
Es waren andere Zeiten gewesen, als er noch zu Hause auf der Plantage lebte. Da hatte es eine gegeben, ihren Namen hatte er im Lauf der Jahre vergessen, die anders gewesen war: ein wildes kleines Tier, heißblütig und lebendig wie der Urwald. Ihm war fast das Herz gebrochen, als sein Vater sie an einen Nachbarn verschenkt hatte. Zum Glück war sie nicht die einzige auf dem Landgut, die sich glücklich schätzte, wenn der junge Herr Marno sie beehrte, das ließ ihn seinen Schmerz vergessen. Er war damals noch jung, doch später hatte er derlei Gewohnheiten aufgegeben. Es schien ihm nicht mehr angebracht.
Während das Mädchen die Schalen und Tabletts auftischte, wechselte sein Blick hin und her zwischen ihren baumelnden Brüsten, die sich gegen ihre Bluse drückten, den Halbkugeln ihres Hinterns, den bloßen Fesseln, den nackten Füßen und den zierlichen Händen. Er überlegte, wie sie wohl wäre, starr wie ein Brett oder einfallsreich wie… Tapupa! Wie lange hatte er an diesen Namen nicht gedacht! Unvermittelt schaute ihn das Mädchen aus ihren vielversprechenden Augen an. Zwei Herzschläge lang starrte Marno zurück, dann entschied er, daß es nicht angemessen wäre, wenn ein erwachsener Mann sich mit einer Sklavin paarte. »Du kannst gehen!« sagte er gnädig und fing an zu essen.
Querinia schloß die Tür zum Eßgemach hinter sich und lief den Gang mit den vielen Bildern, die so düstere Geschichten erzählten, hinunter zum Treppenhaus. Erst auf den Stufen zum Erdgeschoß wurde das beklemmende Gefühl in ihrer Brust etwas schwächer. Sie mochte es nicht, wie der Herr sie seit einiger Zeit ansah. Vor allem seitdem ihr die dicke Curma ungefragt erklärt hatte, daß der Herr sie wahrscheinlich bald werde zu sich kommen lassen, was eine große Auszeichung sei. Shalima hatte dem widersprochen, der Herr habe das noch nie getan. Neidisch sei sie, hatte Curma daraufhin lachend geantwortet, nur neidisch, weil bei Shalima schon lange niemand mehr auf solche Ideen gekommen wäre. Shalima hatte danach nichts mehr gesagt.
Querinia eilte durch den Hof, passierte den Durchgang, der zum Sklavenhof führte, und ging in die Küche, an deren Wänden kupferne und eiserne Pfannen und Töpfe hingen. Curma stand am Tisch, so daß man nur ihren Rücken sehen konnte, und knetete Teig, während die alte Shalima auf der Bank saß und mit geschlossenen Augen ihren Ellbogen rieb. Bisweilen verzog sich ihr faltiges vergilbtes Gesicht, das auf der einen Seite geschwollen und bläulich verfärbt war, vor Schmerz. »Ist es noch nicht besser?« fragte Querinia die grauhaarige Alte. »Sie stellt sich nur an«, kam es von Curma. Die Köchin drehte sich um, einen länglichen Fladen mehlbestäubten Teigs in der Hand: »Ein dummes Weib ist sie. Habe ich ihr nicht gesagt, sie solle sich vor Nestorio hüten? Jeder weiß, wie es ist, wenn der es auf einen abgesehen hat. Aber nein, sie hört ja nicht. Ja, sagst du, habe ich gesagt, ja, sagst du, zu allem, was er sägt, egal was. Jetzt schau, was du davon hast!« Zornig wandte sie sich wieder um, schlug den Teigfladen auf den Tisch und hieb ihn mit der Faust platt. »Er ist so ein boshafter Mensch!« stöhnte die Alte und schaute mit feuchten Augen zu Querinia auf. Das Mädchen starrte hilflos zurück, sie wußte nicht, was sie darauf antworten sollte. Schließlich, um doch etwas zu entgegnen, sagte sie: »Er führt sich auf, als wäre er etwas Besseres als wir.«
Curma schlug noch einmal kräftig auf ihren Teig und kam dann vom Tisch zu den beiden. Mit einer raschen Bewegung packte sie das Mädchen am Kinn, so daß sich ihr Daumen und ihr Zeigefinger in seine Wangen gruben. »Und ob er etwas Besseres ist. Er ist der Bonze! So weit steht er über dir wie Herr und Herrin über Nestorio. Was bist du denn schon? Bildest dir wohl etwas ein, dummes Ding, nur weil der Herr ein Auge auf dich geworfen hat? Nichts bist du, nichts, gar nichts.« Sie ließ das Mädchen los und zischte leise: »Mach so weiter, und du bist die nächste. Sei froh, daß es nicht dich trifft. Hast wohl vergessen, wie es ist, wenn er dich auf dem Kieker hat, was?« Querinia, auf deren Wangen sich die Abdrücke von Curmas Fingern rot abzeichneten, schüttelte den Kopf. Sie hatte es nicht vergessen.
Pfeifend kam Sica zur Türe herein, ein Mann von nußbrauner Haut und wenig helleren Zahnen. Er teilte seit geraumer Zeit das Lager der Köchin. »Nun sitzt nicht den ganzen Tag faul rum und schafft endlich etwas!« herrschte Curma die anderen beiden schroff an und begrüßte mit glänzendem Lächeln ihren Liebhaber. Während sie tuschelten und lachten – Curma gurrend, Sica meckernd –, trat Querinia zum Trog, wo der Abwasch stand. Sie nahm einen mit Essensresten verkrusteten Topf, tauchte ihn ins Wasser und scheuerte ihn. Dabei dachte sie, daß Curma sicherlich recht hatte. Es wäre nicht gut, wenn Nestorio den Eindruck bekäme, sie könnte Mitleid mit der Alten haben. Er würde wütend darüber werden, und statt Shalima würde er dann sie piesacken. Es war besser, wenn sie sich von ihr fernhielt, solange der Bonze einen Groll gegen sie hegte. Es wäre klüger. Andererseits, die Alte tat ihr leid. Mit zusammengepreßten Zähnen scheuerte sie auf dem Topf herum und versank in einem Tagtraum, in dem sie Bonze war. O Nestorio, o Nestorio, dachte sie, wobei sich ihre Lippen zu dünnen Linien über die Zähne zurückzogen.
Wenig später kam eine der Beschützerinnen herein, eine Frau mit kantigem Gesicht, an ihrer Hüfte baumelte ein Säbel. Sie warf der fetten Köchin, die sich bei ihrem Eintreten von ihrem Galan abgewendet hatte, einen scharfen Blick zu, worauf diese hastig eine Schale mit rotem Linsenbrei füllte. Anschließend schnitt sie ein Stück von dem langen Laib Brot ab, ebenso von einem Dörrschinken, der von der Decke hing. Alles zusammen reichte sie der Beschützerin, die auf jener Ecke des Tisches saß, wo eben noch die Köchin ihren Teig geknetet hatte. Wortlos nahm sie die Speisen entgegen und verzehrte sie langsam kauend, den Blick zur Tür gewandt, auf den Hof hinausspähend.
Querinia schaute von ihrem Abwasch hoch. Sie sah, wie Curma zum Herd ging, um das Feuer zu schüren, und dabei wortlos die alte Shalima zur Seite schob, die dort gerade hantiert hatte. Sie sah Sica, der auf einmal nicht mehr wußte, was ihn in die Küche geführt hatte, zur Tür hinaushuschen. Sie sah kurz Nestorio seinen Kopf hereinstrecken, der martialischen Frau einen unbeantworteten Gruß zunicken und wieder verschwinden. Sie sah die Frau auf der Tischkante mit der Tätowierung auf dem Arm, die ähnlich und doch völlig anders war als das Familienwappen auf ihrem Arm oder dem Arm von Curma, Shalima oder Nestorio. Sie sah diese kräftige Frau, die nur mit sich selbst beschäftigt kaute und die vielleicht nicht einmal wahrgenommen hatte, wer sich alles in der Küche aufhielt. Sie spürte, daß Curma recht gehabt hatte: Sie war gar nichts, über ihr stand Nestorio, darüber die Beschützerin, darüber standen die Herrschaften, und vielleicht anschließend, vielleicht auch noch etwas später kamen die Götter. So war die Welt, so war sie nun einmal.
Den frühen Nachmittag verbrachte die Familie auf dem Dach des Hauses, das von einem niedrigen Mäuerchen mit roten Ziegelzinnen umrandet war. Leintücher waren zum Schutz gegen die Sonne gespannt worden, wenige Pfützen, die in der Hitze rasch kleiner wurden, zeugten vom mittäglichen Regenguß. In einem Rohrsessel, ein geöffnetes schmales Büchlein auf den Knien, saß Marno und döste. Ein Stück von ihm entfernt saß Imelde, zu ihren Füßen der kleine Diago, weiter abseits Thesares mit Porquinia und ihren Jungen. Das kleine Mädchen hatte sich einen Welpen geschnappt, streichelte ihn und kraulte ihn am Bauch. Ab und zu öffnete Porquinia träge eines ihrer Augen, um nachzusehen, ob auch alles seine Richtigkeit hatte.
»Also noch einmal! Wie heißen die großen Familien?« fragte Imelde ihren Sohn. Wenig begeistert und lustlos, die Augen bei seiner Schwester und den Hunden, zählte der Junge auf: »Bonareth, Florios, Karinor, Kugres…« Er stockte und schaute hoch zu seiner Mutter.
»Nun sag schon, Schätzchen, einer wird dir doch noch einfallen?« munterte sie ihn auf.
Ratlos knabberte Diago an seiner Unterlippe, bis es fragend aus seinem Mund kam: »Honak?« – »Nein, mein Goldstück«, korrigierte Imelde, »die Honaks gehören nicht zu den acht Familien. Der Name ist zwar wichtig, denn der Patriarch ist ein Honak wie vor ihm sein Vater und Großvater, aber sie gehören nicht zu den acht Familien. Also noch einmal.«
Während der Junge einen weiteren Versuch unternahm, die Namen der Mächtigen der Stadt zusammenzustammeln, dachte Imelde daran, wie schwierig es doch war, ihren Kindern etwas beizubringen. Sie wußte, daß sie ihnen keine gute Lehrerin war, zumal der Unterricht auch ihr keinerlei Freude bereitete. Doch irgendwann mußten die Kinder die wichtigen Dinge des Lebens erlernen, und ihr Vater war ein noch schlechterer Lehrer, da er schnell ungeduldig wurde. Sie seufzte: Welch eine Last!
Imelde bemerkte, daß ihr Sohn verstummt war und sie jetzt erwartungsvoll anschaute. Ihr fiel auf, daß sie keine Ahnung hatte, was er zuletzt gesagt hatte, und da sie nicht zugeben wollte, daß sie mit ihren Gedanken woanders gewesen war, fragte sie ihn: »Sind das jetzt alle?« Mit einem listigen Aufblitzen in den Augen antwortete Diago: »Ja, Mutter, alle zwölf.«
Imelde kniff ihn in die Nase: »Es sind aber insgesamt nur acht, mein Sternchen, also noch einmal.«
Aus der Luke, die zur Stiege nach unten führte, tauchte Nestorios kahler Schädel auf. Als der bullige Mann ganz herausgeklettert war, blieb er regungslos stehen. »Was gibt es?« fragte Imelde. »Eine Depesche ist für dich abgegeben worden, Herrin«, antwortete er. Imelde winkte ihn heran, nahm das versiegelte und gefaltete Pergament entgegen und studierte die Aufschrift. Die Handschrift war ihr unbekannt. Sie erbrach das Siegel, faltete das Pergament auseinander und überflog die sauber geschriebenen Zeilen – bestimmt das Werk eines Schreibers – bis sie den Namenszug der Unterschrift fand.
»Der Brief ist von Zor, Marno!« rief Imelde begeistert. »Er ist von Zor!«
»Welchem Zor?« entgegnete ihr Mann.
»Zordaphero Vuxphez! Erinnerst du dich nicht? Wie seltsam, noch heute morgen mußte ich an ihn und die anderen unserer alten Freunde denken! Zor, Zor, wie lange haben wir nichts mehr von ihm gehört!«
»Zor, tatsächlich Zor?« fragte Marno nach und beugte sich neugierig aus seinem Sessel vor. Früher war Zor ihm fast ein Bruder gewesen. »Wie geht es ihm?« drängte er. »Was treibt er, was hat er erlebt in. all den Jahren?« Dann, nach einer kleinen Pause: »Was will er? Gold? Sind es die Oreales, wegen denen er sich plötzlich an seine alten Freunde erinnert?«
»Du bist garstig«, antwortete seine Frau, ohne von dem Schreiben aufzusehen. »Es geht ihm wohl ganz gut. Er ist mit dem Stab des MarschallGubernators du Metuant nach Port Corrad gelangt und scheint dort inzwischen recht große Ländereien zu besitzen. In Port Corrad, stell dir das vor! Schatz, wo liegt Port Corrad?«
Marno dachte einen Augenblick lang nach: »Ich meine, irgendwo bei Selem, zumindest nicht allzuweit weg davon!«
Imelde schaute von dem Brief hoch: »Selem, meine Güte!« Nach allem, was sie von Selem wußte, paarte sich dort die Hälfte der Bewohner mit den Echsenmenschen aus den Sümpfen, während die andere Hälfte schlichtweg verrückt war. Bei Boron, Selem! Sie schüttelte sich in einem angenehmen Schauer des Entsetzens. Da konnte nicht viel dazu gehören, zahllose Rechtmeilen sein eigen zu nennen! Vor ihrem geistigen Auge sah sie den bemitleidenswerten Zor auf der Veranda seines Pfahlbaus sitzen und über endlose Weiten Sumpflands stieren, während ein schuppenhäutiger Diener oder Sklave unter vielen Verbeugungen näher trat, ein Tablett mit einer Tasse Tee in den Händen, und mit gespaltener Zunge zischelte: »H’rr, noch etw’ss Tt’hee?« Sie reichte Marno den Brief: »Bei Selem, der Arme, ist es nicht schrecklich?«
Marno las nun seinerseits das Schreiben, wiederholte dabei einige Sätze, die er gelesen hatte, laut und schloß dann: »Ich glaube, du hast falsche Vorstellungen, Liebste. Port Corrad ist schließlich nicht Selem. Und selbst wenn… Oderin du Metuant hätte sich nie dorthin schicken lassen, wenn es dort nichts zu holen gäbe.« Er blickte auf Nestorio: »Was ist, warum bist du noch da?«
»Verzeih, Herr, doch der Bote brachte noch mehr«, erklärte Nestorio.
»Ich weiß«, antwortete sein Herr etwas ungeduldig, »in dem Brief ist die Rede von einem Geschenk. Hast du es nicht unten abgestellt?«
»Es ist kein Gegenstand, Herr.«
»Was dann?«
Statt einer Antwort beugte sich der Bonze über die Öffnung der Luke: »Komm herauf!«
Imelde zog erstaunt die Brauen hoch. Es lebte? Ein Tier? Doch es verstand auch, also konnte es wohl kaum ein Tier sein. Also mußte Zor… Er hatte ihnen doch nicht am Ende eines dieser gräßlichen Echsenwesen geschickt? Nein, nicht Zor, so skurril war sein Humor nicht – andererseits, die Jahre mochten vieles bewegt haben.
Doch statt einer schuppigen Gestalt mit gezacktem Kamm auf dem Haupt, wie Imelde es trotzdem insgeheim erwartet hatte, kam aus der Luke ein völlig normaler Mensch. Er mochte Mitte Zwanzig sein, Haare und Augen schwarz, das Gesicht verwechselbar, die Haut hellbraun. Nicht überaus kräftig, doch allem Anschein nach in guter Verfassung.
»Wie drollig!« kommentierte Imeldes Gemahl. »Zor hat uns einen Sklaven geschickt. Ich sage dir, er tut das nicht ohne Grund, irgend etwas will er von uns,« Er nahm abermals den Brief in die Hände, überflog ihn ein weiteres Mal, fand jedoch nichts, das auf irgendwelche verborgenen Absichten des Absenders schließen ließ. Er sprach zu dem jungen Mann: »Es wird ja wohl irgendwelche Gründe haben, daß unser Freund dich geschickt hat. Hast du besondere Fähigkeiten?«
Ohne zu zögern, antwortete dieser: »Ich kann lesen und schreiben, Herr, und auch ein wenig rechnen,«
Imelde verdrehte die Augen zum Himmel: »Sonderlich gut erzogen ist er jedenfalls nicht. Selem – meine Güte!«
Nestorio zischte zu dem Schwarzhaarigen: »Diener sagen Herr, Sklaven nicht. Außer mir. Auch hast du nur über mich zu reden, wenn der Herr oder die Herrin dich nicht mit Namen ansprechen.« Dabei betonte er ›Herr‹ und ›Herrin‹ als Zeichen seiner privilegierten Stellung. Der Gemaßregelte antwortete nicht, sondern blickte nur mit unbewegtem Gesicht zurück.
»Wie kann ein Sklave lesen und schreiben lernen?« fragte Imelde weiter.
Der Angesprochene warf seinen neuen Herrschaften unter halbgesenkten Lidern einen verstohlenen Blick zu. Er ließ ihn von dem Mann mit den geölten Löckchen und der herrischen Rabennase zu dessen um einige Jahre jüngeren Frau wandern, deren brauenlose, stark umschminkte Augen eng beieinanderstanden, und dann zurück zum großporigen Gesicht des Bonzen. Ihm antwortete er: »Ich war einst Praiosschüler in Neetha,« Der Bonze wußte gewiß nicht, wo Neetha lag, und Imelde kümmerte es nicht, wie ein einstiger Praiosschüler Sklave ihres Freundes Zor werden konnte. Ein Gedanke keimte in ihr. Marno kommentierte das Gehörte mit einem lächelnden Blick auf seinen neuen Besitz: »Er lernt schnell, so schlimm scheint es in Port Corrad dann doch nicht bestellt zu sein. Zor hat uns wirklich ein wertvolles Geschenk geschickt, einen Sklaven, der lesen und schreiben kann! Allerdings weiß ich augenblicklich nicht, wofür wir ihn verwenden sollen.« Er griff abermals nach dem Brief: »Warum diese Großzügigkeit? Ob er einfach angeben will?«
Marno kam nicht mehr dazu, abermals den Brief bis zu seinem Ende nach einem verdächtigen Hinweis zu durchforsten, denn Imelde hatte einen Entschluß gefaßt. »Wenn du keine Verwendung für ihn hast, Schatz, so weiß ich eine: Er könnte der Hauslehrer der Kinder werden. Er könnte Diago und auch Thesares das Lesen und Schreiben beibringen. Als ich in Diagos Alter war, hatte ich ebenfalls einen Hauslehrer. Er war ein alter Sklave mit weißen Haaren, der stets etwas gebeugt ging. Manchmal nannte ich ihn scherzeshalber Großvater. Er sah wirklich aus wie ein solcher. Ich meine, alle Kinder müßten so einen Großvater haben.«
Vergessene Erinnerungen an ihren alten Lehrer überkamen Imelde, ein Kaleidoskop verblichener Bilder. Wie sanftmütig er doch gewesen war, und wie geduldig er ihr alles so lange erklärt hatte, bis sie es verstand! Aus der Vergangenheit meinte sie, seine alte brüchige Stimme zu hören. Liva hatte er geheißen, Großvater Liva. Welch ein Unglück, daß er so früh gestorben war, gleich nach ihrem elften Tsatag!
Dies war ein Teil von Imeldes Erinnerungen, den sie am liebsten ganz vergessen hätte. Es hatte einen Streit gegeben zwischen ihr und ihren Eltern, einer Geringfügigkeit wegen, jedenfalls sah sie es heute so. Sie hatte sich zu ihrem Tsatag ein Pärchen Goldleiern gewünscht und sich seit Tagen darauf gefreut, ihnen einige Worte beizubringen. ›Imelde!‹ sollten sie rufen und ›Großvater Liva!‹. Doch am Tsatag bekam sie keine Goldleiern, sondem statt dessen Avesfinken. Hübsche Vögelchen, die wunderbar sangen, nur leider nicht sprachen. Imelde war deswegen furchtbar enttäuscht gewesen und hatte sich ungeliebt, zurückgesetzt und sehr gedemütigt gefühlt und deshalb aus Bosheit und schierem Trotz Großvater Liva während eines Spaziergangs an den Hängen des Visra einen Stoß versetzt, so daß er einen Abhang hinuntergestürzt war und zu Tode fiel. Ihre Eltern waren darüber sehr aufgebracht gewesen und hatten sie geschlagen, das einzige Mal in ihrer Kindheit. Zwar nicht während der Züchtigung, aber doch später hatte sie eingesehen, daß sie die Strafe verdient hatte.
»He, du«, befahl Imelde dem Schwarzhaarigen, »geh ein paar Schritte!«
Mit federndem Schritt ging der junge Mann bis zum Ende der Terrasse und drehte sich um.
»Geh langsamer«, forderte ihn Imelde auf, »tu so, als wärst du ein alter Mann!«
Der Sklave verharrte einen Herzschlag lang, dann ging er langsam, steifbeinig und mit dem richtigen Quentchen Unsicherheit in seinen Bewegungen den Weg zurück.
Imelde war sehr zufrieden. »Er ist wirklich ungemein gelehrig«, sagte sie zu Marno.
»Was hast du vor?« fragte er.
»Ich sprach doch von meinem einstigen Hauslehrer«, erklärte sie, »und ich dachte, wenn der Bursche sich anders bewegt und wir ihm die Haare bleichen, vielleicht noch kräuseln und ausdünnen…«
Marno lachte in sich hinein. Er mochte diese kleinen Verrücktheiten Imeldes. Er schloß die Augen, dachte mit ernstem Gesicht nach und öffnete sie wieder.
»Ja, ich kann es mir vorstellen«, sagte er. »Du, geh noch einmal.«
Abermals schlurfte Zors Geschenk zum Ende der Terrasse.
»Immer noch ein bißchen wie ein Junger, der sich ausgibt für einen Alten«, urteilte Imeldes Mann.
»Findest du? Wenn er lange genug übt, wird sich das legen«, gab Imelde mit einem leicht trotzigen Unterton zurück.
»Bestimmt. Aber wäre es nicht besser… He, du, mach einen Buckel… Schieb die Schultern etwas vor, laß die Arme mehr hängen… Jetzt streck den Kopf noch etwas weiter vor!«
Während der Sklave vor ihnen auf und ab ging, verwandelten sich seine Bewegungen unter Marnos Anweisungen immer mehr zu denen eines Greises. Imelde klatschte vor Freude in die Hände und warf ihrem Gemahl einen zärtlichen Blick zu. Wie schlau Marno doch war! Ja, so würde es passen.
»Hat er schon einen Namen?« fragte ihr Gatte.
Sie zuckte mit den Schultern: »Du kennst doch den Brief. He, du, wie hat dich dein Herr Zordaphero genannt?«
»Zurbaranzisco«, antwortete der neue Sklave, wohlbedacht darauf, es nicht seiner Herrin zu sagen, sondern dem Bonzen, der mit abwesendem Blick vor ihm stand.
»Welch scheußlicher Name!« rief Imelde aus. »Du wirst ab heute Liva heißen. Kannst du dir das merken, Liva?«
»Ja«, antwortete er und wandte dabei den Blick von dem Bonzen ab und seinen neuen Gebietern zu.
»Nestorio«, ergriff nun Marno das Wort, »Liva wird hungrig sein, also zeig ihm die Küche. Wenn er fertig gegessen hat, soll ihn Zeradia zu einem Barbier bringen, damit seine Haare gerichtet werden. Etwas Schminke wäre vielleicht auch ganz gut. Außerdem muß das Familienzeichen… Ach, schick sie einfach her, damit ich es ihr erkläre. Du machst derweil eine Kammer für ihn frei. Er ist der Lehrer meiner Kinder und soll nicht mit den anderen hausen. Und jetzt ab!«
Der Oberste aller Sklaven nickte knapp und ging voran zur Luke, gefolgt von dem Neuen, der sich dabei entspannte und zu seinen natürlichen Bewegungen zurückfand.
»Liva!« rief Imelde scharf. »Wie sollst du gehen?« Liva nahm die verkrampfte Haltung wieder ein.
Nur Curma und Querinia waren in der großen Küche, als Liva sie betrat. Er schaute sich flüchtig um und trat zu dem Mädchen. »Ich habe Hunger, Maid«, sagte er. »Wenn du mir etwas zu essen geben könntest?« Querinia blickte unsicher auf den Fremden, von dem sie nicht wußte, wer oder was er war. »Ich bin neu im Besitz unserer Herrschaften«, erklärte er. »Ich werde der Hauslehrer ihrer Kinder sein. Und wenn du mir jetzt etwas zu essen geben könntest… Ich habe wirklich Hunger, Maid.«
Querinia füllte eine Schale mit Linsenbrei. Sie war verwirrt, da sie nicht einschätzen konnte, welches die Stellung des Neuen war. Als Sklave stand er natürlich unter den Beschützern und wahrscheinlich auch unter Nestorio, aber stand er jetzt über ihr, oder war er ihr gleichgestellt? Das war eine schwierige Frage.
»Nun mach schon, Maid«, kam es spöttisch von Curma. »der Herr hat Hunger, Maid.«
Querinia errötete und reichte Liva die Schale. Er nahm sie entgegen und sagte dabei laut: »Ich wußte nicht, daß Kröten sprechen können.«
Querinia lachte nicht, aber ein fröhlicher Funke blitzte in ihren Augen auf. Für Liva war er wie ein einzelner Sonnenstrahl während der Regenzeit. Liva grinste zurück: »Ich heiße Liva, und welches ist dein Name?«
»Querinia. Und das ist Curma. Sie ist die Köchin. Ich helfe ihr.«
»Hast du nichts Besseres zu tun als zu schwatzen, du faules Ding?« kam es grob von der Dicken. »Soll ich denn immer alles allein machen?«
Das Mädchen blickte zur Köchin, dann zu Liva, und als dieser nichts sagte, ging sie wieder ihrer Arbeit nach. Der Schwarzhaarige hatte nichts dagegen eingewendet, daß Curma sie von ihm weggerufen hatte, also war er ihnen wohl gleichgestellt.
Schweigsam aß Liva zu Ende, dann gab er Querinia die Schale zurück. Im Hinausgehen zwinkerte er ihr noch einmal aufmunternd zu. Nachdem er schon einige Zeit fort war, schlug Curma das Mädchen. Als Kröte wollte sie sich nun doch nicht bezeichnen lassen.