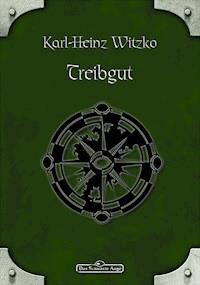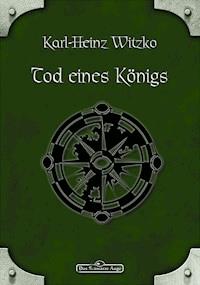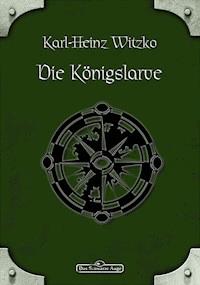Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
Die übliche Verfahrensweise besteht darin, daß der Auftraggeber an die Bruderschaft herantritt. Heißt der Zweite Finger sein Anliegen gut, so bestimmt er einen von uns, sich der Sache anzunehmen, worauf der oder die Erwählte für einen stillen oder spektakulären Tod des Opfers sorgt. Bei der Erledigung unserer Arbeit kommen wir meist den Wünschen des Auftraggebers nach - aber nicht immer. Schließlich sind wir keine Unmenschen. Doch nun zu dir, Bruderschwester ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karl-Heinz Witzko
Spuren im Schnee
Ein Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©
Originalausgabe
Impressum
Ulisses SpieleBand 20
Kartenentwurf: Ralf Hlawatsch E-Book-Gestaltung: Christian Lonsing & Michael Mingers
Copyright © 2015 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN, DERE,MYRANOR, RIESLAND, THARUN und UTHURIA sind eingetragene Marken der Significant GbR.Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.
Print-ISBN3-453-11933-9(vergriffen) E-Book-ISBN9783957524584
Widmung
Der Autor bedankt sich für magiekundliche Beratung bei:
A‘Sar al‘Abastra, einer Magistra mit bewegter Vergangenheit,
Doctor Drinji Barn, einem alternden Magier mit Schuppenproblemen,
und bei Hofmagus Melwyn Stoerrebrandt, dem scharfäugigen Diener seines Kaisers,
im wirklichen Leben auch als Lena, Lars und Stefan bekannt.
Es gab keine Indizien, aber das mußte nicht heißen, daß keine Verbrechen begangen wurden.
– HANIF KUREISHI
Güter und Schlächter
Das Gute, das Schlechte, das Lichte, die Düsternis und eine Frage: Kann das Gute das Schlechte gebären?
Die Erfahrung, daß die Folgen des Guten nicht zwangsläufig gut sind, ist uns auf unheilschwangere Weise vertraut. Dennoch beharren wir darauf, daß das Gute immer zum Guten führen wird und daß, falls einmal Gegenteiliges geschieht, sich irgendein unverständlicher Unfall zugetragen haben muß. Denn anders kann es nicht sein. Also sagen wir etwa: Die Ansätze und Absichten waren gut, oder: Hier wurde des Guten zuviel getan. Es klingt wie eine Ausrede, als steigere man gut so: gut, besser, am besten, zuviel. Ja sogar wie eine Warnung, wie eine Mahnung, daß es eine Grenze geben könnte, deren Überschreiten die Götter nicht dulden, deren Überqueren sie als Hochmut und Hoffart bestrafen.
Sind die Götter gut?
Ein Geweihter der Zwölfgötter, so man ihn danach fragte und so er nicht sogleich nach der Heiligen Inquisition riefe, die dann alsbald mit guß- und schmiedeeisernem Gerät erschiene und begänne, statt seiner die fällige Antwort zu geben, würde die Frage vielleicht so beantworten: Sie sind gerecht. Und was das Gute anbelange, so wisse ein jeder, daß es ständig verteidigt werden müsse gegen die Schergen des Namenlosen und die dämonischen Kreaturen aus den Verliesen der Niederhöllen.
Er würde es weder sagen noch denken, aber es käme dennoch über seine Lippen: Daß das Gute schwächlich sei und ohne eigene Kraft, daß es ständig gepflegt und gehätschelt werden müsse, um nicht zu verdorren. Daß es ihm sonst nicht anders erginge als einem Reisfeld auf der schwülen Insel von Maraskan, das – nicht mehr bestellt von den Händen seiner Bauern, seiner Leibeigenen oder der zur Zwangsarbeit verurteilten Sträflinge – rasch wieder zu dem wird, was es ursprünglich war, nämlich ein Teil des natürlichen Dschungels.
Das Gute, das Schlechte, das Lichte, die Düsternis und eine weitere Frage: Kann das Schlechte das Gute zeugen?
Die Vorstellung, daß aus etwas Schlechtem etwas Gutes entstehen könnte, ist unheimlich. Sie klingt wie eine Einflüsterung des Namenlosen Gottes, wie eine Ausdünstung des lügnerischen Amazeroths, des Dämonenfürsten und ewigen Gegenspielers der weisen Hesinde. Sie ist wie ein Hämmern an den Grundfesten der Welt, ja gar Alverans, der Heimstatt der Götter. Denn wenn das Schlechte sich so wider seine Natur verhalten kann, daß es Elternteil des Guten wird, woher wollen wir dann noch wissen, was das Gute vom Schlechten trennt, was das eine ist, was andere, und ob das, was wir immer als gut erachteten, nicht jederzeit Schlechtes gebären kann? Also klammern wir uns, falls wir derlei Ungemach beobachten, in weißknöcheliger Verzweiflung an die Hoffnung, daß etwas Gutes in jenem Schlechten war, daß es einen guten Kern gab, der letztendlich obsiegte. Wir werden uns davor hüten zur Kenntnis zu nehmen, daß wir jetzt anders argumentieren als zuvor, daß wir nicht von Unfällen sprechen, die dem Schlechten widerfuhren, und von keinem Zuviel an Schlechtem. Täten wir es nicht, so wäre das Leben Willkür.
Doch wie wollen wir eine Zeit beurteilen, in der etwas Schlechtes die Ursache von etwas Gutem ist? Sagen wir: Wie schrecklich sind diese Zeiten, wenn schon das Schlechte Gutes gebären muß? Oder: Wie glücklich sind diese Zeiten, wenn selbst das Schlechte Gutes zeugt?
Das Gute, das Schlechte, das Lichte, die Düsternis und – vorerst – eine letzte Frage: Kann Licht aus Düsternis, kann Düsternis aus Licht entstehen? Die Antwort ist banal, es geschieht jeden Tag, morgens und abends.
Für die Bewohner des rebellischen Maraskans, der Insel, die auch nach dreißig Jahren Besatzung durch das Heer aus dem fernen Gareth nicht zur Ruhe gekommen ist, sind solche Überlegungen eher unbedeutend. Ihre Götter sind Rur und Gror, die Göttlichen Zwillinge, die gleichzeitig Brüder und Schwestern sind. Als Rur vor mehr denn fünftausend Jahren den Weltendiskus als Geschenk für seinen Bruder oder ihre Schwester erschuf und er und sie ihm und ihr dieses Geschenk über die Abgründe der Zeit zuwarf, schuf Rur die Welt symmetrisch und – was kann man von dem Geschenk eines Schöpfergottwesens an seine Geschwistergottheit auch anderes erwarten – vollkommen!
Sicher werden sich auch die Gläubigen der Zwillingsgötter bisweilen die Frage nach der Trennbarkeit von gut und schlecht stellen, schließlich sind sie Menschen, aber sie werden sie auf ihre Art beantworten. Sie werden sagen: Wenn wir das eine beobachten, dann muß es auch ein Gegenstück dazu geben. Alles andere wäre beunruhigend! Denn so hat Rur die Welt geschaffen.
Doch was war das für eine Zeit, in der sich die nachfolgende Geschichte zutrug, dieses Jahr 25 Hal, gezählt nach der Regierungszeit eines Kaisers, der bereits seit zweimal vier Jahren als verschollen galt, vielleicht sogar tot war? Dessen Sohn Brin sich nicht dazu entschließen konnte, sich anders zu sehen, als nur als Stellvertreter seines Vaters, und der darum zögerte, eine neue Jahreszählung unter seinem eigenen Namen zu beginnen? Der zauderte, das Jahr 1 Brin auszurufen und sich selbst Kaiser zu nennen, und statt dessen vorzog, Reichsbehüter zu heißen. War es eine gute Zeit oder eine schlechte Zeit?
Für die meisten Menschen – und vermutlich auch Elfen und Zwerge – war das Jahr 24 nicht viel anders als die Jahre zuvor, nämlich bestimmt von Arbeit und Muße, von alltäglichem Glück und Leid. Doch einige wenige hatten endlich erkannt, daß eine durch und durch schlechte Zeit gekommen war, daß ein Abend über die Welt hereinbrach, der nicht der Abschluß eines Nachmittags war und der nicht sanft überleitete zur Nacht, der vielmehr völlig isoliert aus dem Nichts kam.
In Tuzak, die einst Hauptstadt des Königreiches von Maraskan und nun nur noch Regierungssitz eines tyrannischen Fürsten von Gareths Gnaden war, hatte die Priesterschaft der Zwillinge gerade drei Jahre zuvor aus ihren Heiligen Rollen erfahren, daß schon bald die Wesen aus der Sphäre der Dämonen die Welt betreten würden. Sie hatte deshalb unverzüglich und insgeheim begonnen, einen Ort zu suchen, von dem sie hoffte, daß er Schutz vor den kommenden Wirren bieten möge, und als die Priester meinten, diesen Ort gefunden zu haben, führten sie zweitausend Maraskaner, mithin einen von fünfzig Bewohnern der Insel, weg von dem Eiland Maraskan, dorthin, wo sie gedachten, ihre neue Stadt Asboran, die Verschwiegene, zu erbauen.
Dieser Auszug der Zweitausend erfolgte weder friedlich noch mit dem Einverständnis ihrer weltlichen Herren. Dabei spielte es keine Rolle, daß die Flüchtlinge angaben, eine der vielen Sekten des Rurund-Gror-Glaubens zu sein – was eine Lüge war – und nur nach den Geboten ihres Glaubens zu handeln, denn ein Fünfzigstel weniger Untertanen ist ein Fünfzigstel weniger Abgaben, die als Dukaten die Schatullen eines Herrschers füllen. Allein, niemand konnte die Flüchtenden an ihrem Auszug hindern.
Doch angekommen auf dem tulamidischen Festland, behauptete diese vielköpfige Schar nicht länger, eine Glaubenssekte zu sein. Vielmehr gaben sich die Neuankömmlinge mit einemmal als Nachfahren einer Prinzessin dieses Landes aus, das sie eben erreicht hatten; einer Prinzessin, die einer Sage nach zu einer Zeit, als Maraskan noch nicht einmal von Menschen besiedelt war, an den Gestaden der östlichen Insel gestrandet sein sollte und nie wieder heimgekehrt war. Diese rührende Geschichte, und nicht zuletzt eine größere Menge Goldes, das in gut ausgewählte, offene Hände gelegt wurde, bewog manche der Beraterinnen der Herrscherin des Landes, ein Wort für diese langvermißte Anverwandtschaft zu verwenden. Diese Höflinge taten gut daran, genauso wie sie nicht schlecht daran getan hatten, das fremde Gold in ihren Händen in ihre Taschen gleiten zu lassen. Denn in dem Menschenstrom, der gegen die Küste Araniens gebrandet war, schwammen Hechte, die die Heiligen Rollen der Priesterschaft Rurs und Grors als Verbündete zugewiesen hatten. Diese Hechte hätten keinen Augenblick gezögert, jeden, der ihrer Unternehmung im Wege gestanden hätte – wie sie es selbst ausdrückten –, auf den Weg zu seiner Wiedergeburt zu schikken – ohne jegliches Gefühl von Schuld oder Reue, ohne auch nur einen flüchtigen Gedanken an gut oder schlecht zu verschwenden. Denn auch so hatte Rur die Welt geschaffen.
Bei so vielen Fürsprechern konnte Königin Sybia von Aranien schließlich nicht anders handeln, als die Kinder Shilas als ihre Kusinen, Neffen und Nichten willkommen zu heißen, zumal das Ziel dieser bescheidenen Verwandtschaft nicht die wohlhabenden Städte des aranischen Reiches waren, sondern ein garstiger Landstrich, dafür verschrien, daß er dem Menschen feindlich sei. Das geschah ein halbes Jahr vor Beginn des unruhigen Jahres 25.
Nach einer gängigen, aber leider völlig falschen Theorie war der Exodus der Kinder Shilas einer der Gründe für die sich verschärfenden Repressalien der neureichischen Besatzer Maraskans. Ein anderer Grund war der Verdacht, daß während der alljährlichen Diskusstafette Waffen in das immer noch belagerte Boran geschmuggelt würden, die einzige Stadt Maraskans, die sich nie dem Joch Gareths gebeugt hatte.
Mit der Diskusstafette beginnt das maraskanische Neue Jahr. Sie ist einer der feierlichsten Gebräuche, die der Rur-und-Gror-Glaube kennt. Während ihres Verlaufs wird ein Diskus von der alten Königsstadt Tuzak quer über die gesamte Insel nach der heiligen Stadt Boran geschleudert, symbolisierend den Flug des Weltendiskus von Rur zu Gror. Dieser Brauch wurde im Jahre 25 von Herdin, Fürst von Maraskan und Vasall des Kaisers des Neuen Reiches, verboten. Einher damit ging eine Welle von Verhaftungen von Männern und Frauen, die der Komplizenschaft mit den Rebellen im unwegsamen Innern der Insel verdächtigt wurden, aber auch von Männern und Frauen, von denen nie jemand solche Sympathien angenommen hätte. Doch wie erwähnt, trifft die zitierte Theorie sowieso nicht zu, denn diese Ereignisse waren nur Teil des einzigartigen geschwisterlosen Abends, der über Maraskan und die Welt hereingebrochen war.
Nach der Meinung der meisten religiösen Lehrer Maraskans ist es nahezu unmöglich, die Götter zu beleidigen. Eine Frage der Größe, sagen sie. Gror, da selbst Gott, könnte vielleicht Rur beleidigen, aber warum sollte er und sie seiner geliebten Bruderschwester das antun, und warum sollte Rur eine solche Beleidigung überhaupt als Beleidigung akzeptieren? Und könnte ein Mensch die Götter beleidigen, dann könnte das wohl auch eine Katze, eine Ziege oder eine Kakerlake, die sich ihrerseits wiederum nicht darauf beschränken müßten, nur Götter zu verhöhnen. Nun ist die maraskanische Kakerlake zwar ein Tier von erstaunlicher Beharrlichkeit und beeindruckender Größe, doch hat man noch nie gehört, daß ein Mensch einem Käfer wegen einer Frechheit Rache und Vergeltung geschworen hätte.
Andererseits ist es nicht nur nach der Meinung der Bewahrer des Rur-Gror-Glaubens durchaus möglich – und dazu wesentlich leichter –, statt der Götter die Gläubigen zu beleidigen. Und da dies so ist, blieb das Verbot der Diskusstafette nicht ungeahndet.
Zwar konnte die schwerbewaffnete Macht Gareths auf Maraskan selbst einigermaßen dafür sorgen, daß auch weiterhin die schwüle, unzuverlässige Ruhe im Lande herrschte, nicht so aber in den Städten der Ostküste des aventurischen Kontinents. Denn dorthin, unter den Schutz tulamidischer Herrscher, aber auch den des weit nördlich gelegenen schweigsamen Bornlandes, hatten sich viele Maraskaner geflüchtet, als Reto ihnen vor dreißig Jahren ihr Land gestohlen hatte. Jener Kaiser Reto, der das Mittelreich, was nur ein anderer Name für das Neue Reich ist, wieder zu Stärke und Größe geführt hatte, der der Vater Kaiser Hals war, dessen Herrschaft alles in allem als eine gute und friedliche Zeit galt, und der damit der Großvater des derzeitigen Regenten Brin war. Den sein Volk nach der Abwehr der Orkenhorden als jungen und draufgängerischen Helden verehrte, von dem sich jedoch niemand recht vorstellen konnte, daß er jemals altern würde, war es doch leichter, ihn als den tapferen Recken zu sehen, der an der Spitze einer kleinen Schar und mit einem entschlossenen ›Für die Götter, Recht und Reich!‹ auf den Lippen sich ohne Zögern jedweder Übermacht stellte und vielleicht auch dabei stürbe, anstatt sich auszumalen, daß er dereinsten grauhaarig und altersgefurcht auf dem Thron zu Gareth säße, bedachtsame Entscheidungen fällend.
In diesen Städten der Ostküste, wo kein Kaiser aus Gareth etwas zu sagen hatte, entzündete sich die maraskanische Wut und sprang wie ein brausender Funkenflug von Norden nach Süden, von Stadt zu Stadt, loderte in gewalttätigem Protest auf und verwandelte nicht nur bildlich gesprochen einige Gesandtschaften der mittelreichischen Besatzungsmacht in rußgeschwärzte Ruinen.
Doch nach einigen Wochen, in denen der Griff des Greifen, der das Wappentier des Neuen Reiches ist, um etliches fester um Maraskan geworden war, schien auch diese schlechte Zeit ausgestanden zu sein.
Was hat das alles mit dieser Geschichte zu tun? Wenig, außer daß es die Zeit war, in der Luca lebte, und daß er ihre Hintergründe genausowenig begriff wie die meisten seiner Mitmenschen – und vielleicht auch die Elfen und Zwerge. Allenfalls so viel, daß mittlerweile der Herbst 25 schon fast vorüber war und Luca an diesem Nachmittag, an dem wir seine Bekanntschaft machten, kurz bevor er den Tempel der Zwillinge zu Jergan verließ, seine viele Jahre zurückliegende erste Predigt als Priester Rurs und Grors in Erinnerung gekommen war. Er hatte sie in Jergangrund gehalten, ein Stück außerhalb der Hafenstadt, und über seine Freude über das gelungene Zusammenspiel seiner Sätze, das er nie erwartet hatte, hatte er den sicheren Pferch des tagelang Einstudierten verlassen und sich dazu hinreißen lassen, Dinge zu sagen, deren Sinn er sich nie überlegt hatte, von denen er damals glaubte, daß sie gut, würdig und fromm klängen, Worte, die er als Kind von einem Praiospriester aufgeschnappt hatte: »An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Genauso, wie ein guter Baum gute Früchte trägt und ein schlechter Baum schlechte.«
Ein dickes kleines Mädchen, an dessen Schielen sich Luca noch nach Jahren erinnern sollte, hatte ihn damals in seinem Redefluß unterbrochen: »Was ist mit dem Kurin?«
Luca hatte sie unverständig angeschaut, worauf das Kind erklärte: »Ein gesunder Kurin hat fürchterlich giftige Früchte!«
Und ein anderer Anwesender, einer der beiden Greise, hatte eingewandt: »Aber man kann gute Möbel aus seinem Holz machen. Da traut sich nicht einmal ein Aldec-Käfer ran. Gutes Holz, der Kurin.«
»Aber nur wenn er nicht harzt, das kann bös ausgehn!« hatte daraufhin der zweite Alte mit ernster Miene zu bedenken gegeben, worauf beide in dieses schicksalsschwere, einverständige Nicken verfielen, das vermutlich nur alten Männern zu eigen ist.
Noch während Luca überlegte, wie er sich aus dieser selbstgestellten Falle befreien könne, verwandelte sich seine Zuhörerschaft, die er für so geeignet gehalten hatte für die erste Predigt eines unerfahrenen und überaus unsicheren jungen Priesters, nämlich sieben Kinder und zwei zahnlose Großväter, in das Ungeheuer, vor dem er sich seit Tagen gefürchtet hatte, indem es ihn mit Namen überschüttete, Namen von Pflanzen und Tieren, die er nicht kannte und deren jeweilige Eigenheiten man ihm boshaft ausführlich schilderte. Schlagartig hatte Luca damals begriffen, was es bedeutete, auf Maraskan zu sein. Der Insel, deren Menschen sie fast als ein gelobtes Land betrachten, doch in deren Dschungel es myriadenfach kriecht, hüpft, schlängelt, krabbelt, schwirrt und springt und dessen Bewohner im besten Fall nur lästig, für gewöhnlich aber tödlich gefährlich sind.
Auf dem Heimweg zum Tempel in Jergan, währenddessen er sich wie ein geschlagener Heerführer gefühlt hatte, war Luca eine Bemerkung seiner Mutter in den Sinn gekommen, die sie kurz nach seiner ersten Begegnung mit ihr hatte fallen lassen, nachdem Luca ihr vorgelogen hatte, daß er das verhaßte Jergan verlassen werde, um im Landesinnern einen Platz zu suchen, wo er den Wald roden und einen Acker bestellen könne und wo alles endlich wieder gut werde.
»Hüte dich vor dem Nemezijn. Er ist rachsüchtig, und wenn er glaubt, daß du ihm ein Leid angetan hast, wird er dich unerbittlich deiner Lebtag lang jagen.«
»Ich werde seine Gesellschaft meiden«, hatte Luca geantwortet. »Wer ist dieser Nemezijn?«
»Ein Baum«, hatte seine Mutter erklärt.
»Ein Baum, nur ein einfacher Baum?« hatte Luca überrascht ausgerufen.
»Ja. Ein Baum«, hatte sie bekräftigt. »Und das ist das einzige Gute, das man über ihn sagen kann.«
Der Totengott und andere Verwandte
Der Raum lag im Halbdunkel. Die einzigen Geräusche darin rührten von dem leisen Knistern von Pergament und dem tiefen Brummen einer fetten, schwarzen Fliege. Planlos erforschte sie das Dachzimmer, ließ sich einmal auf dieser Wand nieder, einmal auf jener, erhob sich dann wieder und flog weiter, umkreiste den einzelnen Menschen in der Mitte des Raumes, so lange, bis jener sie mit einer ungeduldigen Handbewegung kurzfristig verscheuchte. Obwohl der Herbst seinen Zenith bereits überschritten hatte und schon in wenigen Tagen fast über Nacht die Urwälder der Insel ihr saftiges Grün gegen ein leuchtendes Rot austauschen würden – nicht braun, nicht gelb, sondern rot, ein Wunder, an das sich Luca nie hatte gewöhnen können –, war es warm, zu warm, wie es immer zu warm war auf Maraskan. »Selbst im Norden dieser Insel ist es noch wärmer als in Khunchom!« hatte Luca einmal jemanden sagen hören. Das mochte stimmen oder auch nicht, Luca konnte es nicht beurteilen, er war nie in Khunchom Stadt gewesen.
Wie spät mochte es sein? Rasch stand Luca auf und ging über die knarrenden Holzdielen zu einem der schmalen Fensterschlitze. Von der Höhe des Tempelturmes blickte er in den engen Talkessel, den der Hira seit dem Anbeginn der Welt in den Untergrund gefräst hatte. An den Wänden des Tals klebten auf einer Vielzahl von Terrassen die Häuser der Stadt, hohe Türme aus Stein und Holz mit geschwungenen Dächern, die wie zu große Hauben wirkten.
Diese Terrassen waren im Laufe der Jahrhunderte dem Tal abgetrotzt worden. Man hatte sie aus seinen Wänden herausgehauen und aufgeschüttet. Denn der wilde Hira hatte nicht daran gedacht, für etwas anderes außer sich selbst Platz zu schaffen auf seinem Weg bis zum nur noch wenige hundert Schritt entfernten Meer.
Den kurzen, frühnachmittäglichen Schatten nach zu urteilen, war es höchste Zeit für Luca aufzubrechen. Tatsächlich war er schon etwas spät dran. Schnell streifte er sich sein Priestergewand über und schnürte es mit hastigen Fingern zu, bereits auf dem Weg zur Tür. Er schob sie auf, schlüpfte hindurch, schob sie wieder zu und eilte die vielfach gewundene Wendeltreppe hinab. Erst kurz vor Erreichen des Tempelraumes verlangsamte Luca seinen Schritt. So, als habe er es überhaupt nicht eilig, als habe er nur eine wenig dringliche Pflicht zu verrichten, ging er durch die gutbesuchte Halle von Ebene zu Ebene, hinab zum Ausgang. Dort angekommen, blickte Luca verstohlen zurück, vorbei an der Alabasterstatue Rurs bis hinauf zu der Grors, am Ende der großen Treppe, als die Arethin das Tempelinnere von seinen Baumeistern hatte anlegen lassen. Das war Arethins Art gewesen, dem Land Respekt zu zollen, indem er es nicht seinem einzigen Tempelbau anpaßte, sondern diesen nach den Gegebenheiten des Geländes erbauen ließ. Ein Respekt, den er keinem seiner Mitmenschen je erwies. Denn auch wenn Fürst Arethin ein kunstsinniger Despot gewesen war, so war er doch ein Despot, einer der schlimmsten, der je über Maraskan geherrscht hatte. Daß er nicht als der allerschlimmste galt, lag nur daran, daß er eine Dynastie begründet hatte und es schwer zu sagen war, welchem der Arethiniden der Rang des Widerwärtigsten gebührte.
Luca ging weiter zum Ausgang. Niemand hatte ihn beachtet, dennoch wurde er das Gefühl nicht los, als ruhten heimliche Augen auf ihm, als müsse alle Welt wissen, wohin er ginge und warum. Wenn auch nicht ganz abwegig im schwatzhaften Maraskan, hatten die Hohen Schwestern des Tempels, die ganz gewiß Geheimnisse zu wahren wußten, ihn erst vor wenigen Stunden über seine Aufgabe unterrichtet. Sie hatten ihm gesagt, daß sich einige Rebellen in der Stadt träfen und daß diese um die Anwesenheit eines Priesters der Zwillinge gebeten hatten. Was der Grund dafür war, konnten die Hochgeschwister Luca nicht sagen, denn der Abgesandte der Rebellen hatte ihn für sich behalten, möglicherweise selbst nicht gewußt. Jedoch argwöhnte Luca, daß sich die Hochgeschwister durchaus ihre Gedanken dazu gemacht hatten.
Warum wollten die Freischärler wohl, daß ein Mitglied des Tempels bei ihrem Treffen dabei sei? Vielleicht wollten sie ein Bündnis schließen oder eine Fehde beilegen, doch das war kein ausreichender Grund für ihre ungewöhnliche Bitte. Schließlich wurden in den unzugänglichen Wäldern und Bergen andauernd Bündnisse geschlossen und wieder gebrochen, und wer gestern miteinander verfeindet war, der war vielleicht schon morgen der zuverlässigste Freund. Wie man sagte, kämpften die zahlreichen Rebellengruppen der Insel fast genauso begeistert gegeneinander wie gegen die kaiserlichen Soldaten. Was also konnte der Grund dieses Treffens sein? Luca war im Laufe der letzten Stunde zu dem Schluß gekommen, daß offenbar wieder – wie im Sommer, als eine überraschende Allianz dreier Freischärlergruppen die Hafenstadt Sinoda für einige Tage besetzt hatte – etwas Großes im Schwange war, eine gemeinsame Unternehmung, bei der jene, die den Plan erdacht hatten, unter allen Umständen verhindern wollten, daß die Verbündeten der nächsten Tage oder Wochen schon an diesem Nachmittag die Schwerter gegeneinander zögen. Dem Priester, als allgemein respektiertem Unparteiischem, käme demnach die Rolle eines Schlichters und Vermittlers zu.
Luca wunderte sich nicht, daß die Hochgeschwister ihn für diese Aufgabe ausgewählt hatten, da er als besonnener und guter Zuhörer galt. Seiner Meinung nach ein Ruf, den er zu unrecht genoß. Denn Luca hielt sich selbst nicht für einen bedächtigen und tiefsinnigen Menschen, ihm fiel nur meistens nichts zu sagen ein.
Draußen standen wie immer Söldlinge im Greifen-rock. Das ging schon seit Mitte des Sommers so, und wie Luca gehört hatte, standen solche Posten nicht nur vor den Eingängen des Jerganer Tempels. Im ganzen Land wachten die Bewaffneten des Kaisers und des Fürsten vor jedem größeren Tempel und an den Orten, wo viele Leute sich trafen oder auch nur vorbeikamen. Luca erschien diese Vorgehensweise lächerlich. Was erwarteten die Soldaten? Daß der narbengesichtige Mujiabor von den Fren‘Chira Marustazzim am hellichten Tag bei ihnen vorbeispazierte, oder gar der Anführer des Haranydas, den manche für den wiedergeborenen Dajin hielten, von dem aber niemand wußte, wie er überhaupt aussah? Glaubten sie das wirklich? Und selbst wenn es sich zutrüge, daß einer der bedeutenderen Anführer oder Anführerinnen der Rebellen gerade hier vorbeikäme, hofften die Soldaten wirklich, daß diese alleine kämen oder nur mit so wenigen Getreuen, daß ein paar Wachen sie gefangensetzen könnten oder auch nur Gelegenheit hätten, Verstärkung herbeizurufen, bevor man sie niedermachte?
Lucas Weg führte direkt an den Wachen vorbei. Hätte er die Wahl gehabt, dann hätte er einen anderen Weg gewählt, aber er mußte diesen nehmen, da blieb ihm nichts anderes übrig. Er dachte fest daran, daß er nicht zu schnell gehen dürfe, aber auch nicht zu zögerlich. Ganz entspannt sollte sein Gang erscheinen, daher zählte Luca seine Schritte. Eins, zwei, drei, vier ...
Auf Höhe der Wachen erkannte der Priester eine von ihnen, eine junge, stämmige Frau, die er vor etwa einem Jahr kennengelernt und mit der er schon öfter Worte gewechselt hatte. Sie starrte fest zu Boden, tat so, als bemerke sie ihn nicht. Im Vorübergehen warf Luca ihr einen Gruß zu, kein ›Preise die Schönheit, Schwester!‹ nach der Art der Maraskaner, sondern ein ›Rondra zum Gruße, Elea!‹, wie sie es gewohnt war. Laut genug, daß sie seine Worte nicht überhören konnte. Ohne aufzublicken, nuschelte die Frau etwas zurück und spuckte dann vor sich auf den Boden.
Luca entging nicht, daß ihre Ohren sich bei seinem Gruß gerötet hatten und daß ihr sonst so offenes Gesicht eine verkrampfte Maske war. O ja, Luca verstand sehr gut, wie peinlich Elea dieses Zusammentreffen war, wie sehr sie dieses Geschick verabscheute, das aus ihr eine Wache gegen ihn, einen potentiellen Feind, gemacht hatte. »Irgendwann wirst du dich entscheiden müssen, Schwester«, dachte Luca. »Wir müssen uns alle für das eine oder andere entscheiden in diesen schwierigen Zeiten!« Er nahm das sorgfältige Zählen seiner entspanntem Schritte wieder auf.
Ein Treppchen führte Luca hinab zur darunterliegenden Terrasse, die er entlangging bis zum nächsten Treppchen, immer weiter hinunter, zum Fluß hin. Sein Ziel war die Brücke zur Imana‘cha, der Insel im Hira, die das räumliche Zentrum Jergans ist. Ein guter Ort, wenn man eine billige Taverne sucht, ein schlechter Ort, wenn man gezwungen ist, dort zu leben, inmitten der ewigfeuchten Wolke des Sprühregens, die der Fluß verursacht.
Luca wußte sehr genau, wie es war, auf der Imana‘cha leben zu müssen, den säuerlichen Geruch der Armut in den schäbigen Wohntürmen zu riechen, sich an das Husten der alten Leute zu gewöhnen und ihr ewiges Klagen über das Reißen in den Gliedern. Im Gegensatz zu den dort schon immer Einheimischen, die trotz ihres Elends in dem – wie Luca früher meinte – maraskanischen Wahn verfangen waren, daß die Welt trotz allem schön sei und man jeden Tag Rur für dieses wunderbare Geschenk preisen müsse, hatte Luca damals, als er selbst auf der Imana‘cha hauste, gelernt, wie es war, sich selbst gleichgültig zu sein, ohne Stolz, ohne Würde, ohne Freude, allenfalls mit der, einigen angetrunkenen Seesoldaten einige Kreuzer abgebettelt zu haben, die dann entweder in billigen Fusel oder in Rauschgurken umgesetzt wurden, die für einige Stunden die klamme Feuchtigkeit in seinem Innern vertrieben und wohlige Wärme brachten.
Luca hatte lange nicht verstanden, warum die Einheimischen die Nase rümpften, wenn er die bittersüßen Früchte aß. Ihm schien es wie Heuchelei, wurden sie doch auf dem Markt gehandelt wie Shatakknollen oder Reis. Erst seine Mutter hatte für nötig befunden, diesem dummen jungen Garethja zu erklären, was so anstößig an seinem Verhalten war. Sie hatte ihm Dutzende von Möglichkeiten aufgezählt, Rauschgurken zuzubereiten. Sie hatte ihm von den jeweils unterschiedlichen Auswirkungen auf Geist und Körper erzählt, davon, daß die Frucht Krankheiten heilen könne oder Gebrechen lindern, daß sie Ruhe brächte oder Zorn, Willensstärke oder Freude. Daß die Rauschgurke nur eine Pflanze sei, die Kraft habe und sie bereitwillig abgebe, und sei es nur als Gewürz. Er aber, Luca, wie alle Fremden, gleiche jemandem, der auf den Markt ginge, um etwa die Zutaten für Brig-Lo‘ner Trippen zu kaufen – ein Gericht, das zu kochen Luca ihr beigebracht hatte.
Er, Luca, belehrte ihn seine Mutter, benähme sich wie jemand, der vom Markt nach Hause ginge und den eben gekauften Kuhmagen nicht in feine Streifen schnitte, in Wein oder Essig aufkoche, mit Rosinen oder Bauschblüten würze, sondern statt dessen zuerst den ungewaschenen, grünen Pansen in sich hineinfräße, dann den Wein tränke, nachher den Essig, schließlich die Rosinen in sich hineinstopfe, zuletzt die ganze Bauschpflanze samt Stengel, Blatt und Wurzelwerk. Also wie jemand bar jeder Sitte und jedes Benimm.
Luca hatte sich darüber beschwert, daß ihm das niemand zuvor gesagt habe. Seine Mutter hatte zuerst geschwiegen und dann fast widerwillig erklärt: »Das ist die Art, nach der ihr Garethjas lebt. Ihr seid blind für die vielen kleinen Rätsel, die Rur in der Welt versteckt hat. Warum sollte man euch eines davon zeigen? Das ist müßig, denn ihr werdet deswegen nicht die Augen öffnen und fröhlich darüber lachen, wie gut dieses eine Rätsel zu Rurs nächstem paßt.«
Zwar sah sich Luca heutzutage als Maraskaner, aber seine Wiege hatte nicht auf Maraskan gestanden, sondern weit weg, auf der anderen Seite des Kontinents, in Schlehen, im Herzen Almadas, der südwestlichsten Provinz des Neuen Reiches. Dieses Schlehen war einer von vielen kleinen Winzerörtchen. Das etwas eintönige Leben dort drehte sich den größten Teil des Jahres über um Wein und Reben und erfuhr nur durch zwei Dinge Abwechslung und Würze, nämlich im Herbst, nach der Lese, wenn die Zeit der Weinfeste kam und Rahja, die Stute, einige Wochen über den schweigsamen Boron und die muntere Tsa triumphierte, oder dann, wenn die jungen Burschen und Mädchen des Dorfes der Hafer stach und sie sich zusammentaten, um heimlich über die unsichtbaren Grenzen in die Nachbarbaronien Bitterbusch oder Cres zu schleichen, um dort ein paar Hasen zu wildern oder gar ein Wildschwein.
Für Luca, dessen erste Mutter bei der Geburt ihres einzigen Kindes gestorben war, hatte nie ein Zweifel bestanden, daß er eines Tages den Hof seines Vaters übernehmen würde, daß gleich diesem sein Leben dem Weinanbau gewidmet sei, daß er seiner Lebtag nicht viel weiter käme als nach Cres, der gleichnamigen Hauptstadt der Nachbarbaronie, wo man neuerdings ein Immanstadium gebaut hatte und wo es einen Medicus gab, dem man zwar nachsagte, ein Kurpfuscher zu sein, dem statt Frau Peraine nur allzuoft der – selbstverständlich! – wesentlich schlechtere Creser Landwein die Hand führe, zu dem die braven Leute aus dem Süden der Baronie Valpokrug aber dennoch gingen, wenn sie ein Weh plagte, das nicht von selbst weichen wollte, wobei sie sich auf dem Weg nach Cres vorsagten, daß der Medicus diesem oder jenem ja auch wirklich geholfen habe, schaden könne es ja nicht.
Allenfalls, hatte Luca gedacht, käme er noch nach Ragath, das als eine richtige Stadt galt, da sie von Mauern umgeben war. Sogar eine Garnison gab es dort, mit Reitern in eisernen Rüstungen, die auf den prächtigsten Pferden Almadas ritten.
Als Luca zehn oder elf Jahre zählte, war ein Kesselflicker nach Schlehen gekommen, der behauptete, aus Punin zu kommen, der Hauptstadt Almadas. Natürlich glaubte ihm Luca kein Wort, schließlich wußte man ja, was von Kesselflickern zu halten war. Punin! Die Stadt war mindestens so groß wie Gareth, wenn nicht sogar doppelt so groß, sicherlich dreimal so prächtig! Und wie bei allen guten Göttern sollte ein Kesselflicker dorthin gelangen, ausgerechnet ein Kesselflicker!
Rondirai war nicht Lucas erste Liebe gewesen, aber sie war diejenige, die sein Leben veränderte. Als er sie zum ersten Mal sah, zählte er nur wenige Monde mehr als siebzehn Lenze und war eifrig dabei, mit einigen seiner Altersgefährten an der Dorfstraße von Schlehen eine Partie Pelura zu spielen. Eben war Luca an der Reihe, die leicht rübenförmige Kugel zu werfen, als Pferdegetrappel die Reiter ankündigte. Fünf an der Zahl, Panzerreiter aus Ragath, Rondirai war die Jüngste im Troß, drei oder vier Jahre älter als Luca. »I-e-ja!«, rief sie fröhlich, als sie an den Bauernjungen vorbeiritt, die Straße hinunter, in Richtung Süden. Ihr Anblick ließ Luca das Spiel vergessen, das gerade noch so wichtig gewesen war, und statt den Urinstinkten der Bauern zu folgen – hütet euch, wenn die Soldaten kommen! –, rannte er den Reitern hinterher, bis zum Ende des Dorfes, blieb stehen und starrte ihnen nach, solange, bis seine Kameraden ihn eingeholt hatten und fragten: »Lucara, was ist?«
»Sie ist wunderschön!« hatte Luca geantwortet.
Wahrscheinlich wäre es bei einigen schlaflosen Nächten oder den gelegentlichen Fluchten zu einem verschwiegenen Weiher in der Nähe des Hofes der Sbarras geblieben, wo der junge Luca oft stundenlang im Gras lag, in den blauen Himmel Almadas schaute, dem Zug der weißen Wölkchen folgte, dem Gesang der Grillen lauschte und vor sich hinträumte, hätte nicht die Krankheit, deren Opfer Lucas Vater noch binnen Jahresfrist werden sollte, schon heimlich begonnen, an dessen Leben zu zehren. So kam es, daß zwei Monde später statt des alten Sbarra der junge sich auf den stundenlangen Fußmarsch nach Ragath machte. Was er damals dort zu besorgen hatte, das hatte Luca schon nach wenigen Wochen vergessen, denn für ihn war nur wichtig, daß er dort Rondirai zum zweiten Mal traf.
Daß er sie traf, sah Luca als Fügung der Göttin Rahja, weshalb er sich in den Kopf setzte, daß er für Rondirai bestimmt sei und sie für ihn. Er dachte, daß es nur noch darum ginge, daß sie das Zeichen verstünde. Also wandte er in diesen wenigen Stunden in Ragath, mit dem Wissen, daß die Göttin auf seiner Seite war, den ganzen Charme auf, den ein almadanischer Junge besitzt, und seine ganze Überzeugungskraft – was nicht wenig war, den von beidem besitzen die Menschen des Yaquirlands viel.
Vielleicht weil Rahja wirklich mit Luca gewesen war, vielleicht auch nur, weil Rondirai nicht aus dem Yaquirland stammte, hatte Lucas Werben Erfolg. Nun begann eine glückliche Zeit für Luca, die sich aber bald in eine zwiespältige verwandelte. Zwar fühlte sich ein Teil von ihm wie der Herr von Schloß Rosenteich, der jeden Morgen auf seinen Balkon tritt und hinunterblickt auf die kleinen Seen, wo die rosafarbenen und weißen Blüten schwimmen, doch der andere Teil sah mit an, wie sein Vater langsam dahinsiechte. Oft sagte Luca zu ihm: »Mein Vater, erlaube mir, dich zu dem Medicus nach Cres zu bringen, oder gestatte mir wenigstens, daß ich selbst dorthin gehe und ihn hole. Ich werde auch dafür sorgen, daß er auf dem Weg hierher nicht säuft.« Aber der – gar nicht so alte – alte Sbarra, der ein sehr götterfürchtiger Mann war, antwortete darauf stets: »Mein Leben ist in der Hand der Zwölfe, Luca. Wenn es ihnen gefällt, so werden sie‘s wieder richten, wenn nicht, so ist auch das ihr Wille.«
Es war nicht der Wille der Götter, die Gesundheit von Lucas Vater wieder herzurichten. Doch bis das unmißverständlich ersichtlich war, verstrichen Wochen und Monde, in denen sich Luca zusehends als Verräter fühlte, wenn er das väterliche Heim verließ, um nach Ragath zu marschieren. Denn war es nicht Verrat, einfach fortzugehen, um Rondirai und das schier unendlich große Glück bei ihr zu treffen, während sich zu Hause Schmerz und Unglück eingenistet hatten? Das waren Gedanken, die Luca quälten, die er aber anfänglich spätestens bei Erreichen der Reichsstraße vergaß.
Anfänglich.
»Rondirai, der Weg ist immer so lange bis Ragath, und ich wage meinen Vater kaum noch allein zu lassen. Aber du, du hast ein Roß! Für dich wäre der Weg weniger beschwerlich! Warum kommst du nicht nach Schlehen, anstatt ich zu dir nach Ragath?«
»Das ist nicht mein Roß, Luculu. Was glaubst du, was ich hier tue, mein kleiner Bauern-Schatz? Ich bin eine Soldatin des Kaisers, ich habe einen Weibel, der mir befiehlt, ich kann nicht gehen, wie‘s mir gefällt.«
»Dann belüge ihn. Sage ihm, du habest eine Muhme in Schlehen, die deiner bedarf!«
»Ich kann nicht, Luculu!«
Es war eine Liebe mit Hindernissen.
Wäre Luca ein kühler Nordmärker gewesen oder ein nüchterner Koscher, dann hätte er sich vielleicht noch etwas anderes gedacht, doch Luca war Almadaner.
Lucas Vater starb nicht von einem Augenblick auf den nächsten, sein Todeskampf dauerte zwei Wochen. Als der Verblichene seine letzte Heimstatt auf dem Boronsanger zu Schlehen gefunden hatte und auch sonst alles geregelt war, konnte Luca endlich wieder einmal nach Ragath. Vier bittere und sehnsuchtsvolle Wochen waren vergangen, seitdem er Rondirai das letzte Mal gesehen hatte. Doch Luca traf Rondirai nicht mehr an.
»Der Kaiser hat sie zu sich gerufen«, erklärte ihm ein alter Veteran, geheimnisvoll hinzufügend: »Sie ist auf dem Wege nach Markan.«
Erst auf dem staubigen langen Rückweg nach Schlehen verstand Luca, was ihm der Veteran hatte sagen wollen: Der Kaiser führte Krieg!
Das geschah im sechsten Jahr, bevor Hal zum Kaiser gekrönt wurde, als Reto herrschte und seine Heerscharen nach Perricum befahl, wo sie samt ihren Rössern in dickbauchige Schiffe stiegen, um auszuführen, was die Feldherrn ihres Gebieters schon seit zwei Jahren geplant hatten. Das geschah in diesem Jahr 6 vor Hal, in dem die arglos im Hafen von Tuzak dümpelnde Flotte des Königreichs Maraskan von feindlichen Galeeren in Brand geschossen wurde, in dem bei Jergan Schar um Schar der in stählerne Rüstungen Gehüllten unter dem Greifenbanner an Land gingen, in dem schließlich Frumold, der glücklose König der Insel, mit einem eilig zusammengestellten Heer nach Hemandu eilte, um sein Königreich zu retten. Denn eine Prophezeiung hatte ihm gesagt, daß dort der beste Ort sei, um gegen die Eindringlinge zu kämpfen. Eine Prophezeiung, die Frumold für unmißverständlich gehalten hatte.
Mittlerweile lebte Luca einsam im Haus seiner Eltern, das nun ganz allein seines war, und trat – so wie er es immer erwartet hatte, wenn auch nicht so bald – in die Fußstapfen derer, die vor ihm darin gewohnt hatten. Es sei dahingestellt, wen er damals mehr betrauerte, den verlorenen Vater oder die verlorene Liebste. Doch jedesmal wenn ein Fremder nach Schlehen kam befragte ihn der Winzer nach Markan. Die wenigsten wußten, wovon er überhaupt sprach.
Etwa drei Monde später gelangte die gute und die schlechte Nachricht an Lucas Ohr. »Der Kaiser hat mit Rondras Segen gesiegt«, berichtete ihm der Veteran in Ragath.
»Dann wird meine Liebste bald wieder hier sein!« frohlockte Luca und faßte im Herzen schon Pläne, Schlehen zu verlassen, um Ragather zu werden.
»Das kann man so nicht sagen«, bekam er als Antwort.
»Warum? Der Kaiser hat gesiegt, also benötigt er Rondirai nicht mehr in Markan!«
»Ja, der Kaiser hat die Markaner bezwungen. Doch das verfluchte Gesindel will es einfach nicht einsehen!« hatte der Veteran zornig erklärt.
An diesem Tag begleiteten Enttäuschung und Wut Lucas Heimweg, und das unablässige Zirpen der Grillen erschien dem Jungen wie ein Spottgesang. Luca stellte sich vor, wie der lügnerische Fürst der Markonier den Frieden mit Handschlag besiegelte, wie einen Pferdehandel, dabei aber schon heimlich die nächsten Ränke schmiedete. Wie seine Getreuen sich heimlich aus ihren Burgen stahlen, nachts Dörfer überfielen und plünderten, was ihnen in die Finger kam, nur um sich gleich darauf wieder hinter ihren Mauern zu verschanzen. Wie sie eben alles täten, um Rondirai zu hindern, zu Luca zurückzukehren.
Nicht im Traum hätte sich Luca vorgestellt, daß die ersten Flüchtlinge von Maraskan bereits die Häfen von Festum, Khunchom oder Al‘Anfa erreicht hatten, daß diesen ersten in diesem und in den nächsten Jahren noch Tausende folgen würden, daß viele der Noblen der Insel nicht räuberisch, sondern verzweifelt in ihren Festungen verweilten, bis sie sie nicht mehr halten konnten und es vorzogen, in den Wäldern Schutz zu suchen, die ihnen kaum weniger feindlich waren, als den fremden Eroberern, anstatt sich deren Joch zu fügen. Noch weniger hätte Luca sich träumen lassen, daß auch diesen Uneinsichtigen noch andere folgten, die zeitlebens nie von einem herrschaftlichen Teller aßen, die nie mehr besessen hatten als Luca.
Einen weiteren Mond wartete Luca auf Rondirai, dann verkaufte er seine Habe.
»Wohin willst du, Lucara?« fragten ihn Freunde und Verwandte.
»Nach Markan«, antwortete er schlicht.
Zwar hielt man Luca deshalb für verrückt, doch brachte sein Vorhaben eine ganz bestimmte Saite in der Seele der Schlehener zum Schwingen, dieselbe, die bei ihren winterlichen Geschichten von Rahjalieb und Rahjalob in der Spinnstube schwang, oder bei vielen ihrer Lieder von der Liebe und vom Wein. Also wünschte man ihm Glück und Aves‘ Segen auf seinem weiten Weg.
Luca reiste so, wie er es gewohnt war, nämlich zu Fuß. Er lebte sparsam, verdingte sich bisweilen als Knecht, fragte sich durch, nach Markan, zum anderen Ende der Welt. Nach etwa einem halben Jahr erreichte er endlich Jergan, im immer noch uneinsichtigen Maraskan.
Es dauerte nicht lange, bis er Rondirai fand.
»Luculu-Schatz, was machst du denn hier!« rief sie erstaunt.
»Ich habe dich endlich gefunden!« antwortete er glücklich. »Nun sind wir wieder vereint.«
Rondirai ließ sich genau erklären, wie Luca nach Maraskan gekommen war, schüttelte bisweilen ungläubig das geliebte Haupt und sagte endlich: »Dir hat wirklich der Yaquirwind den Verstand weggeblasen, Luculu. Komm, geh nach Hause! Verlaß dieses verfluchte Maraskan, das ist kein Platz für dich!«
»Mir egal, ob es ein guter Ort ist oder ein schlechter!« beteuerte Luca. »Ich habe endlich wiedergefunden, wovon ich so lange träumte!«
»Ja, wovon du träumtest!« antwortete Rondirai unwirsch. »Aber hier ist kein Ort zum Träumen! Glaubst du denn, Luculu, die Zeit sei stehengeblieben? Glaubst du denn, nichts habe sich seitdem verändert? Geh nach Hause, Luculu.«
»Für mich hat sich nie etwas verändert«, sagte Luca verzweifelt und fügte dann anklagend hinzu: »Du hast gesagt, du liebst mich.«
»Ja, sicher mochte ich dich gut leiden«, entgegnete Rondirai ungeduldig. »Doch das war vor einem Jahr in Ragath. Ist das denn so schwer zu verstehen? Wir sind nicht mehr in Ragath, wir sind in Maraskan. Also geh endlich nach Hause, zurück nach Schlehen.«
»Ich weiß nicht, was ich da soll!« sagte Luca weinerlich. »Mein Vater ist tot.«
»Das tut mir leid. Aber ich habe keine Tränen mehr für einen einzelnen Toten. Ich habe mehr als genug für ein ganzes Leben gesehen und nicht nur das.«
Was Rondirai mit diesem ›nicht nur das‹ meinte, erfuhr Luca nie, doch das abgöttisch geliebte und doch so abweisende Gesicht hatte dabei einen Ausdruck angenommen, als habe Rondirai nicht nur einen gehörnten Dämonen gesehen, sondern zahllose.
»Der weite Weg ...«, hatte Luca erschöpft gemurmelt.
»Ich habe dich diese Narretei nicht zu tun geheißen!« fuhr ihn Rondirai an, nun wirklich zornig geworden. Sie packte ihn an den Schultern und drehte ihn rasch so, daß er in Richtung des Hafens blickte. »Geh endlich! Hier ist kein Platz für dich!«
Als Luca wieder durch den Tränenschleier sehen konnte, drehte er sich um. Rondirai war gegangen.
Zweimal versuchte Luca in den nächsten Tagen, Rondirai wiederzutreffen. Beim ersten Mal tat sie zuerst so, als sähe sie ihn nicht, und gönnte ihm dann, als ein Erkennen unvermeidlich war, wenigstens einen finsteren Blick. Beim zweiten Mal verdrehte sie nur noch die Augen, wie jemand, der von einem Hund belästigt wird, der keine Hündin findet.
Zu diesem Zeitpunkt hätte Luca noch genug Dukaten besessen, um das nächste Schiff nach Perricum zu nehmen, auch für einen weiteren Teil der Reise hätten sie ausgereicht. Doch ihm war, als sei er zu einer Reise aufgebrochen, bei der er nie irgendwo angekommen war, als sei es auch nicht möglich, jemals das Ende dieser Reise zu erreichen. Er war auf einer Landstraße, die sich mit einemmal vor und hinter ihm aufgelöst hatte, die nicht mehr davon berichtete, woher sie kam oder wohin sie führte, die einfach da war, ohne Sinn, ohne Anfang und Ziel.
Und weil es einen Anfang ohne Ende in Lucas Verständnis nicht gab, vor allem weil er sich nicht entscheiden konnte, ob er bleiben oder gehen sollte, blieb Luca. Er suchte sich eine Herberge, betrauerte dieses unverdiente Leid, das über ihn gekommen war, und beschloß nach drei weiteren Tagen, daß nur diese verfluchten Markonier – er nannte sie für sich immer noch so, obwohl er schon vor Wochen gelernt hatte, daß sie Maraskaner hießen – schuld an allem seien. Sie hatten Rondirais Seele vergiftet, aber er, Luca, würde sie wieder heilen! Deshalb ging er am nächsten Tag zuversichtlich ins Heerlager der Kaiserlichen. Verzweifle nicht, meine Liebe, dachte er.
Doch ein zweites Mal kam Luca zu spät, denn Rondirais Trupp war ins Landesinnere befohlen worden. Trotzdem ließ Luca die Hoffnung nicht fahren. Er wußte, Rondirai würde in wenigen Tagen zurückkommen und dann ...
Aber Rondirai kehrte nicht mehr zurück.
Schuld daran war nicht der Stahl eines Rebellen, auch nicht eine hinterrücks geworfene Wurfscheibe, sondern ein kleines Tier, halb so groß wie ein Männerdaumen und entfernt einer Grille ähnelnd. Ein Tierchen ganz ohne Bosheit, das bloß einen sicheren Ort für seine Brut gesucht hatte und deshalb seinen Legestachel in Rondirais weiche Haut stach. Die Folge davon war ein täglich wachsendes Geschwulst, das endlich ein Feldscher aufschnitt. Er beherrschte seine Kunst noch viel schlechter als weiland der Medicus in Cres selbst in voller Trunkenheit. Der Feld-scher und das Grillentier brachten Rondirai den Tod.
Doch auch das erfuhr Luca nie. Für ihn begann eine Zeit lähmender Trauer, während der er irgendwann zu der Einsicht kam, daß Rondirai nie mehr zu ihm zurückkommen werde, daß sie sich um ihn noch weniger scherte als der Himmel um die Wolken des vergangenen Jahres. Ihr Verschwinden aus seinem Leben stellte sich für Luca so dar, daß sie eines Tages einfach gegangen war, ohne Gruß, ohne Abschied, kurz bevor wieder alles gut geworden wäre.
Bis Luca sich dieses aber eingestand, hatte er den Ort seines Strandens gründlich zu verabscheuen gelernt. Er mochte diese fremde Stadt nicht. In ihrem Tal war sie ähnlich eingesperrt wie er in seiner Not, und von ihren Turmhäusern, die dort, wo sie enger zusammenstanden, die Gassen in dauerhafte Dunkelheit tauchten, erwartete er, daß sie jederzeit über ihm zusammenstürzten. Er befürchtete das nicht, er erwartete das nur, an manchen Tagen sogar mit einer beinahe freudigen Entschlossenheit, falls das Wort ›freudig‹ für ihn noch einen Sinn gehabt hätte. Auch die Menschen der Stadt waren Luca ein Greuel, teilweise deshalb weil sie ihm und überhaupt allen Garethjas wenig freundlich gesonnen waren, vor allem aber deswegen, weil er nichts Nettes an ihnen sah. Angefangen bei ihrem kaum verständlichen Geschnatter, dem Maraskani, von dem sie steif und fest behaupteten, es sei ebenfalls Garethi, bis hin zu ihren Speisen, die so scharf gewürzt waren, daß es kaum schlimmer hätte sein können, hätte man ihm gleich den Mund mit Lauge ausgespült, und die zu allem Überdruß auf geradezu würdelose Weise die Geschäftigkeiten des Gedärms förderten.
Dann sahen diese Fremden auch noch auf geradezu verdächtige Weise aus wie die ungläubigen Novadis vom Südufer des Yaquirs, jedenfalls was ihre Hautfarbe anbelangte! Denn ernst und verschwiegen konnte man dieses laute, lärmende Volk, dem das Wort ›Geheimnis‹ völlig unbekannt zu sein schien, kaum nennen. Außerdem verehrten auch sie einen falschen Götzen, nur daß er eben nicht Rastullah hieß, sondern Rur. So groß konnte der Unterschied also nicht sein. Was Luca aber am meisten verabscheute, war seine Verlorenheit, war seine Hilflosigkeit, war, daß es in dieser Stadt nichts gab, das ihm ein bißchen vertraut gewesen wäre, war, daß er sich vorkam wie ein Tor, der nichts wußte und nie etwas gelernt hatte.
Nachdem Luca seinen letzten Silbertaler in Heller gewechselt hatte, schlief er auf der Straße und zog bald darauf auf die immerfeuchte Imana‘cha. Dort wurde er Teil der großen Gleichgültigkeit, die kein Morgen kennt und auch den Augenblick nur selten bemerkt. Ein neuer Weg schien Luca vorgezeichnet, nicht mehr der des Winzers, sondern der eines Bettlers, der ein Leben im Schmutz führt, der – solange er noch jung und ansehnlich ist – vielleicht das Glück hat, sich für ein paar Münzen und eine halbe Stunde an einen Seemann oder eine Matrosin verkaufen zu können, und der im Alter an seinen faulenden Geschwüren stirbt.
In einigen seltenen, nicht ganz unbeachtet verstrichenen Augenblicken, diesen winzigen Splittern der Gegenwart, dachte Luca: Ich muß hier weg! Und dann wieder: Wenn ich gehe, dann war alles umsonst.
Dutzendmal nahm Luca sich vor, gleich am nächsten Tag zu einem der Werber zu gehen, die Tagelöhner für die frisch entstandenen Großgrundbesitze und Holzplantagen suchten. Denn die neuen Herren und Herrinnen hatten Bedarf an Arbeitskräften, da sie zuvor zur Schaffung ihrer Besitze die ansässigen Bauern vertrieben hatten. Nachdem Luca den Einarmigen getroffen hatte, gab er dieses Vorhaben auf. Denn der Einarmige erzählte ihm, was ihn als einer dieser Waldarbeiter erwartete.
Man fragte die Tagelöhner nicht, ob sie jemals einen Baum gefällt hätten, sondern drückte ihnen Äxte und Sägen in die Hände und ließ sie von Waffenknechten der Herrschaften dorthin führen, wo die edlen Hölzer wuchsen. Am Schlagort angekommen, wies man die Arbeiter an: Das rodet ihr bis heute abend. Unterdessen schwärmten die Bewaffneten aus und bezogen in einem großen Umkreis um die Schlagstelle herum Wache. Den ganzen Tag standen sie da, auf ihre Lanzen gestützt und in ihren Waffenröcken erbärmlich vor sich hinschwitzend. Worüber sie wachten, das wußte man nicht so genau, ob über die Tagelöhner oder darauf, daß nicht unversehens eine Rebellenbande die Waldarbeiter überfiele.
Den großen Bäumen rückten die Tagelöhner zu fünft oder sechst zu Leibe. Sie hackten so lange auf die dicken Stämme ein, bis sie endlich nachgaben und fielen. Unkundig wie diese Waldarbeiter waren, war es immer ein Glücksspiel, in welche Richtung der Baum stürzte und welche anderen Bäume er mit sich riß. Sobald also Geschrei anhub, schaute man nicht lange, sondern begann zu rennen und zu beten, daß der Stamm nicht gerade dorthin fiele, wo man sich aufhielt, und einen unter sich begrub. Das gelang nicht immer, versicherte der Einarmige Luca glaubhaft. Und dann war da natürlich noch der Wald selbst, mit seinen wehrhaften Bewohnern.
Eines Tages, nachdem Luca schon etliche Monde auf der Imana‘cha verbracht hatte, Monde, in denen er weniger gelebt hatte, als vielmehr zufällig anwesend gewesen war, bettelte er eine Frau um ein Almosen an, die er zwar schon öfter gesehen hatte, aber die er bei seinem täglichen Streben nach ein paar Kupferstücken nicht gleich erkannte. Die Frau war etwas über fünfzig, und ihr gehörte ein Stand auf dem Markt, an dem Luca nicht nur einmal eingekauft hatte. Sie blieb stehen, sah den Bettler ernst an und sagte: »Was wirst du tun, wenn du einst vor Gror stehst und sie darauf wartet, daß du ihr die Vierundsechzig Fragen des Seins stellst?«
Die Frage kam so überraschend für Luca, daß er zuerst nicht wußte, was er darauf antworten sollte. Die Frau ließ ihm auch keine Zeit für eine Antwort, sondern sprach weiter: »Was wirst du tun, wenn Gror dann sagt: Über achttausend Jahre habe ich auf dieses Geschenk meiner Bruderschwester gewartet. Über achttausend Jahre habe ich begierig gewünscht, deine Fragen beantworten zu können. Gibt es denn nichts, was einer Frage würdig wäre, hat meine Bruderschwester mir nur billigen Tand geschickt?«
Auch wenn Luca Rur und Gror für Götzen hielt, so verstand er doch, worauf die Frau mit ihren Fragen hinauswollte. Die Vorstellung, vor einem Wesen zu stehen, das mächtig genug war, um die ganze Welt als Geschenk zu erhalten, und gefragt zu werden: »Womit hast du eigentlich dein ganzes Leben vertrödelt, Sterblicher?« bereitete ihm ein klammes Gefühl. Rasch hatte Luca geantwortet: »Ich glaube nicht an deinen Gror.«
»Du bist ein Garethja, was, Kleiner?« fragte die Frau. »Ich bin nicht sehr bewandert in eurem Glauben, aber was wirst du sagen, wenn du einst vor Bruder Praios stehst und er darauf wartet, daß du ihm erzählst, was du die ganze Zeit getrieben hast? Weiterhin Maulaffen feilhalten, bis Schwester Hesinde hinzutritt und sagt: Nun, ein wenig Verstand habe ich dir doch gegeben, zumindest genug, um zu reden? Willst du sie beschämen, ebenso wie den Kleinen Bruder Phex, wenn er eingestehen muß: Ich dachte immer, ich hätte ein wenig Beharrlichkeit und Neugier in ihre Herzen gepflanzt, doch das war eine eitle Einbildung von mir!«
Ein Wimmern kam aus Lucas Mund. Die Vorstellung, dem gestrengen Praios, dem allgewaltigen Götterfürsten, gegenüberstehen zu müssen, war schlimm genug, noch schlimmer aber war die Art und Weise, wie die Frau sprach. Man sagte nicht Bruder zum HERRN Praios, auch nicht Schwester zur HERRIN Hesinde, nicht einmal den Götterdieb Phex bezeichnete man schnöde als klein! Man sprach nicht über die Zwölfe, als seien sie Verwandte oder Bekannte von ... nun, vom Markt von Jergan eben! Luca war sich sicher, das sein Schicksal besiegelt sei und die ewige Verdammnis ihn erwarte. Nicht weil er selbst einen Frevel begangen hatte, sondern weil er die Frau nicht sofort am Weitersprechen gehindert hatte und eben in der Nähe war, wenn Praios einen alles verzehrenden Flammenstrahl vom Himmel schickte, was jeden Augenblick der Fall sein mußte. Luca zitterte am ganzen Leib, und Tränen des Selbstmitleids rannen ihm über die Wangen. Als nach einiger Zeit immer noch nicht Verderben und Vernichtung über ihn gekommen waren, wagte Luca wieder aufzusehen. Die Frau war nicht mehr da, offenbar gerade noch rechtzeitig gegangen. Statt dessen lagen ein paar Kupferstücke bei ihm. Luca rang den halben Tag mit sich, was er mit dieser Gabe aus lästerlicher Hand anfangen solle, ob er die Münzen einfach in den Fluß werfen oder behalten sollte. Schließlich ging er zum Tempel Efferds auf der Imana‘cha und spendete dort die Hälfte der zweifelhaften Gabe, den Rest behielt er für sich. Den Herrn Efferd hatte die Frau nicht gelästert, und wenigstens mit einem der Zwölfe wollte sich Luca gutstellen.
Am nächsten Tag wurde Luca abermals an den Rand der ewigen Verdammnis geführt, denn wieder erschien die Frau. »Entschuldige, Bruder, daß ich dich gestern so erschreckt habe«, sagte sie. »Doch ich vergesse immer wieder, daß ihr Garethjas Bruder Praios für einen Tyrannen haltet. Ich verstehe nicht, wie man den Peniblen so sehen mag! Denn wie kann einer ein unbeherrschter Wüterich sein, wenn er doch jeden Tag Licht und Wärme bringt? Vor allem Wärme!« Sie seufzte und wischte sich den Schweiß von der Stirn: »Allerdings übertreibt er sein Geschäft heute mal wieder.«
Statt einer Antwort quiekte Luca nur kurz. Die Zwölfe führten keine Geschäfte, und bestimmt redete ihnen auch kein Sterblicher darin hinein, schon gar nicht dem Herrn Praios! Das war Anmaßung.
Den Tag darauf bettelte Luca an einer anderen Stelle, doch schon am übernächsten hatte ihn die Frau wieder ausfindig gemacht. In dem Versuch, sein Seelenheil zu retten, begann Luca ein Versteckspiel mit ihr. Mal hielt er sich am östlichen Ende der Imana‘cha auf, mal am westlichen, doch wohin er auch ging, die Frau spürte ihn auf, gab ihm einige Münzen und führte dabei ihre lästerlichen Reden. Traf sie ihn auf dem Markt, so begrüßte sie ihn schon von weitem wie einen alten Freund. Nach ein paar Wochen hörte Luca auf, vor ihr zu flüchten. Er hatte sich gefragt, ob die Frau vielleicht eine Prüfung der Götter sein könnte, sich dann aber besonnen, nie gehört zu haben, daß die Versuchung der Gläubigen in der Gestalt einer spindeldürren Frau erschiene, die einem Bettler ein paar Münzen gab und etwas respektlos über die Götter sprach. Vielmehr hatte er daheim von den Geweihten gelernt, daß die Versuchung entweder von verwerflicher Schönheit sei, was man bei dieser Frau wirklich nicht sagen konnte, oder eingehüllt in Schwefelgestank und Grauen, was ebenfalls nicht stimmte.
Mit der Zeit gewöhnte sich Luca an seine Besucherin, freute sich sogar darauf, mit ihr plauschen zu können. Meist hörte er ihr nur zu, denn sie neigte etwas zur Geschwätzigkeit. Eines Tages sagte sie zu Luca, er könne mit zu ihr kommen. Nun verstand der junge Mann, warum die Frau immer so freundlich zu ihm gewesen war. Offenbar hatte sie Gefallen an ihm gefunden und wollte sich ihn zu ihrem jungen Geliebten nehmen. Luca überlegte nur kurz. Die Frau war älter, als seine Mutter gewesen wäre, lebte sie noch. Sie war freundlich, und ihr Galan zu sein war allemal besser, als in der Hoffnungslosigkeit dieses Bettlerdaseins zu verbleiben. Also folgte ihr Luca. Er war einigermaßen überrascht, als sie ihm auf dem Weg zu ihrem Zuhause sagte, daß sie schon lange mit dem Gedanken gespielt habe, sich einen Gehilfen zu nehmen. Luca wußte nicht, ob er ihr glauben sollte, ob es ihr wirklich nur darum ging, oder ob ihr ihre wahren Beweggründe im letzten Augenblick peinlich geworden waren.
Für vier Monde war Luca der Gehilfe der Marktfrau. Er lebte in ihrem Haus, und Tag für Tag ging er mit ihr auf den Basar, wo er wog, feilschte und verkaufte und nach und nach wieder zu sich selbst fand. Eines Abends, als Luca seinen Verdacht schon fast vergessen hatte, war es dann soweit. Dem jungen Mann war aufgefallen, daß die Frau schon den ganzen Tag über mit etwas beschäftigt gewesen war. Abends sagte sie mit einem Ausdruck außerordentlicher Wärme und Zuneigung in den Augen: »Lucajian, ich muß etwas mit dir bereden. Du hast keine Anverwandtschaft auf Hunderte von Meilen. Auch ich bin allein, denn wie du weißt, ist mein Gefährte schon vor Jahren gestorben, und mir war nicht vergönnt, Kinder zu haben.«
Luca bereiteten diese Worte Unbehagen. Inzwischen war ihm nicht mehr gleichgültig, was er tat und was mit ihm geschah. Jedoch hatte er der Frau so viel zu verdanken und wollte nicht Grund eines Leids
für sie sein. Er wünschte sich weit fort.
»Lucajian, hörst du zu?« fragte die Frau.
»Ja«, antwortete Luca mit einem Kloß im Hals.
»Lucajian, willst du mein Sohn sein?«
Luca war sprachlos. Deshalb erklärte ihm die Frau, daß es unter Maraskanern nicht unüblich sei, jemanden an Kindes Statt anzunehmen, der keine Verwandtschaft mehr habe, selbst wenn das Kind schon lange kein Kind mehr sei. Luca überlegte bis zum nächsten Morgen, dann ging er mit der Marktfrau zum Tempel der Zwillinge, wo dieser neue Bund in das Buch der Anwesenden eingetragen wurde, so als sei Luca eben erst geboren worden.
Sechs Jahre lang lebte Luca im Hause seiner Mutter. Die Arbeit auf dem Markt machte ihm Freude, und als er zum ersten Mal ›wir‹ sagte und Jergan und Maraskan meinte, bemerkte er es nicht einmal. Selbst an die bisweilen lose Zunge seiner Mutter gewöhnte er sich, nachdem er sich zurechtgelegt hatte, daß sie nichts Lästerliches im Sinne hatte, wenn sie von den Zwölfgöttern als Dienern Rurs sprach, daß sie damit keine gewöhnlichen Knechte und Mägde meinte, sondern Fürsten und Königinnen, die Vasallen eines wohlwollenden Kaisers waren.
Am Tage nach dem Tode seiner Mutter ging Luca zum Tempel Rurs und Grors. »Ich weiß nicht viel über euren Glauben«, sagte er zu den dortigen Priestern, »außer dem wenigen, das ich von meiner Mutter mitbekommen habe. Deshalb wünsche ich, daß ihr mich lehrt, denn ich habe beschlossen, einer der Priester der Zweie zu werden.« Luca gönnte seiner verstorbenen Mutter diesen Triumph seiner Konversion, den sie zu Lebzeiten nie gehabt hatte, war sich aber gleichzeitig sicher, daß sie das nicht als Triumph angesehen hätte, sondern als etwas völlig Naheliegendes. Nach einem halben Jahr im Tempel verschenkte Luca den Marktstand an zwei Schwestern, die er einige Tage vorher auf der Imana‘cha ausgewählt hatte. Auch wenn ihm das Pathetische seiner Tat bewußt war, so erschien sie ihm doch von zwangsläufiger Richtigkeit.
Das war jetzt drei Jahrzehnte her. Bisweilen erinnerte sich Luca, wie oft er sich in der Zeit seiner Strandung gewünscht hatte, daß alles wieder gut werde. Im Rückblick wußte er, daß tatsächlich alles gut geworden war, nur auf eine Weise, die er sich nie vorgestellt hatte. Ja sogar besser, denn alles in allem hatte er gute Jahre in Jergan verbracht, weshalb Luca sich sicher war, stürbe er heute, so geschähe es mit einem Ausdruck glückseliger Ausgeglichenheit.
Der gewöhnliche Mord
Die Straßen auf der Imana‘cha waren wie immer voll und laut, und die Luft war feucht. Vor einem Haus, dessen Steine mit einem grün-gelben Moos bewachsen waren, das abzukratzen niemand für nötig hielt, blieb Luca stehen und klopfte an die Tür, so wie man ihn geheißen hatte: viermal schnell hintereinander, dann zweimal in Abständen.
Eine Frau mit einem Säugling auf dem Arm öffnete. Bevor sie noch irgend etwas sagen konnte, platzte Luca schon mit der vereinbarten Losung heraus: »Ich bringe dir Grüße von Garalor, aber keine von Arethin!«
Die Frau trat zur Seite, ließ Luca eintreten und führte ihn durch ein Treppenhaus mit ausgetretenen Stiegen, an dessen Wänden grauer Schimmel wuchs, in einen fast leeren Raum in der ersten Etage. Dort warteten bereits zwei Männer und eine brünette Frau. Einer der Männer, ein hagerer Fünfziger, dessen blonde Krause einen seltsamen Kontrast zu seiner recht dunklen Hautfarbe bildete, unterhielt sich mit der Frau, während der zweite, ein breitschultriger Kerl mit kurzem Stoppelhaar, abweisend dreinblikkend, etwas abseits stand. Dieser zweite Mann mochte etwa dreißig sein. Wie alt die Frau war, wagte Luca nicht einzuschätzen, irgendwo zwischen zwanzig und vierzig. Ihr Gesicht hatte früh seine Unschuld verloren, war gezeichnet von den Narben, die die Zeit hinterläßt. Luca bezweifelte, daß sie oft lachte.
»Preiset die Schönheit, Bruderschwester!« begrüßte ihn der Ältere mit einem Kopfnicken. »Ich bin Garamold von den Fren‘Chira Marustazzim. Ihr müßt entschuldigen, Bruder, aber wir sind noch nicht vollzählig.«
»Ich hoffe, du täuschst dich darin nicht, Garamold«, warf die Frau ein und wandte sich an Luca: »Sumujida von den Sira Jerganak. Da wir in Jergan sind, wäre wohl eher mir die Rolle zugekommen, die Gastgeberin zu sein, jedoch haben Garamolds Leute zu diesem Treffen geladen.«
Sira Jerganak und Fren‘Chira Marustazzim – zwei der drei Rebellengruppen, die im Sommer Sinoda besetzt hatten! Also mußte der dritte dem Haranydad angehören, dachte Luca. Doch er wurde anderweitig belehrt.
»Elgoran von den Sira Roabanak«, schnauzte der jüngere Mann grob. Offenbar waren seine Worte unhöflicher herausgekommen, als er beabsichtigt hatte, denn er setzte ein verschämtes ›Bruder‹ hinterher.
»Ich hätte Euch schon nicht vergessen!« sagte Garamold mit einem spöttischen Lächeln. Der jüngere Mann antwortete nicht, sondern setzte statt dessen wieder seine säuerliche Miene auf.
Die Männer trugen die übliche Bauernkleidung: weitärmelige Jacken, dazu bunte Pluderhosen, die unter dem Knie gamaschenartig umwickelt waren. Die Frau trug zusätzlich noch einen Halbrock darüber. Im Gegensatz zu den beiden anderen, die Schnitter mit sich führten – zwar als Waffen gebraucht, aber kein ungewöhnliches Beiwerk, wenn ihre Träger vorgaben, aus einem Dschungeldorf zu kommen –, konnte Luca bei Garamold die lange Klinge eines Tuzakmessers ausmachen. Luca fragte sich, wie der Krauskopf damit an den Stadtwachen vorbeigekommen war. Dieses Schwert konnte man schwerlich mit dem Buschmesser eines Bauern verwechseln.