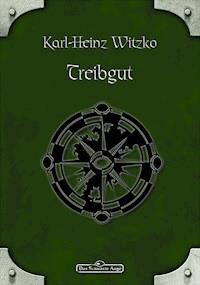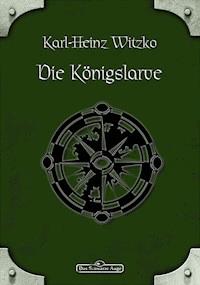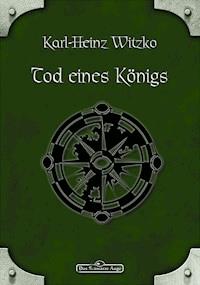
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
»Lange haben wir es nicht mehr gesehen«, wisperten die Schmetterlinge spöttisch. »Was begehrt es von uns? Sollen wir ihm schaden, ihm raten oder es grüßen: Hoch, König von Maraskan?« »Ich bin Dajin, Herrscher dieser Insel, Haran aller Harans«, antwortete der Gegürtete wachsam und furchtlos. (Obschon er nicht wußte, daß dieser Roman nur den ersten Teil seiner Leben erzählte.)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karl-Heinz Witzko
Tod eines Königs
Ein Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©
Das Leben König Dajins in Vergangenheit und Gegenwart I
Originalausgabe
Impressum
Ulisses SpieleBand 34
Redaktion und Lektorat: Catherine Beck Kartenentwurf: Ralf Hlawatsch E-Book-Gestaltung: Christian Lonsing & Michael Mingers
Copyright © 2015 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN, DERE,MYRANOR, RIESLAND, THARUN und UTHURIA sind eingetragene Marken der Significant GbR.Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.
Print-ISBN 3-453-14029-X (vergriffen)
Widmung
In weiten Teilen Aventuriens ist das zerbrochene Rad das Symbol des Todes. Anders auf Maraskan:
Das Rad zerbricht nicht, sondern rollt weiter in den Erinnerungen der Lebenden.
Im Gedenken an Silke Balla, Ulrich Kiesow und Johann Witzko
Die Braut in Weiß, Lilien in ihrem Haar - 1. Kapitel
Der einzelne Baum stand in einer flachen Senke, an deren Rand hüfthohe Sträucher wuchsen. Sie trugen silbergraue Blätter, kaum größer als Daumennägel, die metallisch schimmerten und träge flüsterten, wenn der spärliche Lufthauch sie bewegte.
Obwohl der Baum schon lange abgestorben war, blühte er. Vor Jahren hatte ihm ein Blitz die Seite aufgerissen und dem Baum eine klaffende Wunde beschert, aus der sein giftiges Harz quoll wie dickes Blut. Der bereits alte Kurinbaum erholte sich nie mehr von dieser Verletzung, und eine Schar gefräßiger Käfer gab ihm den Rest.
Und dennoch stand der Baum scheinbar in voller Blüte, jedoch nur auf den ersten Blick. Zahllose Schmetterlinge hatten sich auf den toten Ästen niedergelassen und krochen wimmelnd über die alte Rinde. Tausende mochten es sein, vielleicht sogar Zehntausende. Die Mehrzahl von ihnen war klein, braun und unscheinbar, aus der Ferne leicht zu verwechseln mit verwelktem Laub. Eine Minderheit war bunt, mit Flügeln von Handtellergröße, die aufgeklappt riesige, schillernde Augen vortäuschten oder drohende Rachen mit mörderischen Zähnen. In der Masse ihrer unauffälligen Artgenossen glichen die größeren Falter Primadonnen in irisierenden Gewändern, Fürsten in metallischem Blau und Gold, Königinnen in Orange und Blutrot, Wesiren im gelbgrün gestreiften Gewand. Sie wurden umschwärmt von gedrungenen Gardisten mit silbrigem Zackenmuster auf den fein-geschuppten Flügeln und gnadenlosen Vollstreckern in Samtschwarz.
Gut fünfzig bis sechzig unterschiedliche Arten dieser leichtmütigen Geschöpfe hatten sich auf den verdorrten Zweigen niedergelassen. Sie hingen am Stamm mit zusammengeklapptem oder saßen auf den Spitzen der Äste mit ausgebreitetem Flügelpaar, bildeten mancherorts Trauben oder wimmelten wirr durcheinander, bis auch die letzten von ihnen eine freie Stelle fanden, wo sie zur Ruhe kamen.
Wirr? Nein, wiederum nur auf den ersten Blick. Denn bis auf wenige Ausnahmen zeigten die zerbrechlichen Fühlerpaare dieses Schwarms von Schwärmen in genau eine Richtung. Gerade so, als warteten die tausendfach Geflügelten darauf, daß von dort etwas käme, daß etwas ganz Bestimmtes einträte.
Aber was? Zwar hatte die Zeit die Schmetterlinge herbeigerufen, aber die Zukunft kannten sie dennoch nicht. Denn niemand kennt sie, weder Mensch, Tier, Zwerg, Elf, Achaz noch Gott.
Niemand.
Niemand bis ins letzte genau.
Doch die Welt gebiert Muster. Tagein, tagaus, ohne Unterlaß. Die Muster der Wellenringe auf der Oberfläche eines Tümpels, die Muster der aufgewühlten Wogen der stürmischen See, die Muster des zurückweichenden Wassers am Strand, die Muster der Dünen und des Gerölls in der Unfruchtbarkeit der Wüste, die Muster der wachsenden und zurückweichenden Wälder, die Muster des Wolkenflugs am Himmel, die Muster der Vogelzüge, der Wanderungen der Herden oder der Menschen. Schließlich die Muster in den Gedanken, den Absichten, Triebfedern und Entscheidungen von Mensch, Zwerg, Achaz, vielleicht sogar Elf.
Viele dieser Muster verschwinden wieder, kurz nachdem ihre Entstehung begonnen hat, andere formen sich zuerst zielstrebig, bis sie vor der Zeit scheinbar grundlos wieder verschwinden, manchen bestimmt das Schicksal, in anderen Mustern unterzugehen oder mit ihnen zu verschmelzen. Doch bei einigen von ihnen nimmt die anfängliche Ausprägung stetig an Deutlichkeit zu bis zur vollen Entfaltung.
Das kann binnen eines einzigen Augenblicks geschehen oder sich über einen langen Zeitraum hinziehen. Besonders wenn letzteres zutrifft – und wenn die Muster unmittelbar mit dem Geschick der Menschen zu tun haben – ist der Prozeß ihrer Wahrnehmung eigenartig abgestuft.
Zuerst schlägt die Stunde der Visionäre, Propheten und Seher. Sie erhaschen aus ihren Augenwinkeln, daß irgend etwas in Entstehung begriffen ist. Sie deuten das Wenige, das sie verstehen, und folgern daraus das, von dem sie meinen, daß es eintreten werde. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihre Folgerung auf dem Muster der Sterne am nächtlichen Himmel, der Form eines Priels oder den Schlingen eines Schafsdarms beruht, denn wie Zendajian lehrte, gilt: Kein Teil der Welt ist dem anderen fremd.
Dann kommt die Stunde der Weisen und Philosophen, die ein Teil des Musters erkennen und gelegentlich richtige Schlüsse daraus ziehen. Schließlich die Stunde der Erfahrenen, die eine gewisse Vertrautheit mit dem Guten, Bösen oder auch Gleichgültigen zu verspüren glauben. Und endlich der Zeitpunkt, an dem das Muster sich offenbart, wie ein Schmetterling, der aus seinem Kokon schlüpft und zum ersten Mal seine Flügel ausbreitet, wo es jeder, gleich ob Mensch, Zwerg, Elf oder Achaz, erkennen könnte. Für gewöhnlich fällt dieser Zeitpunkt möglicher Erkenntnis einer plötzlichen Erblindung der Beobachtenden zum Opfer. Das nun Klare und Offensichtliche verschwimmt schlagartig vor den Augen, seine Existenz wird geleugnet, andere Begründungen werden bemüht, Irrtümer eingeräumt, und Entschuldigungen für das noch kurz zuvor Behauptete erscheinen angebracht.
Woher diese befremdliche Sehstörung rührt, ist rätselhaft und schwer begreifbar. Manchmal trägt sie den Namen Wunsch, manchmal auch Hoffnung, doch möglicherweise ist die Frage nach ihrer Ursache eine der Vierundsechzig Fragen des Seins, die lohnenswert genug sind, sie dem göttlichen Gror zu stellen, wenn er dereinst den Weltendiskus in Empfang nehmen wird.
Das Wissen um solche Muster, das Sehen ohne am Ende zu erblinden, öffnet die Tür in die Zukunft. Beides führt zur Kenntnis des Augenblicks, bevor alles beginnen wird, und das liefert das Wissen um den Augenblick, nachdem alles geendet hat. Das ist eine der Schwungfedern des Vogels Macht. Und so können wir mit Fug und Recht folgern, daß sich die Mächtigkeit einer Wesenheit aus dem frühzeitigen Erkennen dieser Muster ableiten läßt.
Zweifellos reichte Rur, der die Welt als Geschenk für Gror erschuf, der sein Bruder und gleichzeitig seine Schwester ist, die Zeichnung auf dem Flügelpaar des ersten Schmetterlings völlig aus, um den gesamten Zeitraum des Flugs des Weltendiskusses zu erahnen.
Die Schmetterlinge hatten den toten Kurinbaum nicht unbedacht gewählt. Er bot ihnen einen guten Ausblick:
Die Schmetterlinge mit ihren gedrungenen Körpern sahen einen gelben Felsen, der sich jäh vom Ufer des warmen Meeres erhob. Die Sonne des späten Nachmittags ließ ihn an manchen Tagen golden erstrahlen, doch meistens erinnerte er an einen vertrockneten Käse mit zahllosen Rissen, wie etwa jetzt, im Niemandsland zwischen Tag und Nacht.
Die Schmetterlinge mit ihren behaarten Leibern sahen eine Stadt auf diesem Felsen, deren Häuser zum überwiegenden Teil schlanke Türme waren.
Die Schmetterlinge, deren Rücken mit dicken Borsten bewehrt waren, sahen einen weißen Palast in dieser Stadt. Er lag ein wenig abseits des Zentrums, seinerseits erbaut aus mächtigen Türmen, acht an der Zahl. Die Türme standen im Kreis. Kein sorgfältig gezirkelter Kreis, sondern ein mit Makeln behafteter, wie einer, den ein schneller Finger in den Staub malt. Die Abweichung vom Ideal war nicht so groß, als daß jemand bestritten hätte, daß die Grundmauern der acht Türme einen Kreis nachbildeten, aber groß genug, um Generationen von Hofbaumeistern ein Dorn im Auge zu sein. Kaum einer aus der langen Reihe von Baumeistern hatte nicht im Verlauf der Jahrhunderte versucht, die Nachlässigkeit des ersten Tages durch Um- oder Anbauten zu verschleiern. Behoben hatte sie keiner von ihnen, denn dazu hätte man mehrere Türme abreißen und neu errichten müssen.
Keiner dieser Baumeister ahnte jedoch, daß die Türme genau so standen, wie es geplant war. Mit Ausnahme eines einzigen, des allerersten Baumeisters. Denn der hatte sie getreu den Träumen einer fast tauben Hirtin errichtet. Doch das war verlorenes Wissen. Verhallt im röchelnden Lärm zahlreicher Schlachten, Kämpfe und Fehden, die das Land mitangesehen hatte, zertreten von Jahrhunderten manchmal nachlässiger, bisweilen wohlmeinender, oftmals unerbittlicher Tyrannei durch das mächtige Reich im Nordwesten, auf der anderen Seite eines breiten Meeresarmes.
An der Basis waren die über dreißig Schritt hohen Türme miteinander verbunden, ebenso in luftiger Höhe. Dort jedoch durch eine Vielzahl kurzer Übergänge und Brückchen, die nachträglich und nach Bedarf oder Laune dem Bauwerk hinzugefügt worden waren, und die meist nur zeitweise Teil des Bauwerkes waren, da sie wieder entfernt wurden, wenn Bedarf oder Laune sich geändert hatten.
Die Türme waren durchzogen von Gängen und Treppenhäusern, sie beherbergten Säle, Gemächer, Kammern, große wie kleine, in denen eine beträchtliche Anzahl von Menschen schlief, sich liebte, aß und starb.
Die Schmetterlinge, deren Köpfe scharfkantige Auswüchse trugen, sahen eine Mauer dieses Palasts, unterbrochen von zahlreichen Fenstern.
Die Schmetterlinge mit ihren Flügeln wie Pfeilspitzen sahen eines der Fenster dieser Mauer. Es stand offen, und der Vorhang flatterte leicht. Von drinnen drangen das nörgelnde Gekrähe eines Säuglings nach draußen, das beschwichtigende Glucksen einer vollen Frauenstimme, das Scharren einer sich öffnenden und wieder schließenden Schiebetür.
Die Schmetterlinge, die statt Saugrüsseln Kiefer besaßen, sahen einen gezackten Riß in der Wand unter dem Fenster. Grünschillernde, platte Käfer wuselten aus ihm heraus, winzige Larven in ihren mattschimmernden Greifzangen tragend.
Die Schmetterlinge, denen Ungeduld fremd war, sahen unter dem Riß in der Wand, unter dem Fenster in der Mauer, die Teil des Palastes war, in der Stadt, die auf dem Felsen lag, auf den verwinkelten Hof des Palastes. Er war mit grobem Sand aus den Alabastermühlen Sinodas ausgestreut, auf dem purpurne und goldene Blüten verwelkten. Zu dieser Tageszeit lag der Hof verlassen da, denn noch nicht einmal die Dienstboten des jungen Königs hatten ihr Tagewerk begonnen.
Die Schmetterlinge, für die alles von gleicher Gültigkeit war, sahen.
Sie sahen einen Mann ins Freie stolpern. In der Mitte des Hofes fiel er auf die Knie, Tränen und Blut liefen über sein Gesicht. Er schrie voller Schmerz und Verzweiflung: »Der König ist tot! Der König ist tot!«
2. Kapitel
Ramelusabs herzförmiges Gesichtchen verzog sich, und ein stoßweises Kichern kam aus ihrem Mund. Als sie den mahnenden Blick ihres Vaters auffing, legte sie rasch beide Hände vors Gesicht, um das Lachen abzudämpfen. Später gäbe es noch genügend Gelegenheit für lautes Gelächter und fröhliche Ausgelassenheit, doch nicht jetzt, während Vetter Marech mit der fremden Frau, die nicht einmal richtig sprechen konnte, ernst den Kreis abschritt. Später, wenn dem jungen Paar die kleinen, brennend scharfen Pastetchen, die speicheltreibend süßen Küchlein oder die heimtückisch bitteren Tränke gereicht wurden, wenn die beiden Frischvermählten Zielscheibe all der Neckereien und Schabernacke wurden, die seit alters her üblich waren. Den Mund unter dem schützenden Zelt ihrer Hände verborgen, verfolgte Ramelusab die feierliche Zeremonie. Ihre Fingerspitzen berührten sacht die bis zur Nase gespaltene Oberlippe, diesen Makel, der ihrem Gesicht Schönheit verwehrte, der ihr den verhaßten Spitznamen Lapijida eingebracht hatte, einen der vielen Namen der Hasenfrau aus den bekannten Volksmärchen.
Ramelusab lauschte der vertrauten Stimme ihres Vetters, der seiner schon bald nicht mehr Zukünftigen die Acht Regeln einer harmonischen Ehe aufzählte, die die Fremde unsicher, stockend und mit eigentümlichen Betonungen nachsprach. Marech hatte zwar lange mit seiner blaßhäutigen Geliebten geübt, damit sie die wenigen Sätze in seiner Sprache einigermaßen beherrschen würde, doch aus dem Mund dieser Frau klangen die vertrauten Worte wie gefangene Tiere, wie drohende Ungeheuer aus den Tiefen des Dschungels. Und manchmal wurden sie sogar dazu.
Vorsichtig linste Ramelusab nach links. Noch immer sprach Endijian jedes von Marechs Worten stumm und mit übertriebenen Lippenbewegungen mit. So als hoffe er, auf diese Weise Marechs Braut zwingen zu können, abermals Silben oder Vokale zu vertauschen, damit sie in ihrer Unwissenheit etwas sage, was ganz bestimmt nicht Teil der Acht Regeln war. Rasch wandte Ramelusab ihr Gesicht von dem stets fröhlichen Nachbarsjungen ab, als sie fühlte, wie das Lachen erneut in ihr aufkeimte.
Ein Lufthauch, sanft wie die Berührung eines Schmetterlingsflügels, kitzelte Ramelusabs Nacken. Sie mußte nicht lange raten, wessen Atem sie von hinten anblies. Noch bevor sich die kräftigen Arme um sie legten, wußte sie, daß ihr Gesichtsloser Geliebter erschienen war. Wer sonst besaß die Dreistigkeit, in Ramelusabs Träumen herumzuwandern, wie es ihm beliebte, ohne sich darum zu kümmern, ob das, was sie träumte, in ihrer Kindheit spielte oder in der Gegenwart? Wer sonst besaß diese ersehnte Rücksichtslosigkeit?
Ramelusabs Geliebter war nicht im wörtlichen Sinne gesichtslos. Es war nur so, daß sie sein Aussehen nicht in Erinnerung behalten konnte. Weder in ihren Träumen, und schon gar nicht im Wachen. Endete der Traum, so verblaßte das Antlitz ihres Geliebten – begann er, so war der Anblick des vertrauten Gesichts jedes Mal überraschend neu.
An der Oberfläche ihres Traums, nicht mehr ganz gefangen darin, aber auch nicht wach, sprach Ramelusab mit ihrem Geliebten. Sie lehnte sich gegen seinen Körper, wandte sich nicht um, zögerte den Augenblick des Neuerkennens hinaus.
»Eigenartigerweise hatte ich Endijian völlig vergessen. Denn kurz nachdem Marech mit seiner Frau den Kreis ging – sie haben jetzt auch schon sieben oder acht Kinder miteinander –, hat ihn der Herr, dem unser Dorf damals gehörte, fortgeführt. Ich weiß nicht einmal genau, wohin er ihn brachte, irgendwohin aufs Festland, wo er ebenfalls Anwesen besaß. Page solle Endijian dort werden, hieß es damals, das sei eine große Auszeichnung. So geschah es dann auch, und selbstverständlich haben wir nie wieder etwas von Endijian gehört. Ich weiß nicht, worin die Auszeichnung bestehen sollte, wenn sie bedeutete, von einem Tag auf den anderen in einen fernen Winkel der Welt verschleppt zu werden. Weder wir Kinder haben das damals verstanden noch seine Familie.
Als wir von Endijians Auszeichnung erfuhren, scherzten wir mit ihm, rangen ihm Versprechen ab, wovon er uns zu erzählen habe, wenn er von seinem Ausflug in die weite Welt zurückkäme. Doch als unser Freund weder nach Tagen noch nach Wochen zu uns zurückkehrte, begriffen wir endlich das, was die Erwachsenen von Anfang an verstanden hatten: Endijian war nicht ausgezeichnet, sondern nur Opfer einer Laune geworden. Der Herr wollte eben in seinen anderen Besitzungen einen Pagen aus unserer Gegend haben. Nun gut, oder auch schlecht, Herrschaften können befehlen, was sie wollen, dennoch schworen wir Kinder uns damals, daß wir nie ausgezeichnet werden wollten, daß wir uns eher im Dschungel verstecken würden, auch wenn ihn noch so viele Marasken und wilde Parder durchstreiften.
Das war natürlich noch während der alten Herrschaft, drei, vier Jahre bevor sich der Herrscher selbst zum König ausrief, wovon wir auf dem Land sowieso erst ein paar Monde später erfuhren. Nicht daß sich seither Wesentliches geändert hätte. Heutzutage benötigen die Herrschaften zwar keinen Pagen mehr in Gareth, Beilunk oder Raggert, aber vielleicht statt dessen in Jergan. Für die Zurückbleibenden macht das keinen Unterschied, ob jemand weit weg ist in Gareth oder Beilunk oder weit weg in Jergan. Weit ist weit, weg ist weg.«
Ramelusab drehte sich in den Armen ihres Geliebten um. Mit einer Spur von Überraschung erkannte sie wieder das vertraute, so schöne Gesicht, das wie immer alles verstehend lächelte. Sanft zeichnete der breite Daumen ihres Geliebten die Linie ihres Kinns, der Wangen und der gespaltenen Lippe nach. Ramelusab wandte sich nicht ab, so wie sie es sich seit den letzten Tagen ihrer Kindheit angewöhnt hatte. Dieser Daumen durfte sie berühren, denn im Beisein ihres Traumgeliebten empfand sich Ramelusab nicht als häßlich. Er war der einzige Mensch, vor dem sie sich nicht fürchtete.
Sie lachte: »Jetzt fällt mir wieder ein, wie der Praiosgeweihte – der Herr hatte selbstverständlich seinen eigenen – damals erfuhr, was wir Kinder uns geschworen hatten. Er war sehr erbost, meinte, solche Schwüre seien eine arge Sünde gegen die Götter, besonders gegen den Herrn Praios, und deshalb großes Unrecht. Überhaupt befänden wir frechen Gören uns sowieso schon halb auf dem Weg der Verdammnis.
Ich weiß nicht, ob der Geweihte sich wirklich einbildete, mit uns Kindern leichteres Spiel zu haben als mit den Erwachsenen. Vielleicht entsprangen seine Worte auch seiner fortwährenden Enttäuschung darüber, daß ihn niemand in As‘Khunchak sonderlich ernst nahm, zumal wenn er von seinem strengen Gott Praios donnerte und wütete und uns Heiden nannte, weil wir den Kopf schüttelten und ihm jedesmal entgegenhielten, daß unser guter Bruder Praios doch ganz anders sei. Keineswegs so, wie der Geweihte versuchte, uns einzureden. Doch wie vergeblich das war! Er wollte einfach nicht einsehen, daß selbst wir Kinder es besser wußten als er.
Tatsächlich beherrschte der Praiosgeweihte sogar die Sprache der Gemeinen. Nicht sehr gut, aber immerhin einigermaßen. Er hatte eine sehr feuchte Aussprache. Zumal wenn er sich erregte, versprühte er überall seinen Nebel. Du mußt wissen, Geliebter, daß er ohnehin seine Schwierigkeiten mit Z und S hatte. In der Wut verwandelte sich seine Aussprache regelmäßig in ein feuchtes Zischen. Je zorniger er wurde, desto mehr ähnelte er einer Spei-Echse!«
Ramelusab ließ ihre Hand in die Locken ihres Geliebten gleiten, spielte mit ihnen und wickelte sie sich um die Finger wie Bänder. Sie zog sein Gesicht zu sich heran und öffnete leicht den Mund. Kurz bevor sich ihre Lippen und die ihres Gesichtslosen Liebhabers berührten, verscheuchte ein ungleichmäßiges Hämmern Ramelusabs Traum.
3. Kapitel
Ein Schmied, dachte Ramelusab im Halbschlaf. Ein verdammter Hufschmied. Sie sträubte sich gegen das Erwachen, wünschte sich den entglittenen Traum zurück. Eine Geschichte, die sie vor einigen Tagen in einer Taverne erzählt bekommen hatte, sprang ihr urplötzlich ins Gedächtnis. Sie berichtete von einem der kleineren Drachen, der sich auf dem Dach eines Hauses niedergelassen und nicht geruht hatte, bis ...
Ein Drache ist auf dem Dach! erschrak Ramelusab und taumelte von ihrem Lager hoch. Verwirrt sah sie sich um. Sie war nicht in dem Zimmer, in dem sie erwartet hatte zu erwachen. Einige Augenblicke vergingen, bis Ramelusab bewußt wurde, daß sie sich in einem der Palasttürme befand, in einem Verschlag gleich unter dem Dach und nicht in ihrer gewohnten Kammer im Gebäude der Garde. In dem alten Gemäuer ihres bisherigen Zuhauses hatten sich Gurvanmaden eingenistet, deren giftige Ausdünstungen Ramelusabs Kammer und alle umliegenden Gemächer unbewohnbar machten. Jedenfalls solange, bis sich ein Magier fand, das Ungeziefer zu vertreiben, oder besser gesagt, bis einer der Befehliger sich herabließ, nach einem Magier zu schicken.
Das Hämmern, eher ein helles Klingen, hielt an. Es kam nicht von oben, wie Ramelusab – nun ganz wach – feststellte, sondern von draußen. Waffenübungen? So früh? dachte sie und wankte zu einem der schmalen Fensterschlitze. Sie sah hinab auf den Palasthof.
Vier verrenkte Körper lagen auf dem weißen Sand zwischen den verwelkten Blüten. Im Zwielicht des frühen Morgens bildete das Blut, das den Leibern entströmte, dunkle Pfützen. In einer Nische des Hofes erblickte Ramelusab eine kleine Gruppe ihrer Kameraden, halb bekleidet und notdürftig bewaffnet. Vergeblich wehrten sie sich gegen eine Übermacht, die sie mit langen Spießen in diese Nische gedrängt hatte und nun einen nach dem anderen von ihnen totstach. Währenddessen strömten scharenweise Bewaffnete wie Ameisen in die Eingänge der Palasttürme hinein.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!