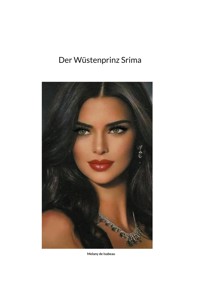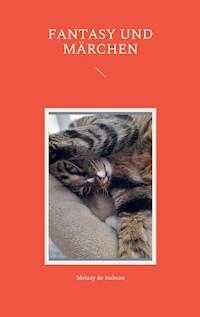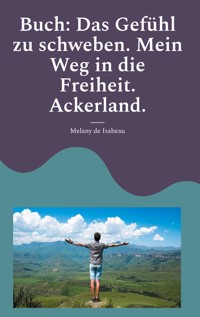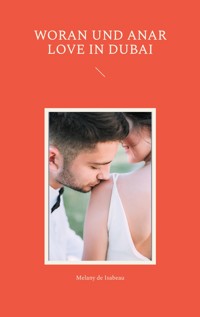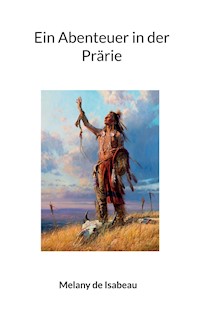Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die kleine Babaya lebt bei ihrem Vater in Afrika. Sie erlebt die schönsten Abenteuer und auch....
Das E-Book Dschungelkind Babaya wird angeboten von Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Kind, Afrika, Elefanten, Landschaft, Babaya
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Als sie noch winzig klein war, und noch so weich, und verschrumpelt wie ein rotes Eibischblatt an den Büschen neben dem Haus, hatte sie erschreckend hässlich ausgesehen.
Die Nase war viel zu groß, ein Kinn war kaum zu sehen. Eine Stirn, ja, die war vorhanden, aber keine Augenbrauen, dafür ein paar lächerliche, ganz kleine Haar – Stränchen.
Herr Vegenda war ziemlich entsetzt.
Aber schließlich hatte er ja noch nie einen neugeborenen Säugling gesehen. Und – um die Wahrheit zu sagen – er wusste auch nicht – was er nun, damit anfangen sollte. „Noch nicht mal einen Sohn, dachte er bestürzt. Ein Mann konnte einen mutterlosen Knaben schon irgendwie aufziehen, aber ein mutterloses Mädchen, na...! Eine Kinderfrau, eine Ayahda, war angenommen worden und stand jetzt neben dem Bettchen. „Gluck – gluck – gluck machte sie leise und stieß gurgelnde Laute aus. Anscheinend war dass die rechte Art, mit kleinen Säuglingen, umzugehen. Sie schien das zu wissen. „Nun fahren Sie schon fort“, sagte der Vater aus lauter Verzweiflung zu ihr. Dann ging er schnell weg. Er war ein englischer Forstbeamter, der in Indien seinen Dienst für die Regierung versah. Jetzt floh er in die kühlen Tiefen seines geliebten Dschungels und versuchte, je, dass winzig kleine Mädchen zu vergessen, dass ihm jedoch so viel Verlegenheit bereitete. Ayahda aber ging auf die Hinter-Verander zurück und rief den anderen Bedienten laut zu: „Ihr könnt jetzt kommen!“ Da eilten sie alle herbei. Man hörte das Rascheln ihrer nackten Füße auf den Kokosmatten.
Sie drängten sich herbei und stellten sich um das Bettchen auf, wobei ihre Gesichter einen etwas albernen Ausdruck annahmen, wie ihn jedoch die Erwachsenen leicht haben, wenn sie Säuglinge oder junge Hunde oder Lämmer betrachten. Und auch sie machten, Gluck – gluck – gluck und schnurrten wie die Katzen und sagten voller Begeisterung: „Fräulein Babaya.“ „Ausgerechnet ein Fräulein Babaya!“ Der Diener stand da, der Koch und der Gehilfe des Kochs, der Aufwäscher, der Wassermann und der Feger, all', diese Inder, die man in diesem Lande braucht, um einen Haushalt zu führen. Aber nicht nur sie, auch die beiden Büroangestellten, – die Boten – alle gluckten, anstatt bei der Arbeit zu sein. Sie alle waren den Anblick von Säuglingen gewöhnt,für sie war er nicht hässlich.
Nur waren ihre Kinder braun, wie Kaffee mit Sahne, eine hübsche Farbe! Und kohlrabenschwarze Augen hatten sie. Jedoch, ein rosiger Säugling mit blauen Augen war etwas Neues für sie. Auf jeden Fall aber war es eine feine Sache, ein Kind im Hause zu haben. Inder mögen Kinder gern. Doch ein kleiner Gedanke ließ ihnen keine Ruhe. Die Boten sprachen ihn zuerst aus: „Ach, ein Mädchen“, sagte der eine. Und der andere wiegte seinen Kopf, dass bedeutet: „Ja“, bei ihnen. Und da es mal gesagt war, pflichteten alle bei, dass es jedoch schade sei, das der Forstbeamte keinen Sohn bekommen hätte, der ihn trösten könne. „Keinen Sohn“, sagte der Koch, und der Diener schüttelte den Kopf. Auch der Küchengehilfe und der Feger schüttelten den Kopf und sagten: „Keinen einzigen Sohn!“ Ayahda, die schon das gleiche gedacht hatte, schnalzte jedoch plötzlich unwillig mit der Zunge. „Engländer mögen kleine Mädchen gern“, sagte sie. Und weil sie sich über die anderen geärgert hatte, fügte sie hinzu: „Habt ihr eigentlich heute keine Arbeit?“ Da schlüpften sie hinaus und murmelten, das Ayahda sich reichlich wichtig nahm – und dabei sei sie doch noch Neuling hier im Bungalow. Der Säugling wurde ihr völlig überlassen und auf indische Art erzogen.Wurde er wach, wurde er jedoch sofort aufgenommen. Schrie er einmal, wurde er sofort gefüttert. Oft sang Ayahda die Kleine in den Schlaf. Dann saß sie mit übereinander gekreuzten Beinen auf den Fußboden, hielt das Kind auf dem Arm und wiegte sich hin und her. Und als dann die ersten schimmernden Zähne durchkamen, rieb Ayahda mit einem ungewaschenen Daumen Zimt auf den schmerzenden Gaumen und gab dem Säugling Hühnerknochen zum Lutschen, was eine ordentliche Säuglingsschwester natürlich entsetzt hätte. Es war kein Wunder, dass Fräulein Babaya ein ganz verwöhntes Kind wurde und bei den ersten kurzen Krappelversuchen schon wusste, dass sie jedoch eine gewichtige Persönlichkeit war. Nur einer sah das nicht ein. Das war der riesige Mann, der Schuhe an seinen Füßen und statt der
flatternden weißen Gewänder einen steifen Khaki-Anzug trug. Das war der Mann,der die Autotüren zuschlug und immer mit so lauten Schritten über den Flur ging und „Boy“ rief, wenn er irgendwas wünschte. Ayahda brachte dem Kind bei, sich von ihm fernzuhalten. Sie wollte es ganz für sich allein haben. Aber Fräulein Babaya gehörte nicht zu der Sorte der furchtsamen, verschüchterten kleinen Mädchen. Sie konnte kaum gehen, als sie sich schon entschloss, dieses schreckliche Geschöpf näher kennenzulernen. Der Mann lag ausgestreckt in einem Liegestuhl auf der Veranda.
Es war Abend. Er trank ein Glas Whisky-Soda und schien nicht ungeduldig zu sein wie tagsüber. Fräulein Babaya stieß gegen ihn und hielt sich an seinen Hosenbeinen fest, um nicht hinzufallen. Der Mann sagte: „Hey!“
Was gibt’s?“ Er war überrascht. Er hatte sie bis dahin kaum beachtet.
Nun sah er sich erst ihre Nase an und ihre Augenbrauen an und war sehr erstaund, dass sie völlig normal aussahen. Und ihre Bäckchen hatten sich wie zwei Äpfel gerundet. Sie sah gar nicht mehr so hässlich aus. Nein, sie war ganz annehmbar, für so ein kleines Wesen. Ihr Vater sprach seine
Gedanken aus und sagte: „So etwas wird also daraus, erstaunlich!“ Er überlegte, was er jetzt tun sollte. Es wäre fein, eine Bekanntschaft zu schließen. Aber es kam ihm nicht in den Sinn, mit einem zweijährigen Kind zu sprechen. Und er war nicht der Mann, der sich mit Gurgeln und Gurren verständigte. Doch er wollte es gern richtig machen,also versuchte er zu gurgeln. Der Erfolg blieb aus!
Das Kind starrte ihn je, nur an, und er kam sich recht dumm vor. Schnell sah er weg, dahin,wo ihre Hände sich an seine Hosenbeine klammerten. Da bemerkte er, dass sie kleine Glasarmringe trug.Diese verwünschte Ayahda dachte er. Indische Frauen behängten ihre kleinen Kinder jedoch stets mit Schmuck, pressten dann die weichen kleinen Knochen in solche engen Ringe. „Himmel“, sagte er plötzlich, hat sie deine Ohren auch je durchlöchert, damit du Ohrringe tragen kannst, was? Lass mich mal sehen.“
Als ihr Vater erst ihr Handgelenk ergriff und sie dann am Ohr zupfte, schrie Babaya laut auf. Das Glas fiel zu Boden, es roch ganz furchtbar, und klein Babaya saß im Nassen. Der Mann rief „Boy!“ Der Diener und Ayahda kam angelaufen, mit einem Ruck wurde Babaya hochgehoben, je ausgescholten und dann gestreichelt, und während der ganzen Zeit sagte Ayahda ihr, sie solle es nie wieder tun. Darauf führten Fräulein Babaya und Daddy – jeder für sich – wieder ihr eigenes Leben. Vorläufig war es nichts mit dem Kennenlernen! Sie wurde drei. Sie wurde vier, viereinhalb Jahre alt. Ihr Vater hätte längst Urlaub nehmen und nach England zurückfahren sollen, denn es ist für die Gesundheit nicht gut, jahrelang ohne Unterbrechung in heißen, tropischen Ländern zu leben; aber der Gedanke, ein kleines Mädchen mitnehmen zu müssen, versetzte ihn in großen Schrecken. Schließlich bot er Ayahda Geld an,einen hohen Lohn, wenn sie mitkommen würde. Ayahda war überrascht. Sie hatte von Anfang an vorgehabt, mitzufahren.Was, sollte sie Fräulein Babaya allein lassen, damit jemand anders für sie sorgte?
Zudem rühmt sich jede indische Dienerin gern damit, in England gewesen zu sein. Und nach diesem Ruhm sehnte sich Ayahda, obwohl sie gehört hatte, dass es ein furchtbar kaltes Land, gänzlich ohne Sonne sei und das man jedoch, nirgendwo, einen ordentlichen Reis mit Curry bekommen könne. In England hasste Ayahda am meisten eine Person, die Tante Maudelana genannt wurde. Sie war eine knochige Frau mit einer tiefen, männlichen Stimme. Und sie war nicht davon abzubringen, mit allen Ausländern in einem Gemisch von gebrochenem Englisch und Zeichensprache zu reden. Dadurch fühlte sich Ayahda beleidigt, denn sie sprach ein sehr gutes Englisch, wenn es auch im Auf und Ab ihrer Stimme wie ein fröhlicher Sing – Sang klang.
Auch Daddy stand mit Tante Maudelana auch gar nicht gut. Sie war viel zu herrschsüchtig und hatte an allem etwas auszusetzen. „Henry, du bist zu dünn. Und sieh dir nur mal deine Finger an. Du rauchst zu viel!“ Wenn es das eine nicht war, war es das andere: „Henry, warum sorgst du nicht dafür, dass deinem Kind die Haare geschnitten werden? Warum sorgst du nicht für ordentliche Kleider? Wie soll sie so jemals zu einem vernünftigen Mädchen heranwachsen? Daddy platzte nicht vor Wut, wenn Tante Maudelana so etwas sagte, wie er es seinen Diener oder den Boten gegenüber gern getan hätte. Nur das Weiß um seine Nase und ein festeres Packen der Pfeife mit den Zähnen verriet seinen Ärger.
Und je länger er in England war, je schweigsamer wurde er..., stiller, und eigensinniger! Während dieser Unterhaltung saß Fräulein Babaya unter einem Rosenbusch und tat so, als höre sie nicht zu. Das gehörte zu ihren Lieblingsspielen. Sie hatte auch stets Erfolg damit, denn keinem Erwachsenen kam es in den Sinn, nicht über sie zu sprechen, solange sie in gewisser Hörweite schien.
Tante Maudelana sagte: „Wie heißt sie denn eigentlich? Willst du mir etwa damit sagen, dass sie noch nicht getauft ist? Du kannst sie doch auch nicht Babaya nennen, wie deine Bediensteten. Ich jedenfalls werde sie auf keinen Fall Babaya nennen!“
Als er nicht antwortete, rückte sie so ärgerlich auf dem Stuhl hin und her, dass er quietschte. Wieder sagte sie: Mir soll es ja gleich sein, aber gib ihr nicht so einen phantastischen Namen... wie Heidoni.“ Das war gerade der Name, den sie Henrys Frau immer übelgenommen hatte. „Aber sie heißt Heidoni“, erwiderte Henry, der sich nun, in eben diesem Augenblick dazu entschlossen hatte. Plötzlich sah Tante Maudelana, das das Kind mit einer Raupe spielte und kreischte laut auf. Sie mochte jedoch kreischende Frauen eigentlich selbst nicht, aber anderseits hasste sie Raupen. „Du kleines Pelztier“, murmelte Babaya und warf einen schrägen Blick aus ihren unternehmungslustigen Augen auf Daddy.
Aber sah den Blick nicht. Oder erkannte er nicht, dass seine mutige kleine Tochter ihm ein Zeichen geben wollte, dass sie auf seiner Seite war?
Und dabei hätte er eine so großartige Verbündete haben können, wenn er es nur gewollt hätte! Herr Vegenda aber wusste nicht, dass kleine Kinder ja, so viel verstehen können.Ein Kind hielt er doch nicht für einen richtigen Menschen mit eigenen Gedanken und Charaktereigenschaften,viele Männer sind so. Nein, Herr Vegenda wusste all das nicht. Er hatte noch vieles zu lernen, durch Erfahrung zu lernen.
*
Herr Vegenda hatte jedoch vorgehabt, das kleine Mädchen bei seinen Verwandten in England zurückzulassen.
Nachdem er aber Tante Maudelana einige Tage genossen hatte, erklärte er ihr in seiner ruhigen Art,über diese sich manche Leute so aufregen konnten, dass nichts – aber auch gar nichts – ihn dazu bringen könne.
Wörtlich sagte er: „Ich sehe sie lieber noch unter heidnischem Einfluss, Maudelana, als unter deiner Art Christentum!“So kam es,das Heidoni' Babaya mit ihrem Vater nach Indien zurückkehrte. Nach seinem Urlaub wurde Herr Vegenda Nilambur versetzt. Das ist ein kleines Dorf in der Nähe der Südwestküste Indiens.
Als Forstbeamter war er dort der einzige Engländer. Sein neues Heim stand auf einem Hügel oberhalb des Basars, wie die Rheihe der indischen Geschäfte heißt. Sein nächster britischer Nachbar lebte zwölf Meilen weit entfernt auf einer Gummiplantage. Dazwischen lagen Reisfelder und Regierungswälder, Herrn Vegendas Wälder. Für die arme kleine Heidi – Heidoni, gab es hier keine weißen Kinder zum Spielen. Sie lebte mit den Bedienten und hörte ihren Gesprächen zu. So kam es, dass sie viel zu früh von den Angelegenheiten der Erwachsenen erfuhr, die sie je, gar nicht wissen sollte, aber auch gar nichts von Büchern oder Unterrichtsfächern, oder Märchen.Sie war genau das was die englischen Damen mit Abscheu ein Hinterveranderkind nennen, weil es auf der Hinterverander die meiste Arbeit von den Bedienten erledigt wird. Dennoch war diese wilde – glückliche Kindheit mit Ayahda besser als ein Leben mit Tante Maudelana, bei der sie sich furchbar unglücklich gefühlt hätte.
Ayahda, die eigentlich – Sara hieß, wurde allmählich etwas plump und träge. Doch war sie mit ihrer Haut wie Kaffee mit Sahne und ihrem glänzenden schwarzen Haar immer noch hübsch zu nennen. Ihr Haar glänzte, weil sie es mit Öl einrieb; es war in der Mitte gescheitelt und im Nacken zu einem dicken Knoten zusammengefasst. Ihre Kleidung bestand aus einem weißen Sari; das ist weiter nichts als ein langes Tuch, das sie um sich geschlungen hatte. Es hüllte sie bis zu den Fußknöcheln ein und war vorne gerafft, damit sie sich frei bewegen konnte. Ein Ende legte sich um ihre Schulter und ließ die Arme frei. Darunter trug sie eine Bluse mit kurzen Ärmeln. Natürlich ging sie barfuß, und ihre Füße waren ziemlich groß und abgehärtet. An ihren Armen klirrten viele Reifen, und in jedem Nasenloch steckte ein kleiner goldener Zierknopf. Aber das Schönste von allem war die Blumenkrone, die Sara über dem Knoten befestigt im Haar trug. Einmal waren es wächserne Tempelblumen, ein andermal rosafarbene Oleanderblüten oder süß duftender Jasmin. Während Sara in die Breite ging, wuchs die kleine Babaya in die Höhe, als sollte sich das gegenseitig ausgleichen. Sie hatte das blasse, jedoch verwaschene Aussehen der Kinder, die in heißen Ländern leben. Selbst ihr Haar war fast farblos. Es war weizenblond, seidenweich und lang. Heidi war stets unordentlich, hatte abgerissene Knöpfe, Löcher in den Schuhen, ungewaschne und abgerissene Nägel.
Stets trug sie einen einteiligen Luftanzug aus Baumwolle und Segeltuchschuhe, oder ein Sporthemd und Shorts, genau wie ihr Daddy. Und natürlich einen Tropenhut, wenn sie nach draußen ging. Das ist ein großer Hut der aus Papiermasse hergestellt, in Form gepresst und mit Stoff überzogen wird. Er lässt keine Sonne durch und ist jedoch sehr leicht. Aber Ayahda bestand nicht darauf,dass Heidi einen Hut trug; sie war nicht streng.Mütter hatten damit nicht nach gelassen. Sie erwarteten stets voller Schrecken, das die unbedeckten Köpfchen ihrer Kleinen in tropischen Ländern schon nach fünf Minuten einen Sonnenstich bekommen; dabei sind sie in Wirklichkeit viel widerstandsfähiger. Ayahda war niemals streg,gleichgültig,worum es ging.Das war auch der Grund,weshalb Heidi sie auch so nett fand. Ayahda fragte nicht, wann Elfi ihre Mahlzeiten einnahm und wann sie zu Bett ging.
War es zu heiß zum Schlafen, konnte sie von ihr aus um Mitter-nacht auch aufstehen und einen Imbiss im Betienten Raum einnehmen; dafür durfte sie sich tagsüber wie ein klein' Tier zusammenrollen und schlafen, wenn sie Lust dazu verspürte.Das war ja auch viel bequemer, als sich Regeln und Uhren zu unterwerfen.Es hatte auch einen Nachteil; da es garkeine R egeln gab, lernte Heidi auch keinen Gehorsam, sondern tat stets nur das, was ihr gefiel. Und das bringt einen nun mal – später oder früher – Ungelegenheiten. Heidi fürchtete sich nicht mehr vor ihrem Daddy. Sie führten im gleichen ein ganz getrenntes Leben. Niemals spielte er mit ihr, niemals! Er würde auch gar nicht gewusst haben, wie man das macht. Dabei war Daddy nicht unfreundlich. Es war nur, dass er gar nichts von kleinen Mädchen verstand und niemanden hatte, der sie ihm begreiflich machte. Er kannte sich mit Bäumen aus, Ayahda mit Kindern. Wenn Daddy aber glaubte, dass es Jahr für Jahr so friedlich und ruhig zuginge, so hatte er sich gründlich getäuscht. Heidi wuchs heran.
*
Heidi war nun acht Jahre alt geworden. Da mischte sich eine englische Dame ein. Diese Dame sagte Herr Veganda, dass heidijetzt zu alt für Ayahda sei und eine Erzieherin brauchte: „Es ist unmöglich, ein Kind in diesem Alter ihrer Ayahda zu überlassen“, sagte sie, „sie hat überhaupt gar kein Benehmen. Und ihre Sprache ist grauenhaft! Sie ist ein richtiges Dschungelkind. Ich werde ihr eine Erzieherin besorgen.“ Daddy hörte mit besorgtem Blick zu. Dieser Blick besagte: „Oh weh! Dafür bin ich nicht zuständig. Ich weiß nicht so recht... aber ich nehme an, dass sie Recht haben.“ Und aus lauter Höflichkeit stimmte er zu. Wahrscheinlich hätte er selbst sich um nichts gekümmert. Aber die Dame fuhr nach England zurück, besorgte sofort eine Erzieherin und telegrafierte Dad' dass diese kommen würde. So war sie nun mal. Und daraus konnte man entnehmen, dass die Erzieherin auch nicht sehr geeignet sein dürfte. Das Telegramm überraschte Daddy doch sehr: „Erzieherin kommt heute an“, lautete es. Er war ganz verwirrt und verlegen. Zuerst musste er Ayahdas Lohn auszahlen, denn er konnte sie doch nicht beide behalten. Und weil er sich etwas schämte, sie so zu behandeln, blickte er dauernd zur Seite, als er ihr sagte, er brauche sie nicht länger. Außerdem gab er ihr noch den ganzen Lohn, für einen weiteren Monat, weil er ihr nicht rechtzeitig gekündigt hatte.Die kleine Babaya stand mit einem Boten vor der Bürotür. Beide wollten gern wissen, weshalb man nach Ayahda geschickt hatte,also lauschten sie. Als Ayahda plötzlich in lautes Schuchzen ausbrach, waren sie jedoch entsetzt.
Da stürzte sie schon heraus und an ihnen vorbei; ihre Hände umklammerten die Geldscheine, und aus ihren Augen liefen die Tränen. Sie warf ein Ende ihres Saris über das Gesicht und eilte zu ihrem Zimmer.
Und viele Reifen klirrten. Heidi stand reglos vor Wut. Als der Bote grinste, stieß sie ihn heftig ans Schienbein.
Dann ging sie hinein und baute sich entschlossen vor Daddys Schreibisch auf. „Ayahda geht nicht weg“, sagte sie. „Wie bitte?“, fragte Daddy. Er war so überrascht, dass er nichts anderes sagen konnte. Er traute kaum seinen eigenen Ohren. „Ayahda geht nicht weg“, wiederholte Heidi. Er starrte sie nur an. Was sollte das bedeuten? Ein Kind sagte ihm, was er tun sollte?Wohin sollte das führen, wenn die Kinder selbst endscheiden durften, wer ihre Erzieherin sein sollte? Es war einfach ungeheuerlich!
Dennoch blieb er höflich und sagte nur: „Sieh mal, eine neue Erzieherin kommt für dich, eine Engländerin.
Du wirst sie bestimmt jedoch leiden mögen.“ „Ich mag sie nicht leiden,“ sagte Heidi. Sie machte ihren Mund ganz schmal, und ihre großen Augen, sahen ihn durchdringend an. Vor dem Blick hätte er sich verkriechen sollen.
Daddy nahm einen Bleistift zur Hand und spielte mit ihm. Besorgt runzelte er die Stirn. Noch einmal versuchte er es. „Frau Sepcalfe sagte mir, ich lasse dich völlig verwildern. Sie sagte, du könntest dich überhaupt nicht benehmen. Warst du denn so ungezogen zu ihr?“ „Sie war ungezogen zu mir“,erwiderte Heidi. „Sie hat zu mir gesagt, ich redete schon, genau, wie Ayahda. Warum sollte ich