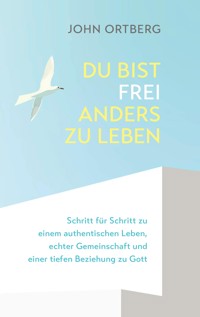
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Viele Lebensbereiche lassen sich nicht allein durch Anstrengung verändern. Bestsellerautor John Ortberg zeigt in diesem geistlich fundierten Praxisbuch, wie echte Veränderung möglich wird – nicht aus eigener Kraft, sondern im Vertrauen auf Gottes Wirken. Inspiriert von den Zwölf Schritten und gegründet auf den Lehren von Jesus, bietet er konkrete Hilfestellungen, um festgefahrene Verhaltens- und Denkmuster zu durchbrechen. Er zeigt, wie wir: • erkennen, wann Willenskraft hilfreich ist – und wann sie uns im Weg steht, • darauf vertrauen können, dass Gott für uns tun kann, was wir selbst nicht zu tun vermögen, • mit unserem Versagen umgehen und die Beziehung zu anderen wieder in Ordnung bringen können Ein alltagsnaher Leitfaden für alle, die sich nach Veränderung sehnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
John Ortberg ist ein Psychologe, evangelischer Theologe, Bestsellerautor, Referent und ehemaliger Seniorpastor der Menlo Park Presbyterian Church in Kalifornien. Er hat zahlreiche Bestseller geschrieben und hält Vorträge und Predigten auf Konferenzen und in Gemeinden überall auf der Welt. Er ist verheiratet mit Nancy, sie haben drei erwachsene Kinder und wohnen in der kalifornischen Stadt Menlo Park.
Zu seinen großen Bestsellern gehören Das Leben, nach dem du dich sehnst und Hüter meiner Seele.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Originally published in English in the U.S.A. under the title: Steps, by John Ortberg
Copyright © 2024 by John Ortberg
Copyright der deutschen Ausgabe © 2025 Gerth Medien in der SCM Verlagsgruppe GmbH,
Berliner Ring 62, 35576 Wetzlar. Mit Genehmigung von Tyndale House Publishers. Alle Rechte vorbehalten.
Wenn nicht anders angegeben, wurden die Bibelverse entnommen aus: Neues Leben. Die Bibel, © der deutschen Ausgabe 2002 und 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Witten/Holzgerlingen
Weitere verwendete Bibelübersetzungen:
Neue Genfer Übersetzung – Neues Testament und Psalmen, Copyright © 2011 Genfer Bibelgesellschaft (NGÜ)
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. © 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart (EÜ)
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe,© 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart (GN)
Hoffnung für alle® Bibel. Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.®. Verwendet mit freundlicher Genehmigung von Fontis – Brunnen Basel. Alle weiteren Rechte weltweit vorbehalten. (Hfa)
Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart (LU)
The Message by Eugene H. Peterson. © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000 NavPress Publishing Group. Alle Rechte vorbehalten. (MSG)
Erschienen im August 2025
ISBN 9783961227013
Umschlagfoto: AdobeStock/ DOUGLAS (Hintergrundmotiv); AdobeStock/ Elnare (Möwe)
Umschlaggestaltung: Kathrin Steigerwald, Hamburg
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
Druck und Verarbeitung: GGP Media GmbH, Pößneck
Printed in Germany
www.gerth.de
Für Nancy. Leidenschaftlich.
Und für die Gemeinschaft der Verdorrten Hand.
Inhalt
Vorwort von John Mark Comer
Einführung
Schritt 1: Das Problem: Ich kann’s nicht
1A: Schließ dich der Gemeinschaft der Verdorrten Hand an
1B: Bitte Gott um einen Moment der Klarheit
1C: Feiere deine Unzulänglichkeiten
Schritt 2: Die Lösung: Er kann.
2A: Richte den Blick auf etwas, das größer ist als du
2B: Übe dich im „Gut genug“-Glauben
2C: Mach die längste Reise
Schritt 3: Die Entscheidung: Ich glaube, ich überlasse es ihm
3A: Werde willens
3B: Übe dich in Gelassenheit
3C: Gib alles an Gott ab. Nimm es wieder an dich. Fang noch mal von vorn an.
Schritt 4: Die Selbstprüfung: eine unerschrockene Lebensbilanz
4A: Begreife, warum du Ordnung schaffen solltest
4B: Stell dich deinem Groll
4C: Stell dich deinen Ängsten
Schritt 5: Das Eingeständnis: der Schritt ins Licht
5A: Sei bereit, wirklich alles offenzulegen
5B: Worauf du achten solltest, wenn du jemanden suchst, dem du dein ganzes Leben offenlegen kannst
5C: Nutze die Kraft der Rechenschaft
Schritt 6: Die Vorbereitung: ganz bereit sein
6A: Mach den Schritt von „fast bereit“ zu „ganz bereit“
6B: Lege dir neue konstruktive Gewohnheiten zu
6C: Nimm deine Identität als geliebter Mensch an
Schritt 7: Die Bitte: in Demut bitten
7A: Sei der Käfer
7B: Steh zu deinen Gefühlen, aber lass dich nicht von ihnen beherrschen
7C: Befreie dich von dem Stein
Schritt 8: Der Schaden: Wem haben wir Schaden zugefügt?
8A: Erstelle eine Liste
8B: Sei bereit, Wiedergutmachung zu leisten
8C: Lerne zu vergeben
Schritt 9: Die Wiedergutmachung: den Schaden beheben
9A: Verstehe, was es bedeutet, Wiedergutmachung zu leisten
9B: Lerne, das direkte Gespräch zu suchen
9C: Lerne, Fehler einzugestehen
Schritt 10: Die Wiederholung: kontinuierliche Lebensbilanz
10A: Lebe einen Tag nach dem anderen
Schritt 11: Die Verbindung: das Leben mit Gott
11A: Vertiefe deine Verbindung zu Gott
11B: Übe dich in Gebet und Meditation
11C: Tu das Nächstrichtige
Schritt 12: Die Berufung: anderen helfen
12A: Gib es weiter, wenn du es behalten willst
12B: Komm wieder
12C: Halte dich an der Hoffnung fest
Epilog: Der 13. Schritt
Danksagung
Anmerkungen
Vorwort
Atme erst mal tief durch …
Du stehst an einer Schwelle.
Du hältst gerade eines der besten Bücher in der Hand, die ich je gelesen habe. Die darin enthaltende Weisheit kann man nicht durch eine Univorlesung oder eine brillante Predigt und eigentlich auch nicht durch das Lesen eines Buches erwerben. Diese Weisheit kann man nur durch die Erfahrung von Leid erlangen.
Man sagt, dass wir über manche Dinge nie hinwegkommen. Aber wir stehen sie durch.
John Ortberg hat vieles durchgestanden. Und er hatte hinterher mehr Mitgefühl, mehr Demut, Weisheit und Gelassenheit, als du dir vorstellen kannst. Da passt es wirklich, dass er in seinem Buch den griechischen Dichter Aischylos zitiert: „Leid, das vergessen nicht vermag, tränkt tropfenweis das Herz, bis, nicht gewollt, Weisheit uns zufällt durch die schreckliche Gunst der Götter droben.“[1]
John ist Weisheit zugefallen und jetzt gibt er sie freundlicherweise an uns weiter.
Nimm dir also Zeit für dieses Buch. Gib deiner Seele Gelegenheit, es zu verdauen, was eine Weile in Anspruch nehmen dürfte. Du kannst dieses Buch durchaus in ein paar Stunden „lesen“; ich habe das jedenfalls getan. Aber etwa bei Kapitel 3 wurde mir klar, dass ich das Buch noch einmal durcharbeiten muss, und zwar langsam und zusammen mit ein paar engen Freunden. Es enthält einfach zu viele gute Gedanken, um es bloß mit dem eigenen Verstand aufzunehmen. Oder eben allein. Außerdem scheint es nur angemessen, ein Buch über die den Anonymen Alkoholikern (im Folgenden AA) zugrunde liegende christliche Spiritualität zusammen mit anderen zu lesen. Wie John so treffend schreibt: „Wir sündigen in der Regel allein, aber heil werden wir gemeinsam.“ Oder wie es bei den AA-Gruppen heißt: „Ich betrinke mich, wir bleiben nüchtern.“
Aber lass mich zunächst Johns Beispiel folgen und das Wichtigste vorausschicken: Dieses Buch wird dich nicht „heilen“. Es bietet dir weder eine simple Formel für Veränderung noch ein cleveres Akronym für einen spirituellen Schleichweg noch das falsche Versprechen einer quasitherapeutischen Selbsthilfe.
Wenige Autorinnen und Autoren – außerhalb und tragischerweise auch innerhalb der Kirche – sind ehrlich; wenige sagen dir wirklich die Wahrheit. John tut es: „Der christliche Glaube ist keine Fertigkeit, die man beherrschen kann, sondern ein Leben, das gelebt werden muss.“
Wir sind nie „am Ziel“, sind nie „fertig“. Wir mögen „geheilt“ sein, aber Gesundheit ist ein Aspekt des Immunsystems, und wir sind immer verletzlich, immer anfällig, immer nur ein mikroskopisch kleines Teilchen von der Katastrophe entfernt.[2]
Nein, dieses Buch bietet keine falschen Versprechungen oder einfachen Lösungen.
Es bietet dir etwas viel Besseres – Hoffnung. Die Hoffnung, dass es ein Konzept gibt, einen Pfad, den die Ersten, die Jesus folgten, den Weg nannten. Und wenn du ihm folgst, wird er dich zum Leben führen.
Wie es in einem der AA-Slogans heißt: „Komm wieder, es funktioniert – wenn du dranbleibst.“ Aber das ist kein kleines Wenn.
Lies also dieses Buch. Lies es langsam. Lies es mit anderen zusammen. Lies es, um trocken zu bleiben. Lies es, um trocken zu werden. Lies es, um Weisheit zu erlangen. Lies es, um die erdrückende Last deines Schmerzes zu ertragen. Lies es, um nicht aufzugeben, wenn die Hoffnung nur ein schwaches Licht am Horizont ist. Lies es, weil Spiritualität, die sich am Jesus-Weg orientiert, keine vorschnelle Lösung bietet, sondern „ein Leben [meint], das gelebt werden muss“.
John Mark Comer
Gründer von Practicing the Way und
Autor des Buches Das Ende der Rastlosigkeit
Einführung
Ich kann meine Familie nicht kitten.
Ich kann meinen Job nicht behalten.
Ich kann meinen Ruf nicht mehr retten.
Ich kann die Menschen, die ich liebe, nicht beschützen.
Ich kann den Schmerz nicht ertragen.
Ich kann nicht aufhören zu trinken. Ich kann dem übermäßigen Essen, dem übermäßigen Fernsehkonsum, übermäßigen Shopping, übermäßigen Arbeiten keinen Riegel vorschieben. Ich kann nicht aufhören, mir Pornos anzuschauen.
Ich kann keinen Ehepartner finden. Ich habe es nicht in der Hand, dass meine Ehe hält. Ich kann meinem Ex nicht verzeihen. Ich kann keine Freunde finden, mein Temperament nicht zügeln, kein Geld sparen, nicht dankbar sein.
Ich kriege es nicht hin, dass meine Haut, Zähne, Haare, Oberschenkel gut aussehen. Ich kann nirgends Befriedigung finden.
Ich kann meinen Krebs nicht durch positives Denken heilen.
Ich kann es meinen Eltern nicht recht machen.
Kann keine Kinder kriegen.
Kann nicht dafür sorgen, dass die Kinder endlich ausziehen.
Kann die Kinder nicht dazu bringen, nach Hause zurückzukehren.
Kann mich niemandem öffnen. Kann nicht die Klappe halten.
Kann nicht schlafen. Kann nicht aufhören, mir Sorgen zu machen.
Kann nicht aufhören, mich mit anderen zu vergleichen. Kann keine Freude empfinden.
Kann meine Bauchmuskeln nicht sehen. Kann nicht genug , , kriegen.
Ich kann nicht verstehen, was mit mir los ist, denn ich habe den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern gerade das Böse, das ich nicht will.
Ich kann keine Kritik ertragen. Kann nicht aufhören zu kritisieren. Kann nicht glauben. Kann den Glauben nicht aufgeben. Ich kann mich nicht dazu bringen, dass ich leben will. Ich kann die Welt nicht retten. Ich kann mich selbst nicht retten.
Ich kriege es nicht gebacken.
Das Problem: Ich kann’s nicht …
Während meines Studiums der klinischen Psychologie arbeitete ich auch für eine Baptistengemeinde. Damals entdeckte ich, dass ich gern predige … bis zu dem Wochenende, an dem die Predigt nicht gut lief. Ich wurde nervös, mir war schwindlig – und das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich rücklings auf dem Podium lag und in die besorgten Gesichter einiger Gemeindemitglieder blickte. Ich war mitten in meiner eigenen Predigt in Ohnmacht gefallen. Was das Ganze noch schlimmer machte, war, dass ich nicht in einer Pfingstgemeinde sprach, in der man für so etwas Anerkennung bekommt. Das waren Baptisten, und die erwarteten, dass der Prediger stehen blieb.
Ich steckte in den Abschlussprüfungen, wollte heiraten und bereitete mich darauf vor, für ein Jahr nach Übersee zu gehen. Daher dachte ich, dass diese Ohnmacht vielleicht ein einmaliges Ereignis war, dem Stress geschuldet, dem ich mich gerade ausgesetzt sah. Ich bat Arch Hart um Hilfe, den Dekan meines Fachbereichs. Er war Psychologe und hatte Bücher über Stressbewältigung geschrieben.
Doch ein Jahr später, als ich das nächste Mal predigen wollte, wurde ich erneut ohnmächtig. Und ein drittes Mal passierte es während eines stressigen Privatgesprächs.
Ich wandte mich erneut an Arch. „Das ist nicht gut“, sagte ich. „Ich kann doch nicht predigen, wenn ich regelmäßig in Ohnmacht falle. Das macht die Leute nervös. Und je mehr Angst ich davor habe, in Ohnmacht zu fallen, desto schlechter wird meine Predigt, und je schlechter meine Predigt wird, desto mehr Angst habe ich. Kannst du mir ein paar Übungen zum Stressabbau geben? Ich möchte dafür sorgen, dass mir das nicht noch mal passiert. Ich werde mich mehr anstrengen, um nicht in Ohnmacht zu fallen.“
„Das ist keine gute Idee“, erwiderte er. Und er erklärte mir: Wenn man ein Problem mit Ohnmachtsanfällen hat, wird der Versuch, nicht in Ohnmacht zu fallen, dazu führen, dass man eher häufiger in Ohnmacht fällt.
„Wie wäre es“, fuhr er fort, „wenn du dir bei deiner nächsten Predigt einfach einen Stuhl auf das Podium stellst? Wenn du merkst, dass du einen Schwächeanfall bekommst, dann setz dich einfach. Im Sitzen ist es viel schwieriger, in Ohnmacht zu fallen. Und außerdem wirst du dann nicht so tief fallen.“
„Aber das wäre doch peinlich“, meinte ich. „Die Leute sagen mir immer wieder, ich solle einfach Gott vertrauen und mehr Glauben haben. Wenn ich einen Stuhl neben mich stelle, würde das doch alle an meine Schwäche erinnern.“
Seine Antwort? „Genau.“
In meinen frühen Tagen als Prediger predigte ich also neben einem leeren Stuhl. Und wenn die Dinge nicht gut liefen, habe ich mich hingesetzt.
Vierzig Jahre später frage ich mich, ob die Ohnmachtsanfälle vielleicht eine göttliche Einladung waren zu erkennen, dass man das Predigen – genauso wie das Leben – nicht in den Griff bekommen kann. Es war der Anfang eines Kampfes, der bis heute andauert – ich spreche hier von meiner Weigerung, meine Schwäche zuzugeben. Viele Jahrzehnte später gipfelte mein letzter Job in einer Gemeinde mit einer viel schlimmeren Erfahrung von Schwäche, Niederlage und Demütigung als damals beim ersten. Und da gab es keinen Stuhl, der groß genug gewesen wäre, um mir Halt zu geben.
Die menschliche Handlungsfreiheit ist ein wunderbares Geschenk. Wir sind keine passiven Opfer. Wir sind dazu aufgerufen, unser Leben mutig und voller Initiative anzugehen. Allerdings gibt es da ein Aber …
Ich habe in den Bereichen des Lebens, die mir am wichtigsten sind, erlebt, wie machtlos ist bin. Ich habe als Vater schmerzhaft versagt. Ich habe meine Berufung als Pastor schmerzhaft vermasselt. Das hat in meinem Umfeld und in mir Brüche hinterlassen, die ich nicht kitten oder beheben kann.
So sieht meine Realität aus. Wenn ich mein Leben leben will, muss ich diese schmerzhaften Schwächen, diese zerbrochenen Stellen in mir annehmen und einbeziehen.
Ironischerweise geht es beim Christsein darum, dass wir ehrlich und verzweifelt anerkennen, dass wir die Dinge nicht in der Hand haben. Deshalb wird Gott uns Menschen, Umstände oder Dinge über den Weg schicken, die wir einfach nicht kontrollieren können. Hier sind drei, über die es sich kurz nachzudenken lohnt: Geburt, Tod und alles, was dazwischenliegt.
Unsere Tochter Laura erzählte mir auf einem gemeinsamen Ausflug von ihrer Schwangerschaft, indem sie als Überraschung ein Paar Baby-Cowboystiefel in eine Schachtel legte, in der ich einen Kuchen vermutete. Wir gaben dem kleinen ungeborenen Kind einen Kosenamen und träumten von dem, was sein würde.
Und dann rief sie eines Tages an, um uns mitzuteilen, dass das Kleine es nicht geschafft hatte.
Und das passierte später noch einmal mit einem anderen ungeborenen Kind.
Und dann ein drittes Mal.
Beim vierten Mal gab es weder Kosenamen noch Träume. Dieses Mal hielt die Schwangerschaft an, wurde aber von einer heftigen täglichen Übelkeit und, schlimmer noch, klinischen Angstzuständen begleitet, die einfach nicht verschwinden wollten. An vielen Tagen saß ich bei ihr und versuchte, ihre Ängste für ein paar Momente mit dem zu lindern, was ich an der Uni gelernt hatte. Doch es war, als würde ich der Flut sagen, sie solle sich zurückziehen. Ihr blasses, zerfurchtes Gesicht und ihre gerunzelte Stirn, ihre Albträume von einer Totgeburt, ihre Kämpfe gegen das Würgen, die Panikattacken und die Verzweiflung schienen fast noch schmerzhafter zu sein als die Fehlgeburten. Das Baby überlebte schließlich eine Geburt, die noch schlimmer war als die Schwangerschaft. Dem Baby und Laura geht es jetzt gut. Sie sind für mich eine tägliche Aufforderung, dankbar zu sein. Sie erinnern mich aber auch täglich daran, wie wenig Einfluss ich auf das habe, was mir am wichtigsten ist.
Während Lauras Schwangerschaft wurde bei meinem Vater ein Kavernom diagnostiziert – eine tumorähnliche Wucherung, die so ungünstig in seinem Hirnstamm lag, dass sie nicht einmal biopsiert werden konnte.
Mein Vater hatte es immer geliebt, Sport zu treiben. Ich war noch ein kleines Kind, als er mir einen Tennisschläger ins Bettchen legte, um mir zu zeigen, was mich erwartete. Aber jetzt ließ ihn sein Körper im Stich. Seine Sprache wurde undeutlich. Eine Seite seines Gesichts erstarrte. Er brauchte einen Gehstock.
Mein Vater hatte sein gesamtes Leben lang davon geträumt, auf die Galapagosinseln zu reisen, also reiste ich im November mit ihm dorthin. Wir sahen Blaufußtölpel, Äquatorialpinguine und tauchende Fregattvögel, und zu seiner großen Freude konnten wir am letzten Tag zwanzig Riesenschildkröten in einem Teich beobachten. Es war der letzte Monat, in dem mein Vater eine solche Reise würde machen können.
Es war unerträglich mit anzusehen, wie quälend langsam mein Vater über eine Leiter vom Schiff in die Schlauchboote hinabstieg, mit denen wir die Inseln erkundeten. Wenn wir abends mit den anderen Reisenden am Tisch saßen, konnten sie meist nicht verstehen, was mein Vater zu sagen versuchte. Das Essen lief aus der gelähmten Seite seines Mundes. Aber das war ihm egal. Er genoss diese Reise.
Ich sah zu, wie die Fähigkeiten, die mein Enkelkind zu erlangen begann, meinem Vater nach und nach verloren gingen. Mir wurde schwindlig, als ich die gegensätzlichen Entwicklungen beobachtete. Seine Fähigkeit zu laufen. Seine Worte, die er nur noch mit großer Mühe äußern konnte. Er bekam eine Ernährungssonde, dann einen Katheter und schließlich Windeln, danach folgten wund gelegene Stellen und eine Gürtelrose, und schließlich konnte er sich nicht einmal mehr aufsetzen. Wir werden hilflos geboren und sterben ebenso hilflos.
Auf dem Schiff, mit dem wir die Galapagosinseln erkundeten, gab es peinliche Momente, in denen ich mich für meinen Vater schämte, aber so mancher Passagier sagte mir: „Ihr Vater ist eine Inspiration für mich. Ich finde seinen Mut unglaublich. Ich hoffe, ich werde auch einmal so sein.“ Eines Tages, es war kurz vor Ende seines Lebens, machte er zwei verschiedenen Menschen Geschenke, die aufgrund seines Zustands eine nachhaltige Wirkung hatten. „Selbst wenn ich sterbe, kann ich noch erblühen“, sagte er mir. Aber er starb trotzdem.
Die Lösung: Er kann.
Gott kann die Welt erschaffen. Kann dafür sorgen, dass die Sonne aufgeht. Kann Gebete erhören. Berge versetzen.
Er kann Weisheit schenken. Hoffnung spenden. Uns den Weg zeigen.
Er kann die Verirrten leiten. Die Einsamen trösten. Die Unterdrückten befreien. Die Ausgegrenzten annehmen. Die Herrschenden stürzen. Die Demütigen segnen.
Meere teilen. Stürme beruhigen. Käfer erfinden.
Für Gerechtigkeit sorgen. Schuld vergeben. Die Vergangenheit wiedergutmachen. Eine Zukunft schenken.
Leben schaffen. Atem einhauchen. Spatzen nähren. Lilien kleiden. Alles wissen. Überall sein. Alle Menschen lieben. Kann uns seinen Willen offenbaren und auch die Kraft geben, diesen auszuführen.
Er kriegt es hin.
Keine dieser Aussagen beinhaltet das leichtfertige Versprechen, dass unsere Lebensumstände genau so sein werden, wie wir es uns wünschen, wenn wir nur genug Glauben haben. Sie sind vielmehr ein Grundkurs in Sachen Realität: Es gibt einen Gott. Und ich bin es nicht.
Dieses Buch erzählt nicht davon, wie du deine Probleme in den Griff kriegen kannst. Es beschreibt eine Lebensweise, an der du dich orientieren kannst, wenn du es eben nicht hinkriegst.
Kate Bowler ist eine brillante Wissenschaftlerin und Autorin. Sie ist eine junge Ehefrau und Mutter, als bei ihr Darmkrebs in Stadium 4 diagnostiziert und sie durch eine Immuntherapie für jeweils sechs Monate am Leben erhalten wird. In einem ihrer Bücher erzählt sie davon, dass sie seit ihrer Kindheit darum ringt, die Kontrolle zu behalten, und dass sie nicht weiß, wie sie damit aufhören soll:
Kontrolle ist eine Droge und wir sind alle süchtig. Als ich klein war, hat mein Vater mir Geschichten aus der griechischen Mythologie vorgelesen, und eine davon gefiel mir besonders gut. Sie erzählt von dem verschlagenen König Sisyphus, der dazu verdammt war, einen Felsbrocken einen unvorstellbar steilen Berg hinaufzurollen, der dann aber kurz vor dem Gipfel wieder hinunterrollte. Er würde in alle Ewigkeit die Erfahrung machen, dass nicht jede Last geschultert werden kann. Genau, dachte ich damals immer, denn ich hatte noch nicht verstanden, worum es hier wirklich ging. Aber wenigstens hat er nicht aufgehört, es zu versuchen.[1]
In diesem Buch geht es nicht darum, den Gipfel zu erreichen. Es geht darum, wie wichtig es ist, das eigene Versagen einzusehen und den „Felsbrocken“ an jemand anderen abzugeben.
Wenn wir versuchen, alles allein hinzukriegen, machen wir es nur noch schlimmer. Wir brauchen die Hilfe von jemandem, dessen Kraft größer ist als die unsere. In einer anderen antiken Geschichte geht es auch um einen König, der einen Stein wegrollte – doch als er diesen zur Seite rollte, blieb er auch dort liegen.
Die Erkenntnis der eigenen Machtlosigkeit und der eigene Schmerz sind hilfreich, wenn man so leben will. Diese Lebensweise ist zwar nicht besonders kompliziert, aber herausfordernd und demütigend, und sie erfordert ein williges Herz. Du musst nicht unbedingt verzweifelt sein, um so zu leben, aber es hilft. Berufliche Misserfolge. Missbrauch oder Vernachlässigung durch die eigenen Eltern. Ein Verrat. Eine zerbrochene Ehe. Krebs. Einsamkeit. Abhängigkeiten. Depressionen.
Aber vielleicht wirst du durch eine überzeugende Vision zu dieser Lebensweise inspiriert, eine Vision, die du aus eigener Kraft niemals umsetzen könntest: das Leben als mutiges Abenteuer für eine edle Sache in einer großmütigen Haltung und in der Gegenwart des Heiligen – ein Leben, das sich dir entzieht, wenn du versuchst, es allein zu leben.
Beides ist ein guter Ausgangspunkt für dein Anliegen. Wenn du einen ehrlichen Blick in dich hineinwirfst und merkst, dass da nicht viel Glaube ist, ist das in Ordnung. Verzweiflung tut es auch – der Glaube wird schon noch kommen. Und wenn du nicht viel Verzweiflung spürst, lebe einfach weiter. Für die Verzweiflung wird das Leben schon sorgen. Selbst ein Sisyphus hat die Sisyphusarbeit irgendwann satt.
Christsein beginnt immer mit der Erkenntnis der eigenen Ohnmacht. Jesus sagte, er sei nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die Kranken.[2] Die Menschen, die ihm begegneten, waren ein armseliges Häufchen – Sünder und Zöllner, Prostituierte, Ehebrecher und Heiden, Ausgestoßene und Unreine, Zweifler und Leugner. Religion, Reichtum, Status, Gesundheit und Schönheit stehen uns oft im Weg, weil sie das Gefühl der Verzweiflung überdecken, das wir empfinden.
Wo finden wir heutzutage eine Gemeinschaft von Menschen, die wirklich verzweifelt nach geistlicher Hilfe suchen?
Eine fällt mir da ein.
Die Entscheidung: Ich glaube, ich überlasse es ihm
„Nicht mein, sondern dein Wille geschehe.“
„Dein Reich komme, dein Wille geschehe.“
Versuch es mal weniger krass.
Tu die nächstrichtige Sache, die ansteht.
„Halbe Sachen halfen uns nicht weiter. Wir standen an einem Wendepunkt. Mit ganzer Hingabe baten wir Gott um seinen Schutz und seine Hilfe.“[3]
„Es gibt einen Gott. Und ich bin es nicht.“
Ich glaube, ich lasse ihn den Laden schmeißen.
Ich glaube, ich überlasse es ihm …
Das Motto „Lass los und überlass es Gott“ wird besonders mit den Recovery-Gruppen der Anonymen Alkoholiker in Verbindung gebracht. Der amerikanische Autor Philip Yancey berichtet, als er zum ersten Mal aus Solidarität mit einem Freund ein AA-Treffen besuchte, war er überwältigt festzustellen, dass es ihm so vorkam, als sei er in einer neutestamentlichen Gemeinde. Millionäre und Prominente mischten sich ungezwungen unter arbeitslose Schulabbrecher und gepiercte Gangmitglieder. Radikale Ehrlichkeit, Willkommenskultur und das Gefühl der gegenseitigen Abhängigkeit waren hier vorherrschend.
Im Laufe der Jahre haben zu viele christliche Autoren und Prediger diese Beobachtung gemacht, um sie alle aufzuzählen.[4] Es gibt sogar ein Buch, das diesen Titel trägt: Warum kann die Kirche nicht mehr wie ein AA-Treffen sein? Die kurze Antwort lautet: Sie kann es, solange die Menschen, die sie besuchen, bereit sind, mehr wie Alkoholiker zu sein. Zu verzweifelt, um sich zu verstecken; zu demütig, um einander zu verurteilen; zu schwach, um allein zu sein; zu bedürftig, um zu schwänzen.
In einem frühen Brief des AA-Mitbegründers Bill W. an die Mitglieder heißt es, dass Menschen, die von ihrer Sucht frei werden wollen, nie „vergessen dürfen, dass sie nur durch Leiden demütig genug waren, die Tore zu dieser neuen Welt zu durchschreiten. Wie privilegiert sind wir doch, dass wir das göttliche Paradoxon so gut verstehen, nach dem Stärke aus Schwäche erwächst und die Erniedrigung der Auferstehung vorausgeht: dass der Schmerz nicht nur der Preis, sondern der Prüfstein der geistlichen Wiedergeburt ist.“[5]
Diese Wiedergeburt in die Nüchternheit und Nützlichkeit vollzog sich durch geistliche Übungen, die später als die Zwölf Schritte bekannt wurden: Eingeständnis der eigenen Ohnmacht, Hingabe des eigenen Willens, schonungslose Selbstprüfung und Bekenntnis der Schuld, Wiedergutmachung, ein Leben in geistlicher Abhängigkeit und im Dienst für andere. Die meisten dieser Grundsätze entstammten der sogenannten Oxford-Bewegung, einer Gruppe, die einen Weg finden wollte, Jesus heute zu folgen. Als Bill W. diese Grundprinzipien in einem inspirierten Moment niederschrieb, ging ihm durch den Kopf, dass sie die Zahl der Jünger Jesu widerspiegeln.
Die Anonymen Alkoholiker haben die Zwölf Schritte von der christlichen Gemeinde übernommen. Und jetzt braucht die Kirche sie wieder zurück. Eigentlich braucht die gesamte Menschheit sie.
Dallas Willard schrieb:
Es ist eine der größten Ironien der Menschheitsgeschichte, dass die grundlegenden Erkenntnisse und Übungen des erfolgreichsten „Recovery“-Programms aller Zeiten – Erkenntnisse und Praktiken, die fast vollständig von den Lichtgestalten der christlichen Bewegung übernommen, wenn nicht sogar direkt von Gott geschenkt wurden – von den Kirchen nicht routinemäßig gelehrt und praktiziert werden. Wie lässt sich diese Tatsache rechtfertigen oder erklären?[6]
Deshalb gibt es dieses Buch. Es soll helfen, die Zwölf Schritte als Lebensprogramm einzuüben. Ich habe es für jeden geschrieben, der nach mehr hungert – egal, ob du ein eingestandenes Suchtproblem hast oder nicht. Es ist kein klassisches „Genesungsbuch“. Ich habe es geschrieben, um jedem zu helfen, einen lebbaren, nicht gesetzlichen geistlichen Lebensstil zu entwickeln, der – nur mal so nebenbei – wiederum den empirisch nachgewiesenen Nebeneffekt hat, dass schon Millionen von Menschen von Suchtproblemen befreit wurden, wo eine schwammige „Spiritualität“ das nicht konnte.
Ich will dir hier einen Leitfaden an die Hand geben, damit du diese Schritte praktizieren kannst. Kluge Menschen sagen, dass die Zwölf Schritte durchnummeriert sind, damit sie in der richtigen Reihenfolge umgesetzt werden. Erst wenn wir unsere eigene Machtlosigkeit erkannt haben, sind wir bereit, uns Gott zu unterstellen. Erst nachdem wir eine Bestandsaufnahme unserer Lebensprobleme gemacht haben, können wir sie einem anderen beichten oder bei Personen, die wir verletzt haben, Wiedergutmachung leisten. Wir haben es hier nicht mit einer zufälligen Zusammenstellung zu tun. Hier wird nichts ausgetauscht, nichts umgangen, nichts übersprungen. Wenn uns ein Schritt nicht behagt, liegt das mit großer Wahrscheinlichkeit daran, dass wir ihn wirklich nötig haben. Also gestehen wir uns das ein. Schritt für Schritt.
Ich habe dieses Buch nicht geschrieben, weil ich ein Experte wäre. Ich habe es geschrieben, weil ich verzweifelt bin. Als ich anfing, Zwölf-Schritte-Gruppen zu besuchen, dachte ich, ich hätte keine Suchtprobleme. Inzwischen glaube ich, ihr Name ist Legion.
Als ich vor Jahren damit begann, mich mit den Zwölf Schritten zu befassen, sagte mir ein langjähriger AAler, dass es nicht lange dauern würde, bis ich neidisch sein würde, kein Alkoholiker zu sein. Er hatte recht. Ich glaube, die geringe Motivation von Menschen, die keine erkennbare Sucht haben, ist der Grund, warum Father Edward J. Dowling, ein Priester und langjähriger Freund der AA, einen Artikel mit dem Titel „A.A. Steps for the Underprivileged Non-A.A.“ („AA.-Schritte für die benachteiligten Nicht-AAler“) verfasst hat.[7] Es war der letzte vor seinem Tod.
Der Harvard-Historiker Ernest Kurtz hat die ultimative Geschichte der AA geschrieben. Er nannte sein Buch Not-God (Nicht-Gott), weil das Grundproblem süchtiger Menschen darin besteht, dass sie sich für Gott halten.[8]
Das wäre auch das Grundproblem von nicht süchtigen Menschen, wenn es so etwas gäbe. Die Wahrheit ist, dass wir alle zu sehr an irgendetwas hängen, das wir nicht kontrollieren können – angefangen bei unserem Ego. Wir müssen alle von etwas befreit werden. Das englische Wort attachment kommt angeblich vom Altfranzösischen attacher, das verwendet wurde, um zu beschreiben, dass etwas mit Nägeln oder Pflöcken befestigt wird[9] – wie die Hände eines Verurteilten mit Nägeln an einem Kreuz. Oder um es mit anderen Worten zu sagen: Jeder wird irgendwann von etwas gekreuzigt.[10]
Eines der vielen Mottos bei AA lautet: „Keep it simple“ („Mach’s nicht kompliziert“), eines der letzten Worte, die einer der Mitbegründer an den anderen richtete. Die Zwölf Schritte werden manchmal beschrieben als „ein einfaches Programm für komplizierte Menschen“. Deshalb ist dieses Buch in kurze Kapitel gegliedert, die verschiedene Facetten jedes Schritts beschreiben, der wiederum an die AA-Schritte angelehnt ist – die ersten drei Kapitel für Schritt 1, die nächsten drei für Schritt 2 und so weiter. Am Anfang jedes Schritts habe ich auch ein Gebet eingefügt, das du vor der Beschäftigung mit den jeweiligen Kapiteln beten kannst und um dich darauf vorzubereiten, diese in die Praxis umzusetzen. Ich hoffe, dass du dieses Buch nicht einfach nur liest, sondern dass es ein Handbuch wird, das dir hilft, die Schritte auch umzusetzen. Vielleicht möchtest du dir auch jemanden suchen, mit dem du dich über deine Reise austauschen kannst.
Nach unten
Traditionell treffen sich Zwölf-Schritte-Gruppen in Kirchengemeinden, allerdings nicht in den Gottesdienst- oder Seminarräumen, sondern in schmucklosen Kellerräumen mit Metallklappstühlen, abgestandenem Kaffee und trockenen Keksen. Der bescheidene Rahmen erinnert daran, dass dies ein Ort ist, an dem man seine eigene Großartigkeit hinter sich lässt. Die Liturgie ist immer die gleiche. Wenn ich sage: „Mein Name ist John und ich bin Alkoholiker“, weiß ich, dass die Gruppe mich mit „Hallo, John“ begrüßen wird.
Die Menschen oben scheinen ihr Leben im Griff zu haben, während die Menschen unten mühsam versuchen, sich nicht aufzugeben. Aber paradoxerweise wird die verzweifelte und hilfsbedürftige Schwäche angenommen und entpuppt sich als Ausgangspunkt großer Kraft. Deshalb sagen die Leute bei AA manchmal: „Wenn du in die Kirche kommst, kannst du nach oben gehen und von Wundern hören. Oder du kannst nach unten kommen und sie sehen.“
Gehen wir also nach unten.
Schritt 1
Das Problem: Ich kann’s nicht
Wir gestanden ein, dass wir unseren größten Problemen ohnmächtig gegenüberstanden und dass wir unser Leben nicht mehr im Griff hatten.
Gott, lenke meine Gedanken heute so, dass sie frei sind von Selbstmitleid, Unehrlichkeit, Eigenwillen, Selbstsucht und Angst. Gott, lenke mein Denken, meine Entscheidungen und meine Einsichten. Hilf mir, mich zu entspannen und es ruhig angehen zu lassen. Befreie mich von Zweifeln und Unentschlossenheit. Führe mich durch diesen Tag, und zeige mir den nächsten Schritt, den ich gehen soll. Gott, gib mir, was ich brauche, um mich jedwedem Problem zu stellen. Ich bitte dich um all diese Dinge, damit ich dir und meinen Mitmenschen so gut wie nur möglich dienen kann. Amen.[1]
Schritt 1A
Schließ dich der Gemeinschaft der Verdorrten Hand an
Wenn du viel Glück hast, wirst du in die „Gemeinschaft der Verdorrten Hand“ eingeladen.
Das erste Mal stieß ich vor 35 Jahren darauf. Ich war gemeinsam mit einem anderen Pastor namens Paul als Referent zu einem zweitägigen Treffen einer kleinen Gruppe von Pastoren in Äthiopien eingeladen worden. Damals trafen sich die dortigen Kirchen im Untergrund. Äthiopien wurde von einem völkermordenden marxistischen Diktator namens Mengistu regiert, unter dessen Herrschaft Hunderttausende starben, darunter auch der Patriarch der äthiopisch-orthodoxen Kirche. Kirchenleiter wurden oft inhaftiert. Christen nannten das Gefängnis „die Universität“, weil ihre Leiter dort oft am meisten wachsen und lernen konnten.
Diese beiden Tage hatten also eine Intensität, die ich bis dato noch nie erlebt hatte. Paul und ich sprachen abwechselnd je neunzig Minuten am Stück vom frühen Morgen bis zur Schlafenszeit in einem engen, überfüllten Raum vor verschwitzten Zuhörern.
Paul hielt den letzten Vortrag des Tages und sprach über eine Geschichte, die im Neuen Testament dreimal erzählt wird und von einem Mann mit einer verkrüppelten oder verdorrten Hand handelt.[1] Dabei ging es ihm vor allem um die Schwäche und die Unzulänglichkeit des Mannes.
Wir wissen nicht, ob der Mann mit dieser Behinderung geboren worden war oder ob er eine Verletzung erlitten hatte. In einem alten Kommentar heißt es, dass er Maurer war und deshalb seinen Beruf nicht ausüben konnte. In der Version von Lukas heißt es, dass seine rechte Hand unbrauchbar war – die wichtigere Hand, die Hand, mit der er arbeiten und Dinge erledigen konnte. Vielleicht war er Bettler. Vielleicht war keine Frau bereit, ihn zu heiraten.
Er besuchte die Synagoge, also war er ein gläubiger Mensch. Er kannte zweifellos die Heilungsgeschichten in den Heiligen Schriften, darunter auch die von der Heilung eines steifen Arms.[2] Doch warum erlebte er eine solche Heilung nicht? Er hatte sicherlich dafür gebetet. Aber geheilt worden war er nicht.
Die meisten Menschen, von deren Heilung im Neuen Testament berichtet wird, kommen zu Jesus und bitten ihn darum: eine Gruppe von zehn Aussätzigen, ein Mann mit einem Sohn, der unter Epilepsie litt, der blinde Bartimäus, der so laut schreit, dass man ihn zum Schweigen bringen wollte.
Der Mann mit der verkrüppelten Hand hat nicht um Heilung gebeten. Wir wissen nicht, warum. Vielleicht war er nur höflich. Vielleicht hatte er die Hoffnung aufgegeben. Meine Frau sagt gern, dass ihre liebsten Gebetserhörungen Antworten auf die Gebete sind, die sie vergessen hat zu beten.
Körperliche Beeinträchtigungen waren in der Antike – wie auch heute noch – mit einem Stigma verbunden. Vielleicht war diese Behinderung ja eine Strafe Gottes. Vielleicht verbarg der Mann seine Hand in seinem Gewand und hoffte, dass niemand es bemerken würde.
Aber Jesus bemerkte es schon. Und er sprach ihn an: „Komm her und stell dich hier in die Mitte.“ Nicht nur „Steh auf“ oder: „Steh auf und komm her.“ Sondern: „Komm her und stell dich hier in die Mitte.“ Zeig, wofür du dich schämst. Enthülle deine Schwäche.
Der Mann saß einen Moment lang da, die verkrüppelte Hand im Ärmel versteckt.
Und dann lesen wir: „Da stand der Mann auf.“
Wir wissen nicht, wie lange er dastand. Alle starrten auf seine Hand. Schlimmer noch: Es waren auch die Leute anwesend, von denen er sich am meisten wünschte, dass sie nicht da wären – körperlich unversehrte, leistungsfähige religiöse Menschen mit starken rechten Händen, mit denen sie einander grüßten und ihre Arbeit verrichteten. Fromme, die mit ihren gesunden Zeigefingern auf die Sünder und die Beschämten und die Rabbis deuteten, die unter Umständen auf die Idee kamen, am Sabbat jemanden zu heilen. Dies war der letzte Ort, an dem er seine verkrüppelte Hand zur Schau stellen wollte.
Und Jesus wusste das. Er wusste, dass Religion die Herzen der Menschen verdorren lassen kann. Er wusste, dass Religion sie zu ausgrenzenden, sich anderen überlegen fühlenden, lieblosen Regelbefolgern machen kann. Markus berichtet an dieser Stelle: „Zornig und erschüttert über ihre Hartherzigkeit sah er sie an.“
Dann sprach Jesus ein zweites Mal. Jetzt wurde es noch schlimmer: „Streck deine Hand aus.“ Jesus lenkte die Aufmerksamkeit auf die Behinderung des Mannes, auf den Körperteil, für den er sich am meisten schämte. Ein Kind wäre in der Lage, diesem Befehl zu gehorchen, aber er nicht. Er hatte es vermutlich schon unzählige Male versucht. Das muss einer der schlimmsten Momente in seinem Leben gewesen sein.
Bis sich etwas änderte.
Immer wieder erinnerte Paul in dem heißen, dunklen, überfüllten Raum in Äthiopien daran, dass Jesus den Mann aufforderte, genau das zu tun, was der Mann nicht tun konnte: „Streck deine Hand aus.“
Und so ist es auch bei uns, sagte Paul. Was Gott von uns verlangt – das, wovon wir wissen, dass wir es tun sollten –, das ist genau das, was wir nicht tun können.
Dann geschah etwas. Diese Kirchenleiter begannen, das zu tun, was auch der Mann in der Geschichte tat. Sie gaben Einblick in ihre Schwächen. Sie baten um Hilfe. Sie standen von ihren Stühlen auf und begannen zu beichten. Sie sprachen über ihre Angst vor der Regierung und davor, verhaftet zu werden. Sie sprachen von ihrem Neid auf den Auftrag anderer oder auf deren Familie, deren Aussehen oder deren Zuhause. Sie beklagten ihre tiefe Unzulänglichkeit. Sie sprachen von den Streitigkeiten in ihren kleinen Gemeinden.
Und irgendwie war eine Kraft spürbar. Beziehungen wurden geheilt. Menschen wurden innerlich erneuert. Hoffnung wurde neu entfacht.
Aber das ereignete sich nicht durch Begabung, Ausbildung oder irgendwelche klugen Einsichten. Es ereignete sich, weil sie ihre Ohnmacht zugaben. Es ereignete sich, weil die Menschen etwas so verzweifelt ersehnten, dass sie mehr nichts zu verlieren hatten und nichts mehr verbergen wollten. Es ereignete sich durch das schmerzhafte Eingeständnis von Hässlichkeit, Angst und Scham.
Es ereignete sich durch die Gemeinschaft der Verdorrten Hand.
Die Gemeinschaft der Verdorrten Hand – so könnten wir eine Gemeinschaft von Menschen nennen, deren Schmerz und Gebrochenheit nicht länger verborgen bleiben und die gerade aus der freien und selbstlosen Offenbarung ihrer Schwäche ungeahnte Kraft von Gott und anderen Menschen schöpfen. Es ist ein widersprüchlicher Ort, an dem die Bekenntnisse, von denen du glaubst, dass sie dich umbringen werden, dich innerlich lebendig machen, an dem die geistlichen Verpflichtungen, von denen du glaubst, dass sie dich fesseln werden, dich befreien und an dem die Erfahrung deiner Hilflosigkeit dir neue Kraft gibt, anderen zu helfen.
Es ist auch ein Ort, an dem die Scham ihre Macht verliert, weil stigmatisierte Personen besonders willkommen sind. Der Soziologe Erving Goffman schrieb in seiner klassischen Studie „Stigma: Über die Techniken der Bewältigung beschädigter Identität“, dass der Begriff „Stigma“ seinen Ursprung bei den alten Griechen hat, ungefähr zur Zeit Jesu. Ursprünglich war ein „Stigma“ ein Brandzeichen auf dem Körper eines entehrten Menschen – eines Kriminellen oder eines Sklaven. Der Begriff bezog sich später auf jedes Merkmal, das dafür sorgt, dass sein Träger unerwünscht ist, zum Beispiel eine körperliche Beeinträchtigung, eine psychische Erkrankung, das Geschlecht oder die ethnische Zugehörigkeit.[3]
Die Menschen, die zur Zeit von Jesus in religiöser Hinsicht den Ton angaben, betrachteten es als Zeichen von Heiligkeit, stigmatisierte Menschen zu meiden und auszuschließen. Doch Jesus verkehrte insbesondere mit Menschen, die zu den genannten stigmatisierten Gruppen gehörten. Tatsächlich verkörperte Jesus selbst letztendlich jede der stigmatisierten Kategorien, die Goffman aufzählt.[4] Nicht nur das, er trug auch buchstäblich das Stigma der Kreuzigung in den Handflächen seiner mit Nägeln durchbohrten Hände. Und sein auferstandener Körper trug diese Zeichen weiter – er lud Thomas ein, sie zu betrachten und zu berühren.[5] Sein Stigma wurde zum Zeichen seiner Herrlichkeit.
Tatsächlich wird das Wort auch ein Mal im Neuen Testament verwendet, als Paulus – der ebenfalls verhaftet und geschlagen und als Verbrecher gebrandmarkt worden war – sagt: „… denn ich trage die Malzeichen (Stigmata) Jesu an meinem Leibe.“[6]
Und so nahm diese seltsame Gemeinschaft der Verachteten und Enttäuschten und Machtlosen ihren Anfang, die Gemeinschaft der Verdorrten Hand, in der das schlimmste Stigma, das die alte Welt auferlegen konnte, zu einer Auszeichnung wurde. In dieser Gemeinschaft werden unsere Schwächen irgendwie nützlicher als unsere Stärken.
Als Paul und ich nach Äthiopien reisten, wurden wir gebeten, fünfzig Studienbibeln für die Gemeindeleiter über die Grenze zu schmuggeln. Auf dem Weg zum Flughafen wurde mir noch eine weitere Bibel ausgehändigt, sodass wir tatsächlich 51 Bücher mitbrachten. Erst nach der Landung kam mir der Gedanke, für das Gelingen der Aktion zu beten (dieses Thema war in meiner theologischen Ausbildung nicht behandelt worden). Ich hatte Angst, verhaftet zu werden, und wusste nicht, was ich tun sollte.
Einer der Koffer mit den Bibeln wurde am Flughafen entdeckt und beschlagnahmt. Der Zollbeamte sagte jedoch, dass er diesen gegen ein Bestechungsgeld freigeben würde. Ich war erst erleichtert, dann überrascht, als er den Preis nannte: Der Beamte wollte eine Bibel für sich behalten. So wurden die ursprünglichen fünfzig Bibeln ausgeliefert; die zusätzliche ging an den Zollbeamten eines völkermordenden Diktators.
Manchmal sind die besten Gebetserhörungen Antworten auf die Gebete, die wir vergessen haben zu beten.
Nach unserer Äthiopien-Reise verloren Paul und ich allmählich den Kontakt. Aber ich habe seine Botschaft nie vergessen und auch nicht, was in jener Nacht unter den äthiopischen Pastoren geschehen war. Kürzlich erzählte ich diese Geschichte im Rahmen eines Vortrags. Hinterher sprach mich einer der Zuhörer an. Paul sei sein bester Freund gewesen, erzählte er mir. Dieser sei ein paar Wochen zuvor bei einem Unfall ums Leben gekommen.
Die Begegnung weckte den Wunsch in mir, Paul für das zu danken, was ich vor so langer Zeit von ihm gelernt hatte und was mir so viele Jahre später geholfen hat. In der Tat habe ich in den letzten schwierigen Jahren meines Lebens so viel mehr über diese Gemeinschaft gelernt. Als ich von seinem Tod erfuhr, empfand ich Trauer, Trauer für seine Familie und seine Gemeinde. Es war ein weiteres Kapitel des Schmerzes in einer leidenden Welt, in der es so vieles gibt, was ich nicht verstehe. Wir haben über nichts die Kontrolle, nicht einmal über unser eigenes Leben.
Erkenne deine „verdorrte Hand“
Der erste Schritt besteht also darin, den Punkt in deinem Leben zu benennen, an dem sich deine Ohnmacht zeigt. Die gute Nachricht ist, dass dies das Einzige ist, was wir in der Hand haben. Es heißt manchmal, dass wir nur diesen ersten Schritt perfekt ausführen müssen: „Eingestehen, dass wir ohnmächtig sind.“
Wir können mit den einfachen Dingen beginnen und das aufschreiben, von dem wissen, dass wir dagegen machtlos sind: das Wetter. Der Verkehr. Die Schwerkraft. Die Wirtschaft. Schluckauf. Der Tod. Mit anderen Worten: Wir beginnen damit, dass wir unsere Grenzen akzeptieren. Es gibt einen Gott. Wir sind es nicht.[7]
Lass uns dann zu den persönlicheren Dingen übergehen.
Die meiste Zeit meines Lebens habe ich, ohne je groß darüber nachzudenken, geglaubt, dass ich im Normalfall in der Lage bin, das, was getan werden muss, auch zu tun. Ich bin in der Lage, einen guten Job zu finden und zu behalten. Ich kann eine Organisation aufbauen und leiten. Ich kann eine Familie gründen. Ich kann ein guter Vater sein. Aber ich habe gemerkt, dass ich das nicht kann. In jedem dieser Bereiche habe ich tiefen Schmerz und Versagen erlebt.
Ich kann die Menschen, die mir am nächsten stehen, nicht heilen. Ich kann mein Herz nicht in Ordnung bringen. Ich kann nicht kontrollieren, was die Leute über mich denken. Ich kann nicht dafür sorgen, dass meine Angst verschwindet. Ich kann meine Traurigkeit nicht vertreiben. Ich kann meine Scham, meinen Neid oder meine Wut nicht beheben. Ich kann meine schreckliche Angst vor der Zukunft nicht loswerden. Ich kann die Wut nicht eindämmen, die manchmal morden möchte. Ich kann nicht verhindern, dass ich um 3 Uhr morgens aufwache und an die Decke starre.
Ich will damit nicht sagen, dass ich früher nicht in der Lage gewesen bin, diese Dinge zu tun, aber jetzt stark bin, und dass alles in Ordnung ist und ich dir das Geheimnis verraten werde, wie ich das geschafft habe. Nein, ich meine, dass ich all das nicht tun kann. Jetzt nicht. Ich lebe täglich neu mit diesem Schmerz. Ich werde nie tagtäglich einen Frieden erleben, der frei ist von diesem Schmerz. Dieser ist schlicht Teil meines Lebens.
Ich kann es einfach nicht.
Steh auf und stell dich in die Mitte
Ironischerweise fällt es gerade den Frommen oft schwer, ihre Fehler und ihr Scheitern zuzugeben. Wir wollen, dass die anderen uns für „geistlich reif“ halten, und denken fälschlicherweise, dass geistliche Reife und das Eingeständnis ernsthafter Kämpfe unvereinbar seien. Wir müssen schließlich unser Image wahren. Das ist auch der Grund, warum Autor Stephen Haynes der Auffassung ist, dass für Christen dem Schritt 1 „ein noch grundlegenderes Eingeständnis vorausgehen muss, das man auch als Schritt 0 bezeichnen könnte: „Wir geben zu, dass es uns – entgegen dem äußeren Anschein – nicht gutgeht.“[8]
Probiere es doch jetzt mal aus, ganz allein, ehrlich, als Gebet: Ich gebe zu, dass es mir entgegen dem äußeren Anschein nicht gut geht.
Und das sollte nicht nur ein rein intellektuelles Eingeständnis sein. Es sollte ein emotionales Eingeständnis der eigenen Ohnmacht sein, die du zutiefst empfindest.
Glücklicherweise lässt Gott hin und wieder zu, dass etwas deine Pläne durchkreuzt – eine Krise, ein Konflikt oder eine andere Person –, etwas, das dir so heftig auf den Magen schlägt, dass du mit schonungsloser Ehrlichkeit zugeben musst: Du kannst dieses Problem nicht allein bewältigen.
Es geht mir nicht gut.
Der nächste Schritt
Benennen, inwiefern es dir nicht gut geht
Der Schauspieler Russell Brand empfiehlt, mit dieser Frage anzufangen: „Hast du ein Problem? Gibt es eine Aktivität oder ein Thema – Trinken, Essen, Geld ausgeben, Glücksspiel, Pornos schauen, destruktive Beziehungen, Promiskuität … –, mit dem du kämpfst, weil du einfach nicht damit aufhören kannst?“[9]Wir könnten Brands Liste problemlos erweitern um Sich-Sorgen-Machen, Lügen, Horten, Betrügen, Urteilen, Klatsch und Tratsch, zwanghaftes TikToken – um jedes Verhalten, das einen Verrat an dem darstellt, was dir eigentlich wichtig ist.
Brand fährt fort: „Wenn die Antwort Nein lautet: Bravo! Weiter so! Dann solltest du auch genug Zeit haben, um anderen, die hier weniger Glück haben, zu helfen und dem Planeten und den Menschen darauf zu dienen.“[10]
Wenn du dir nicht sicher bist, ob du ein Problem hast bzw. in welcher Hinsicht es dir „nicht gut geht“, dann nimm dir jetzt ein wenig Zeit. Atme tief durch. Lockere die Spannung in deinem Gesicht, deinen Schultern und Händen. Was passiert, wenn du still wirst? Worauf richten sich die quälenden Gedanken, die dir durch den Kopf gehen, oder deine Angstgefühle?
Vielleicht ist eine Scheidung dein großes Problem. Oder ein Kind, das dir das Herz gebrochen hat. Oder ein Chef, dem du es einfach nicht recht machen kannst. Oder eine Krankheit, die du nicht loswirst. Oder eine Gewohnheit, die du nicht ablegen kannst. Oder ein Verlust, den du nicht verwinden kannst. Oder ein Traum, den du nicht wiederbeleben kannst. Oder Ängste, die du nicht überwinden kannst. Oder Hass, den du nicht abschütteln kannst. Vielleicht bist du gelangweilt. Empfindest Schuldgefühle. Scham. Wirst von Ängsten geplagt.
Der erste Schritt besteht nicht darin, das Problem zu beheben, zu lösen, zu bewältigen, zu verringern oder in den Griff zu kriegen. Er besteht darin, es zu benennen – es aufzuschreiben.
Aber bevor du das tust, hier noch ein Hinweis, um die Herausforderung (das heißt den Schmerz) noch ein bisschen zu vergrößern: Schreibe nicht nur über eine äußere Situation oder eine Person, sondern benenne auch deine Reaktionen darauf. Hier geht es um deine Ohnmacht. „Meine Ängste … Meine Sorgen … Mein Neid … Meine Unzufriedenheit … Meine Trinkerei … Meine Verbitterung …“
Das ist die Gelegenheit: Schreib alles hier auf, wenn du willst. Greif jetzt zum Stift …
Wenn du das getan hast, bist du nun Teil einer neuen Art von Gemeinschaft. Hier werden die Menschen, die bedürftig, unvollkommen und verkorkst sind, besonders gefeiert. Mein Freund Mike sagt immer, dass du in dieser Gemeinschaft umso willkommener bist, je schlimmer deine Geschichte ist.
Das ist kein gängiges Motto. Es steht nicht über Büros, Datingplattformen oder auf Kirchenportalen. Es ist eigentlich nur für Gruppen von Verlierern gedacht wie Alkoholiker, Süchtige, Sträflinge und andere Freunde von Jesus. Verlier nicht die Hoffnung – die Verzweiflung über unsere Hilflosigkeit ist das, was uns motiviert, nicht aufzugeben.[11]
Zusammenfassung
Wir alle dürfen uns der Gemeinschaft der Verdorrten Hand anschließen, einer Gemeinschaft von Menschen, deren Schmerz und Zerbrochenheit nicht länger verborgen bleiben und die durch die freimütige Offenlegung ihrer Schwäche unerwartete Kraft von Gott und anderen Menschen schöpfen dürfen.Oft fällt es uns schwer, unsere Lebensprobleme zuzugeben.Wenn wir der Gemeinschaft der Verdorrten Hand beitreten wollten, besteht der erste Schritt darin, das Problem beim Namen zu nennen, dem du ohnmächtig gegenüberstehst.Schritt 1B
Bitte Gott um einen Moment der Klarheit
Ach um die, die nie singen, sondern sterben und all ihre Musik noch in sich tragen!
Oliver Wendell Holmes: „The Voiceless“
Ich möchte mir ein paar Minuten nehmen, um mich an dich zu wenden – vor allem, wenn du findest, dass du dein Leben – zumindest im Moment – ziemlich gut im Griff hast. Deine Verzweiflung ist nicht allzu groß. Du bist keiner von den armen, bedürftigen Schluckern, deren Welt völlig aus den Fugen geraten ist. Es scheint also nicht so zu sein, als befändest du dich in einer solchen Krise, dass du ein intensives geistliches Programm brauchst, um dein Leben wieder in den Griff zu bekommen.
Mein Ratschlag lautet: Warte nicht erst auf die Krise.
Die Recovery-Bewegung hat einen endlosen Vorrat an tiefschwarzen Geschichten, in denen tiefe Wahrheiten vermittelt werden. In einer davon geht es um einen kürzlich verstorbenen jungen Alkoholiker, dessen Tod von zwei Freunden beklagt wird.
Freund 1: Mike ist am Alkohol gestorben. Er war erst 32, ein toller Sportler und ein kräftiger junger Mann in der Blüte seines Lebens, der alles hatte, was man sich nur wünschen kann. Aber der Alkohol hat ihn umgebracht.
Freund 2: Das ist wirklich traurig. Hat er es jemals mit den AA versucht?
Freund 1: Oh nein, so schlimm war es dann doch nicht!
Was wir bedenken sollten: Natürlich lohnt es sich, einen geistlichen Lebensstil zu pflegen, wenn die Dinge schlecht stehen. Aber es lohnt sich auch dann, wenn sie das nicht tun. Denn schließlich sind wir für mehr bestimmt als nur für ein Leben, das „doch nicht so schlimm“ ist.
Henry David Thoreau schrieb, dass die meisten Menschen „ein Leben in stiller Verzweiflung führen“.[1] Wir sehnen uns nach mehr, aber weil uns die nötige Leidenschaft fehlt, geben wir uns mit seelischer Mittelmäßigkeit zufrieden. Du wirst nicht erleben, dass ein Traum Wirklichkeit wird, wenn du nicht zuerst einen Traum hast. Und niemand träumt von „so schlimm ist es doch nicht“. Aber viele Menschen enden schließlich genau an diesem Punkt. Wir tragen all unsere Lieder noch in uns, wenn wir das Ende unseres Lebens erreicht haben.
Vielleicht hat die stille Verzweiflung viel mehr Leben verkümmern lassen als die laute Verzweiflung. Was wir brauchen, ist die Klarheit, die wir gewinnen, wenn wir unser Leben nicht an dem von anderen messen, denen es schlechter geht als uns. Die Klarheit, die wir erlangen, wenn wir uns bewusst machen, wie viel Sinn, Wachstum und Liebe uns entgehen, wenn wir uns mit „so schlimm ist es doch nicht“ zufriedengeben.
Der erste Schritt beinhaltet, dass wir uns eingestehen: Wir haben unser Leben nicht mehr im Griff. Aber was bedeutet das? Sein Leben im Griff zu haben, bedeutet nicht, dass man eine offensichtliche Krise bewältigen kann. Die Frage ist: Reichen mein Ego und meine Selbstdisziplin aus, um mein Leben zu steuern?Bin ich wirklich so frei von Täuschung, Burn-out, Enttäuschung, Angst und verborgener Scham, dass ich mich selbst managen kann?
Niemand hat sein Leben „im Griff“.
Das trifft nicht nur zu, weil wir das Altern oder den Tod oder die Wirtschaft oder unseren Chef oder unsere Kinder oder unsere Haare eben nicht in den Griff bekommen können. Es geht nicht nur darum, dass wir unser äußeres Leben und unsere Umstände nicht in den Griff bekommen. Viel wichtiger ist, dass wir nicht in den Griff bekommen können, was in uns ist.
„Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist, und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse.“[2] Diese Worte schrieb der Apostel Paulus vor zweitausend Jahren. Aber um zu erkennen, dass wir unser Leben nicht im Griff haben, braucht es nicht erst den christlichen Glauben, sondern erst einmal nur Ehrlichkeit.
Die in London ansässige „School of Life“ hat ein säkulares Onlinetutorial zum Thema „How to Get Married“ („Wie man heiratet“) entwickelt, das bereits millionenfach aufgerufen wurde. Im Mittelpunkt steht das tiefe Eingeständnis, dass es einfach nicht möglich ist, bestimmte Dinge in den Griff zu bekommen – und das ist irgendwie ernüchternd und amüsant zugleich. Braut und Bräutigam, beide in Schale geschmissen, beginnen mit einem „Ritual der Demut“, bei dem sie aus ihrem „Buch der Unvollkommenheiten“ vorlesen und dabei Dinge eingestehen wie: „Ich bin nicht gut darin, meine Gefühle angemessen zu kommunizieren“ oder: „Ich reagiere selbst bei kleinen Vorfällen eifersüchtig, und dann werde ich kleinlich und giftig, anstatt ehrlich zu sagen, dass ich eigentlich Angst habe, dich zu verlieren.“ Der Kommentator erinnert die Zuschauer: „Selbstgerechtigkeit ist der Feind der Liebe.“
Wenn die jeweiligen Unvollkommenheiten ausgesprochen sind, schaut sich das Paar tief in die Augen und sagt: „Keiner von uns beiden ist völlig unbelastet oder fehlerfrei.“ Die Partner versprechen, sich gegenseitig als Menschen mit Fehlern zu behandeln, „wenn wir es schaffen“.
Und das ist noch nicht alles. Die Gemeinde erhebt sich, um gemeinsam zu bekennen: „Wir sind alle in der einen oder anderen Hinsicht kaputt. Wir haben uns alle schon mal idiotisch verhalten und werden das auch wieder tun. Wir sind alle schwierig. Wir schmollen und werden wütend, geben anderen die Schuld für unsere Fehler, haben seltsame Obsessionen und Probleme, Kompromisse einzugehen. Wir sind hier, damit ihr mit all euren Fehlern weniger allein seid. Wir werden nie alle Details kennen, aber wir verstehen euch.“[3]
Der Autor und Lehrer David Zahl sagt, dass er diesen Clip schon dreißig Mal gezeigt hat und dass diese Stelle immer für Lacher sorgt. Und je älter das Publikum, desto lauter das Gelächter.[4] Es ist eine humorvolle säkulare Version dessen, was andere kluge Menschen schon vor Tausenden von Jahren erkannt haben: „Wir alle gingen in die Irre wie Schafe.“[5] „Wir haben unterlassen, was wir tun sollten, und getan, was wir unterlassen sollten. Und es ist nichts Heiles an uns.“[6]
Unser Leben ist unkontrollierbar. Wir alle haben uns schon idiotisch benommen und werden das auch wieder tun.
Ja, es ist „doch so schlimm“.
Die Schriftstellerin Anne Lamott fasst diesen Aspekt so in Worte: „Jeder ist verkorkst, kaputt, anhänglich und verängstigt, selbst die Menschen, die alles mehr oder weniger im Griff zu haben scheinen. Sie sind dir viel ähnlicher, als du glaubst. Versuche also nicht, dein Inneres mit ihrem äußeren Schein zu vergleichen.“[7]
Wir haben unsere Gedanken nicht im Griff.
Wir haben unsere Zunge nicht im Griff.
Wir haben unsere Gefühle nicht im Griff.
Wir haben unser Verhalten nicht im Griff.
Wir haben unsere Impulse nicht im Griff.
Wir haben unseren Egoismus nicht im Griff.
Wir sind nicht in der Lage, mit unserer Zeit oder unserem Geld so umzugehen, wie wir es gern möchten.
Was schlussendlich bedeutet, dass wir vor allem uns selbst nicht im Griff haben. Natürlich können wir auch unsere Familie, unsere Freunde, unseren Hund oder irgendjemand anderen nicht kontrollieren. Und je länger wir mit Gott leben, desto mehr erkennen wir, wie unkontrollierbar unser Leben eigentlich ist. Deshalb geht es auch im Leben nicht darum, dass wir irgendwelche Krisen vermeiden sollten. Wichtig ist, zu was für eine Art Mensch wir werden.
Ach um die, die nie singen …
Das letzte Lied des Kleinen Vogels
Um uns eine Vorstellung davon zu geben, wie ein gut gelebtes Leben aussehen könnte, hier die Geschichte eines Mannes, der seine Lieder gesungen hat – ein junger Tutsi namens Benyoni. „Benyoni“ bedeutet „Kleiner Vogel“. Er wurde so genannt, weil er trotz Armut und Hungers ständig sang, pfiff und Musik machte. Seine Familie konnte sich keine Gitarre leisten, also baute er sich eine. Er hatte auch einen fröhlichen Glauben, der andere beflügelte und ihn auf ganze natürliche Weise an die Spitze brachte. Im Internat wurde er zum Klassensprecher gewählt. Als die holländische Evangelistin Corrie ten Boom in seine Gegend kam, bestand sie darauf, dass er bei ihren Versammlungen den Gesang leitete, denn wenn er sang, stimmten alle anderen ganz selbstverständlich mit ein. Schließlich ging er als Lehrer an eine Schule und wurde bald zum Schulleiter ernannt.
All das geschah während des Völkermords in Ruanda, als Hutus versuchten, die Tutsis in ihrem Land zu töten. Eines Tages betraten fünf junge bewaffnete Hutu-Soldaten Benyonis Schule. Sie hatten den Befehl erhalten, alle Lehrer hinzurichten. Benyoni tat alles, um sie davon abzubringen. Vergebens. Sie führten ihn und die elf jungen Lehrer, die ihm unterstellt waren, aus der Schule, um sie vor den Augen der Schülerinnen und Schüler zu exekutieren.
Einer der Lehrer brach zusammen. „Bitte tötet mich zuerst“, flehte er die Soldaten an. „Ich könnte es nicht ertragen, meine Freunde so sterben zu sehen.“
„Oh nein“, sagte Benyoni ruhig, „ich bin der Schulleiter. Tötet mich zuerst. Und dann werdet ihr sehen, wie herrlich es ist, nach Hause zu gehen und bei Gott zu sein.“
Benyoni wandte sich an die Soldaten. „Darf ich für euch beten?“
Damit hatten die Soldaten nicht gerechnet, aber nach einigen Diskussionen stimmten sie zu. Die Lehrer an Benyonis Schule hatten großes Vertrauen in seine Gebete und hofften, dass er sie vielleicht aus dieser Situation „herausbeten“ würde.
Aber Benyoni betete nicht um ihre Rettung. Er bat Gott, ihnen allen Mut zu schenken und für ihre Familien zu sorgen. Aber vor allem betete er für die Soldaten. „Sie werden gleich etwas Schreckliches tun“, sagte er zu Gott, „und bald unerträgliche Schuldgefühle haben. Bitte sende jemanden, der ihnen von Jesus erzählt, damit sie Vergebung erfahren können.“
Als sie über den Hügel zum Ort der Hinrichtung kamen, hatte Benyoni eine letzte Bitte. „Bevor ihr uns tötet, möchte ich gern ein letztes Lied singen.“
Auch das war ein Novum. Mordopfer bitten normalerweise nicht darum, für ihre Henker zu singen. Inzwischen waren die Soldaten beunruhigt: „Wie können wir einen solchen Mann töten?“ Aber ihr junger Leutnant gab nicht nach. Wenn sie die Lehrer nicht erschossen, würden die Soldaten selbst getötet werden, wenn sie zum Stützpunkt zurückkehrten. „Ja“, sagte er zu Benyoni. „Du darfst singen. Ein Lied.“
Und Benyoni begann, ein altes Kirchenlied zu singen, das er sehr liebte:
Aus meinen Banden, Kummer und Leid,Jesus, ich komm, Jesus, ich komm,zu deiner Freiheit, Wonne und Freud,Jesus, ich komm zu dir.
Die anderen Lehrer fassten Mut und stimmten mit ein. Sie sangen alle Strophen – bis sie bei der letzten angekommen waren:
Aus der Angst und dem Schrecken des Grabes heraus,Jesus, ich komm, Jesus, ich komm;in die Freud’ und das Licht deines Haus’, Jesus, ich komm, Jesus, ich komm.[8]
Dann wurden diese zwölf jungen Männer erschossen. Dies war das letzte Lied des Kleinen Vogels.
Die Geschichte von Benyonis Leben und Tod wurde mir von einer Freundin von ihm erzählt, einer Frau namens Marti Ensign. Als ich sie zum ersten Mal hörte, fragte ich mich, woher wir diese Geschichte denn kennen, wenn doch die Lehrer alle getötet wurden.
Marti erklärte es mir: Die Soldaten kehrten zu ihrem Stützpunkt zurück und gingen in eine Bar, um sich so schnell wie möglich zu betrinken.
Aber ihr Leutnant rührte keinen einzigen Tropfen an. Er fühlte sich schuldig und war völlig verzweifelt. Er wartete, bis die Nacht hereingebrochen war, und suchte eine alte Quäkerin auf, die dort wohnte und lehrte. „Ich muss wissen, was Männer dazu bringt, so zu sterben“, sagte er.
Sie erzählte ihm von Jesus und dass er – wie Benyoni, der Kleine Vogel – gestorben war, um denen Vergebung zu ermöglichen, die ihn getötet hatten, und dass er auch heute noch Vergebung schenken will. Der Leutnant wurde ein Jesus-Nachfolger. Er begann, Bibelstudien zu leiten, und gab die Geschichte von Benyoni weiter. Nach ein paar Monaten wurde auch der Leutnant erschossen. Aber da war es schon zu spät, um der Geschichte von Benyoni Einhalt zu gebieten. Der Kleine Vogel ging ins Grab mit seinem Lied, das unauslöschlich in den Ohren seiner Mörder klang, und noch Jahrzehnte später hallt es durch die Welt.
Hätte Benyoni auf die große Krise gewartet, um zu einem Glauben zu finden, der ihn befähigte, dem Tod mit einer solchen Haltung zu begegnen, wäre es zu spät gewesen. Es war sein außergewöhnliches Leben vor der Krise, das es ihm ermöglichte, ihr mutig und entschlossen zu begegnen.
Es gibt eine Realität, die jenseits unserer Wirklichkeit liegt. Aus irgendeinem Grund strecken sich oft gerade Menschen, die sich in verzweifelten Situationen befinden – Gefangene, Süchtige, Verfolgte, Arme, Sterbende –, mit einer solchen Intensität und Zielstrebigkeit nach ihr aus, dass ihr Verlangen gestillt wird.
Aber der Rest von uns führt ein Leben in stiller Verzweiflung und geht ins Grab mit unserem Lied im Herzen.
Warte also nicht erst auf die Krise.
Gesucht: eine „lebendige spirituelle Erfahrung“
1931 – es war noch vor der Gründung der Anonymen Alkoholiker – wurde ein hoffnungsloser Alkoholiker (Rowland H.) von seiner wohlhabenden Familie nach Europa geschickt, um sich vom zweitberühmtesten Psychiater der Welt behandeln zu lassen – Carl Gustav Jung.[9]Nach einem Jahr intensiver Psychotherapie war er zuversichtlich, die Ursache seines Problems verstanden zu haben. Nun würde er in der Lage sein, nüchtern zu bleiben. Aber noch bevor er das Schiff nach Hause bestieg, hatte er sich schon wieder betrunken. Er kehrte zu Jung zurück, und dieser teilte ihm mit, dass er nichts mehr für ihn tun könne. Rowland H. kam es so vor, „als hätten sich die Tore der Hölle mit lautem Knall hinter ihm geschlossen“.[10]
„Gibt es keine Hoffnung?“, fragte er.
„Ein einzige“, entgegnete Jung. Er hätte von Menschen gehört, die durch eine „lebendige spirituelle Erfahrung“ eine Beziehung zu Gott gefunden hatten, die sie von dieser Sucht befreite.
Rowland H. begab sich auf eine intensive spirituelle Suche und fand durch die Oxfordbewegung zu einer solchen Beziehung zu Gott. Und er erzählte einem alkoholkranken Freund namens Ebby davon, der ebenfalls durch diese Gruppe zu Gott fand. Der wiederum erzählte es einem anderen alkoholabhängigen Freund namens Bill W. und auch der kam durch die Oxfordgruppe zu einer Beziehung zu Gott. Und damit nahm die Geschichte der Anonymen Alkoholiker ihren Anfang.
Dreißig Jahre später schrieb Bill W. an C. G. Jung, um ihm mitzuteilen, welch wichtige Rolle er bei der Gründung der AA gespielt hatte. Kurz vor seinem Tod schrieb Jung zurück, um seinen Ratschlag von damals zu erläutern. Das Verlangen nach Alkohol, schrieb Jung, sei „auf einer niedrigen Ebene das Äquivalent des spirituellen Durstes unseres Wesens nach Ganzheit. Um es in mittelalterlicher Sprache auszudrücken: nach Vereinigung mit Gott.“ Es sei kein Zufall, dass wir den Begriff „geistige Getränke“ für Alkohol verwenden, sagte er. „Im Lateinischen heißt Alkohol ‚spiritus‘, und man verwendet dasselbe Wort sowohl für die höchste religiöse Erfahrung als auch für das verderblichste Gift. Die hilfreiche Formel lautet ‚Spiritus contra Spiritum‘ [‚Geist gegen Alkohol‘]; entweder [wir stehen] unter dem Einfluss Gottes oder dem des Alkohols – oder was immer wir als Gottesersatz wählen.“[11]





























