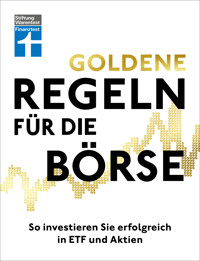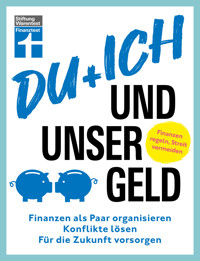
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stiftung Warentest
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wie sich Geld und Liebe gut unter einen Hut bringen lassen Was tun bei unterschiedlichen Gehältern? Wie lassen sich Finanzen in der Partnerschaft gemeinsam organisieren? Soll mit einem oder mit mehreren Finanzplanern gewirtschaftet werden? Dieser Finanzratgeber unterstützt Paare dabei, ihre Finanzen fair zu regeln und sich gleichberechtigt für die Zukunft abzusichern. Ehrliche und transparente Kommunikation über Geld Expertenwissen von Stiftung Warentest verbunden mit Tipps für eine erfolgreiche Paarkommunikation als Grundlage für die gemeinsame Geldanlage-Vision und -Organisation. Mit zahlreichen Grafiken und Impulsfragen. Finanzielle Lösungen bei Heirat, Hausbau, Kind und Karriere Das Buch zeigt, welche finanziellen Veränderungen eine Heirat oder die Gründung einer Familie bewirken und unterstützt dabei, gemeinsam konstruktive Lösungen, wie etwa Mütterrente oder Kindergeld-Depot, zu erarbeiten. Gleichberechtigte Absicherung im Alter Ob mit klugen Altersvorsorge-Strategien wie dem bewährten Pantoffel-Portfolio, einem rechtssicheren Testament oder mit Vollmachten und Lebensversicherungen zur Absicherung im Notfall – planen Sie Ihr Vermögen und Ihre Finanzen so, dass Sie beide im Alter gut abgesichert sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DU+ICHUND UNSER GELD
Clemens Schömann-Finck
Das passende Kontomodell finden
Als Paar haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten, Ihre Finanzen zu organisieren. Wir schauen mit Ihnen ins Detail.
Gemeinsam wohnen
Die gemeinsame Wohnung ist für Paare nicht nur ein großer emotionaler Gewinn. Nun verbringt man sein Leben wirklich gemeinsam. Zusätzlich spart dieser Schritt in vielen Fällen Geld.
Kinderglück ohne Geldsorgen
Kinder sind ein großes Glück, und Kinder kosten Geld. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Herausforderung meistern.
Inhalt
Geld und Liebe
Let‘s talk money
Eine gemeinsame Geldvision entsteht
Resümee
Finanzen gemeinsam organisieren
Kein Streit ums Geld
Das passende Kontomodell finden
Mit dem Money-Date die Finanzen im Blick
Resümee
Gemeinsam wohnen
Glücklich zusammen zur Miete
Den Umzug stressfrei regeln
Die gemeinsame Immobilie
Resümee
Ehe und die Folgen
Heiraten – lohnt sich das überhaupt?
Die Folgen einer Scheidung gestalten
Wo der Trauschein nicht viel ändert
Resümee
Jetzt wird geheiratet
Entspannt zum Standesamt
Was eine Verlobung rechtlich bedeutet
Den richtigen Nachnamen finden
Resümee
Familienplanung
Kinderglück ohne Geldsorgen
Teilzeit ohne Reue
Die Folgen von Trennung und Scheidung
Werden Sie zu Geld-Vorbildern für Ihr Kind
Resümee
Gemeinsam alt werden
Sorgenfrei dem Ruhestand entgegensehen
Mit Wertpapieren fürs Alter vorsorgen
Vom Ersparten im Alter leben
Die Familie absichern
Vorsorge für den Notfall
Resümee
Service
01
Geld und Liebe
Let‘s talk money
Eine gemeinsame Geldvision entsteht
Resümee
Let’s talk money
Liebe und Geld bilden eine schwierige Beziehung. Doch das heikle Thema zu verdrängen ist eine schlechte Strategie. Wie sich Konflikte vermeiden und Lösungen finden lassen.
Vom ersten Date zur gemeinsamen Kasse
Vermeintlich haben Geld und Liebe nichts miteinander zu tun: Liebe ist persönlich und emotional, Geld ist unpersönlich und kalt. Dichter, Songwriter und Schriftsteller versuchen, immer schönere Beschreibungen für das Gefühl der Verliebtheit zu finden, wohingegen es für Geld eine Vielzahl von abwertenden Begriffen wie Kohle, Schotter, Zaster oder Pinke gibt – um nur einige zu nennen. Dabei steht die Geldfrage oft am Anfang einer jeden Beziehung. Es ist der Moment, wo es bei der ersten Verabredung ans Bezahlen geht und sich die Frage stellt: Wer zahlt die Kinokarten, die Getränke oder das Essen? Schon hier kann sich entscheiden, ob aus dem ersten Date mehr wird oder nicht.
Denn natürlich ist es eine Illusion zu denken, dass Geld nur Zahlungsmittel, Recheneinheit und Mittel der Wertaufbewahrung ist, wofür es die Wissenschaft hält. Geld ist Teil unseres Wertesystems. Mit Geld sind Ideale wie Sicherheit, Unabhängigkeit und Freiheit verbunden. Es kann Wertschätzung und Macht ausdrücken. Geld ist so viel mehr als nur Scheine und Münzen. Es ist eben nicht nur das Werkzeug, als das wir es gerne sehen möchten.
Das zeigt sich bei den Worten „Zusammen oder getrennt?“, mit denen der Kellner im Restaurant die Rechnung präsentiert und damit eine ganze Kaskade an Emotionen und Überlegungen auslöst. In diesem Moment prallen all die Vorstellungen, Werte und Erwartungen, die jeder mit Geld verbindet, erstmals aufeinander. Ist sie verärgert, wenn ich getrennt zahlen will? Komme ich dann geizig rüber? Denkt er, dass ich ihn nur ausnutzen will, wenn ich mich einladen lasse? So oder so ähnlich gehen die Gedanken. Ein ansonsten schönes Date kann auf diese Weise einen schalen Beigeschmack bekommen, wenn die Frage des Kellners „falsch“ beantwortet wird.
Als Leser oder Leserin dieses Buches haben Sie die Klippe „Wer zahlt?“ offensichtlich erfolgreich umschifft, und auf die erste Verabredung folgten bei Ihnen noch weitere schöne Treffen. Und dennoch halten Sie dieses Buch in den Händen, um zu erfahren, wie Paare das Thema Finanzen so regeln können, dass es gerecht zugeht, beide gut abgesichert sind und es nicht (mehr) zu Streit kommt – ein wichtiger Schritt, um Ihre Beziehung zu vertiefen. Selbst wenn das erste Date schon eine Weile zurückliegt: Ohne ein gemeinsames Verständnis bleibt die Geldfrage ein ständiger Krisenherd, der jederzeit aufflammen kann.
ENTSCHEIDENDE FRAGE. Geld und Liebe gehen im Leben von Paaren eine untrennbare Allianz ein. Entscheidungen für die Liebe haben auch Folgen fürs Geld. Ob Ausflüge, der gemeinsame Urlaub oder die erste gemeinsame Wohnung – immer geht es um Geld und Kosten. Und immer wieder steht diese emotional aufgeladene Frage des ersten Dates im Raum: „Zusammen oder getrennt?“
Es ist also gut und wertvoll, dass Sie sich gemeinsam damit beschäftigen, was Ihnen in Ihrer (Geld-)Beziehung wichtig ist. Denn worüber man nicht gemeinsam sprechen kann, darüber kann man auch nicht gemeinsam nachdenken, und dafür kann man auch keine Lösungen finden.
Das Buch durchleuchtet deshalb alle wichtigen Finanzaspekte von Hochzeit und Familiengründung bis Altersvorsorge und wird Ihnen mit seinen Informationen und Tipps bei vielen Geldfragen in Ihrer Beziehung helfen.
Es geht in einer Beziehung eben nicht nur um romantische, sondern auch um finanzielle Intimität. Wer nicht weiß, wie viel Geld zur Verfügung steht, kann schlecht planen und kaum beurteilen, wie viel ausgegeben werden darf und ob man noch im Budget liegt. Das führt schnell zu Irritationen und Missverständnissen, wenn es zum Beispiel um die Urlaubsplanung geht: Statt offen zu sagen, dass der Urlaub zu teuer ist und man lieber sparsamer verreisen möchte, werden fadenscheinige Gründe vorgeschoben, die den anderen ratlos zurücklassen.
Davon abgesehen können finanzielle Probleme zur emotionalen Belastung für die Beziehung werden. Geldsorgen können sich schnell auf die Laune auswirken. Man ist reizbar, trübsinnig oder auch abgelenkt, nicht bei der Sache. Wer die Ursachen kennt, kann mit solchen Situationen leichter umgehen. Wer sie nicht kennt, muss rätseln und zieht unter Umständen falsche Schlüsse.
„Die Erfahrung zeigt: Je besser Paare über Geld reden können, desto besser ist ihre Beziehung“, berichtet der Paarberater Michael Mary, der sich schon lange mit dem Thema Liebe und Geld beschäftigt, in einem Interview. Weiter meint er: „Tatsache ist aber auch: Kein Paar möchte seine Liebe durch etwas so profanes wie, Geld‘ beschädigen. Das Thema ‚Geld‘ ist das letzte Tabu in der Liebe. Das Schweigen darüber macht es zu einem der häufigsten Konfliktthemen in Beziehungen. Um zu vermeiden, dass Geld eine zerstörerische Rolle in der Beziehung einnimmt, sollten sich die Partner um einen ständigen Abgleich bemühen.“
Die eigene Prägung in Sachen Geld verstehen
Wie lässt sich das Schweigen brechen? Wie lassen sich Streitigkeiten vermeiden und lösen? Zwei wichtige Werkzeuge dafür sind eine gemeinsame Geldvision und Strategien, um über unterschiedliche Meinungen wertschätzend zu diskutieren. Dazu erfahren Sie mehr im weiteren Verlauf dieses Kapitels. Zuallererst sollten Sie und Ihr Partner sich selbst besser kennenlernen und die eigene Prägung verstehen. Welche Erlebnisse und Erfahrungen haben Sie beeinflusst? Welche Geld-Werte haben Sie, und was verbinden Sie damit? Erst müssen Sie erkennen, was Ihnen wichtig ist, bevor Sie darüber sprechen können. Warum stört es Sie zum Beispiel so, dass Ihr Partner im Supermarkt nicht auf den Preis achtet? Warum hat es Sie geärgert, als Ihre Partnerin darauf bestand, die Restaurantrechnung zu teilen? Womöglich können Sie gar nicht genau sagen, was Sie daran stört und warum es sie stört. Es ist mehr eine Irritation; irgendetwas stimmt nicht und Sie fühlen sich damit nicht wohl.
Es lohnt sich daher auch, darüber nachzudenken, wie Sie zum Thema Geld stehen und was Ihnen wichtig ist. Wofür geben Sie zum Beispiel gerne Geld aus und warum – und bei welchen Dingen sind Sie wiederum geizig? Für was lohnt es sich zu sparen? Was verbinden Sie mit finanzieller Freiheit?
Versuchen Sie, diese Fragen für sich möglich konkret, am besten sogar schriftlich zu beantworten. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Gedanken und Gefühle in Worte fassen. Das kann etwas quälend sein, weil man oft ein eher diffuses Bild hat und erst noch treffende Formulierungen finden muss. Aber es lohnt sich. Denn wenn Sie sich über Ihre eigenen Werte in Sachen Geld klar geworden sind, dann können Sie auch mit anderen darüber sprechen. Der Selbsttest auf der Seite 8 kann Ihnen ebenfalls helfen, Ihre Einstellung zu Geld besser zu verstehen. Er kann nicht nur einen Beitrag dazu leisten, dass Ihnen einige Dinge über sich selbst klarer werden. Der Test kann auch Startpunkte für Gespräche über Geld sein und damit ein gutes Tool, um das Schweigen zu brechen.
Wie denken Sie über Geld?
Dieser spielerische Selbsttest kann Ihnen helfen, Ihre „Geldgeschichte“ und Ihre Geld-Werte besser zu verstehen. Überlegen Sie bei jeder Frage, wie Sie sich einstufen würden und anschließend, warum Sie diese Einstufung gewählt haben.
Genug Geld ist für ein glückliches Leben wichtig.
Sparen und Verzichten fällt mir leicht.
Mich stört es, wenn mein Partner/meine Partnerin/mein Freundeskreis mehr verdient als ich.
Meine Eltern sind in Geldfragen ein Vorbild für mich.
Für besondere Dinge gebe ich auch mal mehr Geld aus.
Ein hoher Kontostand ist für mich wichtig.
Der Aussage „Über Geld spricht man nicht“ stimme ich zu.
Der Aussage „Finanzielle Sicherheit ist wichtig“ stimme ich zu.
Unsere Kindheit spielt eine ganz entscheidende Rolle für unsere Vorstellungen über Geld und unseren Umgang damit. Eltern geben nicht nur Gene weiter, sondern auch Einstellungen, Verhaltensweisen und Glaubenssätze. Wurde offen über Geld geredet, hinterlässt das einen ganz anderen Eindruck, als wenn darüber geschwiegen wurde. Armut oder ständige Schulden hinterlassen andere Spuren als eine Kindheit ohne Geldsorgen. Es ist wichtig, zu erkennen: Welche Geld-Erfahrungen haben mich und meinen Partner geprägt? Wie sparsam, sicherheitsorientiert, freizeitorientiert oder ausgabenorientiert wurde ich erzogen? So etwas wirkt nach. „Der Mensch ist ein kognitiver Geizhals“, sagt die Wirtschaftspsychologin Julia Pitters in einem Interview. „Er strengt sich nicht gerne an. Glaubenssätze sind nur schwierig abzuschütteln und man muss sich der Einstellungen und Mechanismen erst einmal bewusst werden.“
Wie stark diese Prägungen sind, zeigen Beispiele, von denen Paartherapeuten berichten:
Knausrigkeit und Geiz: Eine Frau ist geizig, obwohl sie viel verdient und viel Geld auf dem Konto hat. Ihr Mann leidet unter dieser Knausrigkeit. Der Frau geht es aber gar nicht um größere Anschaffungen oder Rücklagen für Notfälle. Ihr Ziel ist es, eines Tages mehr Geld zu haben als ihr Vater, von dem sie sich nie ernst genommen fühlte. Die Frau will es ihrem Vater beweisen.
Angst vor Reichtum: Ein Mann aus einer vermögenden Familie erbt viel Geld. Er kauft ein Haus und legt etwas für das Alter zurück. Den Rest spendet er. Seine Frau kann ihn nicht verstehen. Der Grund hinter dem Verhalten: Der Mann hat als Kind erlebt, wie Geld eine Familie zerstören kann. Er will nicht, dass das seiner Familie auch passiert.
Große Sparsamkeit: Ein Paar hat ein gemeinsames Konto. Der Mann hat keine Schwierigkeiten, das gemeinsame Geld auszugeben. Die Frau schon. Das führt zu Konflikten. Die Frau will, dass ihr Mann sparsamer ist. Er kontert, dass sie auch mehr Geld ausgeben könnte. Sie schafft es nicht. Sie hat immer das Gefühl, ihrem Mann etwas wegzunehmen. Denn die Frau kommt aus ärmlichen Verhältnissen: „Jede Mark, die meine Mutter für mich und meine Geschwister ausgab, hat sie sich vom Mund abgespart. Das hat uns ein schlechtes Gewissen gemacht.“
Auch gesellschaftliche Rollenvorstellungen werden in der Erziehung und durch das Vorbild der Eltern weitergegeben. Rollenbilder wandeln sich nur langsam. Frauen blicken auf eine jahrhundertelange Geschichte finanzieller Unterdrückung und Bevormundung zurück. Im Jahr 1771 erließ Kaiserin Maria Theresia das Gründungspatent für die Wiener Börse. Aber nur eine kleine Gruppe von Bürgern hatte Zutritt. Draußen bleiben mussten zum Beispiel „Bankrotteure“, Straffällige – und Frauen. „Der Eintritt der Börse wird, ohne Unterschied des Standes, allen denjenigen, die daselbst Geschäfte haben können, gestattet, jedoch ist von solcher das weibliche Geschlecht ausgeschloßen“, heißt es in dem Patent von 1771.
In Deutschland erhielten Frauen erst mehr Rechte, als 1957 das „Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts“ verabschiedet wurde. Bis dahin galten in vielen Bereichen noch die Gesetze aus der Kaiserzeit.
DER MANN BESTIMMT. Im Bürgerlichen Gesetzbuch war damals klar geregelt, dass der Mann das Oberhaupt der Familie ist. In § 1354 des BGB von 1896 stand wörtlich: „Dem Manne steht die Entscheidung in allen das gemeinschaftliche eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten zu; er bestimmt insbesondere Wohnort und Wohnung.“ Ehefrauen durften nur mit Zustimmung ihres Mannes ein Konto eröffnen und eine Arbeit annehmen.
Erst mit der Reform von 1957 durften Frauen auch gegen den Willen ihres Mannes arbeiten – sofern das mit ihren Pflichten in der Familie vereinbar war. Diese Regelung wurde erst 1977 beseitigt. Und Frauen durften mit Inkrafttreten des Gesetzes im Jahr 1958 erstmals ohne Zustimmung des Mannes ein eigenes Konto führen und fortan über ihr eigenes Geld verfügen. Doch die Jahrhunderte der finanziellen Bevormundung haben Spuren hinterlassen.
Gleichzeitig nahm der Mann in der Vergangenheit die Rolle des Ernährers ein, der sich ums Geld und die Finanzen kümmerte, der seine Familie versorgte. Dieses Bild ist trotz allen Wandels in der Gesellschaft noch tief verwurzelt. Das zeigt sich oft an Kleinigkeiten, wie die folgenden drei Beispiele beweisen: Jungen erhielten lange Zeit mehr Taschengeld als Mädchen. Das änderte sich laut dem Kids-Medien-Kompass zum ersten Mal im Jahr 2023. Forscher der Universität Basel berichteten in einer im Jahr 2021 veröffentlichten Studie, dass Frauen in Umfragen oft geringere Gehälter angeben, damit ihre Männer besser dastehen. Und Befragungen zeigen immer wieder, dass Männer beim ersten Date zahlen wollen – auch wenn Frauen dies zunehmend unwichtig wird bzw. sie selber für sich zahlen wollen.
In einer Beziehung prallen diese unterschiedlichen persönlichen und kulturellen Prägungen aufeinander. Menschen kommen zusammen mit verschiedenen Einstellungen zum Geld. Für den einen ist es Mittel zum Zweck, für die andere ein Statussymbol. Für die eine bedeutet es Sicherheit, für den anderen Spaß und Selbstverwirklichung. Diese individuelle Symbolik des Geldes birgt ein erhebliches Konfliktpotenzial – solange man sich nicht darüber klar wird.
Eine gemeinsame Geldvision entsteht
Über Geld zu reden, ist schwierig. Wir stellen Ihnen Strategien vor, mit denen Sie das heikle Thema meistern und die Ihnen helfen, zu einem gemeinsamen Verständnis zu kommen.
Gespräche über Finanzen und Geld sind nicht einfach, vor allem nicht zu Beginn einer Beziehung, wo noch viel Unsicherheit herrscht und Vertrauen aufgebaut werden muss, aber auch später sind sie nicht einfach. Wenn etwas wichtig ist, reagiert man viel sensibler. Sonderlich romantisch scheint das Thema auf den ersten Blick auch nicht zu sein, und es gibt viele Gründe, nicht über Geld zu reden. Scham spielt eine Rolle.
Über Geld zu sprechen ist noch immer ein großes Tabu. Man will nicht knausrig erscheinen, den anderen auch nicht verletzen oder kränken und überhaupt: Ist Liebe nicht viel wichtiger? Vor allem Frauen tun sich schwer, hat Claudia Müller vom „Female Finance Forum“ beobachtet: „Männer reden generell etwas mehr über Geld, weil es ihnen von der Gesellschaft auch ein Stück weit zugeordnet wird. Die Frauen wollen hingegen eher gar nicht darüber reden. Wenn sie in ihrer Beziehung dann doch anfangen, das Thema anzusprechen, reagieren Männer völlig erstaunt.“ Wer über Geld spricht, offenbart auch etwas über die Beziehung, zu der er bereit ist. Man öffnet sich, geht ins Risiko. Wer zum Beispiel vorschlägt, ein gemeinsames Konto einzurichten, drückt damit einen Wunsch nach Verbundenheit aus, den der andere womöglich nicht teilt. Es gibt gute Gründe, nicht unbedingt alles auf ein Konto einzuzahlen, wie Sie im Laufe des Buches sehen werden. Im ersten Augenblick kann die Ablehnung des Vorschlags aber eine ziemliche Enttäuschung sein, die Zweifel aufkommen lassen kann. Das Gleiche kann passieren, wenn es um den Umzug in eine neue Wohnung geht, die das Budget des Partners sprengt. Ist die Partnerin dann bereit, einen größeren Anteil zu zahlen – oder nicht? Welche Lösungen kann das Paar finden? Beim Thema Geld kann also schnell ans Licht kommen, wie sehr sich beide in die Beziehung einbringen möchten. Es kann sich herausstellen, dass das Commitment sehr unterschiedlich ist und sich eine Seite nicht so umfassend auf die Beziehung einlassen will, wie es sich die andere wünschen würde und vielleicht auch gedacht hat. Aber natürlich kann sich auch das Gegenteil herausstellen.
Wertvolle Gespräche über Geld führen
Nähern Sie sich angesichts dieser Sensibilität und Schwierigkeiten dem Thema von einer unverbindlichen und leichten Seite. Wer bedeutungsschwer sagt: „Wir müssen uns jetzt mal zusammensetzen und über Geld reden“, sorgt schnell für angespannte Stimmung, die den offenen Austausch erschweren kann. Beginnen Sie lieber mit harmlosen „Was wäre wenn“-Fragen, zum Beispiel: „Was würdest du tun, wenn du im Lotto gewinnen würdest?“ oder „Was würdest du tun, wenn dein Arbeitgeber dir die Wahl lässt: Mehr Geld oder mehr Urlaub?“ Sie können sich an das sensible Thema herantasten, in dem Sie dann nachfragen, warum sich Ihr Gegenüber so oder so entscheidet. Auf diese Weise bekommen Sie einen ersten Eindruck. Anregungen für weitere Fragen finden Sie auf der Seite 15.
ZEIT NEHMEN. Es kann hilfreich sein, sich dem Kernthema in einem Bogen zu nähern. Denn oft fallen Gespräche leichter, wenn sie nicht am direkten Problem oder bei der akuten persönlichen Situation starten.
Beginnen Sie also eine Unterhaltung über Geld in Ihrer Beziehung eher allgemein und auf sicherem Terrain, um sich dann zu den entscheidenden Fragen vorzuarbeiten. Beginnen Sie zum Beispiel in der Vergangenheit und erkundigen Sie sich nach Erlebnissen aus der Kindheit: „Was hast du dir von deinem Taschengeld gekauft?“, „Wurden gute Noten in der Schule mit Geld belohnt?“, „Hast du das Geld gespart oder ausgegeben?“ Sie merken: Das sind keine schwierigen Fragen, und weil diese Erlebnisse in der Vergangenheit liegen und nichts mit der aktuellen Situation zu tun haben, muss sich niemand angegriffen fühlen. Das senkt Hemmschwellen und baut Vertrauen auf.
Wechseln Sie im nächsten Schritt von der Vergangenheit in die Zukunft. Hier ist alles möglich. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Auch auf diese Weise lässt sich unverfänglich über Geld reden. Es könnte zum Beispiel in diesem Schritt um berufliche Ziele gehen, einen früheren Rentenbeginn oder was man mit einer überraschenden Erbschaft machen würde.
So lernen Sie den anderen und dessen Geld-Werte besser kennen. Zum anderen ergeben sich dadurch Anknüpfungspunkte zum folgenden Schritt: der Gegenwart. Hier können Sie gemeinsam überlegen, was passieren muss, um die Zukunftsziele zu erreichen. Die Verwirklichung der meisten Träume kostet schließlich Geld. Vom Traum des frühen Ruhestands ist es nicht weit zu der Frage, wo man sparen kann und wie man das Geld anlegen kann, um dieses Ziel zu erreichen. Beim Traum von der Weltreise ist es naheliegend, über das Budget für den nächsten Urlaub zu sprechen oder wie die Kosten aufgeteilt werden sollen.
MIT PARTNER. Eine weitere Möglichkeit, um ins Gespräch zu kommen, sind die Statements aus dem bereits erwähnten Selbsttest auf der Seite 8. Anstatt den Selbsttest alleine zu machen, können Sie die Aussagen auch gemeinsam durchgehen. Vergleichen Sie Ihre Einstufungen. Warum haben Sie sich so entschieden, Ihr Partner aber anders? Sprechen Sie über Ihre unterschiedlichen Bewertungen und Ihre unterschiedlichen Einstellungen zum Geld.
Wählen Sie den Ansatz, der am besten zu Ihnen und Ihrer Beziehung passt, und beachten Sie dann zwei wichtige Punkte: Erstens müssen Moment und Umgebung stimmen. Gespräche über Geld und Finanzen werden kaum zu einem guten Ergebnis führen, wenn der eine müde oder die andere nach einem schwierigen Arbeitstag gestresst ist. Meiden Sie laute Umgebungen und Orte mit viel Ablenkung. Setzen Sie sich am besten gemütlich nebeneinander aufs Sofa – oder noch besser: Laufen Sie nebeneinander her! In der Bewegung bewegt sich auch das Denken. Über den Philosophen Aristoteles (384 bis 322 v. Chr.) sagt man, dass er mit seinen Schülern in einer Wandelhalle diskutierte. Daher leitet sich auch der Name seiner Schule ab: Peripatos bedeutet auf alt-griechisch Wandelhalle, die Anhänger des Aristoteles waren die Peripatiker. Die Veränderung der Landschaft beim Gehen kann stimulierend wirken. Kleine Beobachtungen am Wegrand bieten sich an, um das Gespräch aufzulockern. Und auch Gesprächspausen wirken weniger komisch, wenn man gemeinsam durch die Natur läuft, anstatt sich gegenüber zu sitzen.
Der zweite wichtige Punkt: Reden Sie auf Augenhöhe miteinander. Niemand sollte bei den Gesprächen denken, dass der eigene Weg der richtige ist. Der Umgang mit Geld kann sehr unterschiedlich sein, und in Beziehungen geht es schließlich nie darum, Unterschiede komplett aufzuheben. Stattdessen ist es das Ziel, mit Verschiedenheiten – egal auf welchem Gebiet – umzugehen und Lösungen zu finden, mit denen beide leben können.
GEMEINSAME VISION. Statt am eigenen Geldstil festzuhalten, ist es wichtig, einen gemeinsamen Stil, eine Geldvision für die Beziehung zu entwickeln. Hier vereinen sich im besten Fall die unterschiedlichen Prägungen, Vorstellungen und Ansichten zu einem neuen Weg – oder aber Sie finden einen passenden Umgang mit den Unterschiedlichkeiten.
Der Finanzcoach Ramit Sethi stellt in seiner Netflix-Dokuserie „How to get rich“ Paaren (und Sparern) eine sehr mächtige Frage, um ihnen bei der Entwicklung einer gemeinsamen Geldvision zu helfen: „How does your rich life look like?” zu Deutsch: „Wie sieht dein/euer reiches Leben aus?“ Die Frage regt zu Diskussionen und zum Nachdenken an: Was ist uns im Leben wichtig? Was gehört zu unserem reichen Leben – und was nicht? Welche Ziele wollen wir erreichen? Wie wollen wir leben, um sagen zu können, dass wir ein reiches Leben führen? Weiß man, was man erreichen möchte, kann man anschließend über den Weg dorthin reden.
Es geht um das Setzen von Prioritäten – wofür soll Geld ausgegeben werden und wofür nicht? Wer gerne reist, muss dafür an anderer Stelle verzichten. Um es mit den Worten von Sethi zu sagen: „Ein reiches Leben bedeutet, dass Sie großzügig Geld für Dinge ausgeben können, die Sie klasse finden, solange Sie Ausgaben für andere Dinge gnadenlos niedrig halten.“ Das kann für jedes Paar etwas anderes bedeuten. Anregungen für weitere Fragen, die Sie gemeinsam besprechen können, finden Sie auf der folgenden Seite.
Startfragen für Gespräche über Geld
Mit dem Partner oder der Partnerin über Geld zu sprechen ist nicht einfach. Hier ein paar Fragen, die Sie stellen können, um ins Gespräch zu kommen und Ihr Gegenüber – und vielleicht auch sich selbst – besser kennenzulernen.
Geldwert. Wie wichtig ist Geld für dich? Welche Einstellung hast du zum Geld? Welches Gefühl gibt dir Geld?
Überfluss. Wenn du morgen eine Million Euro hättest: Was würdest du mit dem Geld machen, und wie würde sich dein Leben ändern?
Sicherheit. Wie viel Geld ist genug? Ab welcher Summe auf dem Konto fühlst du dich sicher?
Freiheit. Was bedeutet finanzielle Freiheit für dich?
Prägung. Wer oder was hat dich in Bezug auf Geld am meisten geprägt – im Guten wie im Schlechten?
Träume. Welchen Traum willst du dir eines Tages erfüllen?
Pleite. Was würdest du machen, wenn du plötzlich kein Geld mehr hättest?
Großzügigkeit. Wofür gibst du gerne Geld aus und warum? Wo bist du geizig und warum? Wann hast du dir zum letzten Mal etwas gegönnt?
Überstunden. Du hast Überstunden angehäuft. Dein Chef lässt dir die Wahl: Ausgleichstage oder ausbezahlen. Was wählst du und warum?
Karriere. Du bekommst ein Jobangebot: Die Bezahlung ist besser, aber du musst auch mehr arbeiten. Nimmst du es an?
Ziele. Was sind deine kurzfristigen und langfristigen finanziellen Ziele?
Unabhängigkeit. Wie wichtig ist dir finanzielle Unabhängigkeit?
Wichtig ist, einen Weg zu finden, der für Ihre gemeinsame Liebe funktioniert – wie er auch bei anderen großen Beziehungsthemen wie Kindererziehung oder Zeit für sich vs. Zeit gemeinsam gefunden werden muss. Wie wollen Sie Ihre Finanzen regeln? Wie wollen Sie investieren? Wie soll Ihr Leben im Alter aussehen? Und was ist, wenn Kinder kommen? Im Verlaufe dieses Buches werden Sie dazu Informationen und Anregungen finden, wie sich Ihre gemeinsame Vision von einem „reichen Leben“, um Sethis Formulierung aufzugreifen, erfüllt.
Regeln helfen, Konflikte zu vermeiden
Beim Entwickeln Ihrer gemeinsamen Vision sollten Sie sich an gewisse Diskussionsregeln halten. Die Regeln können verhindern, dass ein Konflikt eskaliert, und sie helfen Ihnen dabei, konstruktiv über unterschiedliche Sichtweisen zu sprechen. Sie sind selbstverständlich auch für später gültig. Denn auch eine gemeinsame Vision garantiert nicht, dass es keine Konflikte mehr ums Geld gibt und alles harmonisch verläuft. Aufgrund der Gesprächsregeln, die Sie vereinbart haben, können Sie konstruktiv damit umgehen, wenn sich Bedürfnisse, Einstellungen und Interessen ändern. In Konflikten haben sich folgende Regeln und Strategien bewährt. Versuchen Sie, sie zu verinnerlichen. Sie helfen Ihnen, zu einer Lösung zu kommen.
Beobachtungen als Ich-Botschaften formulieren. Wenn Beobachtungen als „objektive“ Botschaften formuliert werden, können sie aggressiv und angreifend wirkend: „Du gibst zu viel Geld aus.“ Ihr Gegenüber nimmt dann schnell eine Verteidigungshaltung ein. Das erschwert das Finden einer Lösung. Besser sind Ich-Botschaften: „Ich habe den Eindruck, dass du zu viel Geld ausgibst.“ So lässt man die Möglichkeit offen, dass man sich auch irren kann, wohingegen eine vermeintlich objektiv formulierte Aussage wie eine Tatsache klingt.
„Immer“ und „nie“ streichen. Sätze wie „Du schaust beim Einkaufen nie nach Sonderangeboten“ oder „Immer muss ich zahlen“, provozieren Widerspruch. Ihr Gegenüber wird nach Situationen suchen, für die diese Behauptungen nicht zutrafen. Er oder sie wird sich verletzt fühlen, wenn eigene Bemühungen anscheinend nicht wahrgenommen werden. Sagen Sie besser „oft“ und „selten“. So machen Sie auch deutlich, was Sie meinen, bringen aber zugleich zum Ausdruck, dass es manchmal auch anders ist. Noch besser ist es, konkrete Beispiele zu nennen. Auf diese Weise kommen Sie schneller zum eigentlichen Thema.
„Ja“ und „Nein“ richtig verstehen. Die Wörter „Ja“ und „Nein“ können in Diskussionen schnell zu Verwirrungen führen. Denn stimmt der Partner wirklich zu, wenn er „Ja“ sagt? Vielleicht bringt er nur zum Ausdruck, dass er zuhört oder vielleicht ist es nur ein „Verlegenheits-Ja“, weil er eigentlich anderer Meinung ist. Zu einer echten Zustimmung wird ein Ja erst, wenn auch die Umsetzung geklärt ist. „Ohne das ‚Wie‘ ist ein ‚Ja‘ nichts wert“, brachte es der Verhandlungsexperte Chris Voss auf den Punkt. Ähnliches gilt für das Wörtchen Nein. Hinter einer Ablehnung können sich mehrere Bedeutungen verbergen. Nehmen Sie also ein Nein erst einmal nur als Reaktion wahr und nicht als unumstößliche Position. Ergründen Sie, was dahintersteckt. Vielleicht wurde Ihr Vorschlag nicht richtig verstanden und nur deshalb abgelehnt.
Sicherstellen, dass Sie Aussagen richtig verstehen. Schnell kann es in Diskussionen zu bösen Missverständnissen kommen, weil man Sätze unterschiedlich auffasst. Wiederholen Sie mit eigenen Worten die Aussage Ihres Gegenübers. Fragen Sie nach, ob Ihre Schlussfolgerung stimmt. So stellen Sie sicher, dass Sie wirklich über das Gleiche reden. „Nichts annehmen, abklären“, lautet eine wichtige Regel von Verhandlungsprofis.
Scheinpositionen erkennen. Häufig haben die in Diskussionen vertretenen Positionen – absichtlich oder unabsichtlich – nichts mit den wahren Wünschen zu tun. Sie sind nur vorgeschoben, während es eigentlich um etwas ganz anderes geht. Die Geschichte vom Streit der zwei Schwestern um eine Orange auf der Seite 83 ist ein anschauliches Beispiel dafür. Wenn Ihr Partner durch alle möglichen Argumente anführt, dass zwei Wochen Urlaub zu lang sind, will er vielleicht in Wahrheit sagen, dass ihm so ein langer Urlaub zu teuer ist. Scheinpositionen zu erkennen, erfordert Einfühlungsvermögen und Gespür. Das ist schwierig, bringt eine Lösung aber beträchtlich näher.
Immer respektvoll bleiben. Beleidigungen, Beschimpfungen und verletzende Bemerkungen sind ein absolutes Tabu. Sagen Sie nichts, was Sie später bereuen werden.
Neben „Geldprägung verstehen“ und „Geldvision entwickeln“ sind Konfliktstrategien das dritte wichtige Werkzeug. Sie helfen zu verhindern, dass Geld in Ihrer Beziehung zu einem Streitthema wird.
Resümee
Ungelöste Geld-Konflikte können eine Beziehung zerstören. Wie lässt sich das verhindern? Die wichtigsten Punkte in der Zusammenfassung.
Alles beginnt mit wohlwollender Kommunikation auf Augenhöhe: Reden Sie miteinander − auch über Ihre Finanzen! Die Geldfrage ist ein ständiger Begleiter in einer Beziehung: Wie wollen wir Kosten aufteilen? Für was wollen wir Geld ausgeben? Was können wir uns leisten?
Es ist unabdingbar