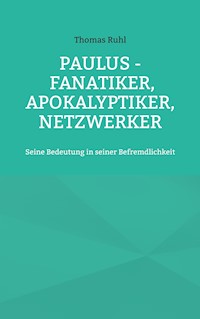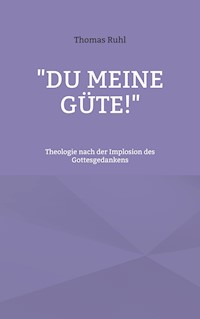
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
"Du meine Güte!" - das ist eine mehrdeutige Redewendung. Mit ihr reagierte ich auf die Implosion des Gottesgedankens. Sie ist Ausdruck meines Erstaunens: Wie unermesslich groß das Universum und wie unfassbar klein seine Bausteine sind. Das ist die kosmologische Dimension. Sie ist Ausdruck meiner Hoffnung: Plausibel und verantwortbar ist nach der Implosion des Gottesgedankens einzig das Vertrauen auf einen "kommenden Gott". Wie das "Maranatha"-Rufen der frühen Anhänger der Jesus-Bewegung. Das ist seine biblische Dimension. Sie ist eine Aufforderung: Sei einfach und spontan gütig. Und frage nicht viel. Das ist ihre ethische Dimension. Sie ist mir ein "Scheitelstein": Wie ein Schlussstein stabilisiert die Güte meine theologischen Überlegungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„In welchem Käfig man sich auch befindet, man muss ihn verlassen.“ (John Cage)
„Dass ich dasselbe ‚Recht‘ hatte, zu sprechen, wie der Baum, Blätter zu treiben.“ (Inger Christensen)
„Wenn die Religion, wenn Religionen einen Sinn haben, dann den, den Bodensatz an Güte der Menschen freizulegen, ihn dort zu suchen, wo er nahezu vollständig versickert ist. Diese Gewissheit müssen wir freilegen und ihr eine Sprache geben.“ (Paul Ricoeur)
„Blinder Bildstock“, Rödermark-Oberroden 2007
Inhaltsverzeichnis
Astrophysik und Theologie
Die Implosion meines Gottes-Gedankens
Credo – ich glaube
Franz führt sich auf
Du meine Güte: Corona / Apokalyptik
Seelsorge/Spiritual Care – „seelsorgen“
Zeit? – geschenkt!
Disruption zur Diesseitigkeit
Warum sollte ich von Gott schweigen?
Navigieren
Das metaphorische Sprechen vom „kommenden Gott“
Nachwort
„Ein Gott für Erwachsene manifestiert sich gerade durch die Leere des kindlichen Himmels.“ (Emmanuel Lévinas)
Astrophysik und Theologie
Um zu verstehen, wie gewaltig groß das Universum ist, braucht es neben der Physik vor allem angemessene bildhafte Vergleiche. Die Skalen und Größenordnungen des Kosmos überschreiten den gesunden Menschenverstand. Wir haben es im gewöhnlichen Leben mit bescheideneren Dimensionen zu tun. Wir können das Universum nicht ohne metaphorische Hilfen ermessen. Viel zu gewaltig und unermesslich groß (und in seinen Bausteinen auch unermesslich klein).
1. Der Blick in den nächtlichen Himmel
Blicken wir zunächst in den nächtlichen Himmel: Wir sehen auf der Nordhalbkugel eine begrenzte Anzahl an Sternen – etwa 3000. Planeten mit wechselnden Positionen. Mit Glück auch Meteoriten, die verglühen und ganz selten einen Kometen. Und bei extrem guten Sichtverhältnissen die Milchstrasse. Wie sehen den Mond mit seinen wechselnden Phasen. Und gerade noch eben mit dem Auge unsere Nachbargalaxie, den Andromeda-Nebel, ca. 2,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt.
Wir bemerken beim Betrachten des Himmels auch etwas von seiner Mechanik: die Sterne bewegen sich von Ost nach West; den Wechsel von Tag und Nacht. Und die wiederkehrenden Jahreszeiten. Den Bogen der Sonne am Tageshimmel spannt sich von Ost nach West. Der Polarstern steht immer im Norden. Das können wir mit unseren Augen sehen. Wir können Sonnenuhren bauen. Und mit Hilfe der Sterne auf den Meeren navigieren.
Wie unermesslich groß das Universum ist, zeigt ein Größenvergleich aus unserer unmittelbaren kosmischen Nachbarschaft. Die Entfernung der Sonne zu α-Centauri, dem nächsten Stern.
Wenn unser Sonnensystem ein runder Leibniz-Butterkeks ist, dann befindet sich α-Centauri, der zur Sonne nächste Stern, zwei Fußballfelder weit entfernt. Wie weit entfernt ist dann allein schon der nächste Nachbar zu unserer Milchstraße, die Andromeda-Galaxie! Das Licht von dort braucht 2,5 Millionen Jahre.
Der dunkle Nachthimmel liefert fundamentale kosmologische Einsichten und Information: Was eigentlich hell sein sollte, ist dunkel – und zwar deshalb, weil das Licht aller Sterne des Universums die Erde noch nicht erreicht hat. Es ist noch unterwegs. Wir können deshalb nur in eine gewisse Tiefe des Universums sehen. Wir sehen nur einen kleinen Teil. Deshalb ist der Nachthimmel bis auf wenige Sterne dunkelschwarz. Die Frage, warum es nachts dunkel ist, ist eine nicht gerade ganz einfache Frage. Schon bis zu diesem Punkt einer Problematisierung der Dunkelheit der Nacht auf der Erde war ein langer Weg. Benannt ist das Problem nach dem Arzt und Astronomen Heinrich Wilhelm Olbers (1758 – 1840) als Olbers’sches Paradoxon.
Wir wissen heute: 1. Es gibt einfach zu wenig Sterne. Es gibt keinesfalls unendlich viele Sterne. 2. Das Weltall ist endlich alt – auch wenn es schon 13, 81 Milliarden Jahre sind. In dieser Zeit kann Licht nur eine begrenzte Entfernung zurücklegen. Deshalb erreicht uns nur das Licht der Sterne, die innerhalb dieser Entfernung leuchten. Aber in diesem Umkreis um uns herum sind es viel zu wenig Sterne, um den Erdenhimmel nachts mit ihrem Licht hell erleuchten zu können. 3. Im Schnitt – über das uns bekannte Universum – gerechnet, strahlen zudem die Sterne jeweils Hunderte von Lichtjahren voneinander entfernt gegen die Finsternis an. Also: Es sind zu wenig Sterne in einem Universum, das begrenzt und damit noch recht jung ist. Deshalb bleibt es nachts auf der Erde dunkel. Das Licht aller Sterne hat uns noch nicht erreicht. Das Licht ist noch unterwegs. Deshalb lässt sich nur eine begrenzte Zahl an Sternen beobachten. Es gibt einen Beobachtungshorizont bei 13,81 Milliarden Lichtjahren. Rechnet man die sich beschleunigende Expansion des Universums mit ein, ergibt das eine Grenze bei 46,6 Milliarden Lichtjahren Entfernung. 4. Bleibt es dunkel, weil auch Sterne eine begrenzte Lebensdauer haben. Sie leben nicht unendlich und leuchten nicht ewig lang. Also: Nachts ist es dunkel, weil das Universum begrenzt alt ist und es zu wenig hell leuchtende Sterne gibt. Das gilt für die optisch sichtbare elektromagnetische Strahlung. Für die anderen Spektralbereiche ist der Nachthimmel nicht „dunkel“. Wir kennen die Kosmische Hintergrundstrahlung (CMB) oder Röntgenstrahlung, γ-Strahlung, Neutrinos oder Gravitationswellen. Für das menschliche Auge aber bleibt die Nacht bis auf wenige Sterne immer dunkel.
2. Die Geschichte des Universums und seine Leere
Die Geschichte des Universums auf ein Jahr projiziert, also 13,7 Milliarden Jahre auf 365 Tage geschrumpft, bedeutet: 1. Januar: Urknall nach dem kosmologischen Standardmodell. 1. Februar: Entstehung unserer Milchstraße. 3. September: die Erde entsteht. 22. September: erstes Leben auf der Erde. 17. Dezember: sog. Kambrische Explosion. 26. Dezember. Zeitalter der Dinosaurier. 30. Dezember: Dinosaurier sterben aus. 31. Dezember 21:00 Uhr: erste Hominiden und um 23:58 Uhr taucht der moderne Mensch auf. Vor 25 Sekunden entsteh die Landwirtschaft. Vor 11 Sekunden die Pyramiden in Ägypten. Vor einer Sekunde: Kepler und Galilei können beweisen, dass sich die Erde auf einer elliptischen Bahn um die Sonne bewegt.
Das Universum ist – trotz Milliarden von Galaxien mit jeweils Milliarden von Sternen - so gut wie leer. Das ist unfassbar. Dazu ein Vergleich: 1 cm3 Luft enthält 100 Trillionen Teilchen (1020) bestehend aus Protonen, Neutronen und Elektronen. Während 1 m3 intergalaktisches Medium nur 1 Teilchen bzw. meist nur ein Atom Wasserstoff enthält. Auch in einem einzelnen Atom ist wenig los. Vergleicht man ein Atom Wasserstoff mit dem Allianzstadion in München, dann ist der Atomkern (ein Proton) wie ein Reiskorn im Mittelfeldpunkt und das Elektron schwirrt weit oben in den Zuschauerrängen. Dazwischen ist nichts. Und dann ist da noch die Entdeckung des Astronomen Edwin Hubble aus dem Jahre 1929 - die sog. Rotverschiebung: das Universum dehnt sich aus. Die Hubble-Konstante liegt bei 67,74 (+/0,46) km pro s x Mpc. Das ist eine messbare Größe. Das Phänomen selbst ist vergleichbar einem Rosinenkuchenteig, der im Aufgehen begriffen ist, so dass sich die Rosinen voneinander entfernen, während der Teig sich aufbläht. Die Raumzeit dehnt das Universum, deshalb entfernen sich die Galaxien voneinander weg, und zwar je weiter voneinander, desto schneller.
3. Der Urknall ist ein Witz
Der Urknall ist ein Witz, weil er ein Witz war. Weil der Big Bang – von Fred Hoyle spontan kreiert – in einem BBC-Interview als Witz leicht spöttisch und abfällig gebraucht wurde. Der Astronom Hoyle hat als Vertreter der „Steady-State-Theorie“ die Schlussfolgerungen seiner Kollegen Hubble, Friedmann und Lemaître, die von einer messbar zunehmenden Beschleunigung sich voneinander entfernenden Galaxien ausgingen, als schlechten Witz abgetan. Das war 1949. Heute wissen wir: Fred Hoyle hat sich geirrt. Der Big Bang ist kein Witz geblieben, sondern als Tatsache genommen im öffentlichen Bewusstsein angekommen. Seither kursiert die Spott-Metapher vom Big Bang durch unsere Köpfe und führt ein Eigenleben. Wir können uns die Entstehung des Universums gar nicht mehr anders denken. Am Anfang war der Big Bang. Vornehm und vermeintlich präziser ausgedrückt, wird aus dem Big Bang eine Singularität. Der inflationäre Gebrauch hat eigentlich erst den „Urknall“ erzeugt. Und seitdem knallt’s am Anfang. Nicht wie an Sylvester um Mitternacht, sondern wie bei einer Atombombe. Und genau darin besteht erst recht der ganze Witz. Der inflationäre Gebrauch des Wortes „Big Bang“ führte zu seiner Reifizierung. So entsteht eine Sache. Eine Tatsache. Es scheint auf der Hand zu liegen: Die Raumzeit expandiert. Man rechnet von heute ausgehend den Zeitstrahl zurück – und schon muss es da einen Anfang gegeben haben. Einen Nullpunkt. Wie mit dem Lineal gezogen, berechnet und gemessen. Ist doch klar! Ohne Urknall geht heute gar nichts mehr. Weder in der Astrophysik noch in der Theologie. Bildgebend waren die beiden Atombombenexplosionen über Hiroshima und Nagasaki. Seitdem wurde so etwas wie der Big Bang plausibel vorstellbar. Einfach und naheliegend. Eigentlich völlig klar. Es muss gewaltig gewesen sein. Da ist die messbare Expansion der Raumzeit. Die kosmische Hintergrundstrahlung. Die 2015 detektierten Gravitationswellen. Vor allem sie stimmen hoffnungsfroh: „Ich werde den Urknall noch hören!“, so Prof. Karsten Danzmann1. Skizzen und Zeichnungen zur Entwicklung des Universums illustrieren es ebenfalls vorstellbar. Es sieht alles so plausibel aus. Kein Zweifel. Da war ein Anfang. Da muss ein Anfang gewesen sein. Was sonst??! Uns gäbe es heute nicht! Und genau das ist die spannende Frage: Ist ein Anfang (von Allem) überhaupt denkbar? Wir können lediglich kausal schlussfolgern. Mehr nicht. Das reicht für’s Leben auf der Erde. Aber nicht für das Universum. Von dem wir ohnehin nur 5% kennen. Der Rest von 95% ist dunkel. Also für uns von bisher unbekannter Natur. Auch deshalb ist der Big Bang ein Witz. Und aus diesem Witz sollten wir lernen. Das gilt für die Astrophysik wie die Theologie. Macht keine Witze!! Denkt nach! Nehmt ernst, was uns L. Wittgenstein „über Gewissheit“ ins Stammbuch geschrieben hat: „Daß es mir – oder Allen so scheint, daraus folgt nicht, daß es so ist.“2 Zu Recht kritisiert Wittgenstein den gesunden Menschenverstand. Der Big Bang ist zu disruptieren. Wir können keinen Anfang von Allem denken. Wir sind nur ein Teil (von Allem). Das ist eine bleibende Grenze. Und sie ist für das menschliche Denken unüberwindbar. Weil menschliches Denken nur Denken innerhalb von geschlossenen Grenzen ist. Das Gehirn ist ein geschlossenes System. Auch das eines theoretischen Physikers. Wie weit dürfen wir extrapolieren? Das ist die Frage. Das Universum in seiner Gesamtheit ist keine mit dem Lineal messbare Größe. Wir können nicht mit physikalischen Mitteln erforschen, was der Physik des jetzigen Universums voraus liegt. Weder der Beginn noch das Ende von Allem sind denkbar. Der menschliche Verstand ist eine lokale Größe. Keine universale! Ist es plausibel, physikalisch von einem Anfang und einem Ende (von Allem) zu sprechen? Für wen? Und unter welcher Hinsicht erscheint etwas als Anfang und als Ende? Da sind die Brillen zu wechseln. Zu bedenken bleibt: „Die Umwelt, die wir wahrnehmen, ist unsere Erfindung.“3 Wir sind Teil eines Prozesses und stecken mittendrin. Selbst unsere Galaxie, die Milchstrasse, deren Teil wir sind, können wir nicht überblicken. Es gibt für uns keine Gesamtansicht. Uns fehlt der Punkt „außerhalb“. Wir schwimmen und driften in unzähligen Prozessen gleichzeitig. Da ist keine Draufsicht von außerhalb möglich. Was wir den Anfang unseres Universums nennen, den Big Bang, ist eine Metapher für unser gesammeltes Nicht-Wissen-Können. Mit Big Bang markieren wir sprachlich eine Unentscheidbarkeit. Der Big Bang ist eine Illusion, eine Einbildung. Wie alles wohl einmal angefangen hat, ist eine unentscheidbare Frage.
Der Urknall wird wie ein Startschuss zu einem 100 m Lauf gedacht. Sollten wir jemals 13,8 Milliarden Jahre alte Gravitationswellen hören können, dann sind sie das Material, aus dem wir uns den Urknall basteln. Es wird eine Konstruktion bleiben (müssen). Er hat immer schon ein Vorher. Die Herausbildung der Raumzeit selbst ist nicht raumzeitlich vorstellbar. Schon gar nicht linear-zeitlich von heute nach rückwärts. Wie dann? Keine Ahnung! Das ist es! Wir haben keine Ahnung. Ein Anfang (von Allem) ist nicht wissbar. Wittgensteins Mahnung ist ernst zu nehmen: „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.“4 Das wird nicht beherzigt. Deshalb ist die Metapher vom Urknall ein Witz. Oder vornehmer formuliert, eine Singularität. Der Big Bang bleibt eine Fiktion – selbst dann noch, wenn wir über Gravitationswellen etwas „hören“ sollten. Da ist kein Anfang nirgendwo. Und auch kein Ende – nirgendwo. Da ist auch keiner. Keiner, der zuständig ist. Und es getan hätte. Deine Gebete bleiben unerhört. Keine Adresse. Sie fallen auf dich zurück. „Der Anfang von Himmel und Erde hat keinen Namen.“5 Und H. von Foerster hat seinen Wittgenstein in jungen Jahren intensiv gelesen: „Die Tatsachen gehören alle nur zur Aufgabe, nicht zur Lösung.“6 Jeder also, der den Urknall als Tatsache verhandelt, macht aus dem Urknall einen Lösungs-Witz. Dabei ist die Frage nach dem Anfang von allem, also nach dem Urknall, eine prinzipiell unentscheidbare Frage. Der „Urknall“ ist eine Trivialisierung. Wer vom Urknall spricht, trivialisiert die Welt. Es darf gelacht werden!
4. Zoomen wir jetzt zurück zur Erde und den vielen Erden
Mit Hilfe des Sonnen-Lichtes (den Photonen) und der Fähigkeit der Pflanzen zur Photosynthese kam es zur Bildung von Sauerstoff in der Erd-Atmosphäre. Und Glucose. Deshalb leben wir heute. Wir leben von der Sonne und sind selbst aus „Sternenstaub“7 geworden. Es brauchte zwei Generationen an Sternen vor der Herausbildung unserer eigenen Sonne samt ihrem Sonnensystem, um die chemischen Elemente zu kreieren, aus den wir bestehen.
Mittlerweile sind weit über 4000 Exo-Planeten bekannt. Planeten, die um ein Zentralgestirn kreisen, sind keine Besonderheit. Wir wissen heute, dass es in unserer Milchstrasse mehr Planeten wie Sterne gibt. Es scheint Milliarden von Planeten mit ähnlicher Masse wie unserer Erde zu geben, die um einen Stern kreisen. Auch in der sog. habitablen Zone. Planeten, die sich wie die Erde in einem fast leeren Universum mit unfassbaren Geschwindigkeiten auf gravitativ definierten Bahnen bewegen. Das Beispiel der Erde mag genügen. Sie dreht sich binnen eines Tages um sich selbst. Am Äquator sind das immerhin 1670,4 km pro Stunde (also 464 Meter pro Sekunde). Die Geschwindigkeit, mit der sich die Erde um die Sonne bewegt, beträgt demgegenüber schon 30 Kilometer pro Sekunde. Und noch deutlich schneller dreht sich die Sonne und ihr Planetensystem zusammen mit unserer Milchstraße. Unsere Sonne befindet sich 25000 Lichtjahre vom Zentrum unserer Galaxie entfernt und benötigt für einen Umlauf 240 Millionen Jahre. Das heißt die Sonne samt Erde bewegen sich mit 220 Kilometer pro Sekunde. Und der Galaxienhaufen der sog. Lokalen Gruppe, zu der die Milchstraße gehört, bewegt sich mit 630 Kilometer pro Sekunde. Das sind unfassbare Geschwindigkeiten, die spontan nicht vorstellbar sind. So unvorstellbar wie die Größe der Entfernungen im Universum und die Leerheit des weiten Raumes zwischen den Galaxien.
5. Astrophysikalisches Gesamtergebnis
Das führt zu folgendem Gesamtergebnis: „Das heißt aber, wir könnten nur regionale, nicht globale Kosmologie betreiben.“8 Was wir wissen, betrifft 5% von allem. Es ist die aus Atomen aufgebaute, für uns sichtbare Materie. Im Unterschied zu den 95 % an Dunkler Energie (68%) und Dunkler Materie (27%). Beide sind für uns nicht direkt greifbar und werden nur bedingt bzw. gar nicht verstanden9: Es gibt einen indirekten Nachweis durch die hohe Rotationsgeschwindigkeit der sichtbaren Materie von Galaxien in deren Außenbereich, die messbar schneller als erwartet ist. Dunkle Materie hat eine gravitative Wechselwirkung, aber keine mit Licht. Oder die Rotverschiebung der expandierenden Raumzeit – wer verursacht das? Die Dunkle Energie ist hierfür das Konzept. Mit guten Gründen lässt sich sagen: „Wir haben im Universum fast alles Wichtige übersehen und dachten, wir könnten das Universum auf einige einfache Vorstellungen und Erklärungen reduzieren. Aber das Universum hat sich gewehrt und lautstark deutlich gemacht, dass es bei Weitem mehr zu bieten hat und sich demgemäß das Geschehen um uns herum entschieden komplexer darstellt.“10 Und wir sind bei weitem nicht die einzigen, aber wir bleiben unerreichbar allein. Die Erde als Himmelskörper irgendwo in unserer Milchstraße hat zwar den Menschen hervorgebracht; ihn aber keineswegs intendiert. Die Erde meint uns nicht. Ich bin nicht gemeint, aber ich bin da. Das gibt mir zu denken.
6. Theologische Schlussfolgerungen:
Zunächst möchte ich festhalten: Wir sollten alle unsere Fragen offenhalten und nicht vorschnell durch eine Antwort abschließen. Die Fragen gilt es zu leben, wie es bei Rilke heißt: „Leben Sie jetzt die Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne zu merken, eines fernen Tages in die Antworten hinein.“11 Diese Offenheit ist deshalb dringend geboten, weil wir viel zu wenig wissen und vermutlich auch in Zukunft viel zu wenig wissen werden. Aus diesem Umstand ziehe ich folgende Schlussfolgerungen:
1. Wir erleben uns kosmisch einsam. "Der Kosmos schweigt uns an" – auf diese kurze Formel hat Bernulf Kanitscheider12 in einem Interview seine kosmologischen und existentialphilosophischen Erkenntnisse gebracht. Kein kosmologisches Modell wird uns trösten können. „Je begreiflicher uns das Universum wird, umso sinnloser erscheint es auch.“13
2. Wir erleben uns fremd auf dem Planeten Erde: Wir fragen unaufhörlich nach Leid und den Ursachen himmelschreiender Ungerechtigkeit, ohne je eine Antwort bekommen zu können. Wir sollten aufhören von Gott in einer objektivierenden Weise als einem „Schöpfer“ zu sprechen. Gott ist kein Handwerker und kein Dings-da. Das Universum ist kein Tontopf. Gott ist nicht aus der Welt heraus als deren Grund und Ursache zu erkennen. Wie aber kommt dann der Gottes-Gedanke in meinen Kopf?
3. Wir erleben eine absurde Situation: Die Physik hat methodisch alle Fragen ausgeklammert, die, um ein Mensch sein zu können, von uns beantwortet werden wollen. Die Physik ist nicht geeignet und auch nicht zuständig, die Kantischen Fragen: Was ist ein Mensch? Was muss ich tun? Was darf ich hoffen? beantworten zu können.
6.1. Fazit: Wir verstehen die Himmelsmechanik
Wir verstehen die Himmelsmechanik. Und dass es unmöglich ist, von der Welt aus auf Gott zu schließen bzw. ihn als einen Schöpfer plausibel denken zu können. „Keine Eigenschaft Gottes … ist aus ihr (= der Welt) zu erschließen, nicht einmal seine Existenz.“14 Das Universum ist uns unverfügbar. Und: „Gott schweigt.“15
Wir verstehen die Himmelsmechanik, aber der Himmel hat uns nicht nötig. Das Universum hat uns Menschen nicht gemeint, aber ich bin da. Daraus ergibt sich ein Impuls: „Unablässig versucht der moderne Mensch, die Welt in Reichweite zu bringen: Dabei droht sie uns jedoch stumm und fremd zu werden: Lebendigkeit entsteht nur aus der Akzeptanz des Unverfügbaren.“16 Deshalb betrachte ich mich selbst in meiner mir unverfügbaren Existenz als ein Geschenk, dass mir widerfahren ist. Auf der Welt, dem Himmelskörper Erde zu sein, ist ein Geschenk. Daraus folgt für mich abschließend:
Wir sollten auf auffällige Korrespondenzen/ Korrelationen/Resonanzen mit theologischen Vorstellungen achten. Worin, von welchen Bildern und Vorstellungen werde ich erreicht, berührt und bewegt? Wie hat es mich verändert? „Eine Resonanzbeziehung ist grundsätzlich ergebnisoffen. Resonanzfähigkeit erfordert daher die Bereitschaft, sich auf Prozesse einlassen, bei denen wir weder wissen, wie lange sie dauern, noch was dabei herauskommt. Sich auf Resonanz einzulassen bedeutet, auf Verfügbarkeit zu verzichten.“17 Das erfordert Vertrauen, Offenheit und eine entsprechende Selbstwirksamkeitserwartung.
6.2. Was fördert mein Vertrauen?
Was an theologischen Vorstellungen fördert mein Vertrauen, meine Offenheit und meinen Mut zu erwarten, weiterhin in Resonanz zu bleiben? Ich setze auf drei Motive:
Ein erstes Motiv: Die Vorstellung eines kommenden Gottes
„Unser Gott ist ein Gott, der kommt.“18 oder in der Formulierung von Berthold Klappert: „So Gott will und er lebt! Und wie ich hinzufügen möchte: … und ER kommt!“19 Also von Gott nur noch unter einem Vorbehalt sprechen zu können – nämlich einem Vorbehalt Gottes. Alles, was wir in unserer Gescheitheit von Gott meinen sagen zu müssen, steht unter dem Vorbehalt: „So Gott will und er lebt! … und ER kommt!“ Mein Gott-Vertrauen speist sich nicht aus einer Gewissheit, dass Gott ist - also der Existenz Gottes -, „sondern aus einer Utopie Gott“20 - dem kommenden Gott.
Ein zweites Motiv: „Ihm, Jesus, glaube ich Gott“21
„Ihm, Jesus, glaube ich Gott“ - das heißt für mich: ich reihe mich ein in die jüdische Tradition der Entwicklung des Gottes-Gedankens und seinen inhaltlichen Wandlungen vom kriegerischen Wüstengott zum einzigen Gott. Es war ein fortdauerndes
Erzählen, „eine Anstrengung“22 und eine Sorge, die diesen radikal außerweltlichen Gott „hervorgedacht“23 und erfunden hat. Und zu einem bildlosen Gott, zu dem einen und später zum universell einzigen Gott – dem Schöpfer von Himmel und der Erde - wurde. Und der Weigerung des Judentums seinen Namen auszusprechen. Darin findet die Verwandlung Jahwes in den einzigen Gott ihren Abschluss. Das ist meine Wurzel. Elazar Benyoëtz, der Aphoristiker, beschreibt es unnachahmlich präzise:
„Das Wissen von Gott ist grenzenlos beschränkt“24
„CredoER ist mir nicht gegeben und kann mir nicht genommen werden ….. Er hat mit mir etwas vor, und das ist meine Zukunft“25
Ein drittes Motiv: „Dein Reich komme“ (Mt 6,10)
In Mk 4, 26 – 32 heißt es: „Er sagte: Womit sollen wir die Gottesherrschaft vergleichen? Oder in welchem Gleichnis sollen wir sie darstellen? Mit einem Senfkorn, das, wenn es auf die Erde gesät wird, kleiner ist als alle anderen Samen der Erde.
Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen essbaren Pflanzen und treibt große Zweige, so dass in seinem Schatten die Vögel des Himmels wohnen können.“ Worauf will der Text hinaus? Er beschreibt: Das Ende ungerechter Verhältnisse wird kommen. Es gibt Hoffnung. Wie „das Wunder des Wachstums der Pflanzen“26. Es geht nicht um eine zukünftige Kirche – das wäre ein Missverständnis; es geht um „Gott und Gottes Zukunft allein“27. Wie es auch im Vater-unser ersehnt wird: „Dein Reich komme“ (Mt 6,10) Das Gleichnis schöpft sein Hoffnungs-Bild aus der Schöpfung28. Die Ordnung des Kosmos dient der Generierung einer Hoffnung, die angesichts der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse unmöglich erscheint.
7. Der nächtliche Sternenhimmel
Auch der Blick in den nächtlichen Sternenhimmel kann das leisten. Er weitet meinen Blick ins unfassbar Offene. Er hilft uns, den Planeten Erde als einen Himmelskörper zu begreifen und sich entsprechend achtsam zu verhalten. Wir sind Mit-Bewohner dieser Erde und nicht ihre Be-Herrscher. Unsere Sicht auf die Welt ist begrenzt, wie der Blick in dem Nachthimmel. Bescheidenheit ist angesagt und ein gesundes Maß an Selbstkritik. Es gibt keinen Grund für überheblich zu sein:
„Ermesse die Weite des Himmels nicht, indem du durch einen Strohhalm schaust.“29
1 Quelle: https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/iq-wissenschaft-undforschung/gravitationswellen-entdeckung-danzmann-100.html
2 L. Wittgenstein; Über Gewissheit. Werkausgabe Band 8, S. 119.
3 Heinz von Foerster; Wissen und Gewissen, S. 26.
4 L. Wittgenstein; Tractatus logico-philosophicus. Werkausgabe Band 1, S. 85 (Nr. 7).
5 So lautet der Titel des Buches von Heinz von Foerster; Der Anfang von Himmel und Erde hat keinen Namen. Eine Selbsterschaffung in sieben Tagen.
6 L. Wittgenstein; Tractatus logico-philosophicus. Werkausgabe Band 1, S. 84 (Nr. 6.4321).
7 Vgl. Sagan, Carl; Druyan, Ann; Dyson, Freeman; Morrison, David (2000); Carl Sagans kosmische Verbindung.: „Wir sind Sternenstaub, der an die Sterne denkt.“ Inspiriert wurde C. Sagan von der Singer-Songwriterin Joni Mitchell, deren durch Lied “Woodstock ": "Glanz wie Sternenstaub, wie funkelndes Gold".
8 Hans Jörg Fahr; Mit und ohne Urknall, S. 330
9 Vgl. Adalbert W. A. Pauldrach; Das Dunkle Universum. Der Wettstreit Dunkler Materie und Dunkler Energie: Ist das Universum zum Sterben geboren?, S. 6 – 23.
10 A. Pauldrach; Das Dunkle Universum, S. 22.
11 Rainer Maria Rilke, Briefe, erster Band: 1897 bis 1914, (Wiesbaden) 1950, S. 49.
12 Quelle: https://www.sueddeutsche.de/wissen/sz-wissen-der-kosmosschweigt-uns-an-1.527259
13 St. Weinberg; Die ersten drei Minuten, S. 162.
14 E. Drewermann; Im Anfang… Die moderne Kosmologie und die Frage nach Gott, S. 1101.
15 Ebd.
16 Hartmut Rosa, Unverfügbarkeit (Einband).
17 Hartmut Rosa. Quelle: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Feine-solidarische-welt.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2FHartmut-Rosa_RESO-NANZ.docx&wdOrigin
18 J. Pohiers; Wenn ich Gott sage, S. 81
19 Berthold Klappert; Der Gott Israels in Seinem Reich und Ort. Plädoyer für eine ortsorientierte Utopie. In: Magdalene L. Frettlöh & Jan-Dirk Döhling (Hrsg.); Die Welt als Ort Gottes – Gott als Ort der Welt. Friedrich-Wilhelm Marquardts theologische Utopie im Gespräch, S. 85.
20 F.-W. Marquardt; Eia, wärn wir da – eine theologische Utopie, S. 575.
21 K. Marti; Heilige Vergänglichkeit. Spätsätze, S. 30.
22 Thomas Mann; Josef und seine Brüder, S. 1698ff.: „Denn Gott ist eine Anstrengung, aber die Götter sind ein Vergnügen.“
23 Ebd., S. 42.
24 Elazar Benyoëtz, Die Zukunft sitzt uns im Nacken, S. 168.
25 Ebd., S. 217.
26 L. Schottroff, Die Gleichnisse Jesu, S. 155.
27 L. Schottroff; Die Gleichnisse Jesu, S. 157
28 Das gilt ebenso für den Sonnengesang des Franz von Assisi.
29 Kodo Sawaki; Zen ist für nix gut, S. 34 und 360.
„Den Gott, den es nicht gibt, immer ein dunkler Riß, ist meiner Seele nah, sooft ich ihn vermiß.“ (Christian Lehnert)
Die Implosion meines Gottes-Gedankens
1. Was ist geschehen?
Es gab keinen lauten, keinen unüberhörbar lauten Knall. Es war auch nicht leise zu hören. Da war überhaupt nichts zu hören – rein gar nichts. Und genau das ereignete sich – zeitlich gestreckt. Und kann nur in der Rückschau – wie von einem Archäologen – zu einem Ereignis rekonstruiert werden. Also ein Nicht-Ereignis. Nix! Fast nichts!
Diese Einsicht ist mir gedämmert. Wie eine Dämmerung – unauffällig und auf leisen Sohlen. Und plötzlich merkst du! Es ist ja dunkel geworden. Oder hell, wenn es um den Übergang von der Nacht zum Tag geht. Auf diese Weise ist mir der Gottes-Gedanke implodiert. Ganz still und leise. Unhörbar leise. Noch nicht mal ein Hauch. Und schon stehst du mitten in der Wolke deines gesammelten Nicht-Wissens. Deines Nicht-wissen-könnens. Wie eine Kehrtwendung. Ein Auf-einmal-anders-denken. Eine Selbsterschließung, eine Selbstauskunft – in der Weise einer langsamen Intuition. Ohne Krach. Ohne Lärm. Ganz unaufgeregt: Ein ganz und gar „stilles Geschrei“30 - bringt meine biografisch-theologische Erfahrung auf den Punkt. Weder ein widerborstig-trotzig atheistisches Bestreiten noch ein geschönt akademisches Verharmlosen durch ein fortgesetztes Beharren auf theistischen Abstraktionen. Es ist eine Implosion. Sie hatte sich mir angekündigt. Es gab mächtig Druck von außen. Stichwort: Gott in Auschwitz. Und die jüdische Vorstellung eines Zimzum31.
Was heißt das?
Kann man nach Auschwitz noch ernsthaft und vernünftig von einem Gott sprechen? Ist das nicht eine unverschämte Verwegenheit? Eine Frechheit, die die Opfer verhöhnt? Und eine Antwort kommt wie ein Echo zurück: „Nicht wie er, sondern wie wir es zulassen konnten, ist die Frage, die uns zunächst von dorther erreicht.“32 Damit ist die Konstruktion eines allmächtigen Gottes völlig im Eimer (der Geschichte). Gott hat sich – im Rückgriff auf eine mythologische anmutende Sprechweise – in sich selbst zurückgezogen. Hat sich verkrochen. Wir haben ihn verjagt.
Und jetzt? Da bleibt mir nur noch die Ethik übrig. „Die Beziehung zum Unendlichen ist die Verantwortung eines Sterblichen für einen Sterblichen.“33 Das sind mir die fast schon wieder verwischten Spuren der lautlosen Implosion meines Gottes-Gedankens. Kein punktuelles Ereignis. Keine Koordinatenangaben. Kein Damaskuserlebnis. Eher schon wie eine aufgewirbelte Staubwolke, die sich allmählich herabsenkt und alles bedeckt. Also nichts zu hören. Nichts zu sehen. Nichts zu bemerken. Keine Auffälligkeiten. Bis ich die Dämmerung bemerkte, war es schon dunkel.
Wie kann ich mich jetzt navigieren? Wie mich orientieren? Was soll gelten? Woran kann ich mich halten?
Geblieben ist mein Wunsch nach Orientierung. Ich will mich zurechtfinden. Geblieben ist auch eine langanhaltende Trauer um den Verlust meiner liebgewonnenen Überzeugungen.
Wie konnte ich mich so heftig täuschen lassen?
Auch eine Scham, mich für den jüdisch-christlichen Gott (im jugendlichen Überschwang) begeistert zu haben. Und erst recht eine Scham wegen der irreversiblen Weichenstellungen in meinem Leben. Trauer! Trauer und kein Trost. Dabei war es einfach nur das falsche Futter für meine Begeisterungsfähigkeit. Schließlich gab es kein anderes. Zweimal war ich deswegen im jüdischen Museum in Jerusalem. Ich habe (regelrecht) nachgeschaut. Die Abfolge im Aufbau der Ausstellung hat mir gezeigt, was das für einer war – der jüdisch-christlich gewordene Gott. Und wie er erfunden, konstruiert und herbei erzählt und abgegrenzt wurde. Eine Kopfgeburt. Ich habe in Jerusalem für mein Leben gelernt. Der Gottes-Gedanke ist keine feststehende Idee; er hat eine Geschichte. Und diese Geschichte ist auf’s Engste verknüpft mit Fragen der Macht, der Herrschaft und der Legitimation von Königen durch Priester, Tempel und Kult. Der Gottes-Gedanke entpuppte sich mir als Herrschaftsinstrument bis auf den heutigen Tag: Du sollst dich nicht länger unterwerfen! Beugen. Unters Joch gehen. Gehorchen und brav sein. Dieser Gott ist tot. Das wusste schon Nietzsche: „Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet! … Dies ungeheure Ereignis ist noch unterwegs und wandert – es ist noch nicht bis zu den Ohren der Menschen gedrungen. … Diese Tat ist ihnen immer noch ferner als die fernsten Gestirne – und doch haben sie dieselbe getan!“34
Das ist der Schlüssel und ich habe ihn für mich gefunden.
Obwohl spätestens mit Jesu Kreuzigung Schluss war mit dieser Form von Religion (mit jeglichen Religionsvorstellungen), ging es noch 2000 Jahre lang munter weiter. Das ist nicht zu fassen. Schon Paulus hatte mit dem „Wort vom Kreuz“/„von der Kreuzigung erzählen“ in 1 Kor 1, 18 mit dem gewohnten Gottes-Gedanken gebrochen. F. Nietzsche hat das in aller Klarheit erkannt: „deus, qualem Paulus creavit, dei negatio“35