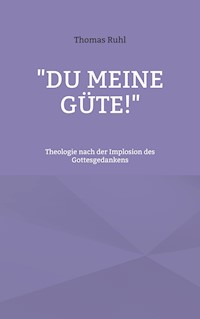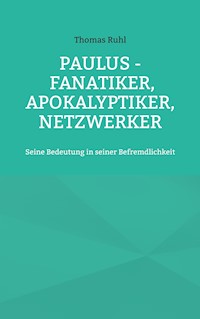
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Paulus bleibt umstritten. Er ist ein Fanatiker geblieben, der ein Apokalyptiker wurde und Netzwerker dazu. Paulus bleibt uns befremdlich. Er nutzte mythische Bilder, um seinen neu gewonnen Glauben und seine entschiedene Hoffnung zum Ausdruck bringen zu können. Der anti-imperiale Paulus und sein Netzwerk frühchristlicher Gemeinden hofften auf ein baldiges Kommen Gottes. Mit seinen Briefen löste er eine unfassbare Rezeptionsgeschichte aus. Paulus bleibt ein Teil der abendländischen Geistesgeschichte. In seinen Briefen zeigt sich Krisenrhetorik auf der Basis einer kontrafaktischen Wirklichkeitsunterstellung. Wer seine Briefe liest, sieht ihm beim Navigieren über die Schulter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Paulus ist zugleich wohl der am meisten missverstandene Autor des Neuen Testaments.“ (Jörg Frey)
„Der Mensch ist das Tier, dem man die Lage erklären muss“ (Peter Sloterdijk)
„Wenn Sie glauben, Sie wüssten, was Sie in der Zukunft erwartet, dann irren Sie.“ (Zygmunt Bauman)
„Die Rechtfertigung rechtfertigt, weshalb die anderen anders bleiben können.“ (Krister Stendahl)
„Die zerbrochene Schale meiner Sehnsucht“, 2001
Inhaltsverzeichnis
Hinführung und zentrale These
Paulus - es gibt Fakten
Paulus - seine Bedeutung für heute
Paulus – der Fanatiker
Paulus – der Netzwerker
Rezeptionsgeschichte
Zusammenfassender Ausblick
1. Hinführung und zentrale These
Von Paulus es gibt Fakten. Von keinem1 antiken Autor neben Cicero wissen wir so viel wie von Paulus. Wir haben biografische Details, kennen seine Reise-Routen und können die sieben authentischen Briefe aus dem NT lesen.
Und - Paulus hat Bedeutung. Paulus wird gelesen, d.h. seine Briefe werden gelesen. Paulus hat in den vergangenen zweitausend Jahren eine unfassbare Rezeptionsgeschichte entfaltet. Er hat inspiriert. Oder sollte ich genauer sagen, seine Fremdheit2 hat inspiriert. Ungebrochen. Bis zum heutigen Tag: „Radikal im Denken, extrem in der Hoffnung: Warum der Apostel Paulus aktueller ist denn je – und sich selbst die wichtigsten Philosophen der Gegenwart für ihn begeistern“3.
Beidem möchte ich jetzt nachgehen. Paulus, wer war das? Und wodurch konnte es zu dieser enormen Bedeutung kommen? Warum diese andauernde Bedeutung? Und worin darf man die Bedeutung des Paulus für uns heute sehen? Warum sollte er für uns heute wichtig sein?
Und - es gibt auch ein ernstes Problem mit Paulus. Bei allem, was wir von ihm wissen, dürfen wir nicht verschweigen: Paulus - scheint ein „jüdischer Fundamentalist“4 gewesen zu sein; vielleicht sogar ein (fundamentalistischer) „Fanatiker“5 in einem ganz modernen Sinn und Wortgebrauch. Auch damit müssen wir uns befassen. Sein „Fanatismus“ hat Spuren hinterlassen. Der (christliche) Anti-Judaismus hat auch Wurzeln – oder mindestens - Anknüpfungspunkte bei Paulus selbst, die eine „missverständliche Lektüre“6 begünstigen. Verantwortlich zu machen für den christlichen Antijudaismus7 oder gar für den Antisemitismus des 20. Jahrhunderts ist er nicht. Heute bleibt es bei einer Warnung: „Eine unschuldige Lektüre des Paulus ist nicht mehr möglich.“8 Paulus war ein „Eiferer“9, ein Radikaler10. Paulus zeigt in seinen Briefen eine „bestimmte Weise der Selbstbehauptung des Ichs“11. Das klingt in unseren Ohren doch recht harmlos. Paulus - das war kein harmloser Mensch12.
Er war auch nicht nur ein überforderter Tüchtiger in der Krise13. Paulus war ein „Fanatiker“14 und blieb fanatisch – „von gerechtem Zorn erfüllt“15. „Paulus ist … der Eiferer geblieben, nur die Gegner sind andere geworden.“16. Woher rührte – zeitlebens – sein „Übereifer“17 – also sein Zorn und seine Wut? Worin sah er sein Vorbild? „Vorbild des ‚Eifers‘ war Pinechas, der einen anderen Israeliten getötet hatte, nur weil er eine Frau aus einer anderen Religion geheiratet hatte. Die Frau hat er gleich dazu getötet. Wenn Paulus Anhänger des ‚Eifers‘ war, muss diese Geschichte von Pinechas einmal ein Lieblingsfilm in seiner inneren Welt gewesen sein.“18 Wir haben es hier mit dem religiösen Ideal des gewaltsamen Eifers aus der Makkabäerzeit zu tun. Sein demonstrativer Gesetzes-Stolz und Über-Eifer für das Gesetz waren „keineswegs typisch“19 in seiner Zeit. Paulus spielte durch diese Haltung eine Außenseiterrolle20; und er blieb – zeitlebens - ein Außenseiter: „Sein neuer Eifer äußerte sich sine vi humana sed verbo.“21 Die Forschung hingegen entscheidet sich tendenziell oft zugunsten des bekehrten Paulus und betrachtet alles mit den Augen und aus der Perspektive des Bekehrten. Aber: „Nicht alles ist wunderbar bei Paulus, oft sprechen der Priester und der Pharisäer durch ihn.“22 Selbst die fragwürdige Metapher eines Vulkans23 wird gebraucht, um Paulus zu charakterisieren. Die "Tollheiten"24 des Paulus - das sollte uns stutzig machen und aufhorchen lassen. Paulus ist eine umstrittene25 und zutiefst fragwürdige Persönlichkeit.
1.1. Leitende These vorab
Paulus lebt/performt „das Gegenmodell zum heutigen Zeitgeist“26 zu allem, was (der damalige ebenso wie) der heutige Zeitgeist von uns will und einfordert. Paulus ist deshalb zunächst eine grundsätzliche Haltung zu den gesellschaftlichen Begebenheiten. Sie drückt sich entschieden und zugespitzt in der Überzeugung aus:
„Ein Sieg über das Siegen“27;
ein Sieg, der das idiotische und kriegerische und zutiefst männliche Immerzu-siegen-Müssen28 überwindet. Darin sehe ich die entscheidende Intuition des Paulus. Es ist seine alles bestimmende Frage. Seine ihn bestreffende untergründige (Psycho-) Dynamik. Das war sein Thema. Und damit ist er in seiner Zeit - und bis auf den heutigen Tag - nicht allein. Christa Wolf hat es im Kontext von Troja ebenfalls als Problem beschrieben. Sie lässt Kassandra sagen:
"Ich sage ihnen: Wenn ihr aufhörn könnt zu siegen, wird diese eure Stadt bestehn.
Gestatte eine Frage, Seherin – (Wagenlenker.) - Frag. - Du glaubst nicht dran. - Woran. - Daß wir zu siegen aufhörn können. - Ich weiß von keinem Sieger, der es konnte. - So ist, wenn Sieg auf Sieg am Ende Untergang bedeutet, der Untergang in unsere Natur gelegt.
Die Frage aller Fragen. Was für ein kluger Mann. Komm näher, Wagenlenker. Hör zu. Ich glaube, dass wir unsere Natur nicht kennen. Daß ich nicht alles weiß. So mag es, in der Zukunft, Menschen geben, die ihren Sieg in Leben umzuwandeln wissen."29
Genau darin besteht für mich der innere Kern des sog. Damaskus-Ereignisses: Paulus hat die Kette des Siegen-müssens für sich unterbrochen. Wie er das und was er da erlebt hat und wie es andere, wie z.B. Lukas, beschreiben, bleibt demgegenüber sekundär. Entscheidend ist seine Intuition: der Sieg über das männliche Siegenmüssen. Deshalb hat Paulus eine solche unfassbar intensive Rezeptionsgeschichte durch die Jahrhunderte! Und rezipiert haben ihn (fast30) ausschließlich Männer: Augustinus, Martin Luther, Johannes Calvin, Blaise Pascal, John Wesley, S. Kierkegaard, Karl Barth, S. Freud, F. Nietzsche, Martin Heidegger, R. Bultmann, Erik Peterson, Jacob Taubes, Walter Benjamin, E. M. Cioran, John D. Caputo u.v.a.m.
Das ist meine zentrale These zu Paulus: Der Sieg über das (männliche) Siegen-müssen.
Es geht 1. nicht um die Frage: War „Paulus, der Gründer des Christentums“31? Das war er nicht. Lüdemann führt die Ursprünge des Christentums auf eine einzige zentrale Person zurück, auf Paulus von Tarsus, womit er das sich ausdifferenzierende Christentum gerade nicht als langwierigen, religiös-kulturellen und sozialen Prozess begreift. Er entwirft eine einseitige "genieästhetische Historisierungslegende"32 und blendet hierbei vor allem die Einflüsse von "machtpolitischen und soziokulturellen Transformationsprozessen"33 aus. Die Einflüsse und der Kontext, in dem Paulus sich bewegt, sind komplett unterschätzt.
Und es geht 2. auch nicht um die Frage: War Paulus vielleicht „der erste Christ“34?
Beide Fragestellungen gehen an Paulus völlig vorbei und können ihn in seiner Bedeutung nicht fassen. Paulus ist auch nicht der „letzte Apostel“35. Paulus hat sich selbst als Apostel bezeichnet. Paulus ist weder der „Architekt des Christentums“ noch ist „das Christentum eine paulinische Religion“36. Paulus ist nicht „der Erfinder der Christlichkeit“37. Paulus ist auch nicht der legitime Verwalter oder der einzig autorisierte Ausleger der Botschaft des Jesus. Paulus ist kein „scheitender Reformator“38gewesen. Er hat keine innerjüdische Sekte zu einer christlichen Kirche gemacht39. Paulus als „Mystiker“40 zu bezeichnen, bleibt ebenfalls fragwürdig. Man sollte ihn auch nicht zum „ersten christliche Theologen“ bzw. zum „Schutzheiligen des Denkens im Christentum“41 hochstilisieren, „der an die Stelle des einfachen Evangeliums Jesu ein kompliziertes Dogma gesetzt habe“42. Das trifft alles nicht wirklich zu. Diese Sichtweisen und Perspektiven sind nicht zielführend. Ich entscheide mich für einen völlig anderen Bezugsrahmen.
Mein Bezugsrahmen sind die Macht- und Herrschaftsverhältnisse (in der Bibel), der politische Machtdiskurs43 und nicht die Fiktion einer wunscherfüllenden Heldengeschichte von Paulus, dem Bekehrten bzw. die Konstruktion einer notwendigen und folgerichtigen Geschichte der Entstehung des frühen Christentums aus dem Judentum im ersten Jahrhundert. Paulus – das ist „Protestliteratur“44. Paulus – das ist „politische Theologie“45; das ist „eine politische Kampfansage an den Cäsaren“46.
Ich halte zusammenfassend fest: Paulus – das ist der Sieg über das (männliche) Siegen-müssen.
In einem ökonomischen Sprachspiel formuliert, bedeutet das Siegen über das männliche Siegen-müssen das Ende einer unaufhaltsamen Wachstumsideologie und einer ungebremsten Profitmaximierung. Paulus ist auch das Ende (digitaler) Aufrüstung und aller Kriegsplanspiele. Paulus entlarvt das, was heute „Nekropolitik“47 genannt wird. Achille Mbembe zeigt messerscharf und klar, wie die Macht (der/einer Souveränität) durch die Schaffung von Zonen des Todes bewerkstelligt wird und in Kraft tritt, in denen der Tod zur ultimativen Ausübung von Herrschaft instrumentalisiert wird. Nekropolitik kennzeichnet die „gegenwärtige Form der Unterwerfung des Lebens unter die Macht des Todes“48. So lange unsere westliche imperiale Lebensweise unhinterfragt fortbesteht, wird es kein Ende der Nekropolitik geben49.
Das klingt vielleicht befremdlich. Wir haben aber zu bedenken. Paulus war kein Dogmatiker, also kein systematischer Theologe in unserem heutigen Verständnis:
Paulus war ein Apokalyptiker50 – geprägt von der Hoffnung auf das baldige Kommen des Reiches Gottes.
Und durchdrungen von der für uns zutiefst verstörenden und disruptiven Überzeugung von der völligen „Verwandlung dessen, was Menschen wissen und wie sie es wissen können“51. Paulus kann deshalb auch „so ganz nebenbei die – für unser Vorstellungsvermögen – größten ‚mythologischen‘ Ungeheuerlichkeiten“52 in seinen Briefen ausbreiten. Er bringt diese (für uns so sehr) befremdlichen Überzeugungen mit einem eigenen Bild sehr plastisch zum Ausdruck. Er schreibt in 1Kor 7, 29:
„Die Zeit gerät aus den Fugen.“53
Meine zentrale These ist eine Interpretation dieser Irritation , Neuartigkeit und Befremdlichkeit54. Sie ist der Versuch, „sich selbst vor dem Text“55 - hier der authentischen Paulus-Briefe - verstehen zu wollen. Das ist ein Verstehens-Schlüssel. Nicht „im“ oder „hinter“ dem Text, sondern „vor“ dem Text stehen – d.h. den biblischen/paulinischen Texte als einen „Entwurf von Welt“56 verstehen und im Kontext meiner/unserer Lebenswirklichkeit begreifen. Nur wenn ich mir den Text auf diese Weise – als „Entwurf von Welt“57 - aneigne, wenn ich mich „selbst vor dem Text verstehe“, wird er sich mir erschließen können und ich ihn verstehen können. Einen Text verstehen, heißt nicht: die „Sache des Textes“58 verstehen, sondern vielmehr und alles entscheidend sich selbst vor dem Text verstehen. Interpretieren ist somit ein „schöpferisches Hervorbringen“59, ein „Sich-Verstehen vor dem Text“60 und keine bloßes Wiederholung - Satz für Satz - noch ein schlichtes, wortwörtliches Übersetzen.
Meine These soll zu einem konkreten Erleben führen: Aha! – das wollte Paulus: einen Sieg über das (männliche) Siegen-müssen. Das ist zwar eine ironisch gedeichselte Formulierung, aber sie leuchtet mir ein. So habe ich ihn ja noch nie gelesen und verstanden.
So wird Paulus für mich diskutierbar. Und das ist auch gut so. Denn Paulus ist 1. von Beginn an umstritten61. Er war keinesweg unangefochten62. Und manchmal ist Paulus auch nicht mehr zu retten63. Das machen seine Briefe deutlich. Sie sind ja geradezu ein Zeugnis seines Umstrittenseins. Und um die inhaltlich-sachliche Mitte seiner theologischen Äußerungen herrscht 2. immer noch ein offener Streit64. Die Inhalte sind wir gewohnt zu hören, aber sie sind uns fremd. Und auch an ihre Fremdheit haben wir uns gewöhnt. Was haben sie mit unseren Problemen und Lebensumständen zu tun? Hinzu kommt 3. die aktuelle politische Großwetterlage als heutiger Verstehenshorizont für Paulus und die Entfaltung seiner Bedeutung. Selten zuvor haben Konflikte65 und die manifeste Erderwärmung den globalen Frieden derart massiv bedroht wie aktuell. Sämtliche Konfliktherde sind unverkennbare Beispiele männlichen Siegen-müssens. Das „Strickmuster“ hat sich seit zweitausend Jahren nicht geändert. Nur die Akteure sind seit den Römern andere. Machtausübung und Unterdrückung sind als Verhaltensmuster geblieben. Was aber seit Paulus deutlich und dramatisch anders ist, nennen wir die Globalisierung bzw. globale Phänomene, wie Erderwärmung und Klimawandel, Militarisierung, Ungleichbehandlung von Frauen und Männern, Hunger, Ausbeutung durch Billiglohn und prekäre Beschäftigung und unendliche Migrationsströme. Deshalb ist 4. noch der Frage nachzugehen, welche Impulse und Verstehenshilfen wir von Paulus hinsichtlich der Zufälligkeit, den Verstrickungen und vorhandenen und politisch gewollten Chancen(un)gleichheiten unseres eigenen Lebens erhalten.
Ich fasse überleitend mit einem Zitat zusammen und formuliere, was jetzt ansteht: "Eine Neuentdeckung des Paulus ist fällig!"66
1 W. R. Inge; ST. PAUL (1914): „Among all the great men of antiquity there is none, with the exception of Cicero, whom we may know so intimately as Saul of Tarsus.“
2 Otto Kuss; Die Rolle des Apostels Paulus in der theologischen Entwicklung der Urkirche. In: MthZ 14 (1963), S. 45: „Zur Fremdheit des Apostels Paulus gehört wesentlich, daß seine Probleme weitgehend nicht mehr die unseren sind.“
3 So Rolf Spinnler in: Die Zeit Nr. 52 vom 17. Dezember 2008, S. 54 – 55.
4 Gerd Theißen; Die Religion der ersten Christen, S. 295. Ebenso: Maximilian Paynter; Das Evangelium bei Paulus als Kommunikationskonzeption, S. 218.
5 Jacob Taubes; Die Politische Theologie des Paulus, S. 38.
6 Ton Verkamp; Die Welt anders. Poltische Geschichte der Großen Erzählung, S. 272.
7 So Claudia Janssen: „Zu den Denkmustern des christlichen Antijudaismus gehört es, dass der Opferkult am Jerusalemer Tempel und dessen theologische Grundlegungen durch Jesu Botschaft und die Schriften des Paulus als überwunden und abgelöst dargestellt werden. Für Paulus und auch für die Evangelien lässt sich jedoch zeigen, dass sie an der Theologie und Praxis des Opferkultes festhielten – mit Kritik, wie sie auch schon Israels Prophetie übt, einer Kritik, die von einer grundlegenden Bejahung ausgeht.“ (Quelle: https://www.ev-akademie-boll.de/fileadmin/res/otg/doku/640611_Janssen.pdf).
8 Ton Verkamp; Die Welt anders. Poltische Geschichte der Großen Erzählung, S. 272.
9 Das ist die Selbstbeschreibung des Paulus in Gal 1, 14: „ζηλωτὴς“.
10 So Lukas Bormann; Autobiographische Fiktionalität bei Paulus. In: Eve-Marie Becker & Peter Pilhofer (Hrsg.); Biographie und Persönlichkeit des Paulus, S.124: „Die Christusimagination ermöglicht Paulus einen radikalen -Diskurs über die Autonomie des autobiographischen Ichs.“
11 Ebd.
12 Gerd Theißen: Predigt über Apg 9,1-9 im Universitätsgottesdienst am 22. August 2010 in der Peterskirche Heidelberg. Quelle: https://www.theologie.uni-heidelberg.de/universitaetsgottesdienste/2208_ssf2010.html
13 Vgl. Rolf Kaufmann; Die Krise des Tüchtigen - Paulus und wir im Verständnis der Tiefenpsychologie
14 Jacob Taubes; Die Politische Theologie des Paulus, S. 38.
15 David Nirenberg; Anti-Judaismus. Eine andere Geschichte des westlichen Denkens, S. 62.
16 Klaus Berger; Paulus, S. 37.
17 Paul-Gerhard Klumbies; Studien zur paulinischen Theologie, S. 10: „den typischen Übereifer des Konvertiten“.
18 Gerd Theißen: Predigt über Apg 9,1-9 im Universitätsgottesdienst am 22. August 2010 in der Peterskirche Heidelberg. Quelle: https://www.theologie.uni-heidelberg.de/universitaetsgottesdienste/2208_ssf2010.html
19 Alexander J. M. Wedderburn; Eine neue Paulusperspektive? In: Eve-Marie Becker & Peter Pilhofer (Hrsg.); Biographie und Persönlichkeit des Paulus, S. 64. Und G. Theißen; Die Religion der ersten Christen, S. 295.
20 Klaus Berger; Paulus, S. 37-43.
21 Anna Maria Schwemmer; Verfolger und Verfolgte bei Paulus. In: Eve-Marie Becker & Peter Pilhofer (Hrsg.); Biographie und Persönlichkeit des Paulus,S. 170: CA 28,21; BSLK 124,9.
22 Pier Paolo Pasolini, „Da ‚ll caos’ sul ‚Tempo’’, 112.
23 Udo Schnelle; Paulus. Leben und Denken, S. 95 und 132.
24 Vgl. Gerd Lüdemann; Paulus, der Gründer des Christentums. zu Klampen Verlag, Lüneburg 2001, S. 245 und 221.
25 Vgl. Christof Landmesser; Umstrittener Paulus: Die gegenwärtige Diskussion um die paulinische Theologie in: Zeitschrift für Theologie und Kirche 105 (2008), No.4 , S. 387 - 410.
26 Rolf Spinnler in: Die Zeit Nr. 52 vom 17. Dezember 2008, S. 54.
27 Ebd.
28 Sehr gut beschrieben wird diese Haltung in Bernhard von Mutius; Disruptive Thinking. Das Denken, das der Zukunft gewachsen ist. 2017, S. 25: „Du kannst spielerisch sein, freundlich sein, charmant sein und viel Spaß haben. Aber du musst gewinnen. Am besten triumphal.“
29 Christa Wolf; Kassandra, S. 132.
30 Es gibt auch Exegetinnen wie Luise Schottroff, Marlene Crüsemann, Claudia Jansen – nur im deutschsprachigen Raum.
31 Vgl. Gerd Lüdemann; Paulus, der Gründer des Christentums, S. 244: „Er ist der wahre Gründer des Christentums.“
32 Ekkehard W. Stegemann in: Neue Zürcher Zeitung, 21.11.2001.
33 Ebd.
35 So Fik Meijer; Paulus: Der letzte Apostel. Biographie. 2015.
36 So lautet die Zusammenfassung gegenwärtiger türkisch-islamischer Paulusdeutungen in: Tobias Specker; Paulus von Tarsus, Architekt des Christentums? Islamischen Deutungen und christliche Reaktionen, S. 121-122.
38 Vgl. G. Theißen; Der Römerbrief, S. 58.
39 Vgl. W. Wrede; Paulus, S. 102.
40 Von A. Schweitzer bis Eugen Biser, Richard Rohr und Sabine Bieberstein.
41 So Albert Schweitzer; Die Mystik des Paulus, S. 366.
42 Gegen diese These der liberalen Theologie schrieb Albert Schweitzer 1911 sein Buch: „Geschichte der Paulinischen Forschung von der Reformation bis auf die Gegenwart“.
43 Vgl. Ralf Krause / Marc Rölli (Hrsg.); Macht. Begriff und Wirkung in der politischen Philosophie der Gegenwart. Oder: Han, Byung--Chul; Was ist Macht? , Stuttgart: Reclam 2005.
44 Jacob Taubes; Die Politische Theologie des Paulus, S. 27.
45 Ebd.
46 Ebd. Völlig entgegengesetzt Michael Wolter; Paulus. Ein Grundriss seiner Theologie, S. 53: „Dass der Begriff ‚Evangelium‘ in der hellenistischen Herrscherverehrung eine ‚zentrale‘ Rolle spielt und Paulus mit ihm ‚bewußt eine politisch-religiöse Sematik (verwendet)‘, kann man getrost ausschließen.“ D iese Breitseite galt U. Schnelle; Paulus. Leben und Denken, Berlin 2. Überarbeitete und erweiterte Auflage 2014, S. 437: „Nicht das Erscheinen des Kaisers rettet, sondern der vom Himmel kommende Gottessohn (1 Thess 1. 9f).“
47 Achille Mbembe (2011) Nekropolitik. In: Pieper M., Atzert T., Karakayalı S., Tsianos V. (eds) Biopolitik – in der Debatte. VS Verlag für Sozialwissenschaften. Und Timo Dorsch; Nekropolitik. In: FR vom 18.2.2021, S. 3.
48 Ebd.
49 Vgl. Timo Dorsch; Nekropolitik. In: FR vom 18.2.2021, S. 3.
50 Ekkehard Stegemann in einem Interview: „Paulus ist nur als Apokalyptiker zu verstehen.“ Quelle: https://reformiert.info/de/schwerpunkt/lmanchmalkann-auch-ich-paulus-nicht-rettenr-16063.htmlUnd Martin Hengel; Paulus und Jakobus. Kleine Schriften III, S. 343.
51 David Nirenberg; Anti-Judaismus. Eine andere Geschichte des westlichen Denkens, S. 64.
52 Martin Hengel; Paulus und Jakobus. Kleine Schriften III, S. 364.
53 Übersetzung von Luise Schottroff in BigS.
54 Schon für die Athener waren die Inhalte der Predigt des Paulus neuartige und befremdlich. So Knut Backhaus in Quelle: https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/areopagrede/ch/856b39cbc9753e2951f0df3fd42c24ff/
55 Paul Ricoeur; Eine intellektuelle Autobiografie. In: ders.; Vom Text zur Person Hermeneutische Aufsätze (1970 – 1999), S. 50. Und Paul Ricoeur; Philosophische und theologische Hermeneutik. In: Ricoeur & Jüngel; Metapher. 1974, S. 33.
56 Paul Ricoeur; Philosophische und theologische Hermeneutik. In: Ricoeur & Jüngel; Metapher, S. 32.
57 Ebd., S. 32.
58 Quelle: https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/bibelauslegung-christliche/ch/803dd0c154bdcda04ae822f361ae8d63/
59 Ulrich H. J. Körtner; Einführung in die theologische Hermeneutik, S. 18.
60 Paul Ricoeur; Philosophische und theologische Hermeneutik. In: Ricoeur & Jüngel; Metapher, S. 33.
61 Vgl. Georg Eichholz; Die Theologie des Paulus im Umriss. 1972, S. 3 – 7. Und aktuell: Christof Landmesser; Umstrittener Paulus. Die gegenwärtige Diskussion um die paulinische Theologie. In: Zeitschrift für Theologie und Kirche 105 (2008), S. 387-410. Und aus feministischer Perspektive: Janssen, Claudia, Schottroff, Luise, u. Beate Wehn Hrsg.); Paulus. Umstrittene Traditio-nen - lebendige Theologie. Eine feministische Lektüre 2001.
62 Vgl. Luzia Sutter Rehmann; Die aktuelle feministische Exegese der Paulinischen Briefe. Ein Überblick. In: Janssen, Claudia, Schottroff, Luise, u. Beate Wehn Hrsg.); Paulus. Umstrittene Traditionen - lebendige Theologie. Eine feministische Lektüre 2001, S. 12.
63 So der Paulusforscher Ekkehard Stegemann. In: reformiert. Quelle: https://reformiert.info/de/schwerpunkt/lmanchmal-kann-auch-ich-paulusnicht-rettenr-16063.html
64 Von Hans Conzelmann; Paulus und die Weisheit. In: NTS 12 (1965/66, S. 231 – 244 bis Marlene Crüsemann; Gott ist Beziehung: Beiträge zur biblischen Rede von Gott. 2014.
65 So die FR vom 14. August 2019 mit dem Artikel: „Die 7 Weltwunden“, S. 23: Iran:
Atomare Gefahr
USA-Russland-China: Globales Wettrüsten
Libyen/Syrien/Afghanistan: Endloser Bürgerkrieg
Türkei: Erdogan und die Kurden
Südchinesisches Meer: Wichtige Handelsroute
Ukraine: Heute ist Krieg durch Putins Überfall auf Ukraine am 24. Februar 2022.
Indien-Pakistan: Alte, neue Feinde
66 Janssen, Claudia, Schottroff, Luise, u. Beate Wehn [Hrsg.); Paulus. Umstrittene Traditionen - lebendige Theologie. Eine feministische Lektüre, S. 7.
1.2. „Paulus“ – das ist ein Konzept
Um nicht gleich in die Irre zu gehen, ist es notwendig, sich zu verdeutlichen, dass für uns und unser spontanes Verständnis Paulus zunächst nicht eine Person darstellt, sondern das, was wir wissenschaftstheoretisch ein Konzept nennen. Ein Konzept hilft „logische Strukturen zu schaffen, um am Ende eine fundierte Bewertung des Untersuchungsgegenstandes vornehmen zu können“67. Insofern ist:
„‘Paulus‘ – ein Konzept.“68
Wenn wir „Paulus“ hören, sind für unseren Ohren folgende Implikationen wie selbstverständlich mitgegeben: „Der Apostel ist systematischer Theologe, er ist Identifikationsfigur für den Interpreten und den protestantischen Pfarrer, er ist männlichen Geschlechtes und hat gegenüber seinen Gegnern immer recht.“69 Das ist nicht Paulus, sondern unser gewohntes Bild von Paulus. „Paulus“ ist zunächst ein Konzept. Es geht um die Brille, durch die wir Paulus zu verstehen gewohnt sind. Es geht um unsere Sehgewohnheit, Hörgewohnheit und Interpretationsgewohnheit. Zu kritisieren ist unsere „Vereinnahmung des jüdischen Mannes Paulus durch die christliche, antijudaistische Auslegung, die sich am Patriarchat als dem einzig legitimen gesellschaftlichen Organisationsmodell orientiert“70. Wir sollten uns in Erinnerung rufen, was für jedes „Paulus“-Konzept von entscheidender Bedeutung sein dürfte:
Wie wird das Verhältnis zwischen Paulus und den Gemeinden gesehen?