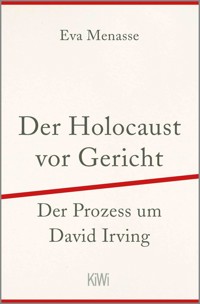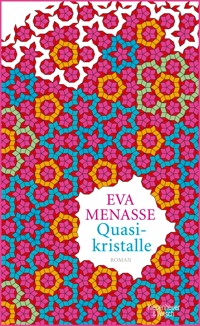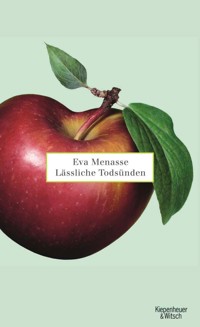11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jeder schweigt von etwas anderem. Auf den ersten Blick ist Dunkelblum eine Kleinstadt wie jede andere. Doch hinter der Fassade der österreichischen Gemeinde verbirgt sich die Geschichte eines furchtbaren Verbrechens. Ihr Wissen um das Ereignis verbindet die älteren Dunkelblumer seit Jahrzehnten – genauso wie ihr Schweigen über Tat und Täter. In den Spätsommertagen des Jahres 1989, während hinter der nahegelegenen Grenze zu Ungarn bereits Hunderte DDR-Flüchtlinge warten, trifft ein rätselhafter Besucher in der Stadt ein. Da geraten die Dinge plötzlich in Bewegung: Auf einer Wiese am Stadtrand wird ein Skelett ausgegraben und eine junge Frau verschwindet. Wie in einem Spuk tauchen Spuren des alten Verbrechens auf – und konfrontieren die Dunkelblumer mit einer Vergangenheit, die sie längst für erledigt hielten. In ihrem neuen Roman entwirft Eva Menasse ein großes Geschichtspanorama am Beispiel einer kleinen Stadt, die immer wieder zum Schauplatz der Weltpolitik wird, und erzählt vom Umgang der Bewohner mit einer historischen Schuld. »Dunkelblum« ist ein schaurig-komisches Epos über die Wunden in der Landschaft und den Seelen der Menschen, die, anders als die Erinnerung, nicht vergehen. »Die ganze Wahrheit wird, wie der Name schon sagt, von allen Beteiligten gemeinsam gewusst. Deshalb kriegt man sie nachher nie mehr richtig zusammen. Denn von jenen, die ein Stück von ihr besessen haben, sind dann immer gleich ein paar schon tot. Oder sie lügen, oder sie haben ein schlechtes Gedächtnis.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 653
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Eva Menasse
Dunkelblum
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Eva Menasse
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Eva Menasse
Eva Menasse, geboren 1970 in Wien, begann als Journalistin und debütierte im Jahr 2005 mit dem Familienroman »Vienna«. Es folgten Romane und Erzählungen (»Lässliche Todsünden«, »Quasikristalle«, »Tiere für Fortgeschrittene«), die vielfach ausgezeichnet und übersetzt wurden. Preise (Auswahl): Heinrich-Böll-Preis, Friedrich-Hölderlin-Preis, Jonathan- Swift-Preis, Österreichischer Buchpreis, Mainzer Stadtschreiber-Preis und das Villa-Massimo-Stipendium in Rom. Eva Menasse betätigt sich zunehmend auch als Essayistin und erhielt dafür 2019 den Ludwig-Börne-Preis. Sie lebt seit über 20 Jahren in Berlin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Auf den ersten Blick ist Dunkelblum eine Kleinstadt wie jede andere. Doch hinter der Fassade der österreichischen Gemeinde verbirgt sich die Geschichte eines furchtbaren Verbrechens. Ihr Wissen um das Ereignis verbindet die älteren Dunkelblumer seit Jahrzehnten – genauso wie ihr Schweigen über Tat und Täter.
In den Spätsommertagen des Jahres 1989, als der Eiserne Vorhang erste Risse bekommt, wird es auch in Dunkelblum, direkt an der ungarischen Grenze, unruhig. Plötzlich legen Studenten aus der Hauptstadt den fast vergessenen jüdischen Friedhof frei, stellt ein Tourist unangenehme Fragen, zetteln ein paar Bauern einen Aufstand gegen den überforderten Bürgermeister an. Die Betriebsamkeit stört das alte Geheimnis auf, das sich zu erheben scheint wie ein Gespenst. »Dunkelblum« ist ein schaurig-komisches Epos über die Wunden in der Landschaft und den Seelen der Menschen, die, anders als die Erinnerung, nicht vergehen.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2021, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © the lightwriter/Alamy Stock Foto
Vor-und Nachsatz: Illustration von Nikolaus Heidelbach
ISBN978-3-462-30358-2
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses Zusatzmaterial ist auch auf unserer Homepage zu finden:
www.kiwi-verlag.de/magazin/extras/karte-zu-dunkelblum
Inhaltsverzeichnis
Hinweis
Widmung
I. Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
II. Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
III. Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Dank
Glossar der Austriazismen
Figurenverzeichnis
Die Arbeit an diesem Roman wurde vom Deutschen Literaturfonds e.V. gefördert.
für Laszlo
I. Teil
Die Österreicher sind ein Volk, das mit Zuversicht in die Vergangenheit blickt.
Redensart[*]
1.
In Dunkelblum haben die Mauern Ohren, die Blüten in den Gärten haben Augen, sie drehen ihre Köpfchen hierhin und dorthin, damit ihnen nichts entgeht, und das Gras registriert mit seinen Schnurrhaaren jeden Schritt. Die Menschen haben immerzu ein Gespür. Die Vorhänge im Ort bewegen sich wie von leisem Atem getrieben, ein und aus, lebensnotwendig. Jedes Mal, wenn Gott von oben in diese Häuser schaut, als hätten sie gar keine Dächer, wenn er hineinblickt in die Puppenhäuser seines Modellstädtchens, das er zusammen mit dem Teufel gebaut hat zur Mahnung an alle, dann sieht er in fast jedem Haus welche, die an den Fenstern hinter ihren Vorhängen stehen und hinausspähen. Manchmal, oft, stehen auch zwei oder sogar drei im selben Haus an den Fenstern, in verschiedenen Räumen und voreinander verborgen. Man wünschte Gott, dass er nur in die Häuser sehen könnte und nicht in die Herzen.
In Dunkelblum wissen die Einheimischen alles voneinander, und die paar Winzigkeiten, die sie nicht wissen, die sie nicht hinzuerfinden können und auch nicht einfach weglassen, die sind nicht egal, sondern spielen die allergrößte Rolle: Das, was nicht allseits bekannt ist, regiert wie ein Fluch. Die anderen, die Zugezogenen und die Eingeheirateten, wissen nicht viel. Sie wissen, dass das Schloss abgebrannt ist, dass die Nachkommen der Grafen jetzt in verschiedenen, weit entfernten Ländern leben, zum Heiraten und zum Taufen aber üblicherweise zurückkommen, woraufhin es große Feste gibt für den ganzen Ort. Die Kinder holen aus den Bauerngärten Blumen und winden Girlanden, die alten Frauen kramen ihre hundertjährigen Trachten heraus, und alle stellen sich entlang der Herrengasse auf und winken. Mit nadelspitzem Lächeln nehmen die ausländischen Bräute wahr, dass hier, trotz der vor Langem erfolgten republikanischen Übernahme, noch auf die Untertanen Verlass ist, zumindest alle heiligen Zeiten einmal.
Begraben lassen sich die Grafen allerdings schon lange nicht mehr hier. Die Gruft kann besichtigt werden, doch sie wird nicht mehr belegt. Zwar hat man die Grafen zwanzig Jahre nach dem Krieg erst unter Hinweis auf die undichte Familiengruft überhaupt wieder nach Dunkelblum gelockt. Unmittelbar nach dem Krieg dagegen hatte man sie – wer genau, ist unbekannt – mit erstaunlicher diplomatischer Kunst ferngehalten: Die Nachrichten, die man zum Zustand der Brandruine übermittelte, waren stark übertrieben. Abreißen, leider, alles abreißen, lautete der mit Tränen und Erschütterung vorgetragene Befund, und die kurz zuvor verwitwete Gräfin im Exil glaubte ihren ehemaligen Verwaltern und Pächtern und Sekretärinnen und Zofen oder wer immer dahintersteckte oder wer immer weitertrug, was er vom Hörensagen wusste oder zu sagen gezwungen worden war. Vielleicht wollte die Gräfin es glauben. Für einen Lokalaugenschein war sie zu faul oder zu feige, für ein Gutachten zu wenig flüssig. Und so wurde das Schloss abgerissen und eine gigantische Menge an bestem Baugrund wurde frei, in einer vormals unerreichbaren, zentralen Lage. Irgendjemand musste damals davon profitiert haben, denn jemand profitiert immer. Seither ist der Ortskern von Dunkelblum baulich und atmosphärisch zweigeteilt: in die jahrhundertealte, bäuerlich-verwinkelte Hälfte, weiß gekalkt und mit blauen oder grünen Fensterläden, und in die andere, schauerlich zweckmäßige, Blech und Silikon, praktisch und abwaschbar, so wie man damals, zur Zeit des Wiederaufbaus, auch innerlich gern gewesen wäre.
Zurück auf Stippvisite kam also, zwanzig Jahre später, der leutselige älteste Sohn der Gräfin, dem man vieles nachsagen konnte, nur nicht, dass er sentimental gewesen wäre. Die Vorfahren safteln!, trompetete er, ließ die Gruft öffnen und abdichten, was dort abzudichten war. Dann segnete der Herr Pfarrer alles mit Nachdruck für die Ewigkeit ein, und die Gruft wurde wieder geschlossen. Damals soll es noch Dunkelblumerinnen gegeben haben, die Durchlaucht nach der Zeremonie die Hand küssten, knicksend. Der Ferbenz hingegen hat genau zur gleichen Zeit einen allgemeinen Frühschoppen im Café Posauner plakatieren lassen. Aber diesem Spaltungsversuch war kein Erfolg beschieden: Wenn der Graf und der Pfarrer riefen, wussten die meisten, was sich gehörte, auch wenn man ansonsten mehrheitlich der Meinung vom Ferbenz war. Der Graf ging vor. Er war ja so selten da. Und so saß der Ferbenz mit dem harten Kern seiner Getreuen im Café Posauner und sie tranken sich die Nasen rot, und obwohl es aussah wie eine Niederlage, wusste jeder von ihnen, dass sie alle sich für immer merken würden, wer da gewesen, und vor allem, wer nicht da gewesen war; und wer von den Anwesenden einen Stiernacken hatte – das waren die meisten –, dem rötete er sich bereits vor Vorfreude, weil mit der Abreise des Grafen die Machtverhältnisse in Dunkelblum schon bald wiederhergestellt sein würden.
Seit die Grafen ihre Gruft ver- und damit ihren Exodus besiegelt hatten, war die Zeit im Grunde stehengeblieben. Zwar wechselten die Jahreszeiten und Rocklängen, und die Fernsehprogramme wurden bunter und mehr. Die Dunkelblumer alterten regulär vor sich hin, aber weil sie reichlich tranken, bemerkte man ihr Altern lange kaum, die Äuglein blitzend, die Wangen rosenrot, bis Freund Flüssigmut und -trost schließlich schnell und erbarmungslos zuschlug. Er war ein Profikiller: Der, den er sich aussuchte, begann morgens beim Aufstehen bloß ein bisschen zu husten, beim Frühstück spuckte er die erste von den vielen, immer schneller aufeinanderfolgenden Portionen Blut und nach höchstens einer Viertelstunde und einer beeindruckenden Sauerei, die den Hinterbliebenen zwar hinterblieb, aber so gut wie nie zur Mahnung gereichte, war die Angelegenheit auch schon vorüber. Fritz, der Dodl, der sich über jeden Auftrag freute wie ein Kind, wurde verständigt und nahm am selben Tag in seiner Werkstatt Maß an den schönen Eichenbrettern, um das sogenannte Holzpyjama zu tischlern. Dazu pfiff er einen Ragtime.
Die Trinker, denen das bisher noch nicht passiert war, hielten es daher auch nicht für wahrscheinlich. Seit Jahrzehnten saß Ferbenz mit den Heuraffl-Brüdern, mit Berneck, dem geflickten Schurl und dem jungen Graun entweder im Café Posauner oder in der mit Bauernkeramik und geflochtenem Stroh verschandelten Jugendstilbar des einst so eleganten Hotel Tüffer, erklärte seinen Mittrinkern Welt und Geschichte und intrigierte so lange gegen den jeweiligen Bürgermeister, den Sparkassendirektor oder den Fremdenverkehrsobmann, bis einer davon zur Tür hereinkam, zwei Runden zahlte und Ferbenz’ unumschränkter Unterstützung versichert wurde. Dabei trank Ferbenz selbst wenig, tat aber mit großem Geschick als ob. Er wusste in jeder Lebenslage, wie man unbeschadet davonkam.
Nur zwei Ecken vom Tüffer entfernt, in der Tempelgasse 4, räumte Antal Grün unermüdlich wie eine Ameise in seinem Greißlerladen herum. Er war Nichttrinker und hielt aus Erfahrung vieles für möglich, obwohl er nie darüber sprach. Drei sehr fadenscheinige Grausträhnen von der rechten Schläfe quer über den Kugelkopf bis übers Ohr gekämmt und in seinem blauen Arbeitsmantel, packte er frische Ware aus und abgelaufene Ware wieder ein, zerrte Kartons und Kisten von da nach dort, belegte Semmeln für das Dutzend Schulkinder, deren Eltern sich solchen Luxus leisten konnten und aus Angeberei auch leisten wollten, las älteren Damen zuvorkommend das Kleingedruckte auf den Bauchbinden der Wollknäuel vor (20 Prozent Dralon, 80 Prozent Polyacryl, nein, meine Werteste, das scheint ganz ohne Baumwolle zu sein) und zog besonders gern eine neue Papierrolle in seine Registrierkassa ein. Jedes Mal staunte er, dass es wieder klappte. Jedes Mal stellte er sich besorgt vor, dass der Mechanismus versagen und das Papier sich kräuseln, es nicht aufgenommen, sondern abgewiesen, ja ausgespien werden könnte. Diese Vorstellung jagte ihm kaltes Unbehagen ein. Wenn er sich darein verbohrte, musste er sich zur Ablenkung ausführlich die Hände waschen gehen. Und erst, wenn wirklich gar nichts mehr zu tun war, wenn die Papierrolle dick und neu, jedes Regal gefüllt, der Steinfußboden gekehrt war, dann erst drehte er nachdenklich an dem neumodischen Metallständer mit den Zeitungen und Postkarten, den er sich kürzlich von einem dubiosen Vertreter mit ausländischem Akzent aufschwatzen hatte lassen und in dem nun, irgendwie merkwürdig, sogar historische Fotografien des Dunkelblumer Schlosses angeboten wurden, nachkoloriert.
Der praktische Arzt Doktor Sterkowitz dagegen trank schon, aber mäßig, und auch nur, weil man das hier so machte. Woanders hätte er Kautabak gekaut oder Zuckerbällchen gegessen, er legte auf ein harmonisches Miteinander mehr Wert als in Dunkelblum üblich. Sterkowitz saß fast immer im Auto, derzeit einem protzorangenen japanischen Modell, und machte Hausbesuche. Er beharrte darauf, dass Hausbesuche ihm selbst mehr Flexibilität schenkten, weil er die, die ohnehin nicht sehr krank oder überwiegend hypochondrisch waren, einfach auslassen konnte, falls er bei den Bettlägerigen länger brauchte. Die Sprechstunden, die er trotz seines Hausbesuch-Services drei Vormittage lang abzuhalten gezwungen war, verliefen daher noch chaotischer, als sie es schon mit regulärer Zeiteinteilung gewesen wären. Impfkinder plärrten, fiebrige Alte kollabierten und mehr als einmal fing er eine beidseitige Lungenentzündung im letzten Moment mit einem antibiotischen Breitbandcocktail ab, weil selbst nach Jahrzehnten nicht alle wussten, dass Doktor Sterkowitz grundsätzlich und nicht bloß im Notfall ins Haus kam, oder weil sie lieber selbst kamen, als vor ihren halbfertigen Bungalows oder ihren abgetakelten Bauernhöfen das protzige Gefährt vorfahren zu sehen. Sterkowitz ließ sich von seinem Servicekonzept nicht abbringen. Die Wahrheit war, dass er einfach gern unterwegs war. Vielleicht fuhr er auch so gern Auto, weil er sich besonders ungern in geschlossenen Räumen aufhielt, wer weiß. Wo er hinkam, riss er die Fenster auf. Ihr müssts atmen, schimpfte er, die Kranken brauchen frische Luft, man erstickt schneller, als dass man erfriert. Aber hier bei uns scheinen alle am liebsten in ihrem Mief zu brodeln!
Doktor Sterkowitz war inzwischen etliche Jährchen über das reguläre Pensionsalter hinaus, aber bisher war das kein Problem gewesen. Er fühlte sich fit, seine Werte waren ordentlich, und die entsprechenden paar Jährchen zuvor war ja der orangene Honda erst neu geliefert worden. Das wäre schade gewesen. Wohin hätte er damit fahren sollen als zu seinen Patienten? Doch langsam begann er zu warten, auf den sogenannten Lebensabend und die Ablöse, die ihm von der Krankenkasse versprochen worden war. Und nun fiel ihm gelegentlich sein Vorgänger ein, wie der damals auf ihn gewartet haben mochte.
Die stehengebliebene Zeit: Weil die Menschen, anders als die Tiere, immer etwas tun müssen, und sei es, an ihren Behausungen herumzubauen, verschaffen sie sich das offenbar lebenswichtige Gefühl, mit der Zeit zu gehen. Das glaubten naturgemäß auch die Dunkelblumer. In Wahrheit aber wurden sie endlich einmal in Frieden gelassen, abgehängt und an den Rand gedrängt, wie sie waren. Ihre lokale Schicksalsbestie, die, wenn sie sich zu bewegen begann, Tod und Verderben brachte, die nicht nur die Menschen, sondern auch die Moral vernichtete auf Jahrzehnte – sie lag schon so lange im Dornröschenschlaf, dass man sie langsam zu vergessen begann. Sie schien für immer erledigt. Sie war nun tatsächlich mit Näglein besteckt, mit solchen aus Metall, nicht mit den Gewürznelkchen aus dem schönen alten Lied. Unbeweglich lag der mörderische Lindwurm in einem Bett aus Beton und Stacheldraht, und das Welttheater fand woanders statt. Das letzte Mal, als man den tödlichen Wurm gespürt hatte, war es im Grunde ein langes Seufzen gewesen, ein tiefes, kummervolles Ausatmen wie in einem schweren Traum. So schien es jedenfalls im Rückblick, aber damals, bei diesem einen, bisher letzten Mal, hatte eine Dunkelblumerin einen spektakulären Zusammenbruch erlitten. Nachdem Agnes Kalmar Anfang November 1956 im Radio die Nachrichten gehört hatte, raffte sie schreiend und weinend eine Decke und ein paar Lebensmittel zusammen und lief mit diesem Bündel bloßfüßig durch den ganzen Ort und in den Wald Richtung Kalsching hinein. Viele hatten sie vorbeirennen sehen, niemand hatte die richtigen Schlüsse gezogen. Manche vermuteten, ihrem Sohn, dem Fritz, sei wieder etwas zugestoßen – beim sogenannten Endkampf um Dunkelblum hatte das Kleinkind einen Kopfschuss bekommen und galt seither als Dodl –, aber der Vierzehnjährige war damals schon beim Tischler in der Lehre und erwähnte das Fehlen seiner Mutter erst am nächsten Tag. Es dauerte weitere zwei Tage, bis Agnes gefunden wurde. Unterkühlt, zerrauft, hexenhaft mit blauen Lippen und Zähnen von den Heidelbeeren zerrte man sie aus dem Wald, sie schrie und wehrte sich und kam in eine weit entfernte Klinik, wo sie blieb, bis wieder Ruhe eingekehrt war. Damals lernte Fritz, sich mehr schlecht als recht selbst zu versorgen, und alle, die ihn kannten, waren darüber erleichtert. Gerade damals, ohne seine Mutter und trotz der Unruhe im Ort, offenbarte sich zum ersten Mal sein freundliches, hilfsbereites Wesen. Nach Feierabend tauchte er in der alten Volksschule auf, die provisorisch zum Bettenlager für die Flüchtlinge umgewandelt worden war, und ging jeden Abend dem Doktor Sterkowitz und Antal Grün zur Hand, als Laufbursche, Träger oder indem er kleine Reparaturen durchführte. Ohne sich abgesprochen, ja eigentlich ohne sich die eigene Entscheidung je bewusst gemacht zu haben, übernahmen der Arzt und der Greißler die ganze Organisation. Sie schufteten bis an den Rand ihrer Kräfte. Fritz war fast immer dabei. Er brachte ihnen spätnachts einen Topf Suppe, den man ihm für die beiden aufgenötigt hatte, er holte Zigaretten und schenkte den Menschen auf den Matratzen bitteren Thermoskannen-Kaffee aus. Das ging wochenlang. Aber als er im Jänner von seinem Lehrherrn, dem Tischler, zum ersten Mal gezeigt bekam, wie man einen Sarg baut, schien Fritz den Zusammenhang zu der erfrorenen jungen Frau gar nicht herzustellen, die er selbst in der Nacht zuvor auf einer Bahre bergen hatte helfen.
Das war, wie gesagt, das letzte Mal, dass sich das schlangenförmige Untier geregt hatte, traumverloren seufzend, dieses Monster mit den vielen Namen, határ, meja, hranica, die alle zu harmlos sind, weil keiner das Feuer und das Gift anklingen lässt, die fatale Mischung aus vergangenen Verbrechen, Vorahnungen, Zukunftsängsten, Hysterie. Nur eines ist sicher: Etwas Gutes ist noch nie von ihr gekommen, von der Grenze.
2.
Zweiunddreißig Jahre und ein paar Monate, nachdem Fritz geholfen hatte, die tote Frau aus einer Schneewehe zu tragen, nahm ein Mann den Postbus nach Dunkelblum. Es war ein heißer Tag Anfang August. Dieser Mann wollte ankommen wie ein Fremder, er wünschte sich den unvoreingenommenen Blick. Doch Dunkelblum ist gut darin, jeden mit Tachteln auf den Hinterkopf gleich so zu bearbeiten, dass er in die alten Rinnen fällt, bäuchlings in die Pfützen der eigenen schlammigen Vorurteile. Und so jubelte ein boshafter Zufall dem Mann die Regionalausgabe einer Tageszeitung unter, die er gelangweilt durchblätterte, eine Tätigkeit, die den Fingern mehr abverlangte als dem Kopf. Draußen Felder bis zum Horizont, regelmäßige farbige Querstreifen, grün-gold-grün-gold-grün-blau, bis auf die Pappelalleen am Bildrand alles schnürlgerade, Kinderbuchästhetik. Topographisch würde es abwechslungsreicher werden, sobald Kirschenstein passiert war. Dass sich die Landschaft erhob, sich zumindest vom Bauch auf die Knie rappelte, würde erst ganz zuletzt geschehen. Erst kurz vor Dunkelblum hat sich die Erdkruste ein bisschen aufgeschoppt, vor unvordenklichen Zeiten. Sie hat damals etwas gebildet, was die Dunkelblumer hochgemut Berg nennen. Die Feldfarben draußen wechselten sich regelmäßig ab, der Himmelsstreifen blieb unbefleckt blau, ohne jedes bisschen Wolkenweiß. Der Reisende wurde schläfrig.
Ein Hitlergruß im Urlaub ist ein Reisemangel, der zur Preisminderung berechtigt, ein entferntes Badetuch aber nicht.
Was? Wie bitte? Gestatten, wie meinen? Ein Schreck, als wäre er dem Sturz in eine Schlucht gerade noch entgangen – dabei war es nur der schwere Kopf, der vornüberkippen wollte und vom letzten Rest Bewusstsein zurückgerissen wurde wie von einem wütenden Kutscher.
Der Postbus holperte über die Fugen der Fertigbetonteile, die eine Zeitlang so beliebt im Straßenbau waren und leider noch nicht gänzlich ausgetauscht werden konnten, genauso wenig wie die Asbestfasern, die noch überall drinstecken, genauso wenig wie die alten Nazis.
Der Abstand dieser Betonschwellen jedenfalls, in Verbindung mit der gemächlichen, der sprichwörtlich postbusmäßigen Geschwindigkeit, hatte in dem Reisenden einen hypnotisierenden Ohrwurmtakt erzeugt: Hitlergruß ist Reisemangel, Hitlergruß ist Reisemangel, hol-ter, hol-ter, hol-ter-pol-ter … so etwas soll es geben, wenn man seinen Kopf nicht jederzeit unter Kontrolle behält.
Was zum Teufel ist ein Hitlergruß im Urlaub? Die Zeitung war ihm beim Einschlafen vom Schoß gerutscht. Ringsum hatten sie schon ihre Bananen und Extrawurstsemmeln aus dem weiß marmorierten Butterbrotpapier, dem sprichwörtlichen Extrawurstpapier, zu wickeln begonnen. Wenigstens war bisher noch kein hartes Ei geschält worden und verbreitete seinen mephistophelischen Geruch.
Er nahm die Zeitung und blätterte sie durch. Den Hitlergruß hatte er sich bestimmt nicht eingebildet, der musste irgendwo dadrinnen sein. Aber jetzt versteckte er sich vor ihm, vermutlich, um ihn an seinem Verstand zweifeln zu lassen. Dabei wusste er schon lange: Zweifeln am Verstand ist überflüssiger Kraftaufwand. Das Zweifeln ebenso wie der feste Glauben daran. Keine Anstrengungen im Umgang mit dem Verstand, war seine Devise. Einfach ignorieren, das ist natürlicher Umgang.
Aber wo war er denn jetzt, der Hitlergruß? Nicht in der Politik, die aus kaum eineinhalb Doppelseiten bestand, nicht im Lokalteil – Feuerwehrfest in Kalsching, abgebrannter Stadel im benachbarten Ehrenfeld … ein merkwürdiger, von der Zeitung selbst weder hergestellter noch kommentierter Zusammenhang. Da hat die freiwillige Feuerwehr wohl zu viel gefeiert, aber auch Spaß muss sein, und die jungen Leute, die Tag für Tag mutig ihr Leben riskieren, wie die Bildunterschrift den Burschen mit den souveränen Säufernasen Hohn sprach, die haben bei ihrem verdienten Vergnügen, wie es im Festartikel hieß, nachts halt den Stadel geopfert, ein Lob auf die Alliteration und ein Scheiß auf den Stadel, soll er brennen, wer braucht ihn denn, wir sicher nicht. Schon folgte der Sport, fast üppiger als die Politik, dazwischen Werbung und Kleinanzeigen, Dragica bietet inspirierende Massage, als ob sie nicht wüsste, dass dabei etwas aus dem Körper rauswill und nichts in den Geist rein, Ilonka bietet geflegten Begleitservice, richtet der sich an Flegel, oder streicht der Druckfehler Erfahrungswerte hervor? Beim Unterrainerbauer beginnt am Sonntag der Ab-Hof-Verkauf, in der Sternsingergasse ein Kinderflohmarkt. Außerdem: der Heuraffl, der Graun und der Malnitz haben ausg’steckt, alles wie immer. Aber da, in der Rubrik Aus aller Welt: Hitlergruß im Urlaub ist Reisemangel; Unterzeile: Entfernen der Auflage einer Sonnenliege aber nicht. Ein Urlauber war mit seinem Urlaub nicht zufrieden gewesen, er hat ihn zwar tapfer bis zum Ende abgedient, die Sonne und das Buffet konsumiert, vermutlich unter bereits die Klage formulierendem inneren Protest. Innerer Protest gleich innere Emigration, nachher immer schwer zu beweisen. Aber von seinem guten Geld wollte er doch etwas zurück, uns schenkt ja aa kaner wos, net woahr, und welcher Trumpf sticht besser als politische Empfindlichkeit? Dass man ihm sein im Morgengrauen ausgebreitetes Handtuch weggeräumt und durch spießiges Frühaufstehen geglücktes Reservieren einer Sonnenliege in der ersten Reihe nicht anerkannt hat, ließen die Richter nicht gelten. Ließ die Richter sozusagen sonnenliegenkalt. Im Gegenteil: Da er angegeben hatte, erst nach dreißigminütiger Diskussion seine Sonnenliegenauflage zurückbekommen zu haben, bot sich den Richtern die Gelegenheit, mit einem Satz zu kontern, der den Zeitungsleser in gesundes Gelächter ausbrechen ließ, in eine Art sommerhellen Postbusjubel: Soweit der Kläger einen Mangel darin sieht, dass die Wegnahme der Auflage zu einer dreißigminütigen Diskussion geführt habe, ist zu berücksichtigen, dass eine Diskussion mindestens zwei Personen erfordert.
Die Köpfe der Bananenesser und Butterbrotpapierraschler drehten sich dem Mann zu und wieder von ihm weg, ruckartig. Kein Blick streifte ihn. Das Kopfruckeln war kritisch gemeint. Niemand von diesen alten Echsen wollte wissen, warum er lachte. Schon gar nicht wollten sie mitlachen. Zum Mitlachen haben sie keine Zeit. Nicht mit ihm. Das Kopfruckeln sollte heißen, dass sein Lachen bemerkt und missbilligt worden war. Was bei den Echsen fast das Gleiche bedeutet: Sobald sie etwas bemerken, missbilligen sie es. Aber damit hätten sie ruhig einmal früher anfangen sollen, sagen wir vor fünfzig Jahren …
Da hat er also Pech gehabt, unser Kläger. Jedoch, der Hitlergruß! Hier hat er seinen Stich gemacht. Von Klubanimateuren wurden kabarettistisch die typischen Begrüßungen der Nationen vorgeführt. Beim Beispiel Deutschland befleißigten sich die Animateure eines harten Stechschritts, rissen die Arme hoch und brüllten Heil! Da fühlt man sich als zahlender deutschsprachiger Gast nicht geschätzt und willkommen, das sah das Gericht genauso. Und gewährte dem Kläger eine Entschädigung in einer Höhe, für die er sich immerhin zwei bis drei gute Mittagessen in einem soliden Wirtshaus dieser Gegend leisten könnte, zu zweit, versteht sich, für sich und seine ebenfalls geschädigte Frau. Eine Entschädigung, die also keine spürbare Minderung des Preises darstellte, jedoch eine Anerkennung seiner gekränkten Gefühle.
Hätte der Besucher nur nicht weitergelesen! Hätte die kleine Meldung doch hier geendet! Er wäre amüsiert und besänftigt bis an sein Ziel geschaukelt, ein wenig verschwitzt von den Kunstledersitzen, Trotteln gibt’s überall, Hit-ler-gruß-ist-Rei-se-man-gel, er wäre vielleicht doch noch eingeschlafen, er hätte den Bananenessern Mitgefühl und den Butterbrotraschlern ein Lächeln geschenkt. Der junge Tag hätte sich harmlos und friedlich gestellt, aber genau das, seien wir ehrlich, sind die Tage eben nie, keiner von ihnen, also sollten wir es uns auch nicht vorgaukeln lassen. Die letzten Sätze der Meldung stachen aus dem trockenen Agenturduktus heraus, der Redakteur hatte sie selbst hinzugefügt. Die letzten Sätze lüfteten nicht nur unerwartet die Anonymität des Klägers, sondern lieferten dem Ortskundigen einen Schwall Subtext mit, wie eine Schlammlawine. Im Exklusivinterview mit unserer Zeitung drückte Dr. Alois F. seine Zufriedenheit über das ergangene Urteil aus. Um die Höhe der Rückzahlung sei es ihm nie gegangen, sondern darum, die Geschmacklosigkeiten der ägyptischen Animateure im Sinne zukünftiger Gäste zu unterbinden. Im Übrigen werde Dr. F. nach dieser Erfahrung in Zukunft auf kostspielige Fernreisen verzichten. Die Heimat sei schön genug.
Der Reisende knüllte eine Ecke der Zeitung in der Faust zusammen und sah sich aufgebracht um. Da wusste man wieder, wo man war. Auf dem Weg wohin. Wie zur Bestätigung kauten die anderen, stierten und raschelten. Ihm taten mit einem Mal die Knochen weh. Er unternahm keine Vergnügungsfahrt, sondern saß im fade schweißelnden Postbusdunst in eine Richtung, die er seit Jahrzehnten gemieden hatte. Demnächst würde der Bus in Kirschenstein halten, danach in Tellian, in Ehrenfeld, zuletzt in Zwick, das schon ein Ortsteil von Dunkelblum war. Und der Kläger in diesem Fall war kein hobbyjuristelnder, wegen seiner jahrelangen Zuckerkrankheit schwer gereizter Rentner aus Landshut oder Amstetten – auch bei einem solchen wäre es interessant zu wissen, was ihn an dem Hitlergruß gestört hätte! –, es war auch kein durch und durch bewältigt habender, friedensbewegter Familienvater aus der Achtundsechziger-Generation – der hätte peinvoll genickt und gemurmelt, recht geschieht uns –, nein, es war der notorische Doktor F. aus Dunkelblum. Er war es zweifellos, man hätte ihn gar nicht verschämt abkürzen müssen. Der war wohl noch stolz darauf, auf seinen symbolischen Sieg am weit entfernten Gerichtsstand München. Und den störte natürlich nicht der Hitlergruß an sich, sondern der Umstand, dass er von ägyptischen Animateuren ausgeübt worden war, in der Welt des Alois F. ein Synonym mindestens für schwule Falotten. Dem Redakteur aus der Lokalredaktion war das gewiss bewusst, das wusste hier jeder, bis an die nahegelegenen Landesgrenzen. Der Herr Doktor F., der war bekannt. Dagegen würde ein unbedarfter Leser aus der Hauptstadt oder aus einem anderen Bundesland gar nichts bemerken. Die Unbedarften wären gerührt zu hören, dass F., darauf jede Wette, die fast vierhundert Schilling Entschädigung einer frisch verwitweten jungen Mutter oder einem Rollstuhlfahrer, dessen fahrbarer Untersatz einer kostspieligen Reparatur bedurfte, gespendet hatte. Denn auch für seine Wohltätigkeit ist der Dokter Alois weit über Dunkelblum hinaus bekannt.
Der Hauptplatz, die Endstation, war menschenleer. Die Sonne stand direkt über der Pestsäule. Seit zweihundert Jahren streckte eine halbnackte Bettlerin aus Sandstein den Ankömmlingen anklagend ihren Becher entgegen. Auch ohne das überscharfe Sonnenlicht glaubte man ihr, dass sie am Verdursten war. Die beiden Heiligen zu ihrer Seite, Rochus und Sebastian, denen Wind und Wetter die empfindlichen Nasen abgeschmirgelt hatten, sodass sie dreinsahen wie beleidigte Sphingen, gaben ihr seit über zweihundert Jahren nichts zu trinken. Noch lange, nachdem der Bus gewendet und sich davongemacht hatte, zurück in die belebtere, normale Welt oder in eine geheimnisvolle Remise, wo er Kräfte sammelte, um je wieder wegzukommen, stand der Besucher hier im Sonnenlicht, eine kompakte Ledertasche zu seinen Füßen. Die anderen Fahrgäste waren schnell und geräuschlos verschwunden wie Mäuse in ihre Löcher. Er sah sich alles in Ruhe an, um sich zu vergewissern, dass er wirklich wieder da war: Der Turm, der als Einziger von der alten Schlosspracht übrig geblieben war, schaute mit missmutig zusammengekniffenen Fensterschlitzen zurück. Dort hinten beginnt Asien, sagten die Dunkelblumer gern mit pathetischem Schaudern in Richtung Grenze, wir sind die letzten Ausläufer. Der Verlust des Schlosses hatte bewirkt, dass in fast jedem Haus eine Aufnahme davon aufgestellt worden war, gerahmt, an prominenter Stelle. Und immer noch wurden Ansichtskarten verkauft. Das wusste er, denn er hatte kürzlich eine erhalten – nachkoloriert! Jetzt vermissten sie es. Damals, als sie es abrissen, hatten sie das Wort Tourismus noch nicht buchstabieren können, da sagte man Fremdenzimmer, die waren eine Art Gnade. Den Begriff historischer Ortskern hatte es auch nicht gegeben. Kerne waren etwas, das man ausspuckte.
Links und rechts war dem Schlossturm kurz nach dem Krieg ein Mäuerchen im alten, weiß gekalkten Stil angebaut worden, als sei er ein grotesk aufgeblähtes Schmuckelement innerhalb einer Park- oder Friedhofsmauer. So stand er seither da, als Riese mit winzigen, verstümmelten Flügelchen, die ihm die angrenzenden zweckmäßigen Neubauten nur unzureichend vom Leib hielten.
Direkt gegenüber lag das Hotel Tüffer. Es war schon lange nicht mehr im Besitz der Gründerfamilie, sondern von den Reschens übernommen worden, die immerhin verständig genug gewesen waren, ihrer Trophäe nicht nur den Namen, sondern auch den eleganten rosafarbenen Schriftzug aus den Zwanzigerjahren zu lassen. Sie hatten insgesamt wenig verändert. Die dumpfe Ahnung, dass der Geschmack der ursprünglichen Besitzer den Erwartungen weitgereister Gäste besser entsprach, war in diesem Fall mit zwänglerischem Bauerngeiz eine glücklich-konservatorische Verbindung eingegangen. Der Besucher stieß die Tür auf und atmete vorsichtig ein. Der Geruch der Räume – Patschuli, Kölnischwasser, Bohnerwachs und Kerzen – ließ ihn für ein paar sehnsüchtige Sekunden zurückreisen, er war wieder jung, kaum achtzehn, Damen jeden Alters lächelten ihn an. Es war der Duft von vor dem Wahnsinn, der zu Ende gehenden besseren Zeit, elegant, schwebend. Dieses harmonische Gebäude mit seinen dunklen Holztäfelungen, den Messinglampen und grünen Glasschirmen passte nicht mehr in die Zeit und schon gar nicht in die Gesellschaft. Wenn es dafür eines Beweises bedurft hätte, stand er in Gestalt der Haustochter Zenzi im Billigdirndl hinter der Art-déco-Rezeption und starrte einem trampelhaft entgegen.
Ein Zimmer, sagte er, für ein paar Tage oder mehr.
Sie hielt ihm zwei Schlüssel hin: Der klobige Anhänger, der in allen Hotels der Welt daran erinnern soll, das fremde Eigentum niemals mit vor die Tür zu nehmen, sondern es schon aus Gewichtsgründen allzeit an der Rezeption abzugeben, hatte sinnigerweise die Form eines riesigen, verschnörkelten Bartschlüssels. Mit einem solchen Ungetüm war früher wahrscheinlich das Schlosstor geöffnet worden.
Ist das auch ein schönes Zimmer, fragte er.
Sie zögerte, legte den ersten weg und gab ihm einen anderen: Des scheenste, des wos i Ihna geben kann.
Ich werd das genau überprüfen, sagte der Reisende, beinahe gerührt von dem verdoppelten Relativpronomen, dann zwinkerte er ihr zu, weil sie ihm leidtat und weil er sie später vielleicht noch brauchen konnte. Dass er aus der Gegend stammte, hatte sie offenbar nicht gehört.
3.
Wie sich später herausstellte, war der seltsame Gast etwa zur gleichen Zeit in Dunkelblum eingetroffen wie Lowetz, an dessen Vornamen sich niemand erinnern konnte, da er ihn selbst nicht zu brauchen schien. Er wollte den Sommer nutzen, um sich darüber klar zu werden, was mit seinem Elternhaus geschehen sollte. Seine Mutter war ein paar Wochen zuvor gestorben. Weder war sie krank noch besonders alt gewesen, und trotzdem, wie es ihr untröstlicher Nachbar Fritz mit einiger Anstrengung als unfreiwilliges Bonmot herausgebracht hatte – wegen seiner Verletzung im Kleinkindalter war er schlecht zu verstehen, aber die Familie Lowetz war auf sein gutturales Stammeln eingehört: Trotzdem ist sie in der Früh aufgewacht und war tot.
Lowetz war nicht in Dunkelblum geboren, jedoch sein Vater. Seine Mutter war von drüben, aber das hatte sie über die Jahrzehnte geschickt vergessen gemacht. Ein Sprachtalent, vor allem eine Nachahmungskünstlerin. Dass es schwer sei an der Grenze – diese Arie sang sie gemeinsam mit den Dunkelblumerinnen ihrer Generation im blütenreinen Jammersopran. Lernen Sie Geschichte, junge Frau, hatte ihr Sohn sie einmal angeschnauzt, aber in solch seltenen Momenten der Disharmonie zwischen ihnen (oder früher zwischen ihr und seinem Vater) lief etwas über ihr Gesicht … als zöge eine winzige Hand sorgfältig einen Vorhang vor, und sie schaute ins ferne Innen.
Lowetz setzte sich ab, sobald er konnte. Er hatte vorgehabt, nie mehr zurückzukommen. Er hatte gelernt zu reden wie die Hauptstädter, er sagte zum Beispiel nicht mehr z’sammen, weil es dort z’samm heißt. Rufma uns z’samm. Und dann setzma uns z’samm. Z’sammen vermeiden, das genügte beinahe als Camouflage. Er war das Paradiesgeschrei der Unwissenden leid, all der glattrasierten Hauptstadtakteure und ihrer schmalhüftigen Mädchen, die Dunkelblum und Umgebung als perfekte, weil schnell erreichbare Provinz ansahen, von der sie per Befehl erwarteten, dass sie provinziell bliebe – für den höchst unwahrscheinlichen Fall, dass sie einmal einen Rückzugsort brauchten. Ruhe, Weite, Leere und eine unberührte Natur! Als ob es so etwas gäbe. Ruhe, Weite, Leere im Kopf und ein unberührtes Gewissen – da kämen wir eher zusammen. Da kamaten mir eher z’samm. Und sogar z’sammen.
Die Dunkelblumer dagegen strebten seit jeher danach, in ihrem Maßstab Hauptort zu sein, das heißt, sich zumindest über die umliegenden Bauerndörfer zu erheben. Und es gelang ihnen, was aber nicht ihr Verdienst, sondern der mittelalterlichen Entscheidung des inzwischen emigrierten Grafengeschlechts geschuldet war. Eine Kreuzung von Handelswegen, der Rundblick von der zum Berglein aufgeschoppten Platte – weiß Gott, was der Grund gewesen war für die Grundsteinlegung. Ein Graf begann, ein erstes Stück Schloss zu bauen, dieses wuchs gemächlich und nährte an seiner Schlossnabelschnur den Ort. Dabei hätte es ebenso gut Zwick treffen können oder Kalsching, aber diese Vorstellung war für die Dunkelblumer ganz aus der Welt, sie hätten darüber so sehr gelacht, dass man ihre rosigen Gaumenzäpfchen sah. Damit, mit dieser Wahrnehmung ihres kümmerlichen Möglichkeitssinns, hätte Lowetz eigentlich schon das Wichtigste über sie wissen können.
Die Dunkelblumer lebten ungeniert weiter im Stand einer zufälligen Bevorzugung. Das Schicksal ihres Schlosses und der Grafen hatte sie keinen Deut nachdenklich gemacht, sie taten, als wäre das gänzlich abgetrennt von ihnen – was konnten sie denn schon dafür?
Man hat immer so viel zum Tun g’habt, man hat sich nicht kümmern können.
Sie machten einfach weiter nach dem Krieg, wie alle, jedenfalls wie die meisten. Wie alle, denen das Weitermachen nicht verwehrt war, zum Beispiel, weil sie schon tot waren.
Eines Tages verlangte es die Dunkelblumer nach der ersten asphaltierten Straße, und sie bekamen sie. Bald gierten sie nach einem Supermarkt, dann nach einem zweiten, wegen dem Wettbewerb, schließlich nach einem Drogeriemarkt. Und seit sie sogar einen Baumarkt hatten, standen dessen elektrische Glasschiebetüren allen Geschmacksdelikten offen, samstags sogar bis siebzehn Uhr. Den Bahnhof hatten sie in den letzten hundert Jahren gleich dreimal niedergerissen und neu gebaut, jedes Mal schlimmer. Derzeit hatte er Glasbausteine, Alufenster und die Farbe von Erbrochenem im Zwielicht. Aber kaum war er fertig gewesen, wurde er aus dem Verkehr gezogen – ausnahmsweise stimmte die gern missbrauchte Floskel. Die Auslastung war zu gering, niemand nahm mehr den Zug, seit sich jeder Kleinhüttler und -häusler einen Personenkraftwagen leisten konnte. Leisten konnte war dabei falsch gesagt: einfach leistete, ohne Modalverb. Dafür wurde woanders eingespart, wo, das musste jeder schon selber wissen. Die armen und die reicheren Leute in Dunkelblum hatten eines gemeinsam: jeder ein dickes Auto. Nur Lowetz’ Mutter fuhr fast bis zuletzt einen alten spinatgrünen Corsa, was man als höflichen Akt des Widerstands ansehen konnte. Kurz vor ihrem Tod hatte sie ihn an ein junges Mädchen weitergegeben, das sie mochte und das ihr, wie sie ihrem Sohn am Telefon erzählte, gelegentlich zur Hand ging.
Das Lowetz-Haus lag am Ende einer Sackgasse, im alten Teil von Dunkelblum. Ohne großen Dekorationsaufwand hätte man hier Filme drehen können, die die lang vergangenen Zeiten zeigten. Als jüdische Händler verkleidete Komparsen könnte man hier durch die Gassen huschen lassen, mit ihren Körben voller Posamentierwaren, Stoffen, Bändern, Knöpfen, und einen prägnanten, unbedingt schnurrbärtigen Schauspieler in der Rolle des Eisen-Edi mit seinem Rucksack voller Wetzsteine. Er war vom fahrenden Volk der Lovara, im Frühling und Herbst zog er durch die Lande und schliff die Messer und Scheren. Er machte das so gut, dass damals viele überzeugt waren, er verfüge über Zauberkräfte. Der Vater der aktuellen Heuraffls, der jähzornig und eifersüchtig war, verbot seiner Frau eines Tages, ihre Messer und Scheren dem Edi zu geben. Er kündigte an, sie selbst zu schleifen. Doch es gelang ihm nicht recht, obwohl er sich in der ganzen Umgebung, bis hinüber zu den Drüberen, bei allen erkundigte, die etwas mit Metallen und Klingen zu tun hatten. Er bekam seine Messer einfach nicht so scharf, und sie wurden auch viel schneller wieder stumpf. Das steigerte seinen Zorn auf den Edi, der sich jedoch das übliche halbe Jahr nicht blicken ließ. Die Frau Heuraffl, damals eine frische, fest gebaute Blondine, musste sich zum Schlachten Messer bei den Nachbarn ausborgen. Das Städtchen erwartete gespannt die Ankunft des Scherenschleifers. Die Vorhänge bewegten sich. Man hatte so ein Gespür. Als Edi endlich eintraf, warnte ihn keiner. Man wartete ab, hinter den spaltbreit offenen Fenstern. Ohne Begrüßung wurde Edi in den Heuraffl-Hof hineingezerrt und zusammengeschlagen. Als der alte Heuraffl von ihm abließ, brüllte er ihm die Frage ins blutige Gesicht, warum die Messer eigentlich genau ein halbes Jahr scharf blieben, so lange, bis Edi wiederkäme. Warum ein Zauberer wie er die Messer nicht entweder länger scharf machen könne oder vielleicht sogar kürzer, dann könne er öfter kommen und noch mehr verdienen, du dreckiges Stück, deine Preise sind ja auch nicht geschenkt! Edi, der die Nase gebrochen, zwei Zähne verloren hatte und sich, ohne seinen Peiniger anzusehen, vom Boden aufrappelte, murmelte in seinem komischen Dialekt, dass sie einfach nicht hielten.
Sie halten nicht länger, es geht nicht.
Das murmelte er immer wieder, auch noch, als er sich wegschleppte, um die restlichen Kunden zu besuchen. Viele wollten diese Begründung damals gehört haben: Es hält nicht länger, es geht einfach nicht. Und natürlich haben die Abergläubischen an diesen Satz gedacht, als der alte Heuraffl, der damals ja erst um die vierzig war, ein paar Wochen später im oberen Weingarten von der Leiter fiel und tot war. Doktor Bernstein wurde geholt, der Vorgänger von Sterkowitz. Bei manchen hält das Herz nicht länger, sagte der Doktor, der von der Affäre mit dem Messerschleifer nichts zu wissen schien: Da kann man nichts machen, und man kann es leider auch nicht vorhersehen. Aber die Zigeuner, die sehen in die Zukunft, murmelten die Abergläubischen, die lesen in den Händen, die Zigeuner wissen, was hält und was nicht. Das sagten sie nicht dem Doktor Bernstein, sondern zueinander. Aber selbst wenn die damaligen anderen Heuraffls, die Brüder des Alten, die wilden Onkel der aktuellen Heuraffls, über eine Racheaktion gegen den Eisen-Edi nachgedacht haben sollten, fiel diese dem Trubel nach der Ankunft des Führers zum Opfer. Da hatten sie alle miteinander anderes zu tun, sehr viel hatten sie nämlich zu tun und zu schaffen und zu verändern, sie wollten damals zum Beispiel unbedingt so schnell wie möglich die weißen Flaggen hissen und befürchteten, dass Kirschenstein ihnen zuvorkommen könnte. Und so ist es gar nicht sicher, ob der Edi überhaupt noch einmal nach Dunkelblum gekommen ist. Und wer danach eigentlich die Messer und Scheren schliff.
So jedenfalls sah es im schönen, behaglichen Teil von Dunkelblum aus: unebene Kopfsteine, die Lowetz’ Mutter früher, als sie die Sprache noch nicht so gut beherrschte, Schachbrettsteine genannt hatte. Verwinkelte Gassen, kaum mehr als fuhrwerksbreit. Langgestreckte niedrige Häuschen, geduckt wie furchtsame Schulkinder, außen weiß gekalkt. Farbige Fensterrahmen und dazu passende Fensterläden, meistens in Blau oder Grün, aber es gab auch die gehobene Version mit einer Art Senfgelb, das in ein schwer beschreibbares Rot eingefasst war. Es war kein richtiges Weinrot, ging zwar in Richtung Rubinrot, bog aber kurz davor woandershin ab, wurde dennoch kein Toskanarot und natürlich schon gar nicht das der Feuerwehr. Es war wohl einfach Dunkelblumrot, besonders stattlich in Kombination mit dem Gelb, und war auf den besseren, den etwas größeren alten Häusern zu finden. Überall gab es Blumen, Geranien, Vergissmeinnicht, Wein, der die Mauern emporkletterte, und Töpfe voller Kräuter, die in den Hauseingängen auf dem Boden standen. Der alte Teil von Dunkelblum war eine Welt für sich, unübersichtlich, labyrinthisch, im Sommer lauschig und kühl. Man konnte ihn als unheimlich empfinden, wie einen traumschönen Irrgarten, imstande, einen zu verschlingen, aber ebenso sehr als Zuflucht, wo einen niemand finden konnte, der nicht von hier war. Diese beiden Möglichkeiten lagen nebeneinander wie Karten, die der Zufall ausgab.
Als Lowetz um die Ecke bog, den Blick hob und sein Elternhaus ihm gegenüberstand wie eine Erscheinung, sah er es sich an, als wäre es ihm neu. Nachbar Fritz hatte den Garten und die Blumenkästen an den Fenstern regelmäßig gegossen. Davon abgesehen wuchs alles, wie es wollte, und so wirkte es beinahe verwunschen. Der Apfelbaum senkte seine vollbehangenen Äste über den rissigen Holzzaun, als bäte er höflich um Hilfe. Im Haus war es ein bisschen staubig, lockerer, dekorativer Staub, der sich seit dem Tod der Mutter aus der Luft herabgesenkt hatte wie ein Zeitmesser. Nun erst, da sie nicht mehr da war, erkannte Lowetz ihren ungewöhnlichen Geschmack, eigentlich den beider Eltern. Sie hatten keine Moden mitgemacht, sie ließen sich von sich selbst anleiten. Sie besaßen nur wenige alte, aber herzlich geliebte Möbel, die sie teilweise geschenkt bekommen hatten, wenn Nachbarn modernisierten. Am Eiskasten hing ein Schwarz-Weiß-Foto von Lowetz als Kind, zirka acht Jahre alt, daneben die Ansichtskarte vom Schloss, die neuerdings wieder auf dem Markt war. Immerhin gab es seit einigen Jahren einen Geschirrspüler, einen kleinen. Dass der kleine teurer war als ein großer, hatte ihm seine Mutter nicht geglaubt. Sie hatte auf dem kleinen bestanden, für eine kleine Küche, ein kleines Haus. Ein kleines Leben?
Das Grün vor den Fenstern schuf eine Stimmung wie unter Wasser, wie auf dem Grund eines nicht allzu tiefen Meeres. Überrascht fühlte sich Lowetz zu Hause. Rundherum befand sich Dunkelblum, das war nicht zu leugnen – am Weg hierher hatte er den geflickten Schurl mit seinem grausam vernarbten Gesicht gesehen, wie er mühsam die Tür zum Tüffer aufdrückte, und er hatte sich den Rest der Gesellschaft drinnen vorstellen können, mit den roten Nasen und blutigen Witzen. Aber dieses Haus war eine Insel. Er setzte sich und ließ die Arme hängen. Etwas war anders gewesen bei ihnen, aber er konnte nicht genau sagen, was. Seine Eltern hatten alles mitgemacht, den Kirchgang am Sonntag, den Faschingsumzug, das Schützenfest. Beim Kameradschaftsbund war Lowetz’ Vater nicht gewesen, auch nicht beim von den Kameraden dominierten Frühschoppen. Aber da waren bei Weitem nicht alle dabei, nur die Lauten und die Feigen. Was wirklich nicht in jedem Fall dasselbe war. Ob das, für seinen Vater, schwer oder leicht gewesen war? Nicht dabei zu sein? Er fragte sich das zum ersten Mal. Von den alten Familien, deren Namen auf dem Friedhof viel öfter vorkamen als andere, fielen ihm noch die Malnitz ein. Mit dem Malnitz-Toni und dessen Vater, dem alten Malnitz, waren alle böse, warum, das wusste er nicht. Das war schon immer so. Sein Vater dagegen war eher neutral gewesen, so würde er meinen. Aber was wusste er schon. Er selbst war abgehaut, sobald er konnte. Hätte man in dem Kaff wenigstens Sprachen lernen können, hatte er früher manchmal geschimpft, dann hätte man noch weiter weggehen können als bloß in die Hauptstadt! Du kannst alles machen, hatte die Mutter gesagt, verschieb nichts auf später, was du wirklich willst. Auf die Idee, die Sprache seiner Mutter zu lernen, war er nie gekommen.
Nun schien es ihm, als hätte es schon seine ganze Kraft gekostet, das Städtchen zu meiden. Zu mehr war er nicht in der Lage gewesen. Er war einfach fortgerannt, aber er hatte sich nicht anderswo verankert. Und deshalb war er zurück, Dunkelblum brauchte nur an der Schnur zu zupfen. Er saß in der fast leeren Stube auf einem Bugholzstuhl der mütterlichen Großeltern, die er gar nicht gekannt hatte. Das hatte mit den anderen, den Dunkelblumer Großeltern ein Theater gegeben, vom dem sogar er als Kind noch gehört hatte. Erst bringt er eine von drüben, dann passen ihr unsere Sessel nicht!
Eine verirrte Hummel taumelte durch den Raum, Geräusch wie früher Mutters Handmixer. Die Sonne streckte ein paar Lichtfinger durch Gebüsch und Fenster herein, über den rohen Holzboden. Hier ist der Schatz versteckt, schien sie zu sagen, genau hier. Lowetz ahnte, dass er das Haus nicht gleich verkaufen konnte. Er liebte es so sehr, wie er den Ort drumherum hasste. Er musste es noch behalten, er musste sich zumindest mit dem Haus versöhnen, sonst war ja niemand mehr da.
4.
Der ältere Herr, der seit einigen Tagen im Hotel Tüffer logierte, war freundlich und neugierig, in einer Weise, wie man es hier weder kannte noch eigentlich schätzte. Er schlenderte aufmerksam durch den Ort wie der Inbegriff eines Touristen. Mit denen war Dunkelblum bisher nicht gesegnet, allen Versprechen der Landespolitiker zum Trotz. Die Radfahrer und Wanderer, die an den Wochenenden bei Schönwetter auf ein paar Stunden einsickerten, brachten den Heurigen und Wirtshäusern kaum zusätzlichen Umsatz, und dass das Tüffer nicht Bankrott machte, hing nicht an den selten belegten Zimmern, sondern an der täglich geöffneten Bar, dem günstigen Mittagstisch und der Selbstausbeutung der alten Frau Reschen. Für kunsthistorisch Interessierte bot das Städtchen nichts weiter außer der Pestsäule und einem im Krieg halb verbrannten, unzureichend restaurierten Altarbild, auf dem hinter und neben den Aposteln mehrere Teufel zu sehen waren, kleine gefiederte und ein großer mit Pferdefuß. Der Schlossturm war wegen Baufälligkeit nicht zugänglich, für die gräfliche Gruft brauchte man eine Anmeldung.
Pläne für ein Heimatmuseum wurden zwar seit langer Zeit diskutiert, konnten aber nicht umgesetzt werden, weil sich im Gemeinderat zwei kompromisslose Fraktionen gebildet hatten. Die einen, angeführt vom Reisebüroinhaber Rehberg, hatten eine Art gräflichen Themenpark im Sinn, wo Ahnentafeln, Wappen, Tapisserien, Perücken, Rüstungen sowie die berühmte goldene Passion Christi (gehämmert, zwei mal drei Meter) derer von Dunkelblum gezeigt werden sollten, obwohl niemand die Grafen gefragt hatte, ob sie all das überhaupt zur Verfügung stellten. Die anderen beharrten auf einem Bekenntnis zur bäuerlichen Kultur, einem Handwerks- und Weinbauernmuseum, das mindestens mit einer historischen Traubenpresse ausgestattet sein müsse.
Auf dem alten jüdischen Friedhof waren seit Anfang des Sommers irgendwelche langhaarigen Studenten am Werk, sie mähten und jäteten, verbrannten Unkraut und stellten umgefallene Grabsteine wieder auf, aber zum Herzeigen war da natürlich auch nichts. Beinahe hätte man die Existenz dieses Friedhofs vergessen gehabt, hinter seiner hohen Mauer war er unsichtbar gewesen. Dass die Tore nun, außer am Samstag, offen standen, berührte eigenartig. Niemand verstand, was das Ganze sollte. Wer kein Grab zu pflegen hatte, ging ja nicht freiwillig auf einem Friedhof spazieren, und selbst wenn jemand das gewollt hätte, waren der katholische und der evangelische schön genug. Dort hatte die Sparkasse vor Jahren sogar Bänke gespendet, acht am katholischen, drei am evangelischen, Bänke von der Bank.
Aber diese jungen Leute hatten ein Papier aus der Hauptstadt vorgezeigt, und so sollten sie halt Holunder umschneiden, wenn sie nichts Besseres zu tun hatten. Das war die Ansicht des unfreiwilligen und überforderten Bürgermeisters Koreny. Er hatte sich nie zur Wahl gestellt. Er war nur aus Gutmütigkeit Vizebürgermeister geworden, als treuer Anhänger des energischen Heinz Balf, aber Balf, ein Immobilienmakler und Hobbymarathonläufer, war letztens von Doktor Sterkowitz persönlich in die Hauptstadt chauffiert worden, mit Schwellungen in den Achselhöhlen. Es hieß, er würde lange nicht zurückkommen, wenn überhaupt. Und so war der dickliche, rotblonde Koreny Bürgermeister geworden, zu seinem eigenen tiefen Entsetzen.
Und Koreny hatte diese Sache eben genehmigt, und je öfter sich misstrauische Bürger erkundigten, desto nachdrücklicher machte er seinen Standpunkt klar. Immerhin kam das von oben. Aber seine Leute hier, die waren ja gegen alles, weil sie einfach nichts von Politik verstanden. Die Langhaarigen hatten ein rechtmäßiges Papier aus der Stadt, und es besagte, dass die israelitische Kultusgemeinde den Auftrag gegeben hat, den Friedhof zu sanieren. Sie bezahlen das auch, und basta. Nein, uns kostet das gar nichts. Ja, natürlich ist es richtig, dass das Bedenkjahr endlich vorbei ist. Aber der Herr Bundeskanzler hat ja damals auch gesagt, dass man nicht nur am, wie sagt man, Stichtag sich erinnern soll, sondern dass die Erinnerung etwas sein sollte, das länger dauert. Auch der Kardinal hat das gesagt. Oder sogar der Bundespräsident?
Am Ende der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause gab es einen kleinen Zwischenfall, winzig, letztlich unbedeutend. Die unsinnige Bemerkung einer jungen Frau brachte zutage, wie schlecht des Bürgermeisters Nerven waren. Flocke, die jüngste Tochter von Malnitz und seiner Frau Leonore, wollte ihren Vater abholen und hatte offenbar schon eine Weile in der halb offenen Tür zugehört. Gerade war Rehberg vom Reisebüro mit seinem Vortrag in Sachen Heimatmuseum zum Ende gekommen. Rehberg hatte Pfarrer werden wollen und war Touristikkaufmann geworden. Ohne dass es ihm bewusst war, erwartete er seither von der Welt Rücksichtnahme auf die Enttäuschung seiner Ambitionen, er versuchte, sich als Leuchtturm von Bildung, Manieren und strategischer Übersicht zu gerieren. Es gelang ihm selten. Bis auf Ferbenz waren ihm die meisten rhetorisch unterlegen, aber das kümmerte sie nicht. Sie hörten ihm gar nicht zu, sie überstimmten ihn oder schrien ihn nieder. Rehberg, dessen Stimme wie ein ausgeleierter Keilriemen klang, hatte noch einmal beschworen, welche Besuchermassen andernorts in Ausstellungen wie Die Schätze der Kuenringer, Die Frauen der Babenberger und Die Schlösser der Habsburger geströmt seien, weil Adel und Aristokratie einfach die Attraktionen der Zukunft seien. Die Menschen sehnten sich nach der guten alten Zeit. Auf diesem speziellen Gebiet, Tourismus, Fremdenverkehr, fühlte sich Rehberg noch kompetenter. Die Weinbauern und Handwerker, die aus unklaren Gründen in diesem Landstrich meistens sozialistisch wählten, hatten ihren Unmut durch Zwischenrufe wie Kerzlschlicker und Unfreundlicheres geäußert, aber ihn wenigstens ausreden lassen. Bürgermeister Koreny wollte die Sitzung schließen und den Tagesordnungspunkt vertagen oder umgekehrt und zog sich davor zur Beruhigung und zum Zeitgewinn noch einmal das Taschentuch über die nasse Stirn. Und da krähte die freche kleine Malnitz von der Tür her etwas von einem Grenzmuseum, etwas Besonderem, das außer uns niemand hat. Wir zusammen mit den Drüberen, alles zweisprachig, da gibt’s Verbindungen, die müsste man nur wieder ausgraben, das wäre einmal ein Alleinstellungsmerkmal. Mit dem sperrigen Wort schien sie Rehberg nachzuäffen, der es wahrscheinlich gerade verwendet hatte. Das wäre ihm zuzutrauen, solche Wörter, als wäre er ein G’studierter.
Das reicht jetzt, schrie Koreny und seine sommersprossige Faust sauste wie von selbst auf die Tischplatte vor ihm. Für einen Moment blickten alle auf, sogar der Doktor Ferbenz, der aus Altersgründen nur noch bescheidener Schriftführer war, schweigend, dienend, sich heraushaltend, aber natürlich immer dabei, niemals entging ihm ein gesprochenes und schon gar kein unterdrücktes Wort. Die Sitzung is g’schlossen, brüllte Koreny und fühlte sich beim Laufenlassen der Affekte überraschend erfrischt, i bin müd, es is haaß, der nächste Termin wird ausg’hängt zu gegebener Zeit.
Und sogar davon erfuhr der neugierige ältere Herr, der im Tüffer logierte. Er schlenderte durch den Ort und plauderte an Gartenzäunen und in Hofeinfahrten. Er besuchte die Heurigen und verkostete den Wein. Er stand so lange bewundernd vor Rehbergs Reisen, bis dieser herauskam. Jahreszeitbedingt war das Schaufenster mit einem Sandhaufen, einer Topfpalme und einem ledernen Kamel dekoriert. Weil der Herr so interessiert und aufmerksam war, fasste Rehberg Vertrauen und berichtete, dass er von einem Reiseanbieter einen prächtigen aufblasbaren Dampfer bekommen habe, als Werbung für dessen Kreuzfahrten. Doch zögerte er, ihn ins Schaufenster zu stellen. Er kannte seine Klientel. Kreuzfahrten ließen sich hier beim besten Willen nicht verkaufen, das stabilste Geschäft machte er mit den Arrangements für die Adria: Postbus nach Kirschenstein, Eisenbahn nach Graz, dort erreichte man den Bäderbus, der hielt in allen adriatischen Badeorten, lud die Touristen vor der Tür jedes noch so kleinen Hotels ab, wenn sie vorbestellt hatten. Rehbergs intelligente Zusatzleistung bestand darin, dass er in Graz einen Studenten bezahlte, der mit einer Namensliste und einer gelb-roten Dunkelblum-Fahne die Gäste vom Bahnsteig abholte und zur Abfahrtshaltestelle des Bäderbusses begleitete. Sie lag nur zweimal um die Ecke, aber die Menschen wurden sofort unsicher, sobald sie die vertraute Umgebung verließen. Auf solche Einfälle war er stolz. Sie kamen aus der ganzen Umgebung, noch von hinter Kirschenstein. Bevor sie in eine der lauten, verwirrenden Städte fuhren, kamen sie lieber zu ihm. Deshalb blieb Rehberg optimistisch. Die Reisebranche wuchs, überall, sie würde auch in Dunkelblum wachsen. Dem Herrn Dokter Alois hatte er schon einen Badeurlaub in Ägypten verkauft, auch wenn der mit ein paar Kleinigkeiten nicht zufrieden gewesen war – er war halt ein verwöhnter Herr. Rehberg hatte Hoffnung, insgesamt. Aber der wunderschöne Dampfer? Mit seinen liebevoll aufgedruckten Luken und den winkenden Menschlein am Oberdeck? War das nicht – größenwahnsinnig?
Der Fremde, nachdem er sich alles angehört hatte, gab Rehberg einen Rat, der ihn sofort überzeugte. Er persönlich sei der Ansicht, sagte der Gast, dass in den Schaufenstern das Unerreichbare zu hängen habe, damit der Kunde träumen kann. Man betritt ein Geschäft, weil und obwohl viel mehr darin ist, als man sich leisten kann. Man will ein Stück vom Paradies, nicht gleich das Paradies selbst. Selbst der Markttandler habe samstags neben den Türmen frisch geschnittener Extrawurst eine Trüffelsalami liegen, wenn auch nur eine winzig kleine. Summa: Man müsse Rehberg zutrauen, selbst die luxuriöseste Kreuzfahrt auf dem prachtvollsten Schiff planen und organisieren zu können, dann würde man vertrauensvoll eine kleine Reise bei ihm buchen. Der Mensch will sich strecken und nicht zusammenducken, sagte der freundliche Herr, der im Hotel Tüffer abgestiegen war, da sind wir alle gleich. Und Rehberg war so dankbar, dass er den Fremden in sein Geschäft bat, ihm, bevor er den Dampfer aufblies, ein Stamperl kredenzte und sich bei dieser Gelegenheit seine unmaßgeblichen Ansichten zu den ganz alten, den wirklich hässlichen Geschichten Dunkelblums entlocken ließ – der Herr schien ihm der richtige Adressat. Am Ende dieses denkwürdigen Zusammentreffens sah man die beiden hinter der Glasscheibe herumklettern, den Sandhaufen mit einer Kehrschaufel verschieben, die Palme verrücken und den wirklich herzanrührenden, riesigen, bildschönen weißen Dampfer mit all den lachenden Gesichtern auf eine lange, geschwungene Bahn blaues Packpapier setzen, sodass man meinen konnte, die Donau führe direkt zu den Pyramiden. Oder sollte das der Nil sein? Der war doch bestimmt nicht so blau. Das Lederkamel stand für den Rest des Sommers vorne rechts und staunte.
Nach einigen Tagen des Spazierens und Besichtigens hatte der Gast aus dem Tüffer eine Mitfahrgelegenheit gefunden. Bei heruntergekurbelten Fenstern sah man ihn gut gelaunt auf dem Beifahrersitz von Flockes verbeultem spinatgrünen Auto sitzen und den Kopf hin und her wenden. Wie er auf Flocke gestoßen war? Man weiß es nicht. Möglich, dass Rehberg das Geschrei im Gemeinderat erwähnt hatte, aber wahrscheinlich war es viel einfacher. Rehberg war nicht an allem schuld, was in Dunkelblum schiefging, auch wenn sich der Berneck, der geflickte Schurl und die Heuraffl-Zwillinge seit Jahren einen Spaß daraus machten, ihm genau das einzureden.
Na, Rehberg, was hast jetzt wieder ang’stellt, fragten sie etwa und hakten ihn von beiden Seiten unter, wenn er das Pech hatte, ihnen abends, nach ihrem ausführlichen Wirtshausbesuch, vor die Füße zu geraten. Er antwortete nie, verteidigte sich nicht. Er versuchte, den Kopf abzuwenden, was schlecht ging, da er von ihnen umringt war. Er versuchte, sich ihrem Griff zu entwinden, nicht heftig, sondern schwach und greinend. Er zappelte wie ein Kind. Loslassen, jammerte er mit seiner bedauernswerten Stimme, lassts mich los, ich hab nichts gemacht. Sie stießen ihn zum Spaß ein bisschen herum, Fäuste gegen die Oberarme, und johlten: Der Rehberg ist unschuldig, der Rehberg hat nichts gemacht, und was er gemacht hat, hat er nicht gewollt und nicht einmal bemerkt, dass er es gemacht hat, hahaha!
Einmal, vor vielen Jahren, als sie noch jung und ungestüm waren, hatten sie ihn ein paarmal in den Hintern getreten, einfach, weil sie es ausprobieren wollten. Da stürzte er so unglücklich, dass er liegen blieb, irgendetwas mit dem Knie oder Knöchel, nicht gebrochen, sondern gerissen. Lowetz’ Mutter fand ihn da, Ecke Tempel- und Sternsingergasse, er war ganz still, aber bei Bewusstsein. Er hatte sich nicht rufen trauen, aus Angst, dass die Burschen zurückkämen, aber der Frau Lowetz erzählte er, er müsse wohl einen Moment das Bewusstsein verloren haben. Auch dem Doktor Sterkowitz versicherte er, gestolpert zu sein, im Dunkeln, vielleicht über ein Tier, Herr Dokter, es gibt jetzt Waschbären! Sterkowitz ahnte die Wahrheit. Ich muss das anzeigen, sagte er probehalber, aber da warf Rehberg sich in die Brust, sah ihn fest an und fragte: Derf ma’ nimma stolpern? Wird man schon dafür angezeigt, dass man sich den Haxen bricht? Was ist denn das eigentlich für eine Welt?
Sterkowitz bemerkte den hochfrequenten Tremor der Hände und Beine, verabreichte ein leichtes Beruhigungsmittel, fixierte das Bein und kam auf die Anzeige nicht mehr zurück. Doch machte er später eine Bemerkung zum Ferbenz, und dieser machte eine Bemerkung zu seinen Burschen, die manchmal einfach ein bisserl übermütig waren, net woahr, und seither schubsten sie ihn nur herum, brachten ihm ein paar blaue Flecken bei, zogen an seinem Sakko und manchmal auch an seinen Ohren. Nichts Schlimmes, mir wer’n doch noch an Spaß verstehen? Mehr war auch gar nicht nötig.
Rehberg war wahrlich nicht an allem schuld, nicht einmal an seiner Stimme, nur an seinen Schaufenstern. Es sind also viele Gelegenheiten denkbar, bei denen der Herr aus dem Tüffer und Flocke zufällig ins Gespräch gekommen sein konnten, möglicherweise einfach, als er den Heurigen ihrer Eltern besuchte. Flocke verbrachte die Sommerferien zu Hause. Und auch sie wanderte gern herum, besuchte regelmäßig den Dodl Fritz und den Greißler Antal Grün. Ihm half sie, Inventur zu machen, aus irgendeinem Grund machte ihn das so nervös, dass er es allein nicht schaffte. Den Studenten auf dem verwilderten Friedhof brachte sie Most und Wurstsemmeln vorbei. Flocke Malnitz hatte ihren eigenen Kopf, aber einen eigenen Kopf zu haben, das lag ein bisschen in der Familie. Immerhin schienen die Dunkelblumer Unterschiede zwischen den einzelnen eigenen Köpfen zu machen, denn das Mädchen bezeichnete man als Hippie. Das wäre zu ihrem Vater niemandem eingefallen.
Und nun sah man sie, wie sie den Fremden in ihrem Auto mitnahm. Sie fuhren hinauf auf die Zugspitze, wie viele den sogenannten Hausberg scherzhaft nannten, denn er hieß Hazug, mit einem Drüberen-Namen, er hatte keinen deutschen. Die meisten Dunkelblumer sagten deshalb einfach: der Berg. Flocke und der Besucher blickten von dort hinunter ins Land, in die beiden Länder. Eine schöne Aussicht, wie das alles dalag, gewellt, gefleckt, bunt und einladend. Die Grenzanlagen waren zu erkennen, aber von oben wirkten sie wie aus Draht und Zahnstochern gebastelt. Hier wie dort fuhren winzige Traktoren fleißig durch die Felder, die kleinen, spitzigen Kirchtürme zeigten stramm in Richtung Gott, und die Weingärten sahen aus wie Verzierungen, gekräuselte Samtbänder zwischen den glatten Vierecken. Die Ortschaften dazwischen wie hingeschüttet, ausfransend. Die Bausünden der Nachkriegszeit spielten von oben gesehen kaum eine Rolle, nur ein bisschen Grellorange oder Himmelblau blitzte in manchen Zwischenräumen auf. Aber dass es ungeheuer dicht war im Zentrum von Dunkelblum, das konnte man von oben gut erkennen. Wie fester gepackt, geschnürt, zusammengedrückt, wie am tiefsten Punkt einer Kiste, wo alles von oben doppelt und dreifach lastet. In Dunkelblum lastete es von unten. Aber das Dichte kann ja auch schön sein, warm und hochenergetisch. Früher hat man einfach nicht so viel Platz gebraucht.
Der Gast aus dem Tüffer schlug vor, nach Ehrenfeld zu fahren, dort habe er vor Urzeiten Freunde gehabt. Überhaupt sei ihm das kleinere Ehrenfeld harmonischer erschienen, friedlicher.
Na, ich weiß nicht, sagte Flocke zweifelnd.
Der Gast sagte, er habe in der Zeitung gelesen, dass letztens ein Stadel abgebrannt sei. Ob sie davon gehört habe?
Gehört, fragte Flocke zurück, lachte, schob die Unterlippe vor und blies ihre Stirnfransen in die Höhe, was ein Tick von ihr war. Das war unser Stadel, also aus dem Erbe meiner Mutter. Und die Feuerwehr hat am selben Abend in Kalsching gesoffen. Wenn das kein Zufall ist!
5.
Die Besitzerin des abgebrannten Stadels, Leonore Malnitz, war die Königin von Dunkelblum. Sie eine Landschönheit zu nennen, wäre eine Untertreibung gewesen. In ihrer Jugend hatte sie oft genug gehört, sie müsse unbedingt an einer Misswahl teilnehmen, aber da schnaubte sie nur. Als die Misswahlen Ende der Fünfzigerjahre wieder begannen, war sie verheiratet und ihre ersten beiden Kinder waren geboren. Und als es noch ein paar Jahre später üblich wurde, dass die männlichen Dunkelblumer in der Bar des Tüffer saßen und den Bildschirm angrölten, über den die Bikinimädchen mit ihren Nummerntafeln liefen, verursachte sie eine Schlägerei.
Widerlich und frauenfeindlich, rief sie laut, als sie mit einem Lieferschein mitten durch den Fernsehraum schritt, weil die Reschens damals noch Malnitz-Wein ausschenkten: Denkt einer von euch Fleischbeschauern eigentlich an die eigenen Töchter?
Die Männer grölten, einige versuchten, ihr auf den Hintern zu klatschen, sie drehte sich um und wischte dem Nächstbesten eine, mit einem theatralischen Knall. Leider stand dieser Nächstbeste sofort auf, packte sie am Arm und zog sie an sein rotes Gesicht heran. Leonore lehnte sich so weit wie möglich zurück, weniger aus Angst als aus Ekel.
Berneck, hör auf, schrie die Wirtin Resi Reschen, aber es war zu spät. Der junge Graun, der damals höchstens zwanzig Jahre alt war, warf dem Berneck zu dessen Überraschung von hinten den Arm um den Hals und drückte unter Ausnutzung des Ellbogenhebels zu. Leonore stolperte und riss sich los. Frau Reschen zog sie hinter die Schank, schob sie von dort in die Küche und beim Lieferanteneingang hinaus. Vor der Tür prüfte Leonore, ob beide Ohrringe dran waren, bedankte sich und riet der Frau Reschen, die Viecher