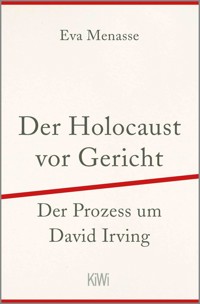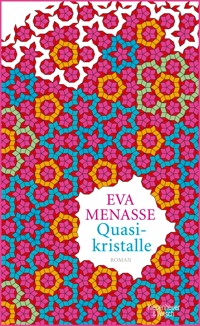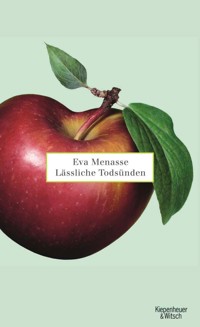
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Menschen sind Wesen, die mehr sein wollen, als sie sind In einer postmodernen Gesellschaft forscht Eva Menasse nach archaischen Mustern. Sie spürt den sieben Todsünden nach und findet Trägheit und Gefräßigkeit, Wollust und Hochmut, Zorn, Neid und Habgier in den Taten ihrer ganz und gar weltlichen Protagonisten. Wie schon in ihrem Debütroman »Vienna« erzählt sie mit der ihr eigenen Mischung aus Poesie und Komik Geschichten, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen. Auf Gott können wir längst verzichten. Doch haben wir damit auch die Sünde abgeschafft? Anhand der alten Lehre von den sieben Todsünden widmet sich Eva Menasse den großen Themen der Literatur: Liebe und Hass, Schuld und Vergebung. Denn die Menschen verfehlen einander auch heute aus denselben Gründen wie vor Jahrhunderten. Ein Familienvater ist zu träge, um gegen Töchter und Exfrau ein eigenes kleines Glück durchzusetzen. Ein junges Liebespaar vermeidet die Kompliziertheiten der Sexualität, indem es den einen zum Pfleger, die andere zur Kranken macht. Ein Mann verpasst sein ganzes Leben, weil er sich keine Schwäche leisten will. Und ein geschiedenes Paar bekämpft einander bis ans Grab des gemeinsamen Kindes. Leidenschaftlich und liebevoll geht die Autorin mit ihren Figuren ins Gericht. Hinter den Fassaden, da, wo die Sünden sind, steckt schließlich der menschliche Kern. Und so wie die einzelnen Todsünden einander berühren und ineinander übergehen, tun es auch diese Geschichten. Orte und Figuren tauchen auf und kehren wieder, Zusammenhänge erschließen sich quer durch die Kapitel – wie in »Vienna« erschafft Eva Menasse mit unverwechselbarem Witz und erzählerischer Rasanz ein großes Ganzes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Eva Menasse
Lässliche Todsünden
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Eva Menasse
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Eva Menasse
Eva Menasse, geboren 1970 in Wien, begann als Journalistin bei »Profil« in Wien. Sie wurde Redakteurin der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«, begleitete den Prozess um den Holocaust-Leugner David Irving in London und schrieb darüber ein Buch. Nach einem Aufenthalt in Prag arbeitete sie als Kulturkorrespondentin in Wien. Sie lebt seit 2003 als freie Schriftstellerin in Berlin. Ihr Debütroman »Vienna« war bei Kritik und Lesern ein großer Erfolg.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Auf Gott können wir längst verzichten. Doch haben wir damit auch die Sünde abgeschafft? Anhand der alten Lehre von den sieben Todsünden widmet sich Eva Menasse den großen Themen der Literatur: Liebe und Hass, Schuld und Vergebung. Denn die Menschen verfehlen einander auch heute aus denselben Gründen wie vor Jahrhunderten.
Ein Familienvater ist zu träge, um gegen Töchter und Exfrau ein eigenes kleines Glück durchzusetzen. Ein junges Liebespaar vermeidet die Kompliziertheiten der Sexualität, indem es den einen zum Pfleger, die andere zur Kranken macht. Ein Mann verpasst sein ganzes Leben, weil er sich keine Schwäche leisten will. Und ein geschiedenes Paar bekämpft einander bis ans Grab des gemeinsamen Kindes.
Leidenschaftlich und liebevoll geht die Autorin mit ihren Figuren ins Gericht. Hinter den Fassaden, da, wo die Sünden sind, steckt schließlich der menschliche Kern.
Und so wie die einzelnen Todsünden einander berühren und ineinander übergehen, tun es auch diese Geschichten. Orte und Figuren tauchen auf und kehren wieder, Zusammenhänge erschließen sich quer durch die Kapitel. Mit der ihr eigenen Mischung aus Poesie und Komik erschafft Eva Menasse ein großes Ganzes.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2009, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
eBook © 2012, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © plainpicture/Folio Images
ISBN978-3-462-30661-3
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Trägheit
Gefräßigkeit
Wollust
Zorn
Hochmut
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
Neid
Habgier
für Anna und Su
Trägheit
›Diese Hilda‹ hatte Fritz in einem Lokal namens ›Paradise Now‹ kennengelernt, eigentlich ein purer Zufall. Er ging sonst nie in solche Lokale, er bewegte sich seit vielen Jahren in einem Zirkel aus drei, vier Kneipen und Kaffeehäusern, einer Handvoll gutbürgerlicher Restaurants, der Betriebskantine und dem Espresso, das an die Squash-Halle angeschlossen war. Eines Nachts, als Karin einen ihrer hysterischen Anfälle hatte, war sie noch bei Sinnen genug gewesen, diese Gaststätten in irgendeiner Reihenfolge durchzurufen. Und so hatte sie ihn gefunden, im ›Blaubichler‹ oder im ›Jakobinerwirt‹, kurz nach Mitternacht. Fritz war berechenbar, er verließ ungern seine gewohnten Bahnen. Deshalb hatte er all die Jahre nur Affären mit Arbeitskolleginnen gehabt oder, seltener, mit den Frauen seiner Squash-Partner, und im Nachhinein tröstete er sich damit, dass eine Frau wie ›diese Hilda‹ gar nicht in sein Leben gepasst hatte.
Dabei sah sie wirklich gut aus, wenngleich dunkel. Auch mit dunkelhaarigen Frauen hatte er wenig Erfahrung, irgendwie war er bisher immer nur an Blondinen geraten. Ob das bereits eine Vorliebe war, hätte er nicht zu sagen gewusst. Karin war blond wie ein Schwedenmädchen, natürlich waren ihre beiden gemeinsamen Kinder blond, kein Wunder, er selbst war auch ein ganz heller Typ. Aber sogar Judith, die Älteste, von Karin mit in die Ehe gebracht, hatte einen Kopf wie ein Kornfeld, deshalb sahen sie alle fünf aus wie eine richtige, glückliche Familie. So viel Blond ist hierzulande rar, da sind zu viele Slawen drübergelegen, witzelte Karin gern und schien sich dabei verwegen zu fühlen. Dass Karins Freundinnen auch alle blond waren, und wenn nicht von Natur aus, dann gefärbt, war Fritz erst nach vielen Jahren aufgefallen, erst, nachdem er ausgezogen war. Und selbst da hatte er dem keine Bedeutung zugemessen.
Jedenfalls hatte es Fritz gleich ein bisschen komisch gefunden, eine Frau anzusprechen, die vor einem grasgrünen Cocktail saß, mit einem Pfirsichfächer am Glasrand. In seinen Kreisen trank man Bier und guten Wein, die Frauen tranken gern Champagner. Aber dieser ganze Abend war irgendwie aus der Reihe gefallen, wegen seines Kollegen Wolfgang, der abends in der Kantine, nach dem Spätdienst, plötzlich sein Leben vor ihn hingekotzt hatte, die kaputte Ehe, das behinderte Kind, und der ihn dann gezwungen hatte, ihn in dieses ›Paradise Now‹ zu begleiten, ganz gegen seine Gewohnheit. Fritz hatte nicht Nein sagen können. Emotionen, also Naturgewalten gegenüber war er wehrlos. Und er war es nicht gewohnt, über Persönliches zu sprechen, auch wenn in der Redaktion schon einige Gerüchte über Wolfgang kursierten. Als Wolfgang das dritte Krügel bestellte, ihn mit geröteten Augen fixierte und erklärte, er denke ständig über Mord und Selbstmord nach, nur könne er sich einfach nicht entscheiden, ob er seine Frau auch umbringen solle oder ob ihr Überleben nicht die schönste Strafe sei, da hatte Fritz unbehaglich gedacht: Die Pavlovic, die intrigante Chefin vom Dienst, wäre in diese Lage gar nicht erst gekommen. Aber er, er galt ja als ehrliche Haut. Ihm kippte man Intima hin, die anderen runtergegangen wären wie Öl, und ihm war es nur peinlich. Fritz begann zu schwitzen, und es hatte quälende Minuten gedauert, bis er begriff, dass Wolfgang gar keinen Ratschlag erwartete. Und deshalb war er dann mitgegangen ins ›Paradise Now‹, aus Erleichterung, aus schlechtem Gewissen und einem sich leise regenden Allmachtsgefühl, das sich als Verantwortungsbewusstsein perfekt zu tarnen verstand.
Natürlich hielt Fritz sich für einen reflektierten Menschen. Karin hatte ihm oft genug vorgeworfen, dass er träge sei, aber wenn er sich treiben ließ, dann, hielt er sich zugute, tat er das immer in vollem Bewusstsein. Dass ihm einiges über sich selbst entging, hätte er vehement bestritten. Wenn er manche Dinge so nahm, wie sie kamen, dann deswegen, weil er im Widerstand keinen Sinn sah. Also betrachtete er seinen Nicht-Widerstand im Endeffekt als bewusste Entscheidung. Davon ließ er sich nicht abbringen. Von solchen Entscheidungen seinerseits, ohne überflüssigen Energieaufwand zustande gekommen, hatte Karin doch selbst am meisten profitiert! Schon ihr Kennenlernen war so überstürzt gewesen, dass andere vielleicht bloß aus Prinzip opponiert hätten. Oder welcher Fünfundzwanzigjährige wäre nach nur einer Liebesnacht mit einer Frau samt Kleinkind zusammengezogen? Karins Pragmatismus hatte ihm auch später noch oft eingeleuchtet. Warum sollte sie jetzt eine Wohnung suchen, die in einem halben Jahr, wenn man sich besser kennen und umso mehr lieben würde, doch nur wieder zu klein wäre? Und eine Wohnung brauchte sie. Zwar hatte der Kindsvater, ein junger Regisseur, ihr die ehemals gemeinsame Unterkunft reumütig überlassen, nachdem er ihr seine Affäre gebeichtet und sich im nächsten Moment aus dem Staub gemacht hatte. Von dem nehm ich nichts, nur ihn aus, das Dreckschwein, hatte jedoch Karin gezischt und die Unterlippe dabei auf eine Art in den Mund gezogen, wie Fritz es später noch oft zu sehen bekommen sollte. Aber damals konnte Fritz, der sich unter einer frisch verlassenen jungen Mutter ein rotgeheultes Wesen vorgestellt hatte, nicht umhin, sie für diese pointierte Lebenswut zu bewundern. Das war endlich eine Frau, die wusste, was sie wollte, kein stirnfransiges Mädchen mit speckigen Taschenbüchern im Bett, wie er sie bisher auf der Uni oder auf Partys aufgegabelt hatte.
Dass sie schwanger war, hatte Karin ihm erst ein paar Wochen später mitgeteilt, nachdem sie den Mietvertrag unterschrieben hatten. Fritz hatte nichts dabei finden können, in der ersten Nacht gleich geschwängert, da war er fast stolz auf sich. Und für die kleine Judith wäre es nur gut. Die hatte an dem Schock des Vaterwechsels ohnehin zu kauen, das sah er ganz genauso. Der Regisseur, Judiths Vater, war übrigens so übel nicht, aber das hatte Fritz für sich behalten. Karin war da emotional verwickelt, das glaubte er zu verstehen. In den Jahren, als Judith und Paula heranwuchsen – sie sahen wie Zwillinge aus –, hatte Fritz manchmal zwischen Karin und dem Regisseur vermittelt. Es ging immer ums Geld, das ist ja klar in solchen Fällen.
Oft genug hatte er fast Verständnis für den Regisseur gehabt. Es mochte ja sein, dass der Regisseur insgesamt zu wenig zahlte, und zwar weil er seine Einkünfte nicht korrekt versteuerte. Karin verbreitete dieses Gerücht, wo sie nur konnte. Aber warum Karin dann ausgerechnet wegen einer Winterjacke aus dem Ausverkauf explodierte und nach Rechtsanwälten, Richtern und dem Jugendamt schrie, das verstand eigentlich nicht einmal Fritz. Zugegeben hätte er das nie. Auch nicht, wie amikal seine Vermittlungsgespräche mit dem Regisseur verliefen. Er hatte sich die Lösung immer schon vorher genau überlegt, meistens, indem er herauszufinden versuchte, was Judith sich gerade wünschte. Das schlug er dem Regisseur dann gleich nach der Begrüßung vor, und danach konnten sie in aller Ruhe Rotwein trinken und sich über die Kulturszene austauschen.
Nach der Winterjackenaffäre war es ein Skitag am Semmering gewesen. Der Wochenendvater lud sogar Paula dazu ein. Das nahm Karin nicht unbedingt den Wind aus den Segeln – bei Dingen des täglichen Gebrauchs spart er an seinem einzigen Kind, nur um sich dann als toller Abenteuerpapi zu inszenieren! –, beendete aber immerhin ihren juristischen Aktionismus: Der Brief an den Rechtsanwalt lag noch ein paar Tage auf ihrem Schreibtisch, bis er verschwand, und zwar nicht im Briefkasten.
Ansonsten war der Regisseur pflegeleicht. Er verbrachte jedes Jahr einen schönen Sommerurlaub und oft auch einen Winterurlaub mit seiner Tochter, er nahm sie verlässlich jedes zweite Wochenende zu sich, er setzte sie nur äußerst sparsam seinen wechselnden Gefährtinnen aus, und besonders, als Judith in die Pubertät kam, schien sie das geheimnisvolle Nebenleben mit ihrem Vater zu genießen. Man hörte, dass Vater und Tochter einander am provençalischen Strand Beckett und Brecht mit verteilten Rollen vorlasen.
Wie gesagt, Streit gab es eigentlich nur ums Geld. Als Karin etwa plötzlich beschloss, dass Judith den Namen ihres Vaters zugunsten von Fritz’ Namen aufgeben solle, war Fritz angenehm überrascht, wie wenig Widerstand der Regisseur leistete. Karin hatte Fritz vorgeschickt. Auftragsgemäß erklärte er, dass Judith es in der Schule leichter haben würde. Man erspare ihr eine Stigmatisierung als Scheidungskind, und sie selbst habe schon oft danach gefragt, warum sie eigentlich anders heiße als der Rest der Familie – hier übertrieb Fritz ein bisschen. Und also geschah es, obwohl der Regisseur ein ganz merkwürdiges, irgendwie flackerndes Gesicht gemacht hatte, wie Fritz später Karin berichtete, die daraus eine etwas ordinäre Befriedigung zu ziehen schien.
Als Fritz sich ›dieser Hilda‹ gegenüber in die Bank zwängte, streifte er mit der Schulter einen künstlichen Palmwedel. Sie lächelte ihn an. Ihre Stimme war viel höher und mädchenhafter, als ihr rassiges Aussehen vermuten ließ. Sie lebte allein und hatte einen erwachsenen Sohn. Sie habe es immer bedauert, nur ein Kind zu haben, aber ihre Ehe sei schwierig genug gewesen und dann auch bald zerbrochen. Sie beneidete Fritz überschwänglich um seine ›zweieinhalb‹ Kinder. Warum sagte er plötzlich ›zweieinhalb‹? Früher hatte er immer ›drei‹ gesagt, aber nach seiner Trennung von Karin beschlich ihn manchmal das Gefühl, dem Regisseur etwas zurückgeben zu müssen. Oder etwas mit ihm gemeinsam zu haben, so genau dachte er darüber nicht nach.
Hilda sagte, sie warte sehnlich auf Enkelkinder, sie gehe ihrem Sohn damit schon so auf die Nerven, dass er ihr diesen Wunsch wohl aus Trotz nie erfüllen werde. Jedenfalls drohe er damit. Dann bin ich selber schuld, sagte sie und lachte.
Das Thema behagte Fritz nicht. Schließlich war seine Jüngste noch keine vier. Karin hatte sie als späten Liebesbeweis haben wollen, als Sühne für eine Affäre, an die sich Fritz kaum mehr erinnerte. Dass Judith sofort nach der Schule ausgezogen war, schien auch eine Rolle gespielt zu haben, nie hätte man das bei diesem schüchternen Mädchen vermutet.
Hilda drängte Fritz, ihr ein Foto von den Kindern zu zeigen. Erst zierte er sich, er fand das ›Paradise Now‹ einen in jeder Hinsicht unpassenden Ort für solche Vertraulichkeiten. Sie sagte natürlich, was alle sagen (›ach, so schön blond‹) und behielt das Bild lange in der Hand, aber danach kam seine Familie eine Weile nicht mehr vor.
Sie hatten dann ein paar wirklich gute Wochen. Fritz’ erste Befürchtungen hatten sich schnell zerstreut – Hilda wohnte im Haus des ›Paradise Now‹ und ging nur hinunter, wenn in ihrer geschmackvoll eingerichteten Wohnung der Wein ausgegangen war.
Vor allem hatte Hilda einen unglaublichen Körper. Nach all den Jahren, den Erfahrungen, den oft viel jüngeren Frauen in der Redaktion hatte Fritz nicht mehr erwartet, von einem Körper noch einmal so begeistert zu sein. Dabei hatte Hilda unzählige Operationen an der Wirbelsäule hinter sich, aber die Narben waren ja nur am Rücken. Die sah er selten, Fritz war ein konventioneller Liebhaber. Doch die durch das Rückenleiden bedingte Gymnastik, das Muskeltraining, die fast besessene Beschäftigung mit allen Funktionen ihres Bewegungsapparats hatten Hilda schlank und geschmeidig gehalten. Und ihre Schamhaare ließ sie von der Kosmetikerin bis auf einen schmalen Streifen auf dem Schambein komplett entfernen. Fritz fand das ehrlich, auch vornehm, nicht so einschüchternd wie die wuchernden Büsche, die zwanzig Jahre zuvor üblich gewesen waren.
Karin war diesbezüglich inkonsequent. Sie experimentierte mit Cremes, von denen sie Ausschläge bekam, mit Rasierern, mit denen sie sich schnitt, oder sie vergaß beides und hatte Stoppeln zwischen den Beinen. Dann war da noch diese besondere, leichte Tönung von Hildas Haut, die Fritz faszinierte, etwas irgendwie Olivfarbenes. Karin dagegen hatte seit einiger Zeit mit dem Solarium etwas übertrieben.
Fritz jedenfalls fand Hilda perfekt. Anatomisch genau hatte er sie auch Anton beschrieben, bei dem er seit der Trennung von Karin lebte – zwei Arbeitskollegen, denen, für alle Welt überraschend, plötzlich die Ehen in die Luft geflogen waren. Anton hatte gelacht und ihn damit geneckt, dass er ihn gar nicht für einen solchen Sexisten gehalten hätte. Doch Fritz tat sich schwer, Hilda darüber hinaus zu charakterisieren. Unglaublich lieb sei sie, hatte er schließlich gesagt, nachgiebig, fürsorglich, natürlich keine so starke Frau wie Karin, so stark sei ja kaum eine. Dass Hilda ihm tagsüber E-Mails mit albern blinkenden Smileys und Herzchen schickte, verschwieg er. Aber nachdem Anton mit den beiden einmal ein Glas Wein getrunken hatte, schien er ohnehin zu verstehen. Wie geht es deinem Kätzchen, fragte er nun manchmal und mimte den Neidischen. Fritz stak dieser Ausdruck wie ein Widerhaken im Gedächtnis. Er glaubte nicht, dass Anton ihn verhöhnte, trotzdem war ihm ein bisschen unbehaglich.
Unter der Trennung von Fritz und Karin litt am meisten Paula. Während das kleine Lottchen zum Glück noch kaum etwas begriff und Judith nicht nur von ihrem Studium, sondern vor allem von ihrer ersten großen Liebe abgelenkt war, schien sie völlig den Halt zu verlieren. Sie war schon seit Judiths Auszug schwierig gewesen und hatte in einem beängstigenden Ausmaß abgenommen.
Ein paar Wochen, nachdem Karin ihn unter Flüchen und Drohungen hinausgeschmissen und angekündigt hatte, seinen Umgang mit den Kindern ›in deren Interesse‹ fürs erste so gering wie möglich zu halten, war Fritz mitten in der Nacht aufgewacht, weil Anton, der im Pyjama unerwartet zerknittert aussah, vor ihm stand und ihm das Telefon hinhielt. Sie werde seiner Tochter nicht mehr Herr, hatte Karin geheult, und es liege nicht an ihr, wirklich nicht, sie lasse sich nicht alles anhängen. In einem zweistündigen Gespräch, in dem sie tobsüchtig mehrmals aufgelegt, danach aber gleich wieder angerufen hatte, waren sie schließlich übereingekommen, dass Fritz zu festgelegten Zeiten mit Paula lernen würde. Jedes Mal, wenn er in den folgenden Wochen die alte Wohnung betrat, traf er nur das Mädchen an. Karin legte Wert darauf, ihm nicht zu begegnen, und Paula bemerkte einmal abfällig, sie habe doch längst einen Neuen.
Fritz kam mit Paula viel besser zurecht als erwartet. Bei ihm war sie brav wie ein Lämmchen, und sie bemühte sich mit dem Lernen. Nur beim Abschied hing sie jedes Mal an seinem Hals wie eine kleine Geliebte, schob ihm ihre Hände wie gierige Tiere in den Hemdkragen und flehte unter Tränen, mit ihm kommen zu dürfen. Und jedes Mal vertröstete er sie mit schlechtem Gewissen auf die Zeit, wo er eine eigene Wohnung haben würde. In seine unordentliche Männer-WG konnte er das Kind wirklich nicht mitnehmen, außerdem traute er Anton nicht, der seit seiner Trennung mit Mädchen ausging, die immer jünger wurden. Aber seine eigene Wohnungssuche betrieb er bestenfalls halbherzig. Denn dieses unverbindliche Junggesellenleben war schon eine süße, ungewohnte Freiheit, das wenigstens gestand er sich ein.
Gelegentlich, wenn er sich nach der Arbeit mit Hilda traf, hatte sie große Papiertüten mit dem Schriftzug eines teuren Spielwarengeschäftes dabei. Sie schien dauernd Kinder kennenzulernen, und sie beschenkte die Kinder ihrer Arbeitskollegen zu allen Geburtstagen. Sie verwandte auf diese Geschenke viel Zeit und Liebe. Sooft ein neues zur Welt kam, geriet sie ganz aus dem Häuschen. Um als Gratulantin jederzeit gerüstet zu sein, bewahrte sie in einer ihrer Schreibtischschubladen im Büro ein kleines Sortiment Babyschuhe, Schmusetücher und speichelechte Stofftierchen auf. Doch davon wusste Fritz nichts, darüber spotteten bloß die Kolleginnen. Das einzige Mal, als Fritz Hilda abholte, war ihm die riesige Pinnwand hinter dem Schreibtisch, übervoll mit Kinderfotos, zwar aufgefallen, aber er dachte nicht weiter darüber nach, denn er hatte es eilig, wieder hinauszukommen.
Fritz wich allen Gelegenheiten aus, die seine Beziehung hätten publik machen können. Für die gemeinsamen Abendessen schlug er im Restaurantführer Lokale nach, die abseits seines üblichen Parcours lagen. Er sei einfach noch nicht so weit, hatte er Anton, seinem einzigen Mitwisser, zu erklären versucht, obwohl er sich mit Hilda so wohl wie schon lange nicht fühle. Vielleicht sei er von den achtzehn Jahren mit Karin ja doch irgendwie geschädigt, scherzte er, der sonst für das allgegenwärtige Wohlstandsgerede von Traumatisierung und innerer Bearbeitung nur Spott übrig hatte. Er wolle einfach nichts überstürzen, behauptete er, und außerdem gehe es ihm gegen den Strich, wie Judith und Paula Karins Herrenbekanntschaften kommentierten. Doch als Anton eine seiner gedankenlosen Bemerkungen machte (›Angst vor den Töchtern‹), wurde Fritz richtig wütend, was ihn selbst am meisten überraschte. Es gehe nicht um Angst, zischte er, sondern um Respekt, den Kindern gegenüber und Hilda auch, Respekt, verstehst du, weißt du überhaupt, was das heißt?
Eines Tages brachte Hilda einen grünen Plüschfrosch. Den habe sie unbekannterweise für das kleine Lottchen gekauft, ja, kaufen müssen, flüsterte sie und zwängte ihm das Spielzeug in die Hand. Fritz betrachtete den Frosch, dessen Vorderbeinchen ängstlich zitterten, und als er aufsah, erschienen ihm die bittenden Augen Hildas und des Frosches auf perverse Weise verwandt. Fritz reagierte ungehalten, unbeherrscht, so, wie er es Karin gegenüber oft hatte tun wollen und niemals tat.
Wie sie sich das vorstelle, hatte er höhnisch gefragt und Hilda das flauschige Ding in den Schoß geworfen, ob er die Dreijährige ›unbekannterweise‹ von ihr grüßen solle? Oder das Geschenk als sein eigenes ausgeben? Und was sie eigentlich bezwecke? Wolle sie ihn zu etwas drängen? Da könne er ihr gleich sagen, dass … Nein, nein, hatte Hilda gewimmert und den Frosch in ihren Armen gewiegt, es tue ihr leid, sie habe wohl nicht nachgedacht, nur dieses Fröschlein so unglaublich süß gefunden, und da habe sie … ganz unschuldig, manchmal bin ich halt ein bisschen dumm, verzeih mir bitte, kannst du das? Fritz hatte den Rest des Abends im grimmigen Hochgefühl eines Mannes verbracht, der widerstrebend Verzeihung gewährt, wofür ihm mit immer neuen Wellen ausufernder, untertäniger Zärtlichkeit gedankt wird. Dieses gefährliche Spiel setzte sich bis in die Nacht fort, in der Hilda sich ihm in einem Ausmaß unterwarf, dass Fritz noch am nächsten Tag, mitten in der Redaktionskonferenz, von der Erinnerung eine Erektion bekam, sich dafür dann aber ziemlich schämte.
Als nächstes wurde Judith von ihrem blassen Tierarzt-Aspiranten betrogen, und Karin, Fritz und der Regisseur wechselten sich an ihrem Krankenbett ab. Die beiden Väter wurden beauftragt, Judiths Habseligkeiten aus der Wohnung am Gürtel abzuholen. Zum Glück trafen sie den Blassen dort nicht an, denn Fritz hätte beim besten Willen nicht gewusst, wie er sich verhalten sollte. Das Rachebedürfnis der Frauen zu Hause war grenzenlos, aber weder Fritz noch der Regisseur waren zur Exekution solch unausgesprochener Wünsche geeignet. In diesen Wochen entspannte sich das Verhältnis zwischen Fritz und Karin deutlich. Die Konzentration auf ihr seelisch verwundetes Kind und, wie er später erfuhr, auf die sich vielversprechend entwickelnde neue Liebe machten Karin geradezu leutselig. Deshalb sah er auch keinen Grund, ihr nicht entgegenzukommen, und zog bereitwillig für drei Wochen zu den Kindern, als Karin mit dem Neuen in die Karibik fuhr.
Fast war alles wie früher, und er konnte sich einer gewissen Sentimentalität nicht erwehren: Er stand morgens auf, machte Frühstück, brachte die Kleine in den Kindergarten und trank nachher am Küchentisch einen Kaffee, bevor er in die Redaktion aufbrach. Leider bedeutete das eine Zwangspause mit Hilda. Denn abends Termine zu erfinden, ging ihm gegen den Strich, das hatte er Karin gegenüber zu oft getan. So etwas machte man nur mit der Ehefrau, vor den Kindern erschien ihm das irgendwie unmoralisch. Es kam sogar so weit, dass er wieder masturbierte, und wie früher achtete er darauf, nur die weißen Handtücher zu nehmen. Er tröstete sich damit, dass die Enthaltsamkeit begrenzt sei. Hilda und er tauschten tagsüber dreckige E-Mails aus, das bereitete ihm erhebliches Vergnügen. Doch als auf einmal keine dreckige, sondern eine sehnsüchtige, viel zu pathetische E-Mail mit vielen blinkenden Herzchen kam, die mit der Frage endete, ob nicht die beiden Mädchen einmal abends auf die Kleine aufpassen könnten, meldete Fritz sich ein paar Tage überhaupt nicht mehr bei ihr.
Daheim begannen sich seine Töchter auf unklare Weise zu regen. Jedes Mal, wenn er sich zu ihnen setzte, fingen sie mit den Schwierigkeiten an, die sie mit ihrer Mutter zu haben behaupteten, klagten und jammerten, zählten selbstmitleidig Karins Unzulänglichkeiten und Ungerechtigkeiten auf, doch Fritz war unaufmerksam, reagierte kaum und wollte die versteckten Botschaften nicht hören. Eines immerhin schien ihm klar: Dies war kein guter Zeitpunkt, um Hilda bei ihnen einzuführen.
Schließlich brach Hilda alle Abmachungen und rief eines Abends an. Paula, die ans Telefon gegangen war, erstarrte erst und schnitt dann Grimassen zu Judith, die seit ihrem schweren Schlag meistens zu Hause war. Fritz war so wütend wie erregt, als er Hildas kindliche Stimme hörte. Er wechselte nur ein paar Worte und legte dann auf. Paula und Judith zischte er zu, dass er ausgehe und wahrscheinlich über Nacht bleibe. Judith werde hoffentlich imstande sein, Lottchen am nächsten Tag in den Kindergarten zu bringen. Dann ging er geräuschvoll, begleitet vom Schweigen seiner Töchter.
Als Hilda die Tür öffnete, packte er sie und drängte sie ins Schlafzimmer. Nachher stellte er fest, dass er sogar die Wohnungstür offen gelassen hatte. Er fiel wie ein Verrückter über sie her, ihm war, als könnte er sich auf diese Weise blindlings von ihr, von Karin, von seinen verzogenen Gören, von seinem ganzen beschissenen Leben abspalten. Noch nie war er sich so fremd gewesen. Als er, nach einem gewaltigen Orgasmus, bei dem er brüllte wie ein Tier – Fritz hatte männliche Geräusche beim Sex immer verabscheut –, widerstrebend aus seinem Rausch erwachte, bemerkte er, dass sie einen riesigen braunen Teddybär unter sich begraben hatten. Hildas seligen Blick konnte er kaum ertragen. Und doch fühlte er sich geläutert. Plötzlich lag er wie ein Kind in ihren Armen und machte unsinnige Versprechungen. Danach gingen sie händchenhaltend ins ›Paradise Now‹, saßen unter der künstlichen Palme und knutschten wie Gymnasiasten.
Später konnte er nicht mehr sagen, ob es an Paula lag, die sich zu gebärden begann wie eine Irre und ihn schließlich mit totaler Nahrungsverweigerung erpresste, an Karin, die nach ihrer Rückkehr aus der Karibik genauso unberechenbar, aggressiv und bedrohlich war wie in den schlimmsten Ehezeiten, an Hilda, die ihn mit ihrem grenzenlosen Verständnis fast erstickte, oder an ihm selbst, der die Sache mit Hilda vielleicht überschätzt hatte. Vielleicht war es doch nur eine der üblichen Affären gewesen, die ihren Reiz verlieren, sobald sie verbindlich werden.
In den Jahren, die folgten, machten seine großen Töchter im Streit gelegentlich noch Bemerkungen über ›diese Hilda‹, als hätten sie etwas gegen ihn in der Hand. Im Grunde hatten sie nur vorzubringen gehabt, dass sie ›so scheußlich schwarzhaarig‹ war, denn sie kannten sie ja kaum. Als die Angelegenheit frisch war, hatten sie noch ganz andere Sachen über Hilda gesagt, aber das hatte Fritz sich mit ihrer emotionalen Überreizung erklärt und so schnell wie möglich vergessen.
Als Fritz seinen fünfzigsten Geburtstag feierte, im ›Blaubichler‹ oder im ›Jakobinerwirt‹, lud er sogar Anton dazu ein. Der war ihm über die Jahre irgendwie abhanden gekommen, Fritz hätte gar nicht mehr genau sagen können, warum. Klar, dass auch Karin kam, mit ihrem dritten Ehemann, einem Funktionär der Industriellenkammer. Seit den furchtbaren Wochen damals, als Paula zwei Tage lang auf der Intensivstation lag und Karins Karibikbräune dort im Neonlicht noch fremder aussah als ihr verkabeltes Kind, lief es mit ihr eigentlich wieder ganz gut. Fritz konnte mit dem Funktionär allerdings viel weniger anfangen als mit dem Regisseur. Er fand es fast unfair, den Funktionär als Gast bei seinem Geburtstagsfest zu haben, während der Regisseur fehlte. Karin jedenfalls hatte ihm unlängst sogar Handwerker besorgt, für die Renovierung der Wohnung, die wirklich überfällig war. Die Küche war tatsächlich seit Paulas Geburt nicht gestrichen worden! Für solche praktischen Aufgaben hatte Karin immer schon ein Händchen gehabt. Auch bei der Auswahl der Fliesen hatte sie ihn beraten, Fritz konnte nichts dabei finden, sie hatte schließlich selber lange genug da gewohnt.
Als er damals, nach der Sache mit Hilda, bei Anton zusammengepackt hatte und endgültig zurück zu den Kindern gezogen war, hatte er kurz überlegt, was mit den Kartons geschehen sollte, die er bei seinem Auszug in Karins Keller deponiert hatte, vorübergehend, wie er damals glaubte. Er beschloss, sie im Keller, der ja nun seiner war, zu lassen. Was ihm in all den Monaten bei Anton nicht abgegangen war, konnte nicht so wichtig sein. Irgendwann, in ein paar Jahren, könnte man die Sachen noch einmal durchschauen. Vielleicht wäre es dann ganz lustig, auf längst Vergessenes zu stoßen. Aber wahrscheinlich würde man sie nie mehr öffnen, diese alten Kisten. Wenn er an die schlimme Zeit damals schon unbedingt denken musste, dachte er noch am liebsten an die Szene mit Lottchen. Als er mit dem ersten Umzugskarton keuchend im vierten Stock angekommen war, hatte seine Jüngste ihm die Tür weit geöffnet, theatralisch den Schnuller aus dem Mund genommen und gekräht: ›Und jetzt bleibt Papa für immer.‹
Gefräßigkeit
Martine war gerade siebzehn, lang, dünn, zur Zeit braungebrannt und bestimmt noch nicht trocken hinter den Ohren. Der Campingurlaub mit ihrem Freund war eine einzige Katastrophe gewesen, und sie war froh, endlich von ihm weg zu sein. Sie hatten überhaupt kein Geld, und die Idee, in die Toskana zu fahren, war deshalb von vornherein ziemlich bescheuert. So waren sie die ganze Zeit an dem einen Strand gehockt, der vom Campingplatz aus zu Fuß zu erreichen war, Essen aus dem Supermarkt, Brot, Tomaten, Käse, drei Wochen lang nichts Warmes, das war Martine nicht gewöhnt. Ihr Freund, zehn Jahre älter als sie, vertrug die Sonne nicht, das, musste sie sagen, war dann beinahe ein Vorteil. Sie hatte um fünfzehntausend Lire eine Luftmatratze gekauft, gleich am ersten Tag, da hatte sie noch nicht gewusst, dass es mit dem Geld so knapp werden würde. Und so schaukelte sie tagein, tagaus auf der Luftmatratze auf dem Meer, auf ihrem ›Wassergrill‹, und hielt sich mit der Hand an einer Boje fest, um nicht abzutreiben. Er saß derweil am Strand im Schatten, im langen Hemd, eine alberne Kappe auf dem Kopf, und las Freud. Die ganze Traumdeutung und dann noch alle Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Für andere Unternehmungen war es viel zu heiß. Wenn sie am mittleren Vormittag den Strand erreichten, kippte ihr schon fast der Kreislauf weg. Abends saßen sie vor dem Zelt im Staub und spielten Karten. Dreimal hatten sie miteinander geschlafen. Man begann sofort zu schwitzen und glitschte nur so aufeinander herum. Er war ihr erster Liebhaber, und zuerst hatten sie ein halbes Jahr lang alles andere gemacht, außer richtig. Alles andere hatte ihr sehr gefallen. Aber bei richtig, da spürte sie einfach nichts. Und zu dem Schweiß noch der Staub, auch im Zelt.
Eigentlich war sie die ganzen drei Wochen nur wirren Träumen nachgehangen. Zuhause in der Stadt, da war dieser Arzt, bei dem sie in den Ferien aushalf, zweiundzwanzig Jahre älter als sie, der machte sie ganz unverhohlen an. Wenn sie daran dachte, war es, als würde in ihrem Bauch, gleich hinter dem Nabel, etwas herunterfallen. Wie beim Achterbahnfahren, nur fällt es da hinauf. Am Abend vor ihrer Abfahrt hatte der Arzt sie geküsst und wie wild an sich gepresst. Daran dachte sie häufig, und immer fiel dann das Ding hinter dem Nabel herunter. Fast immer. Ihr Vater hatte sie vor dem Arzt gewarnt. Unhommes à femmes, so höre man, aber sie hatte nur gelacht. Der alte Trottel, hatte sie gefragt, und ihr Vater hatte gelächelt. Es war so leicht, ihren Vater zu beruhigen. Er wollte beruhigt werden, deshalb.
Wenn sie auf der Luftmatratze lag, machte sie sich klar, dass sie sich zum Arzt nichts weiter vorstellen konnte. Nur die prickelnde Erinnerung an den Abschiedskuss, aber keine Tagträume zur Zukunft. Sich auszumalen, dass sie mit dem Arzt dasselbe tun könnte wie mit ihrem Freund im Zelt, war unmöglich. Das wollte sie auch gar nicht, da war sie sicher.
An Fiona dachte sie kaum, auf der Luftmatratze. Das war wie früher, als Kind zu Weihnachten, da hatte sie sich auch immer bemüht, möglichst gar nicht daran zu denken, denn sie hatte geglaubt, die Freude sei dann größer, reiner. Nicht wie ihr kleiner Bruder, der dauernd fragte, wann kommt endlich das Christkind, dabei hätte er doch wissen müssen, dass es irgendwann auf jeden Fall kommt. Wenn man weiß, dass etwas Schönes passieren wird, hält man vorher gedanklich die Luft an, sozusagen.
So wie sie auch niemals, unter keinen Umständen, hinuntergeschaut hätte, während sie zur Gloriette hinaufstieg. Kein Blick zur Stadt hin, immer nur starr auf ihre Zehen. Und erst dann umdrehen, wenn man ganz oben war. Wenn der Höhenunterschied zum Ausgangspunkt am größten ist, ist es auch das Gefühl. Sie als Orpheus hätte nicht versagt, aber das behielt sie in der Schule für sich.
Fiona hatte sie es einmal zu erklären versucht, nicht am Weg zur Gloriette, sondern im Auto auf der Höhenstraße. Fiona steuerte den Wagen ruhig durch eine Serpentine nach der anderen, Martine war hingerissen. Sie versuchte, Fiona nicht direkt anzuschauen, sondern nur aus dem Augenwinkel. Sie grübelte nach einer interessanten Bemerkung und entschloss sich dann, ihr geheimes Kinderspiel preiszugeben. Eigentlich war es kein Kinderspiel, sie machte es ja immer noch so. Aber das verschwieg sie. Während sie ihr Prinzip des Nicht-Hinunterschauens, des Vermeidens von Vorfreude beschrieb, hatte sie wieder das Gefühl, dass sie zu viel mit den Händen fuchtelte. Plötzlich kam ihr ihr T-Shirt, bestickt mit einem Pfau aus Pailletten, total peinlich vor, aber dazu war es jetzt zu spät. Fiona trug ein apfelgrünes Fred-Perry-Polohemd, zwei von drei Knöpfen geschlossen, bei jedem anderen wäre ihr das spießig vorgekommen. Martine warf einen Blick auf Fionas Profil. Sie schien zu lächeln. Erzähl weiter, sagte Fiona und tastete nach dem Traubenzucker, der neben der Handbremse lag. In einem Anfall von Übermut nahm ihr Martine den Traubenzucker weg und begann ihn aufzumachen. Sie erzählte weiter, fast hysterisch, mit viel zu großen Worten. Formulierungen wie stärkste Empfindung, verwässernde Zwischenstufen, Selbstbeherrschung der Augen und der Gefühle kollerten aus ihrem Mund, während das perforierte gelbe Bändchen um den Traubenzucker natürlich wieder abriss. Sie kratzte den Rest der Folie mit dem Fingernagel ab, während sie, übertrieben ironisch, davon sprach, dass die meisten Menschen sich eben nicht beherrschen könnten und sich daher selbst um die größten Empfindungen brächten. Wortwiederholung!, mahnte die kritische Instanz in ihrem Kopf. Gerade bei einem Wort wie ›Empfindung‹ in dieser Situation sehr nachteilig. Sie hatte den viereckigen Traubenzucker endlich ausgepackt. Sie beugte sich zu Fiona hinüber, fragte sich, ob es wirklich wahr sein konnte, was sie da tat, und hielt ihn ihr vor den Mund, dabei bemüht, ihr nicht mit dem Arm die Sicht zu nehmen. Fiona runzelte die Stirn, schnappte mit makellos geschminkten Lippen danach und zog den Kopf sofort zurück. Es hatte nicht die geringste Berührung gegeben. Du furchtbare kleine Romantikerin, sagte Fiona, und übrigens, deine Sandalen stinken.
Am Tag, als Martine ankommen sollte, hatte Fiona sich gerade wieder so im Griff. Die ersten zweieinhalb Wochen in dem italienischen Städtchen waren ein Balanceakt gewesen, mit irgendwie herumgebrachten Tagen und Nächten, in denen sie mit Alkohol, Zigaretten und kleinen Tabletten alle Grenzen aufsuchte, die sie kannte. Zweimal war sie mit einer Gruppe aus dem Sprachkurs essen gegangen, aber nach kurzer Zeit saß sie nur da und konnte die Stimmen kaum voneinander unterscheiden. Sie war dann immer früh aufgebrochen und hatte sich in der kleinen Wohnung, die sie gemietet hatte, wieder ihren speziellen Ritualen zugewandt.
Im Kurs gab es mindestens zwei junge Männer, von denen sich unter anderen Umständen Ablenkung und Selbstbestätigung hätten erhoffen lassen, aber jeder Gedanke an Sex löste in Fiona zur Zeit Panik aus. Und nun sollte das Mädchen kommen. Sie hatte schon daran gedacht, einfach nicht zum Bahnhof zu gehen. Dann müsste die Kleine wohl den nächsten Zug nach Hause nehmen, und im Herbst könnte man von einem schrecklichen Missverständnis sprechen. Aber so etwas schaffte Fiona nicht, da war sie doch zu sehr Lehrerin.
Vielleicht tat ihr das Mädchen sogar gut, in all der romantischen Verehrung, die es ihr entgegenbrachte, in seinem jugendlichen Übermut, der von den Härten des Lebens noch nichts wusste. Es geschah nur alle paar Jahre, dass eine Schülerin sie wirklich interessierte, und so wie mit Martine war es noch nie gewesen. Sie war ihr sofort aufgefallen, gleich in der ersten Stunde, weil sie so skeptisch schaute und als einzige fließend Französisch sprach. Die anderen schienen sie als Anführerin zu akzeptieren, obwohl Martine nichts Erkennbares dafür tat. Das brachte ihr bei Fiona den nächsten Pluspunkt ein. Sie kannte alle gruppendynamischen Spielchen, die die Mädchen in diesem Alter miteinander trieben, und die typischen Herrschaftsgesten der Leitzicken, wie es sie in fast jeder Klasse gab, verabscheute sie. Sie hatte in manchen Fällen ein gewisses Vergnügen daran gefunden, gerade die Leitzicken zu demütigen, und beobachtete danach mit naturwissenschaftlichem Interesse, wie sich die Machtverhältnisse verschoben.
Vielleicht hatte sie es mit Martine ja ein bisschen übertrieben, aber im vergangenen Frühling, als sie so verliebt war wie noch nie, war das junge Mädchen gerade die richtige Begleitung gewesen. Sie unternahmen schwelgerische Ausflüge ins Umland, die nicht nur die Wochenenden schnell herumbringen sollten, welche der geheime Geliebte derzeit noch mit Frau und Kind verbringen musste, sondern schon Erkundungsreisen waren für eine gleißende Zukunft zu zweit.