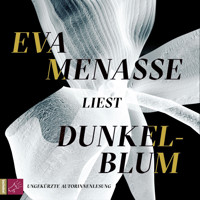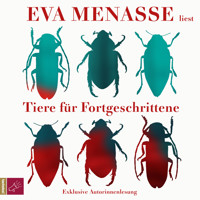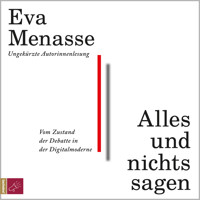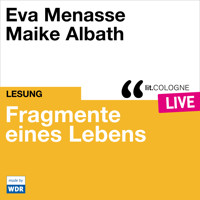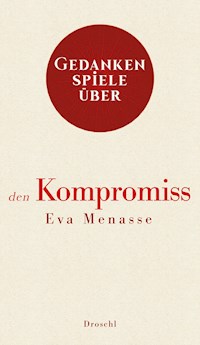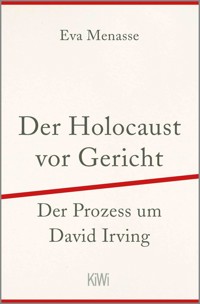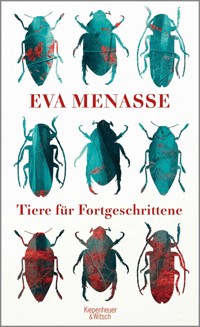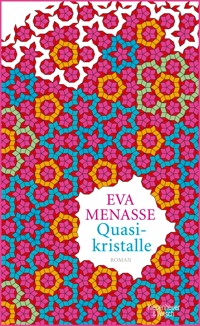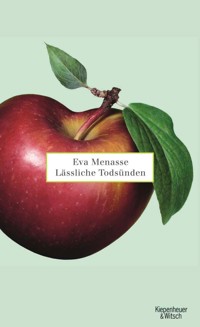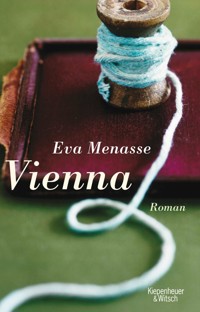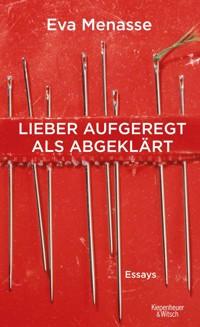10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zieht sich eine liberale Gesellschaft gerade den Boden weg, auf dem sie fest stehen sollte? Ein Essay darüber, was die digitale Massenkommunikation zwischenmenschlich anrichtet. Nichts hat das Zusammenleben so umfassend verändert wie die Digitalisierung – wir denken, fühlen und streiten anders, seit wir dauervernetzt und überinformiert sind. Die Auswirkungen betreffen alle, egal, wie sehr sie die neuen Medien überhaupt nutzen. Es ist ein Stresstest für die Gesellschaft: Der Überfluss an Wissen, Geschwindigkeit, Transparenz und Unlöschbarkeit ist, unkanalisiert, kein Wert an sich. Demokratiepolitisch bedeutsam wird dies bei der vielbeschworenen Debattenkultur. Denn die Umgangsformen der sogenannten Sozialen Medien haben längst auf die anderen Arenen übergegriffen, Politik und Journalismus spielen schon nach den neuen, erbarmungsloseren Regeln. Früher anerkannte Autoritäten werden im Dutzend abgeräumt, ohne dass neue nachkommen, an die Stelle des besseren Arguments ist die knappe Delegitimierung des Gegners getreten. Eine funktionierende Öffentlichkeit – als Marktplatz der Meinungen und Ort gesellschaftlicher Klärung – scheint es, wenn überhaupt, nur noch in Bruchstücken zu geben. In ihrem Essay kreist Eva Menasse um die Fragen, die sie seit vielen Jahren beschäftigen: vor allem um einen offenbar hoch ansteckenden Irrationalismus und eine ätzende Skepsis, vor denen niemand gefeit ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Eva Menasse
Alles und nichts sagen
Vom Zustand der Debatte in der Digitalmoderne
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Eva Menasse
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Eva Menasse
Eva Menasse, geboren 1970 in Wien, begann als Journalistin und debütierte im Jahr 2005 mit dem Familienroman »Vienna«. Es folgten Romane und Erzählungen (»Lässliche Todsünden«, »Quasikristalle«, »Tiere für Fortgeschrittene«), die vielfach ausgezeichnet und übersetzt wurden. Preise (Auswahl): Heinrich-Böll-Preis, Friedrich-Hölderlin-Preis, Jonathan-Swift-Preis, Österreichischer Buchpreis, Bruno-Kreisky-Preis, Jakob-Wassermann-Preis und das Villa-Massimo-Stipendium in Rom. Eva Menasse betätigt sich zunehmend auch als Essayistin und erhielt dafür 2019 den Ludwig-Börne-Preis. Ihr letzter Roman »Dunkelblum« war ein Bestseller und wurde in neun Sprachen übersetzt. Sie lebt seit über zwanzig Jahren in Berlin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Was hat die digitale Massenkommunikation zwischenmenschlich angerichtet?
Nichts hat das Zusammenleben so umfassend verändert wie die Digitalisierung – die Menschen denken, fühlen und streiten anders, seit sie dauervernetzt und überinformiert sind. Die Auswirkungen betreffen alle, egal, wie sehr sie die neuen Medien überhaupt nutzen. Es ist ein Stresstest für die freie Gesellschaft: Der Überfluss an Information, die Unlöschbarkeit und der Zwang zur Geschwindigkeit haben enorm giftige Seiten.
In ihrem literarischen Essay kreist Eva Menasse um Fragen, die sie seit vielen Jahren beschäftigen: digitale Umgangsformen, die auf die anderen Arenen übergegriffen haben, etwa auf Politik und Journalismus – sie spielen längst nach den neuen, erbarmungsloseren Regeln. Vormals anerkannte Autoritäten, die im Dutzend abgeräumt werden, ohne dass neue nachkommen, weil an die Stelle des besseren Arguments die knappe Delegitimierung des Gegners getreten ist. Und spätestens seit der Coronapandemie fällt auf, dass der Irrationalismus so ansteckend geworden ist wie ein Virus.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2023, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben
ISBN978-3-462-30142-7
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Kapitel I. Zeitenwende
Kapitel II. Ansteckende Krankheiten, ansteckende Medien
Kapitel III. Maßstäbe 1
Kapitel IV. Maßstäbe 2
Kapitel V. Die ideale Debatte und was von ihr übrig ist
Kapitel VI. Das digitale Ich und die anderen
Kapitel VII. Angst und Anonymität, Masse und Moral
Kapitel VIII. Religionsmetaphern und moralisches Flügelschlagen
Kapitel IX. McWhorter goes Germany
Kapitel X. Vom Zauber der Unklarheit
Dank
Literaturverzeichnis
für Mona
Kapitel I.Zeitenwende
»Das Internet« ist zu groß, um darüber zu schreiben. Zu anderen Themen fällt manchmal der Satz, es sei darüber schon alles gesagt, bei diesem müsste er lauten: »Es sagt doch alles dauernd selbst.« Hier ist ein erstes Problem: Man kann sein Verhältnis zu diesem Thema nicht mehr trennscharf definieren; kann man es überhaupt noch mit Abstand betrachten, oder ist man bereits zu sehr in seinen klebrigen Fäden verstrickt? Auch der Falter im Spinnennetz glaubt vermutlich, noch vieles wahrnehmen und beurteilen zu können, obwohl er die Perspektive nicht mehr wechseln kann. Immerhin hat er einmal fliegen können, während so viele andere bereits im Netz geboren wurden – digital natives.
Ohne Zweifel gibt es die analoge Welt noch. Dort stinken die Mülltonnen und müssen die Nabelschnüre Neugeborener händisch von Erwachsenen durchschnitten werden. Früchte reifen ohne Zutun und verfaulen wieder, Vulkane brechen aus, Wüsten entstehen, Gletscher vergehen. Es gibt dort draußen Blut und Tränen, Schimmel, Lärm, Vogelgesang und Erdbeben. Es gibt echten Zufall, spontane Liebe, unaufklärbare Verbrechen, Mutationen und Geheimnisse. Und es gibt typisch menschliches Verhalten, darunter Ängste, die sich in Jahrmillionen körperlich eingeschrieben haben und weitervererbt werden. Menschen fürchten sich intuitiv immer noch vor Skorpionen und Schlangen anstatt vor Autos.
So bestürzend langsam ist dieses Säugetier, einerseits. Seine durchschnittliche Lebenserwartung mag sich, zumindest für die in Industriestaaten lebenden Exemplare, binnen zweihundert Jahren mehr als verdoppelt haben; im Vergleich zu der Zeit, die seine Reaktions- und Verhaltensmuster gebraucht haben, um sich auszubilden, ist das nicht einmal ein Wimpernschlag.
Andererseits verheddert sich das hochmütige, himmelsstürmende Säugetier augenscheinlich immer häufiger in seinen eigenen Erfindungen. Das ist ihm schon früher widerfahren, als es Waffen schuf, die weiter entfernt töteten, als seine Augen sehen konnten, als es Bomben baute, die Landstriche auslöschten und auf Jahrzehnte kontaminierten, als es versuchte, sich zu klonen, und begann, in die eigenen genetischen Strukturen einzugreifen. Inzwischen züchtet es sowohl Fleisch wie Intelligenz im Labor. Faszinierend bleibt, dass es seinen potenziell lebensbedrohlichen Ehrgeiz selbst immer künstlerisch-analytisch begleitet hat. Es dachte sich Ikaros aus, der zu nah an die Sonne flog, sodass seine künstlichen Flügel schmolzen, Midas, der in seiner Gier zu ungenau wünschte und verhungern und verdursten musste, weil ihm auch Wasser und Brot zu Gold wurden, eben alles, was er berührte. Und ein wiederkehrendes Motiv ist das vom vergessenen Zauberspruch, von der verlorenen Kontrolle über die eigenen Schöpfungen. Im Märchen vom süßen Brei, dem kürzesten der Brüder Grimm, wird eine ganze Stadt unter dem Hirsebrei begraben wie Pompeji unter dem Lavastrom, weil nicht das hungrige Kind, sondern seine Mutter den magischen Topf in Betrieb genommen hat und nicht mehr zu stoppen vermag. Dasselbe Motiv goss Goethe in seiner Ballade vom »Zauberlehrling« in eine ewig gültige Form: »Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los.«
Man könnte sich also gelangweilt zurücklehnen, unauffällig auf dem iPhone die Weltlage überfliegen, die privaten Nachrichten checken, nach einem Flug googeln oder ein Pornobild verschicken und dabei denken: Es ist bloß technischer Fortschritt, vor fünfzig Jahren noch so unvorstellbar wie hundert Jahre davor die Passagierluftfahrt. Das Leben wird immer leichter, Wissen und Möglichkeiten explodieren einerseits und sind doch, betörendes Paradox, theoretisch für alle erreichbar. Ängstliche und Skeptiker hat es ebenfalls immer gegeben. Wisst ihr noch? Damals, als die erste Eisenbahn fuhr, dachten manche, die inneren Organe des Menschen würden die vierundzwanzig Stundenkilometer nicht vertragen, könnten innerlich abreißen und einander tödlich beschädigen. Damals, als die ersten Fotografien gemacht wurden, glaubten manche, der Apparat stehle ihnen die Seele. Und in Wahrheit? Machen wir immer weiter, schicken wir Sonden zum Mars, setzen wir Stents in Herzkranzgefäße, fast so leicht, wie man Glühbirnen einschraubt, haben wir Kühlschränke, die selbständig Milch und Butter nachbestellen, und Roboter, die unsere Gefühle erkennen und zum Trost halbwegs glaubhafte Liebesbriefe schreiben.
Aber das stimmt nicht. Diesmal ist es anders, größer, umfassender, folgenreicher. Die Digitalisierung aller Lebensbereiche ist mit einer Wucht und Geschwindigkeit über die Menschheit hereingebrochen wie keine andere Erfindung zuvor. Sie verändert sich und uns immer weiter, beständig nur in ihrem lawinenhaften Charakter. Gerade weil die Rechenleistungen sich dauernd multiplizieren, ist unabsehbar, was als Nächstes kommt.
»Das Internet« ist ja keine Erfindung allein, sondern eine ganze Serie von seit Jahrzehnten ineinandergreifenden, aufeinander aufbauenden technischen Errungenschaften. So als hätten sich, wie in einem guten Skript, viele geniale Tüftler verabredet, um gemeinsam etwas zu schaffen, das die Welt noch einmal neu aufsetzt. Und das ist gelungen. Jetzt, im Nachhinein, könnte man die Zeitpunkte markieren, als die einzelnen Bestandteile aneinander andockten und einander fortschrieben, als die Entwicklungen einander schwindelerregend beschleunigten. Als sich die Knoten formten und verbanden wie die Myzele unter dem Waldboden, als Triebe sprossen und aufeinander zustrebten.
Nicht zufällig heißt es »Netz«. Es umspannt nicht nur den Planeten, sondern verbindet seine menschlichen Bewohner in einem viel weiter reichenden Ausmaß als alle alten Netze, die bloß äußerlich Schienen, Strom- und Telefonleitungen an den Erdball legten. Denn es durchdringt die Bewohner inzwischen auch. Zu seinen physisch-technischen Ausformungen hat es psychologische, soziologische, ja metaphysische Aspekte gewonnen. Und sogar naturhafte. Es ist so schnell gewachsen, es wucherte über seine eigenen frühen Konstruktionsfehler so eilig und blindlings hinweg, dass es dadurch Eigenschaften einer Naturgewalt erlangte; die ersten Fehler erzwangen so viele Improvisationen, dass inzwischen niemand mehr korrigierend eingreifen kann. Um es noch einmal neu und besser, mit dem heutigen Wissensstand aufzubauen, ist es schon lange zu spät. Die Menschen können deshalb, einer Art digitalem Urknallchaos geschuldet, nicht mehr auf den Grund ihrer eigenen Kreation schauen; sie hat sich unter ihren Händen wieder verschlossen: »Das Ergebnis ist […], dass wir das Internet heute nicht mehr von innen prüfen können, wie man es mit den Büchern eines Finanzunternehmens tun könnte, sondern so behandeln müssen, als wäre es ein Teil der Natur. Wir müssen es erforschen, als wäre es ein unbekannter Kontinent, obwohl wir selbst es geschaffen haben«, schrieb Jaron Lanier schon vor über einem Jahrzehnt.
Das Internet mag als Werkzeug gedacht gewesen oder es in Teilen noch immer sein. Aber eine Fähigkeit, an der vorab niemand einen Nachteil hätte erkennen mögen, hat unter den Menschen enorme Verheerungen angerichtet: die digitale Massenkommunikation. Nichts hat innerhalb von wenigen Jahren menschliches Leben und Verhalten so massiv verändert. Als wäre es eine Weltformel, können die Dauervernetztheit der Menschen, ihr Dauergespräch, ihr Dauerstreit zur Erklärung von so vielem, fast allem, herangezogen werden, was in den letzten Jahren scheinbar so unerklärlich angeschwollen ist, die Wut, der Hass, die Überforderung, der Frust, der grassierende Irrationalismus, die Verschwörungserzählungen und die politische Extremisierung. Die Folgen können überall beobachtet werden, in den »alten« Medien, in der Politik und im hintersten Kaff, gerade auch dort, wo das Netz selbst gar nicht mehr hinreicht. Niemand kann sich seinen Auswirkungen entziehen, alle agieren heute grundlegend anders als noch vor fünfzehn Jahren: Richter, Kinder, Umweltschützer, Kommunikationsexperten; Politiker und Journalisten sowieso, sogar Flüchtende.
Wahrscheinlich ist es eine Weltformel: die Weltformel der globalen Gesellschaft wird gebildet aus den heißen Drähten, an denen sie unentrinnbar hängt.
Man könnte das, was fast mit einem Schlag eingesetzt hat, analog dem World Wide Web auch »Weltkommunikation« nennen. Eine solche ist zum ersten Mal möglich, indem ein Großteil der Weltbevölkerung theoretisch unkompliziert miteinander in Verbindung treten kann, ohne große Hürden oder Kosten, in Echtzeit, ungeachtet aller Zeitverschiebungen und Entfernungen. Es begann, als das »mobile« oder altmodisch so genannte »Handtelefon« vom Telefonnetz, den Mobilfunkanbietern und ihren Phantasie- und Roamingpreisen unabhängig wurde. Plötzlich war es kein Telefon mehr, obwohl es in den meisten Sprachen immer noch so heißt, sondern war zum maximal potenten Weltempfänger und -sender geworden. Hierin liegt aber bereits ein kategorialer Unterschied: Während die »alten Massenmedien« wie Kino, Radio und Fernsehen Millionen von Konsumenten zu leicht erreichbaren Empfängern machten (und all die Ängste von Lenkung und Beeinflussung hervorriefen, die heute lachhaft wirken), haben die neuen Telefone einen erstaunlichen Teil der Medienmacht zurück an die Masse gegeben.
In George Orwells weltberühmtem Totalitarismus-Roman »1984« hängt bei allen Mitgliedern der »Äußeren Partei« ein unabschaltbarer »Teleschirm« zu Hause an der Wand, aus dem gelegentlich Befehle dringen, der die Bewohner aber vor allem belauscht und ausspäht. Aber dass umgekehrt alle von überall her, ohne sich groß zu bewegen, eine Unzahl an Ereignissen außerhalb ihrer eigenen vier Wände sehen, hören, kommentieren, bewerten und damit direkt beeinflussen können, lag 1948, als der sterbenskranke Autor seinen letzten Roman schrieb, wohl jenseits jeder Vorstellung. Orwell mit seiner analytischen Phantasie hätte dieses Kippbild gewiss nicht weniger bedrohlich gefunden: egal, ob man zu allen ins Privateste reinbrüllen und -lugen kann oder ob alle von zu Hause aus woanders reinlugen und -brüllen – das ähnelt sich systemisch doch sehr.
Indem die neuen Telefone zu etwas ganz anderem wurden, veränderten sie auch ihre Besitzer. Anders als vom Teleschirm entfernt man sich ja nie von ihnen, die meisten nehmen sie mit auf die Toilette und ins Bett. Und dem eigenen Mail-, Instagram- oder Twitter-Account kann sich sowieso niemand entziehen; vorübergehendes Ignorieren verschlimmert die Sache eher, denn es staut Flutwellen auf.
Diese Geräte haben schier unendliche Fähigkeiten erlangt. Mit allem, was sie speichern, bilden sie einen Großteil (wenn auch nicht alles) der individuellen Eigenschaften und Charakteristika ihrer Besitzer ab. Sie, die Menschen, sind in Wahrheit die »Endgeräte«, sie sind seither zu empfindlichen und beweglichen Schwärmen zusammengeschaltet. Aber während sich dank der Menge an laufend erhobenen Daten nun so vieles, vom Wetter über die Erderwärmung bis zum Wahl- und Konsumentenverhalten, immer präziser berechnen lässt, sind die psychosozialen Interferenzen zwischen Milliarden Telefonbesitzern völlig unberechenbar geworden. Enorme Emotionen werden digital freigesetzt, »geteilt« und um die Welt geschickt, sie pflügen Politik und Gesellschaft um, einschließlich des Lebens vereinzelter digitaler Eremiten, die nie ein solches Gerät besessen und nie an »sozialen Netzwerken« teilgenommen haben.
Diese digitale Massenkommunikation, von deren Auswirkungen auf wohlhabende und demokratische Gesellschaften dieser subjektive Essay handeln soll, war ungefähr ab dem Jahr 2009 erreicht, als, drei Jahre nach Twitter, mit WhatsApp eine Anwendung auf den Markt kam, die noch einfacher, direkter, privater war als E-Mail oder Facebook. Von diesem Zeitpunkt an sind, nur als besonders eindrückliches Beispiel, in den USA die psychischen Probleme von Kindern und Jugendlichen ebenso wie ihre Selbstmordraten um ein Vielfaches in die Höhe geschossen.
Auch alle anderen negativen Auswirkungen sind natürlich längst bekannt und beschrieben; Begriffe wie Onlinesucht und Internetkriminalität, Cybermobbing, Cyberstalking und Cyberwar liegen so gut im Mund wie früher Bankraub oder Heiratsschwindler.
Trotzdem will mir scheinen, dass das wahre Ausmaß der gesellschaftlichen Veränderung nicht richtig wahrgenommen, vielleicht sogar bannend abgeleugnet wird, außer von Beobachtern an seinen beiden äußersten Rändern: jenen, die das Netz von Anfang an mit aufgebaut und Gefahren und Fehlentwicklungen früh erkannt haben, wie Jaron Lanier oder James Bridle, und den ganz anderen, vom genau entgegengesetzten Rand, nämlich den fernstehenden Laien, die noch nie eine eigene Webseite, geschweige denn einen Twitter-Account hatten, aber die atmosphärischen Veränderungen umso genauer spüren, weil nichts, auch keine Lebenserleichterung oder unverzichtbare neue App, sie davon ablenkt. Der Installationskünstler und Technologie-Philosoph Bridle sprach einen Satz aus, der von beiden Rändern stammen könnte: »Die Welt ist nicht digital, die Welt ist analog. Und das meine ich nicht im Sinne von knisternden Schallplatten im Vergleich zu sauberen MP3s oder ähnlichem, obwohl es eine entsprechende Qualitätsminderung gibt. Was zwischen den Einsen und Nullen passiert, geht verloren, und das Ergebnis ist tiefe Gewalt, weil das, was verloren geht, entweder gelöscht oder gewaltsam unterdrückt wird«.[1]
Mensch und Gesellschaft wurden folgenreicher und vor allem viel schneller umgeformt als selbst durch die Industrialisierung. In eineinhalb Jahrzehnten sind die Bedingungen des Menschseins grundlegend andere geworden. Die globale Digitalisierung ist daher die einzige und wahre Zeitenwende – eine solche kann niemals ausgerufen, sondern erst in der Rückschau bemerkt werden. Kein Krieg, keine Wirtschaftskrise, auch nicht die Pandemie hatten vergleichbare Auswirkungen. Die Art, wie Menschen die Welt wahrnehmen, ist eine andere geworden, ihr Verhalten und ihre kognitiven Fähigkeiten haben sich ebenso verändert wie die Grundlagen des Zusammenlebens, die Ansprüche an-, die Ungeduld mit-, der Hass aufeinander.
»Die Menschen sind nicht darauf vorbereitet, mit Milliarden Zeitgenossen in voller Kenntnis ihrer Gegenwart zu koexistieren. Früher wurden die Diskretionsabstände zwischen den Nationen und Kulturen durch die Geografie hergestellt. Schwer überwindbare Entfernungen sorgten für Diskretion, mental und politisch. Doch Globalisierung bringt den Triumph der Indiskretion mit sich«[2] – Peter Sloterdijk sagte Globalisierung, wo heute Digitalisierung gemeint wäre. Ein großer Gedanke, gelassen ausgesprochen: »in voller Kenntnis von Milliarden Zeitgenossen«. Mehr noch: Die Menschen waren vor allem nicht darauf vorbereitet, dass sie mit diesen Milliarden in Austausch treten können, ihnen zuhören müssen und auf sie Rücksicht nehmen sollen. Bis heute haben sie kaum Zeit gefunden, die gigantischen Veränderungen gedanklich nachzuvollziehen. Wie gesagt, schon früher wurde gelegentlich befürchtet, die menschliche Seele könnte den rasenden Neuheiten nicht hinterherkommen. Vielleicht ist diese Niederlage in Langsamkeit aber erst jetzt wirklich erlitten.
Eine Weile schien mir daher »Des Kaisers neue Kleider«, Hans Christian Andersens geniales Kunstmärchen, die perfekte Metapher für die Digitalmoderne zu sein: Zwei Betrüger – man könnte sie auch zwei gute Psychologen nennen – machen sich des Kaisers umfassende Eitelkeit zunutze. Denn erstens liebt der Kaiser schöne Gewänder, zweitens hält er sich, wie die meisten Menschen, für besonders schlau. Die Betrüger-Psychologen behaupten nun, die edelsten Stoffe weben, die schönsten Roben schneidern zu können. Dumme Menschen ebenso wie solche, die nicht für ihr Amt geeignet seien, könnten diese Kleider nicht einmal sehen. Und das Verhängnis nimmt seinen Lauf; am Ende zieht der Kaiser huldvoll, aber nackt inmitten einer prächtigen Prozession durch die Stadt. Weil vorher niemand wagte, das Offensichtliche auszusprechen: dass da gar nichts war, nicht auf den Webstühlen, nicht auf den Schneidertischen und nicht am Körper des Kaisers. Genauso, könnte man denken, wie kaum einer der flinken App-Auskenner sich eingestehen will, dass die barrierefreien, wissensvermehrenden und freiheitsliebenden Eigenschaften der Digitalisierung den happy few im Silicon Valley und anderswo Unmengen an Daten, Dollar und Bitcoin in die Kassen spülen, gleichzeitig als Kollateralschaden aber so viel anderes mit sich reißen, Kompromiss- und Diskursfähigkeit zum Beispiel, Großmut und Wohlwollen, Fairness und Vernunft.
Aber so einfach ist es natürlich nicht. Nichts ist so schwarz oder weiß, so nackt oder bekleidet. Nichts ist so binär wie die primäre Funktionsweise eines Computers, obwohl ein unversöhnliches Entweder-oder aus den Netzwerken heraus die meisten vielschichtigen Debatten befallen zu haben scheint. Auch Andersens Märchen hat flirrende Zwischentöne, deshalb ist es ja große Literatur.
Die meisten Leser erinnern das Ende nicht ganz richtig. Es stimmt zwar, dass ein Kind mit seinem Ausruf »Der Kaiser ist ja nackt!« die Autosuggestionsblase des ganzen ängstlich-verlogenen Kaiserreichs aufsticht. Aber dann folgt noch eine weitere Drehung, die das Märchen ambivalent und hintersinnig enden lässt: »[…] er dachte bei sich: ›Nun muss ich aushalten.‹ Und die Kammerherren gingen und trugen die Schleppe, die gar nicht da war.«
Der nackte Kaiser geht also einfach weiter, als sofortige Buße für seine Dummheit, vor allem aber, weil es das Amt verlangt. Dem nächsten Kammerherren den Mantel herunterzureißen, um die eigene Blöße zu bedecken, steht gerade einem Kaiser nicht zu, auch nicht in der äußersten Demütigung. Er »muss aushalten«. Queen Elizabeth II. hätte genauso gehandelt. Weitergegangen sind und wären sie, der ausgedachte Kaiser, die hochdisziplinierte Königin, bis zum bitteren Ende der Prozession. Damit die Form gewahrt bleibt. Auch was man verbockt hat, bringt man in Würde zu Ende.
Und das ist vermutlich die weiterhin gültige Metapher für ernsthaftes Sprechen, Schreiben und Denken in der erbarmungslosen Digitalmoderne, die nichts vergessen und alles verdrehen kann: weiterhin dem eigenen Auftrag folgen, so selbstkritisch und dennoch unbeirrt wie möglich, im Bewusstsein, dass man ja ohnehin nackt ist und kaum noch nackter gemacht werden kann.
Kapitel II.Ansteckende Krankheiten, ansteckende Medien
»You can talk a mob into anything, it thinks by infection«
– John Ruskin
Am Beginn des Jahres 2020 brach eine Pandemie über die Welt herein, und zum ersten Mal in der Geschichte lebte niemand mehr, der sich an die vorhergehende erinnern konnte. Einige erschrockene Wochen lang waren die Nachrichten fast monothematisch. Das Zusammentreffen von Menschenleere und Massenmedien schuf skurrile Bilder: Vermummte Fernsehteams filmten auf den leergefegten Hauptplätzen der Welt zuerst einander, bevor sie in Zeitlupe über die Stein- und Stahlwüsten von Petersplatz, Times Square oder Champs-Elysées schwenkten, sodass man als Zuschauer eine Ahnung von Nahtod-Erlebnissen bekam, alles Schöne zieht langsam und stumm noch einmal vorbei … In den Talkshows, die bis dahin den nationalen Stammtisch zumindest hatten vortäuschen sollen, wurde der Abstand der Teilnehmer in ihren Sesseln so vergrößert, dass eine »Gesprächssituation« kaum noch entstand; übersprungshaft fiel mir ein, dass in den Alpen das Jodeln erfunden worden war, um einander von Bergspitze zu Bergspitze auf dem Laufenden zu halten.
In meiner Erinnerung sieht die Coronazeit als Kurve so aus: das unruhig-unterhaltsame Leben von einem Tag auf den anderen abgeplättet auf die gerade Linie eines Herztoten, dann ein heftiger, stolz-glücklicher Ausschlag nach oben, als sich zeigte, wozu die moderne, global vernetzte Wissenschaft fähig war. Und schließlich, in nervösen Zuckungen, ein langer und tiefer Abstieg in den Keller der Desillusionierung. Es erschienen diese »Figuren wie aus dem Spätmittelalter« auf den Demonstrationen, Menschen, »die den Weg in die Moderne und damit zu naturwissenschaftlicher Evidenz und zum Staatsbürgertum innerlich nicht mitgegangen sind«, wie es wieder Peter Sloterdijk so spitz beschreibt. Und er analysiert: »Es gibt für den Selbstgenuss nichts Schöneres als solche Räusche des Irrsinns, euphorische Erfahrungen in der Annahme des gemeinsamen privilegierten Zugangs zur Welt«.[3]