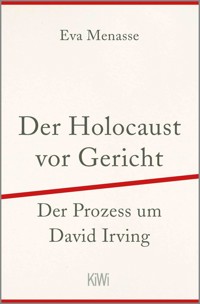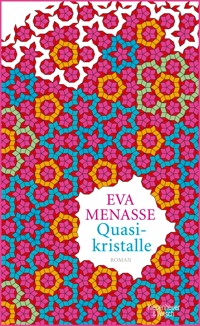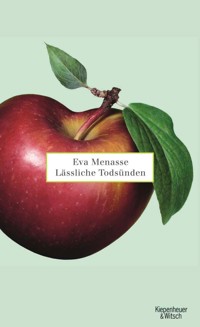9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Wer den Mund aufmacht, macht sich angreifbar.« In Eva Menasses Essays und Reden lassen sich das Temperament und die unbändige Formulierlust dieser Autorin noch einmal neu entdecken: in liebevoll-boshaften Langzeitbeobachtungen über Deutsche und Österreicher, in engagierten politischen Interventionen, aber auch in leidenschaftlichen Bekenntnissen zu Lieblingsautoren wie Richard Yates, Alice Munro und Ulrich Becher. Ein besonderes Augenmerk gilt der öffentlichen Rolle des Schriftstellers, ein Feld, auf dem man in Deutschland bekanntlich nur alles falsch machen kann.Die Heinrich-Böll-Preisträgerin des vergangenen Jahres versucht zu ergründen, was der Preispatron heute denken, schreiben, tun würde. Sie hadert mit Günter Grass und hält ihm doch eine Geburtstagsrede, sie preist das literarisch-musikalische Genie Georg Kreislers und dankt Imre Kertész für die Mühe, die er sich und seinen Lesern mit seiner unerbittlichen literarischen Genauigkeit macht. Eva Menasses pointierte und elegante Texte werfen erfrischende Blicke auf die Gegenwart und beweisen die Relevanz von Literatur. Sie beziehen Stellung, sie sind ein starkes Plädoyer gegen Lauheit – und ein Lektüregenuss. »Der Gebrauch der Literatur ist mühsam. Sie stellt mehr Fragen, als sie Antworten gibt. Wenn sie antwortet, dann nicht auf die Fragen, die wir gestellt haben. Sie hat dunkle Falten und trübe Winkel, nur deshalb leuchtet sie und deshalb klärt sie auf.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Eva Menasse
Lieber aufgeregt als abgeklärt
Essays
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Eva Menasse
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Eva Menasse
Eva Menasse, geboren 1970 in Wien, begann als Journalistin beim österreichischen Nachrichtenmagazin profil. Sie wurde Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und begleitete den Prozess um den Holocaust-Leugner David Irving in London. Nach einem Aufenthalt in Prag arbeitete sie als Kulturkorrespondentin in Wien. Sie lebt seit 2003 als Publizistin und freie Schriftstellerin in Berlin. Ihr Debütroman »Vienna« sowie ihr Erzählungsband »Lässliche Todsünden« waren bei Kritik und Lesern ein großer Erfolg. Für ihren Roman »Quasikristalle« wurde sie mit dem Gerty-Spies-Preis, dem Alpha-Literaturpreis und mit dem Heinrich-Böll-Preis der Stadt Köln ausgezeichnet. 2015 ist sie Stipendiatin der Villa Massimo in Rom.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
In Eva Menasses Essays und Reden lassen sich das Temperament und die Formulierlust dieser Autorin noch einmal neu entdecken: in liebevoll-boshaften Langzeitbeobachtungen über Deutsche und Österreicher, in engagierten politischen Interventionen, aber auch in leidenschaftlichen Bekenntnissen zu Lieblingsschriftstellern wie Richard Yates, Alice Munro und Ulrich Becher. Besonderes Augenmerk gilt der öffentlichen Rolle des Schriftstellers, ein Feld, auf dem man in Deutschland nur alles falsch machen kann. Die Heinrich-Böll-Preisträgerin von 2013 versucht zu ergründen, was der Preispatron heute denken würde. Sie hadert mit Günter Grass und hält ihm doch eine Geburtstagsrede, sie preist Georg Kreislers Genie und dankt Imre Kertész für seine unerbittliche literarische Genauigkeit. Menasses pointierte und elegante Texte beziehen Stellung, sie sind ein Plädoyer gegen Lauheit – und ein Lektüregenuss.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
I. Politisch-Feuilletonistisches
Lieber aufgeregt als abgeklärt
Nicht christlich, sondern krank
Mut zur Wut
Aus enttäuschter Liebe
Was nur die Literatur vermag
Wer den Mund aufmacht, macht sich angreifbar
Dünne Haut und Konsensschrott
Unter Piefkes
Wasserkopf und Krone
Meister einer Klasse, die er selbst erfunden hat
Tanz vor dem Orkan
Raus aus dem Quadrat
Welcher Preis passt zu mir?
II. Literarisches
So lacht die Hölle
Zart, klar und unbarmherzig
Die Unterschätzte
Jubeltag für Schriftsteller
Mehr Herz als Verstand auf Papier
Diamant mit Umgebung
Ein schöner, böser Traum
Ein Dissident, kein Publikumsliebling
III. Autobiographisches
Bürohunde und Zickenkriege
Berliner Humor erlernen
Haus am See
Ich hatte einen Vogel
Stell dir vor, du hättest den Hintern von Montserrat Caballé
IV. Zwei Erzählungen
Und Goethe war übrigens Jungfrau
Guten Abend, gut’ Nacht
Quellennachweise
Vorwort
»Je genauer ich meine Meinung zum Ausdruck zu bringen vermag, desto genauer produziere ich im Andersdenkenden die Widerlegung meiner Meinung. Wäre ich still gewesen, wäre der Widerpart reiten oder baden gegangen, jetzt schreibt er aber einen fulminanten Artikel. Ein Artikel mit meiner Meinung weckt fünf mit der Gegenmeinung. Also habe ich der Sache, falls es sie gibt, eher geschadet«, schreibt Martin Walser in »Vormittag eines Schriftstellers«.[1]
Die »Sache«, das weiß der ironische Selbstzerfleischer Walser natürlich, ist viel mehr als der zufällige, tagesaktuelle Anlass, aus dem man einen Meinungsartikel schreibt, für den man mehr oder weniger fulminante Widerreden einstecken muss und von dem man sich möglicherweise schon ein paar Jahre später erstaunt oder missmutig distanziert. In Summe ist die Sache der Diskurs, jenes vielstimmige, oft nervige Meinen und Streiten, in dem eine offene Gesellschaft ihre Übereinkünfte und Frontlinien, Tabus und Dringlichkeiten überprüft und verändert. An dieser oder jener Stelle am Diskurs teilgenommen zu haben, ist bei all der Vielmeinerei zweifellos ziemlich unbedeutend, und das, was man in den Ring geworfen hat, nicht unbegrenzt haltbar. Trotzdem – und das ist eine der wenigen Sicherheiten, die ich mir über die Jahre bewahrt habe – ist es weder uncool noch anmaßend, sich als von Beruf schreibender Mensch gelegentlich an öffentlichen Debatten zu beteiligen. Die Hohepriester des Purismus – sich immer nur über das »literarische Werk« artikulieren und die Finger bloß nicht an Politik schmutzig machen – erscheinen mir nicht nur auf spitzfindig gewendete Weise eitel, sondern auch ein wenig fade, wie Kinder, die nie mitspielen wollen, weil man ja auch einmal verlieren könnte.
Beim Sichten der Texte, die für dieses Buch infrage kamen, ergaben sich schnell Schwerpunkte, die, unabhängig von Chronologie, nun die Reihenfolge bestimmen: ein Haufen Politisch-Feuilletonistisches, und darin wiederkehrend Stücke speziell zu Österreich und Deutschland, Wien und Berlin – ein Thema übrigens, das ich hoffe, biographisch hinter mir zu lassen. Nach über fünfzehn Jahren in Berlin, fern von meinem seltsamen kleinen Heimatland, geht mir das exegetische Selbstvertrauen langsam verloren. Und so ist es nur fair, dass in jüngeren Texten deutsche Spezifika einer genaueren Betrachtung unterzogen werden. Lange genug war ich fast unkritisch verliebt in mein Gastland, dem ich aber weiterhin, wenn in Österreich die ganz Rechten auf ihrem hirnlosen Vormarsch noch weiter kommen sollten, verzweifelt nachrühmen werde, dass es mir quasi politisches Asyl bietet.
Zweitens gibt es Betrachtungen zur Literatur im engeren Sinn, wobei ich, wie viele Kollegen, dazu übergegangen bin, fast nur noch über Bücher oder Autoren zu schreiben, die mich begeistern. Natürlich verraten manche dieser Aufsätze viel über die Ansprüche an das eigene Schreiben, bilden eventuell den Kern einer Privatpoetologie.
Im dritten Teil finden sich im Autobiographischen wurzelnde Texte – das nur zuzugeben ist gefährlich, wo man doch als Schriftstellerin auf Schritt und Tritt über den »wahren« Anteil in den eigenen Büchern verhört wird. Es sind jedenfalls Texte, die mir am Herzen liegen, weil die dazugehörigen Erlebnisse offenbar so stark waren, dass sie als eigene Geschichte herausmussten und nicht warten konnten, bis sie als überformtes Material oder als kleine Verzierungssplitter in einen Roman oder eine Erzählung passten.
Trotz der Genrebezeichnung »Essays« beschließen zwei kleine Erzählungen den Band: die eine, »Und Goethe war übrigens Jungfrau«, weil ich sie wiederum endlich vom Geruch des Autobiographischen befreien möchte – seit sie vor vielen Jahren erschien, werde ich zu Diskussionen über Astrologie eingeladen, weil Leser überzeugt davon sind, dass ich wirklich eine sternenverrückte Tante hatte. Hatte ich nicht. Alles erfunden, es tut mir leid – nur in Astrologie-Foren ist dieser Umstand natürlich, wegen meiner schreienden Fachunkenntnis, bekannt.
Die andere Erzählung ist, in ihrer ganzen schüchternen Kürze, die allererste belletristische Arbeit, die ich veröffentlicht habe. Aus reiner Sentimentalität beschließt sie den Band – weil ich ihr dankbar bin, weil das Schreiben in dieser assoziativen Freiheit eine Mutprobe war, ohne die alles Weitere nicht hätte begonnen werden können.
Mit dem Älterwerden scheint einem das entschlossene Meinen immer schwerer zu fallen. Deshalb stoße ich ja, mit dem Instinkt einer Leserin, die nie einem anderem System als dem der spontanen Lust gefolgt ist, gerade jetzt auf die Aufsätze Martin Walsers. In dem obengenannten Essay spricht er von den Folgen, die man gewärtigt, sobald man »seine Meinung genau zum Ausdruck« gebracht hat, man erfährt aber nichts darüber, dass schon das ja die Ausnahme ist. Ich vermute, Schriftsteller werden gerade auch solche, die beim Meinungsschreiben massiv davon behindert werden, dass ein obsessiver Kopf-Schachspieler immer gleich den Gegenzug ausführt, also das Gegenargument formuliert, um das ursprüngliche zu entwerten. Die sich in die Literatur flüchten, weil diese Ambivalenz und Offenheit nicht nur zulässt, sondern verlangt. Ein zu Ende geschriebener, in sich schlüssiger Meinungsartikel ist da fast ein Wunder, weil es einmal gelungen ist, die eigenen Gegenstimmen weiträumig auszuschalten. Das ist aber nur dann der Fall, wenn einem die vorherrschende Meinung zu einem bestimmten Thema so falsch oder disproportional erscheint, dass man gar nicht anders kann, als sich zu Wort zu melden. Oft ist das ein mühseliger, schmerzhafter, aber unausweichlicher Akt der Selbstbehauptung – so etwa der bestimmt nicht angenehm zu konsumierende Text »Nicht christlich, sondern krank«.
Beim Vergleich von anderen, weniger lanzenhaften Texten wird der aufmerksame Leser bemerken, dass ich mir über die Jahre gelegentlich widerspreche. Allerdings wäre das Gegenteil wohl verdächtiger. Denn einmal gewinnt eben der Alarmist im Kopf die Oberhand, ein andermal der Besänftiger. Die passende Antwort auf diesbezügliche Beschwerden hat vor Jahrzehnten der große österreichische Kulturhistoriker Egon Friedell gegeben: »Wenn ich mir schon widerspreche, warum widersprechen Sie mir dann?«
E.M.
I.Politisch-Feuilletonistisches
Lieber aufgeregt als abgeklärt
Dankesrede zum Heinrich-Böll-Preis
Was hätte wohl Heinrich Böll dazu gesagt? Zur Umfrage einer Wochenzeitung kurz vor der letzten Bundestagswahl, in der von achtundvierzig bekannten Wissenschaftlern, Künstlern, Intellektuellen etwa ein Viertel mehr oder weniger deutlich, mehr oder weniger stolz ihre Wahlverweigerung öffentlich bekundeten? Wo dieses Viertel der Befragten egozentrische Sätze schrieb wie »selten war ich mir so unschlüssig«, unfreiwillig komische Sätze wie »früher habe ich noch an Parteien geglaubt«, denkfaule Sätze wie »wie soll man in differenzlosem Feld eine Entscheidung treffen«, und bemitleidenswert erschöpfte Sätze wie den folgenden: »Das Beste, was wir im Augenblick haben, ist die erzwungene Solidarität unter uns Wahlmüden«? Was hätte er gesagt zu dem großen Essay eines angesehenen Wissenschaftlers, der wortgewaltig viel richtige Kritik an hochkomplexen politischen Phänomenen äußerte, nur um dann mantraartig zu dem unterkomplexen Schluss zu kommen, die einzige Möglichkeit, darauf zu reagieren, sei, nicht mehr wählen zu gehen?
Was hätte Böll gesagt angesichts von Medien, die diese todschick gewordene Politikverdrossenheit, diese Denk- und Entscheidungsfaulheit nicht bloß transportieren, sondern lustvoll vervielfältigen, indem sie ausgerechnet den Nichtwähler zum Superstar aufbauen, der einfühlsam zu seinen Beweggründen interviewt wird? Wo sich Talkmaster inzwischen auch in gehobenen Programmen als unerbittliche Ankläger gerieren, die dem Angeklagten, also dem Politiker, der ohnehin vorverurteilt ist, aus ihren unendlichen digitalen Archiven seine Fehlleistungen, Tränen und falschen Versprechungen vorspielen? Wo sie einem Kanzlerkandidaten, der über Maßnahmen zur Gleichberechtigung spricht, als Antwort höhnisch O-Töne aus Fußgängerzonen zeigen, wo irgendwelche Frauen sagen, dass ihnen die Mundwinkel dieses Bewerbers aber einfach nicht gefallen?
Was hätte Heinrich Böll gesagt angesichts einer Öffentlichkeit, in der sich die Reste von Sachpolitik aufgelöst haben wie in einer homöopathischen Zuckerlösung, weil es nur noch um Äußerlichkeiten geht, um Fingerhaltungen, Halsketten und die Frage, wie einer »ankommt« und nicht, ob er etwas zu sagen hat?
Was würde Heinrich Böll heute zur Lage in seinem Deutschland sagen? Nach fast siebzig Jahren Frieden ist es zu einem der reichsten und mächtigsten Länder der Welt geworden, während anderswo auf der Welt, nicht nur in Syrien, täglich Tausende fliehen und Hunderte sterben, während regelmäßig Dutzende, an schlechten Tagen auch Hunderte Flüchtlinge im Meer zwischen Afrika und Europa ertrinken, und die paar wenigen, die ihre Haut heil bis zu uns gerettet haben, treten nach kurzer Zeit in unseren kalten Kirchen lieber in den Hungerstreik, als ein sinn- und trostloses Dasein als zwar durchgefütterter, aber jeder Zukunft beraubter Asylant zu führen. Was hätte Böll gesagt zu diesem Deutschland, das sich am liebsten dann intellektuell anstrengt, wenn es darum geht, die eigene Untätigkeit zu verteidigen, die eigene erstickende Langeweile zu beschwören?
Ich weiß nicht, was er gesagt hätte, aber eines ist sicher: Heinrich Böll hätte etwas gesagt, und nicht zu knapp. Dieser Mann, der mit achtundzwanzig Jahren aus den Schützengräben eines verbrecherischen Krieges kam, der in den Nachkriegsjahren von sich selbst und seiner Familie verlangte, eher zu hungern, als dass er seine Freiheit als unabhängiger Schriftsteller aufgegeben hätte, dieser Autodidakt, der in den ersten Jahren gar nicht anders konnte, als wie besessen aufzuschreiben, was er an Gräueln erlebt hatte, und der, neben Wolfgang Borchert, der Erste war, der mit seinen Texten den sinnlos verheizten Soldaten und ermordeten Juden ein Denkmal setzte – der hat zeitlebens lieber einen Fehler gemacht, als den Mund zu halten. Der hätte sich niemals von vermeintlich wohlmeinenden Beratern oder vom Comment des Literaturbetriebs sagen lassen, dass es sich für Schriftsteller nicht schickt, sich zur Lage zu äußern. Dass es sich rächen könnte, beim nächsten Buch. Dass es großspurig wirkt, wenn man sich politisch artikuliert, als jemand, der doch bloß etwas geschrieben hat. Worin, bitte, geschätzter Autor, geschätzte Autorin, besteht denn Ihre Expertise, sich zu äußern? Haben Sie ein Rentenkonzept in der Schublade? Oder eine bessere Idee, um die Finanzkrise zu lösen? Wollen Sie sich mit diesem tagespolitischen, gar parteipolitischen Dreck Ihre zarte Poetenhand ruinieren? Na also. Dann überlassen Sie das doch lieber weiterhin uns, den festangestellten Kommentatoren, die wir dafür bezahlt werden, dass wir Tag für Tag eine frische Meinung haben und diese handzuhaben verstehen wie ein Schwert. Und für Wahlempfehlungen gibt es ja, alle vier Jahre, die Starfriseure und Seriensternchen.
Über die Freiheit des Schriftstellers schrieb Heinrich Böll: »Er muss zu weit gehen, um herauszufinden, wie weit er gehen kann.«
Das hat Böll sich zur Maxime gemacht, ebenso wie der um zehn Jahre jüngere Günter Grass. Sie kamen auf der Seite der Schuldigen aus dem Krieg, sie begannen auf den Trümmern zu schreiben, auf denen ihrer Städte ebenso wie auf den Trümmern all dessen, was Deutschland einmal ausgemacht hatte, als nationale Idee, als Ort von hochstehender Kultur und Zivilisation, bevor es die Gaskammer erfand.
Die Energie von Böll und Grass, ihr Land mit der Kraft ihrer Worte zu einem anderen, besseren Land zu machen, war immens und einschüchternd. Als sie älter wurden, diese Energie aber keineswegs nachließ, während das Wirtschaftswunderland um sie herum an die Stunde Null schon gar nicht mehr erinnert werden mochte, wirkten sie auf einmal lächerlich.
Plötzlich wollte niemand mehr sein wie sie, sie schienen querulantisch, besserwisserisch, moralapostelhaft. Plötzlich wollte keiner mehr die öffentliche Arena betreten, die sie den Schriftstellern und Intellektuellen gerade erst erkämpft hatten – das klingt zwar paradox, ist aber wahrscheinlich bloß die natürliche Bewegung der Geschichte, eine Bewegung wie Ebbe und Flut.
Eine neue Zeit kam und urteilte vernichtend wie Rainald Goetz, der Böll und Grass »die präsenilen Chefpeinsäcke« nannte. Auf diese Art der verbalen Abwicklung möchte man übrigens auch mit einem Böll-Zitat antworten: »Ich hoffe, du hast nicht in den Eisschränken der Ironie das Gefühl der Überlegenheit frisch erhalten.« Damals jedenfalls ging die intellektuelle Deutungsmacht über die Phänomene der Gegenwart fast gänzlich auf die Journalisten über.
Schriftsteller und Politik, das ist in Deutschland seither eine unmögliche Verbindung. Es gilt als veraltet und peinlich, sich auch nur in der Nähe von Politik oder gar Parteien sehen zu lassen. Auch dem Wort »politisches Engagement« haftet etwas unsouverän Aufgeregtes an, als wäre so ein Engagierter ein überschäumendes Kind, das es leider noch nicht besser weiß. Wenn ich es recht sehe, hat die Unvereinbarkeit dieser beiden Sphären nach der Wiedervereinigung eher noch zugenommen, wenn auch aus geradezu entgegengesetzten Gründen: Während die Kollegen aus der DDR ihre speziellen Erfahrungen mit Zwang, Vereinnahmung und Staatsschriftstellerei gemacht hatten, sah Heinrich Böll mit dem zeitlichen Abstand und den mit ihm automatisch einhergehenden Schlampereien und Vereinfachungen nun beinahe wie der (demokratische) Staatsschriftsteller der guten alten Bonner Republik aus.
Nichts könnte falscher sein. Heinrich Böll war ein großer Moralist – auch das ein Wort, das konjunkturell zum Schimpfwort taugt, weil selbst die Moral gelegentlich aus der Mode kommt –, aber er war auch ein grandioser Polemiker und ein wilder Widerborst. Wer heute seine politischen Essays, seine Reden, seine Zwischenrufe, ja seine Leserbriefe liest, dem stockt der Atem vor so viel Angriffslust, sprachlicher Zuspitzung, triefender Ironie. Da ist ein heißer, kämpferischer Ton, ein Ton, den man heute kaum noch hört und liest, nicht einmal, wenn sich verfeindete Feuilletonisten beharken.
Im Vergleich dazu ist der aktuelle deutsche Diskurs in ritueller Höflichkeit erstarrt. Kaum einer langt, auch ad personam, so hin und macht sich gleichzeitig durch ehrlichen Einsatz des Pronomens »ich« so verwundbar, wie Böll es tat. Man könnte auf den Gedanken kommen, dass Heinrich Böll, der die Nazidiktatur und den Vernichtungskrieg überlebt hatte, danach alle Rüstungen für immer abgelegt hat. Dass Böll, der massenmörderischen Diktatur entkommen, fortan entschlossen war, diese junge Demokratie schreibend und protestierend auf ihre Tauglichkeit zu überprüfen, am eigenen Leib, ob sie »echt« war und sich wirklich nicht wieder zurückverwandeln würde, ob man nicht doch noch Reste von Willkür, Denk- und Redeverboten zutage fördern könnte.
Für diese demokratische Tauglichkeitsprüfung hat Böll »sich eingesetzt« im Wortsinn, er musste zwar nicht mehr, wie im Krieg, sein Leben einsetzen, aber alles andere hat er eingesetzt, seine Person, seinen Ruf, sein Gewicht als Schriftsteller und Nobelpreisträger. Als der RAF-Terror begann, stand er ganz allein auf weiter Flur mit seinem Versuch, in einem Klima von gesellschaftlicher und politischer Hysterie auf die fatale Mitwirkung der Medien an ebendieser totalen Hysterie hinzuweisen.
Dafür hat ihn die Springer-Presse mit einer Hasskampagne überzogen, die Böll als Sympathisanten von Terroristen diffamiert, die ihm den berühmten Polizeieinsatz beschert hat – sein Haus wurde von schwerbewaffneten Polizisten umstellt und nach Terroristen durchsucht. Das hat ihn tief gekränkt, und die Kampagne hat bis zu seinem Tod nicht aufgehört.
Die Causa Böll von 1972 bleibt ein schreckliches Lehrbeispiel dafür, wie in einem Zustand von Radikalisierung beruhigende und deeskalierende Texte gar nicht mehr verstanden werden können, wie alles, was in einer solchen Atmosphäre gesagt und geschrieben wird, plump der einen oder anderen Seite zugeschlagen wird. Bist du nicht für mich, so bist du gegen mich. Es bleibt ein beunruhigendes Beispiel dafür, wie Mitte und Mäßigung plötzlich spurlos verschwinden können.
»Elf Millionen Bundesbürger schlürfen täglich den Polit-Porno-Zynismus von BILD ein«, schrieb Böll glasklar und ungebrochen: »Ich weiß, es ist Mode geworden, die Springer-Presse für indiskutabel zu halten. Ich mag mir diesen intellektuellen Luxus nicht leisten.«[2]
Der intellektuelle Luxus, der nur ein anderes Wort für Feigheit ist: Da ist er, dieser Böll, der ganz unverbraucht und gegenwärtig zu mir spricht, von dem man bis heute so viel lernen kann. Ihn lesend, begreife ich noch einmal neu den Unterschied zwischen dem professionellen Kommentator des Zeitgeschehens, dem Journalisten, dem Lobbyisten, dem Politiker, und uns, den Autoren.
Denn wir sind allein, wir haben keinen Zeitungsverlag, keinen Konzern und keine Partei hinter uns. Die einzige Kraft, die wir haben, ist unsere Stimme und unsere Verletzlichkeit. Wir sind komische Käuze in stillen Kammern, wir verweigern uns der Hochgeschwindigkeit der Geschäftswelt, dem absurden Postulat der Schwarmintelligenz, der vermeintlichen Alternativlosigkeit einer Hundertschaft von gefährlichen Entwicklungen. Wir nehmen uns viel Zeit für seltsame, altmodische Gedanken. Wir haben und brauchen Abstand. Genau das ist unsere Expertise, die Voraussetzung für einen anderen, hoffentlich freieren Blick.
Vielleicht ist ja der Künstler, der sich politisch äußert, die einzige authentische politische Figur. Die anderen sprechen als Profis. Wir aber fallen aus der angestammten Rolle und werden zu Privatleuten mit einer papierdünnen Haut, sobald wir uns öffentlich mit der Welt außerhalb unserer Werke beschäftigen.
Das ist gefährlich, unangenehm und nicht jedermanns Sache. Das ist eine Mutprobe, denn es ist schon so manchem Autor zum Verhängnis geworden, an dessen wohlformulierten Misston man sich noch nach Jahren erinnerte, während die Sprachhülsen der Dauerredner täglich von den nächsten überschrieben werden. Man braucht uns dafür nicht zu bewundern. Das Einzige, das wir mit Nachdruck verlangen, ist: ernstgenommen zu werden, so ernst wie all die anderen auch. Nicht für illegitim oder anmaßend erklärt zu werden. Oder, mit Heinrich Böll gesagt: »Was Autoren sind: auch Bürger, möglicherweise artikulierte. Sonst nichts. Ich bin gegen Heldenverehrung, Denkmäler, Images und Ikonen.«[3]
In seinem vorletzten Roman mit dem brillanten Titel »Fürsorgliche Belagerung« beschreibt Heinrich Böll eine klaustrophobische Welt totaler Überwachung. Eine kleine Gruppe Reicher und Mächtiger wird Tag und Nacht überwacht. Warum? Weil ein Anschlag verhindert werden soll.
Doch je perfekter das Sicherheitsnetz, desto gefährdeter fühlen sie sich. Zu den eminenten Vorkehrungen von Sicherheit gesellt sich eine tiefe psychische Verunsicherung. Hinter jeder Ecke steht ein Bewaffneter und begleitet sie bis auf die Toilette. Die solcherart Beschützten haben keinerlei Privatsphäre mehr, ihre Telefone werden überwacht, ihre Briefe gelesen, jeder ihrer Schritte wird kontrolliert, über buchstäblich jede ihrer Lebensäußerungen wird Buch geführt. Diese Lückenlosigkeit führt zu immensen Kollateralschäden. Denn wenn ein Sicherheitsmann und sein Vorgesetzter alles über einen wissen, dann weiß es auch die Ablöse des Wachmanns und der Stellvertreter des Vorgesetzten, es wissen die Komitees, die regelmäßig zusammentreten, um die Sicherheitsmaßnahmen zu evaluieren. Je mehr es wissen, desto sicherer gibt es Lecks. Es gibt Sicherheitslecks, aber vor allem gibt es Informationslecks. Die Hauptfigur des Romans, Fritz Tolm, ist mit einem Schmierblatt namens »Das Blättchen« zum Multimillionär geworden, aber natürlich gibt es Konkurrenten unter den Schmierblättchenmachern. Und diese Konkurrenz spielt die privaten Informationen über Tolm und seine Familie gnadenlos aus.
Das ist der großartigste Schachzug Bölls in diesem Roman: dass er zeigt, wie ein völlig übersteigerter Sicherheitswahn sich zauberlehrlingshaft gegen die kehrt, die ihn in Gang gesetzt haben. Die umfassend Überwachten und Durchleuchteten können zwar vielleicht vor Anschlägen bewahrt werden, aber sie haben keine Sekunde Ruhe mehr, sie werden unvermeidlich zu Opfern von Erpressung und öffentlicher Demütigung.
Man erkennt die Parallelen. Unnötig zu sagen, weshalb dieser Roman heute vermutlich noch viel aktueller ist als zur Zeit seiner Entstehung, als Heinrich Böll zu beschreiben suchte, was er im Deutschen Herbst über die Physik der Gesellschaft gelernt hatte. Ich muss nicht erinnern an die heutigen technischen Möglichkeiten, die so schnell über unsere Gewissheiten und Empfindlichkeiten, vor allem über unsere Gesetze hinweggestürmt sind, dass wir die Implikationen noch gar nicht begriffen haben. Wir glauben noch, dass der weltweite öffentliche Pranger unser größtes Problem ist, jener Pranger, der heute Shitstorm heißt, der zum ersten Mal seit dem Mittelalter wiedererrichtet wurde und der, wahrhaft demokratisch, für jeden jederzeit bereitsteht. Dabei lauert etwas viel Größeres gleich hinter der nächsten Ecke. Was da lauert, ist so monströs und unbegreiflich, dass wir es noch kaum denken können, während es unsere Computer schon rechnen.
Wir haben, nach einer kollektiven Schrecksekunde von mehreren Monaten, inzwischen immerhin begriffen, dass wir überwacht werden, wir alle, jedermann, ganz fürsorglich und unauffällig. Alle unsere Daten sind im Besitz von Konzernen und Geheimdiensten, es ist derzeit unklar, wer genau was über uns weiß, aber das Unheil liegt im nächsten Schritt: Man ist technisch nicht mehr weit davon entfernt, dass missbräuchlich alles mit allem verknüpft werden kann. Unsere Gesundheitsdaten, die bei der Krankenkasse hinterlegt sind, unsere Einkäufe, die per Strichcode erfasst und mit der Karte bezahlt worden sind, unsere Bewegungsprofile, da wir ja alle Handys und Navigationsgeräte besitzen, unsere Adressbücher, Telefonverbindungen, Kontobewegungen, die Inhalte unserer E-Mails. Sobald das alles miteinander verbunden werden kann – irgendwo gespeichert ist es längst –, sind wir nackt. Denn zusammengerechnet ergeben diese Daten ein ziemlich genaues Abbild unseres Selbst: unserer Neigungen, Vorlieben, Gelüste, Geheimnisse.
Wir müssen das endlich verstehen: Wir sind zwar Menschen aus Fleisch und Blut, aber wir sind inzwischen alle auch Datenbündel. Die Daten, die über uns kursieren, können uns fast lückenlos beschreiben. Und diese Daten – und damit wir selbst – sind derzeit Freiwild; was unsere Daten betrifft, leben wir im Wilden Westen, wo es kein anderes Recht gibt als das des Stärkeren, der die besseren Programmierer und die größten Speicherkapazitäten hat.
Obwohl es zu seinen Lebzeiten noch kein Internet gab, scheint Heinrich Böll das alles vorausgesehen zu haben. Denn dieser Irrsinn, dem wir gerade entgegengehen, ist Ergebnis einer ganz bestimmten giftigen Kombination von entfesseltem Kapitalismus (die Konzerne, die unsere Daten sammeln, damit sie unser Konsumverhalten noch besser einschätzen können) und Sicherheitswahn (die Geheimdienste, die unsere Daten sammeln nach der ziemlich verzweifelten Logik: Wer den ganzen Heuhaufen nach Hause schleppt, hat irgendwo da drin auch die Terroristen-Nadel). Und der Sicherheitswahn wird von skrupellosen Medien genauso befördert wie zu Bölls Zeiten. Wir alle lassen uns ununterbrochen einreden, dass wir hochgefährdet sind, nicht durch Freizeitunfälle (was statistisch stimmen würde), nicht durch Autounfälle (was statistisch stimmen würde), sondern durch Terroristen. Und deshalb schauen wir gelähmt zu, wie demokratische Grundrechte, in Jahrhunderten erkämpft, Schritt für Schritt außer Kraft gesetzt werden: das Recht auf Privatsphäre, die Unschuldsvermutung, das Briefgeheimnis, das Recht auf einen fairen Prozess, das denen, die zum Beispiel in Guantánamo einsitzen, seit vielen Jahren verwehrt wird.
Aber das Interessante ist: Jetzt, da die Grundfesten unserer westlichen Demokratien zum ersten Mal wirklich unterhöhlt werden, beginnen sich Schriftsteller wieder zu benehmen wie damals Heinrich Böll. Sie melden sich zu Wort, sie zeigen ihr Gesicht, sie gehen hinaus, machen Lärm und machen sich angreifbar. Das ist die einzige gute Nachricht: dass Bölls Erbe noch nicht ganz verloren scheint. Eine Schmerzgrenze scheint überschritten, bei den Menschen meines Berufsstandes, die ja nicht nur von Schriftlichem, von Briefen und Texten und Kommunikation leben, sondern die, um überhaupt Schriftsteller zu sein, vor allem »hochrechnen können müssen«, wie es Katja Lange-Müller einmal formuliert hat. Das ist, was wir täglich tun, wenn wir schreiben: Das, was ist, gedanklich in die Zukunft und in alle seine Spielarten hinein zu verlängern. Das Was-wäre-wenn ist unser Geschäft. Deshalb bin ich lieber eine aufgeregte Autorin als ein abgeklärter Nichtwähler.
Und deshalb waren es wohl, nicht nur in Deutschland, die Schriftsteller, von denen die ersten Proteste kamen, als die Enthüllungen von Edward Snowden, dieses großen Helden unseres noch jungen Jahrhunderts, begannen. Als vor acht Wochen zwei Dutzend deutscher Dichter fast siebzigtausend Unterschriften von Bürgern, die unseren Protest und unsere Forderung nach Aufklärung unterstützten, persönlich zum Kanzleramt brachten und dort abgaben, haben wir uns wieder einmal rundum lächerlich gemacht, wie uns auf allen Kanälen umgehend bescheinigt wurde. »Hochmütig und peinlich« sei das, sagte ein berühmter Schauspieler. Wo er das sagte? Natürlich in einer Talkshow. Nicht draußen im Regen.
Eine junge Lyrikerin namens Anke Bastrop hat im Anschluss daran einen hinreißenden Text geschrieben:
»Ich wollte mich dort hinstellen: in der ganzen stolzen Fragilität, dieser seltsamen Angreifbarkeit unseres Menschseins. Ohne sichernde Aufmärsche, Fanfaren und Megaphone. So, wie jeder einzelne der Welt gegenübersteht. Mit Hochmut hat das wenig zu tun, mit Nacktheit viel. Ich wollte das: verletzbar sein. Es entspricht dem Stand des Wortes in der virtuellen Welt.«[4]
Das ist die Saat von Heinrich Böll, die überwintert hat und wieder aufgehen wird.
Was immer wir tun, denken wir an Bölls Worte: »Herr Oberst, wir gefährden die Demokratie nicht, wir machen Gebrauch von ihr.«
Machen wir Gebrauch von unserer Demokratie. Damit aufzuhören, ist das Einzige, was verboten ist.
Nicht christlich, sondern krank
Zur Debatte um die Präimplantationsdiagnostik
Im Leben eines Menschen gibt es nichts Schlimmeres als den Tod des eigenen Kindes. Eine besondere Spielart dieses absoluten Horrors ist die Totgeburt oder der frühe Kindstod. Im Mutterleib und direkt danach ist das menschliche Leben am empfindlichsten, am rätselhaftesten, am wunderbarsten. Wenn das Mysterium der Geburt mit dem Tod zusammenfällt, berührt es auch den Unbeteiligten tief und eiskalt; es erscheint so falsch, grausam und pervers.
Für die Frauen, die ein totes Kind gebären mussten, ist es eine Lebenskatastrophe, die unter Umständen niemals heilt.
Aber selbst die »normale« Fehlgeburt, wo der Körper die Frucht in den ersten drei Monaten abstößt, weil sie nicht gesund war, ist eine schwere psychische Belastung, die einer langen Zeit der Verabschiedung, Trauer und Verarbeitung bedarf. Die Therapeuten wissen das. Die Frauen, die es durchleiden mussten, wissen das. Und ihre Männer, die Beinahe-Väter, wissen das auch. Oft wissen es sogar die Pfarrer.
Wer es nicht weiß, ist unsere Gesellschaft als Kollektiv und unsere Bundeskanzlerin. Vielleicht ist das der letzte Bereich, wo unsere ach so fortschrittliche, aufgeklärte Gesellschaft, die ansonsten jeden Autounfall als traumatisierungsträchtig erkennt, noch zutiefst männlich geprägt und hundertprozentig frauenfeindlich ist. Es ist jedenfalls der einzige Bereich, wo es für Frauen geradezu verstörend ist, dass der Bundeskanzler konservativ und weiblich ist. Denn über Fehl- und Totgeburten und ihre Folgen redet man nicht. Es ist ein Tabu. Man redet auch nicht darüber, dass man die Hilfe der Reproduktionsmedizin in Anspruch nehmen muss, weil man auf »normalem Weg« keine Kinder bekommen kann. Das alles sind »Frauensachen«, die umgehend »weggesteckt« werden müssen, das haben andere doch auch geschafft.
Angela Merkel hat sich nun ausgesprochen für ein Verbot der Präimplantationsdiagnostik (PID), bei der Embryonen nach der künstlichen Befruchtung auf genetisch bedingte Krankheiten untersucht werden. Teile der SPD und der Grünen wollen sich der Kanzlerin anschließen. Dies bedeutet ganz einfach, dass gewisse Frauen per Gesetz dazu gezwungen werden, vorhersehbare Fehlgeburten und Spätabtreibungen zu erleiden. Dass gewisse Eltern ihre neun Monate lang getragenen, geborenen, aber dann nicht lebensfähigen Kinder sterben sehen müssen. Dass sie vielleicht nie ein gesundes Kind bekommen.
Obwohl das nicht sein müsste.
Es wird behauptet, dass der Gesetzgeber zwischen schweren und nicht so schweren Krankheiten entscheiden müsste, selbst wenn er nur die engste Form der PID, also ausschließlich für genetisch schwer vorbelastete Paare, erlauben würde. Doch darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, Herr über Leben und Tod zu spielen, wie manche Konservative mit ganz unchristlich selbstgefälligen Mundwinkeln sagen und sich dabei ihrem Platz im Paradies gewiss schon nahe fühlen.
Es ginge schlicht und einfach darum, sich innerhalb der bereits bestehenden Gesetzeslage verhältnismäßig und rational zu verhalten. Um etwas Sinnvolles zum Thema PID sagen und entscheiden zu können, muss man das ganze Bild in Augenschein nehmen, alles, was in diesem heiklen Bereich erlaubt und was verboten ist, von der Zeugung bis zur Geburt.
Die Verhältnisse sind nämlich so: Jede Frau in Deutschland kann jedes gesunde Kind, das sie nicht haben möchte, bis zur zwölften Lebenswoche abtreiben lassen. Das ist ein Recht, das die Frauenbewegung, besonders unterstützt von den Grünen, vor Jahrzehnten durchgekämpft hat, auf das sie stolz ist und das nicht zurückgenommen werden kann und darf.
Zweitens: In den letzten Jahren hat die vorgeburtliche Diagnostik große Fortschritte gemacht. Man darf und will die ungeborenen Kinder im Mutterleib auf alles Mögliche untersuchen. Es ist natürlich schön zu erfahren, dass das Ungeborene gesund ist. In einer ängstlichen Gesellschaft lassen Frauen heute aber wahrscheinlich zu vieles zu. Sie wollen die Gewissheit, dass alles in Ordnung ist. In der Regel haben sie sich vorher nicht gefragt, wie sie mit einer schlechten Nachricht umgehen würden. Diese schlechte Nachricht, oder nur die schlechte Prognose (und was gibt es in diesem Bereich oft für Fehldiagnosen, wo auch gesunde Kinder als krank angekündigt werden!), stürzt werdende Eltern in kaum aushaltbare Konflikte. Was für ein Kind bin ich bereit zu ertragen, obwohl ich es noch nicht einmal gesehen und im Arm gehalten habe?
Die absurde Angst vor dem Down-Syndrom zum Beispiel ist ja nur entstanden, weil man das ungeborene Kind zweifelsfrei darauf testen kann. Sie führt dazu, dass erheblich mehr gesunde Babys verloren gehen als überhaupt Down-Syndrom-Babys entdeckt werden. Denn die Entnahme des Fruchtwassers – in dem man eben nichts anderes als das Down-Syndrom und andere, extrem seltene Chromosomenanomalien sowie Neuralrohrdefekte feststellen kann – ist ein Eingriff, der die Schwangerschaft jeder hundertsten Frau beendet. Und trotzdem empfehlen manche Ärzte ihn nicht nur, sondern üben – angeblich aus Angst vor Schadenersatzforderungen – sogar Druck auf die Frauen aus, besonders, wenn diese über fünfunddreißig sind. Einer Freundin, die nach mehreren Fehlgeburten endlich »richtig« schwanger war und diese Untersuchung gut aufgeklärt verweigerte, wurde mit schwerem Geschütz zugesetzt: »Ein behindertes Kind bürden Sie nicht nur sich, sondern auch der Gesellschaft auf!«
Was aber, wenn die Untersuchung durchgeführt und die Nachricht schlecht, wirklich schlecht ist und die Eltern ein schwer- oder schwerstbehindertes Kind auf gar keinen Fall bekommen wollen? Für diese zum Glück extrem seltenen Fälle gibt es die Spätabtreibung, zu jedem Zeitpunkt vor Einsetzen der Wehen, also bis unmittelbar vor der natürlichen Geburt.
»Spätabtreibung« aber ist ein Euphemismus für einen der grässlichsten Vorgänge, die in Deutschland gesetzlich erlaubt sind. Es bedeutet: Das Ungeborene wird mit einer Spritze ins Herz, durch die Bauchdecke der Mutter, getötet, dann werden die Wehen eingeleitet, und das Kind wird auf normalem Wege geboren. Das dauert so lange, wie es eben dauert, eine »normale Geburt«, viele Stunden, um ein krankes, bereits totes Kind loszuwerden. Würde man das Kind ohne Giftspritze einfach zu früh zur Welt kommen lassen und es lebte, hätten die Ärzte nämlich die Pflicht, alles für sein Weiterleben zu tun, so wie sie es ja auch für die Frühchen tun. Deshalb muss man es vorher totspritzen. Jene Frauen, die das in einer Panikreaktion nach einer niederschmetternden Diagnose machen ließen, werden diesen Schatten auf ihrer Seele meist bis an ihr Lebensende nicht mehr los.
Es war ein richtiger Schritt der letzten Regierung, die Abläufe in diesen wenigen, tragischen Fällen etwas besser zu regeln. Es gibt jetzt eine Bedenkzeit, die eingehalten werden muss, und eine Pflicht zur umfassenden Beratung.
Aber angesichts solcher Fälle, und angesichts von hundertzehntausend ganz normalen deutschen Abtreibungen pro Jahr, ist jeglicher »Embryonenschutz« in der ersten Woche nach der Befruchtung eine vollkommen irrationale, menschenverachtende Groteske.
Gefragt wird: Wann beginnt das Leben? In Deutschland streitet man erbittert über einen Zeitkorridor von vierundzwanzig Stunden nach der Befruchtung. Wegen dieser Haarspaltereien müssen in der deutschen Reproduktionsmedizin befruchtete Eizellen im »Vorkernstadium« eingefroren werden, also noch bevor sich die Kerne von Ei- und Samenzelle vollständig vereinigt haben. Und wenn sie sich vereinigt haben, müssen alle Embryonen in den Körper der Mutter eingesetzt werden. Obwohl es oft gute Gründe gäbe, nur ausgewählte zurückzusetzen.
Doch ein wenige Tage alter Embryo ist – bei höchstem Respekt vor dem menschlichen Leben! – kein Mensch. Es ist ein Zellhaufen mit Menschpotenzial. Deswegen stellen die Juden, ein ebenso familienfreundliches wie ethisch geschultes Volk, schon die Ausgangsfrage anders: Sie fragen, wann etwas »beseelt« ist. Ein Embryo in der ersten Lebenswoche ist es dieser Auffassung nach nicht. Deshalb kann man ihn sowohl untersuchen wie verwerfen; deshalb ist Israel eines der Länder mit der freizügigsten Reproduktionsmedizin.
Die Natur sortiert missglückte, kranke Embryonen im Normalfall in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft aus. Hier liegt auch die Grenze für den legalen Schwangerschaftsabbruch, deshalb sind die Spirale und die »Pille danach« erlaubt, die beide – in einem viel früheren Stadium – befruchtete Eizellen zum Abort zwingen. Aber hier weiß es unser Gesetzgeber besser als selbst die Natur und schützt den Zellhaufen sogar noch früher.
Alle diese bizarren Details wissen nur Betroffene. Sie schweigen still, denn sie schämen sich für ihr Unvermögen, auf normalem Wege Kinder zu bekommen. Sie lassen es unwidersprochen zu, dass man ihnen den Wunsch nach »Designerbabys« unterstellt oder dass sie »Gott spielen« wollten. In Österreich hat mir ein hochrangiger Politiker der Grünen einmal gesagt, man solle Kinderlosigkeit als Schicksal annehmen. Natürlich war es ein Mann, natürlich ein Katholik, und natürlich hat er selbst Kinder. Und gewiss würde er einen Blinddarmdurchbruch oder eine verengte Herzarterie nicht als Schicksal annehmen, sondern zum Arzt gehen.
Eine PID