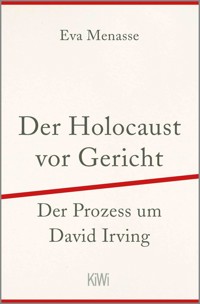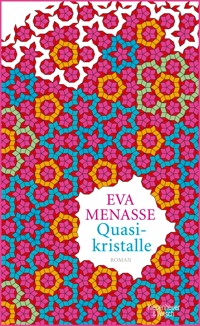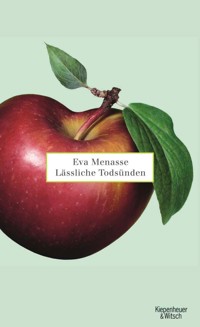9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein bedeutsamer, aus der aktuellen Literatur herausragender Roman« Die ZeitSo hat lange niemand mehr erzählt – Eva Menasses Familiensaga fängt von Wien aus ein ganzes Jahrhundert ein. Von der Vergangenheit bleibt nur, was erzählt wird. Eva Menasse macht das Erinnern zum Ausgangspunkt des Erzählens und entwirft mit den fulminanten Geschichten einer Wiener Familie mit jüdischen Wurzeln den Bilderreigen einer Epoche. »Mein Vater war eine Sturzgeburt«: Kopfüber, wie die Hauptfigur, fällt der Leser in diesen Roman und erlebt, wie die Großmutter über ihrer Bridge-Partie beinahe die Geburt versäumt. So kommt der Vater der Erzählerin zu Hause zur Welt, ruiniert dabei den kostbaren Pelzmantel und verhilft der wortgewaltigen Familie zu einer ihrer beliebtesten Anekdoten. Hier, wo man permanent durcheinander redet und sich selten einig ist, gilt der am meisten, der am lustigsten erzählt. Fragen stellt man besser nicht, obwohl die ungewöhnliche Verbindung der Großeltern, eines Wiener Juden und einer mährischen Katholikin, im zwanzigsten Jahrhundert höchst schicksalsträchtig ist. So verschlägt es deren drei Kinder auf der Flucht vor den Nazis in die Welt. Während der eine in England Fußballer wird und der andere sich im Dschungel von Burma als Soldat durchschlägt, geht die schöne Schwester Katzi in Kanada verloren. Über sie wird später am Familientisch auffällig geschwiegen, lieber redet man vom legendären Onkel Königsbee, der mit Wortverdrehungen wie »Das ist nicht meine Dämone« unsterblich geworden ist. Doch als die Enkel beginnen, Fragen zu stellen, zerrinnt ihnen das einzige Erbe, der tragikomische Geschichtenfundus, zwischen den Fingern. Eva Menasse beeindruckt mit einem Ensemble hinreißender Figuren und unerwarteten Begebenheiten und zeigt wie nebenbei das Entstehen und den Zerfall von Familiengeschichte und Identität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 589
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Eva Menasse
Vienna
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Eva Menasse
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Eva Menasse
Eva Menasse, geboren 1970 in Wien, begann als Journalistin bei »Profil« in Wien. Sie wurde Redakteurin der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«, begleitete den Prozess um den Holocaust-Leugner David Irving in London und schrieb darüber ein Buch. Nach einem Aufenthalt in Prag arbeitete sie als Kulturkorrespondentin in Wien. Sie lebt seit 2003 als freie Schriftstellerin in Berlin. »Vienna« ist ihre erste literarische Veröffentlichung.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Mein Vater war eine Sturzgeburt«: Kopfüber, wie die Hauptfigur, fällt der Leser in diesen Roman und erlebt, wie die Großmutter über ihrer Bridge-Partie beinahe die Geburt versäumt. So kommt der Vater der Erzählerin zu Hause zur Welt, ruiniert dabei den kostbaren Pelzmantel und verhilft der wortgewaltigen Familie zu einer ihrer beliebtesten Anekdoten. Hier, wo man permanent durcheinander redet und sich selten einig ist, gilt der am meisten, der am lustigsten erzählt. Fragen stellt man besser nicht, obwohl die ungewöhnliche Verbindung der Großeltern, eines Wiener Juden und einer mährischen Katholikin, im zwanzigsten Jahrhundert höchst schicksalsträchtig ist.
So verschlägt es deren drei Kinder auf der Flucht vor den Nazis in die Welt. Während der eine in England Fußballer wird und der andere sich im Dschungel von Burma als Soldat durchschlägt, geht die schöne Schwester Katzi in Kanada verloren. Über sie wird später am Familientisch auffällig geschwiegen, lieber redet man vom legendären Onkel Königsbee, der mit Wortverdrehungen wie »Das ist nicht meine Dämone« unsterblich geworden ist. Doch als die Enkel beginnen, Fragen zu stellen, zerrinnt ihnen das einzige Erbe, der tragikomische Geschichtenfundus, zwischen den Fingern.
Eva Menasse beeindruckt mit einem Ensemble hinreißender Figuren und unerwarteten Begebenheiten und zeigt wie nebenbei das Entstehen und den Zerfall von Familiengeschichte und Identität.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2005, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
eBook © 2012, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Getty Images/Charles Schiller
ISBN978-3-462-30660-6
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Fördernachweis
Widmung
Anfang
Chuzpe
Glück & Unglück
Schwarzblende
Neubeginn
Späte Liebe
Kriegsende
Ansichtssachen
Idyll
Opfer & Täter
Besucher
Rollenspiele
Spätfolgen
Die Erbin
Rückblick
Ende
Nachruf
Erläuterungen zu einigen Austriazismen
Die Arbeit an diesem Roman wurde vom Deutschen Literaturfonds e.V. gefördert.
für Michael
Anfang
Mein Vater war eine Sturzgeburt. Er und ein Pelzmantel wurden Opfer der Bridgeleidenschaft meiner Großmutter, die, obwohl die Wehen einsetzten, unbedingt noch die Partie fertigspielen mußte. Bis auf ein einziges dramatisches Mal hat meine Großmutter alle Partien ihres Lebens fertiggespielt, denn eine Partie in der Mitte abzubrechen war unzumutbar. Deshalb hätte sie über den Karten beinahe die Geburt meines Vaters versäumt. Oder besser gesagt: Deshalb wäre mein Vater beinahe unter einem mit grünem Filz bespannten Kartentisch zur Welt gekommen, was übrigens seinem Charakter und seinem Lebensweg gar nicht schlecht entsprochen hätte.
Das einzige, was meiner Großmutter im Leben Freude machte, war Bridge. Sie saß, wie an fast jedem Tag seit jenem, an dem sie meinen Großvater geheiratet hatte und aus einem kleinen mährischen Dorf nach Wien gezogen war, mit ihren Bekannten im Café Bauernfeind und spielte. Das war ihre Art, mit der Welt, die ihr selten behagte, fertig zu werden. Sie verschloß davor die Augen, ging ins Kaffeehaus und spielte Bridge.
An jenem Tag, als mein Vater geboren wurde, verzögerte sich die Partie. Es wurde noch Kaffee bestellt. Die Wehen schienen nicht stärker zu werden, und die Bridgepartnerinnen meiner Großmutter kümmerten sich ohnehin nicht darum. Beim Abrechnen brach der rituelle Streit unter den Spielerinnen aus. Eine zahlte ihre Spielschulden nie gleich, sondern bat immer um Aufschub und stiftete dadurch Verwirrung. Dabei ging es bloß um ein paar Groschen. Manchmal gelang es einer vielleicht, einen Schilling zu gewinnen, doch den war sie am nächsten Tag bestimmt wieder los. Im gesamten gesehen gab es kein signifikantes Ergebnis. Trotzdem zeterten sie und machten einander Vorhaltungen. Zwei von ihnen konnten nicht besonders gut rechnen, die anderen beiden, darunter meine Großmutter, sahen schlecht, gaben es aber nicht zu.
Diejenige, die immer die Abrechnung führte, war eine von denen, die nicht rechnen konnten. Sie verwechselte oft die Kolonnen, ob aus Konzentrationsmangel oder aus Unredlichkeit, weiß heute niemand mehr. Denn sie irrte sich auch zu ihren eigenen Ungunsten. Darüber hinaus hatte sie eine sehr kleine, verschnörkelte Schrift, gerade bei Ziffern.
Die dritte, die immer Kredit wünschte, war nur bereit, ihre Schuld vom vorvergangenen Tag zu bezahlen. Am vergangenen Tag hatte sie auch verloren, aber mehr. Und am meisten verlor sie an jenem Tag, an dem mein Vater geboren werden sollte. Das nun wollte sie aber am allerwenigsten bezahlen. Von der vierten weiß ich nichts.
Der Zahlkellner vom ›Bauernfeind‹ kam lange nicht. Er war ein stadtbekannter Feschak, und die Damen, mit Ausnahme meiner Großmutter, pflegten mit ihm kindisch zu kokettieren. Meine Großmutter kokettierte nie. Irgend etwas in ihr war schon früh erfroren, sie war eine blasse, rotblonde Schönheit, die der Welt bloß ironische Strenge zeigte. Sie tobte nur zu Hause. Ihr Busen war sagenhaft. Der Zahlkellner vom ›Bauernfeind‹ behandelte sie ausgesucht. Er war mindestens zehn Jahre jünger als sie, und wobei sich die Bridgepartnerinnen ihn und meine Großmutter gerne vorstellten, hätten sie bei ihrer Seele nicht laut gesagt, nicht einmal heimlich, zueinander. Dabei hatte der Zahlkellner vom ›Bauernfeind‹ wahrscheinlich bloß Respekt vor der Unnahbarkeit meiner Großmutter, und sie hat ihn vielleicht niemals richtig bemerkt. Am Tag der Geburt meines Vaters bemerkte sie nur ärgerlich, daß er nicht kam. Die Damen kramten in ihren Börsen und rutschten auf den Plüschbänken hin und her. Meine Großmutter wurde nervös. Es wurde dunkel, und die Wehen wurden stärker.
Mein Onkel, der damals sieben Jahre alt war, erwachte, als das Licht anging. Er schlief auf einem schmalen Sofa, das quer zum Ehebett seiner Eltern an dessen Fußende stand. Er erwachte, weil es plötzlich hell war und weil seine Mutter schrie. Sie lag in ihrem Pelzmantel, einem schwarzen Persianer, quer über dem Ehebett. Mein Großvater schrie auch, aber von der Tür her. Außerdem schrie mein Vater, der, wie es später immer wieder erzählt wurde, einfach herausgerutscht war und den Pelzmantel verdorben hatte.
Mein Vater schrie, weil das für ein Neugeborenes normal ist. Zeit seines Lebens würde mein Vater die Dinge gewissenhaft so machen, wie er sie für normal hielt, auch wenn ihm das objektiv selten gelingen sollte. Die Einstellung meiner Großmutter zu dieser letzten Schwangerschaft und diese Geburt selbst erforderten es allerdings besonders, sich von Anfang an so normal wie möglich zu verhalten. Denn meine Großmutter, bereits über vierzig, hatte dieses dritte Kind nicht haben wollen. Sie hatte mit Stricknadeln, heißen Sitzbädern und mit Vom-Tisch-Springen versucht, es loszuwerden. Sie erzählte das später gern.
Aber mein Vater war den Stricknadeln ausgewichen und hatte sich bei den Sprüngen angeklammert, so müsse es gewesen sein, sagte man in meiner Familie später immer und nickte dazu. Über die heißen Bäder sagte man nichts. Er wollte es ihr dann recht machen, indem er schnell und schmerzlos herausrutschte, aber meiner Großmutter hat es selten jemand recht machen können. Mein Vater hatte die Bridgepartie verdorben und er verdarb den schwarzen Persianer, eines der großzügigen Geschenke, mit denen mein Großvater seine zahllosen Seitensprünge zu sühnen versucht hatte. Meine Großmutter geruhte diese Geschenke wortlos anzunehmen und ins Kaffeehaus zu gehen, um Bridge zu spielen.
Meine Großmutter schrie, weil die Hebamme noch nicht da war. Weil das Kind noch an der Nabelschnur hing und alles voll Blut war. Weil mein Großvater weder in der Lage schien, das ältere Kind, meinen Onkel, aus dem Zimmer zu entfernen, wie meine Großmutter es für passend gehalten hätte, noch sich anzuziehen und einen Arzt oder die Hebamme holen zu gehen.
Mein Großvater, dessen Lieblingstonart eigentlich das halblaute, mürrische Schimpfen war, das man in Wien »keppeln« nennt, schrie, weil meine Großmutter schrie. Anders hätte er sich kaum Gehör verschafft. Außerdem lagen auch seine Nerven bloß. Das Bild, das sich ihm auf seinem Ehebett bot, war ebenso grotesk wie faszinierend. Es muß ein wenig an die griechische Mythologie erinnert haben, von der mein Großvater allerdings keine Kenntnis hatte: Ein Wesen, halb schwarzes Schaf, halb Mensch, hatte geboren. Denn aus Scham vor ihrem Mann und ihrem Sohn hielt meine Großmutter den Pelzmantel über ihrem Unterleib fest geschlossen. Sie lag halb eingerollt auf der Seite und umfing mit ihrem Körper meinen Vater, von dem nur der Kopf aus dem Mantel sah und der vor dem schwarzen, pelzigen Hintergrund besonders blutig und neugeboren wirkte.
»Du bist an allem schuld«, schrie meine Großmutter, »du hast mich zu spät abgeholt!«
»Wo ist mein Schal«, schrie mein Großvater von der Tür her, »du hättest früher nach Hause gehen sollen!«
»Du hast mir dieses Kind angehängt«, schrie meine Großmutter, »im Kasten neben der Tür!«
»Wahrscheinlich hast du unbedingt die Partie zu Ende spielen müssen«, schrie mein Großvater, »in welchem Kasten?«
»Mit welcher Schickse hast du dich herumgetrieben«, schrie meine Großmutter, »du Blinder, neben der Tür, hab ich gesagt!«
»Geh, gib a Ruh«, sagte mein Großvater resigniert, der seinen Schal gefunden hatte und sich anschickte zu gehen. Denn wie jeder wußte, der ihn auch nur ein bißchen kannte, waren alle seine Geliebten immer jüdisch und übrigens meistens ebenfalls verheiratet. Noch nie hatte er mit einer Schickse ein Verhältnis gehabt. Er kannte nur eine einzige Schickse näher – die Frau, mit der er verheiratet war.
Unter diesen Umständen kam mein Vater zur Welt: als Sohn eines jüdischen Vertreters für Weine und Spirituosen und einer katholischen Sudetendeutschen, die aus der Kirche ausgetreten war.
Ein paar Wochen später kam die Tante Gustl, eine der Schwestern meines Großvaters, um das Kind zu begutachten. Die Tante Gustl hatte einen reichen Christen geheiratet und benahm sich seither wie eine große Dame. Ihr Vater, mein Urgroßvater, hatte schon die konfessionsübergreifende Wahl seines Sohnes, meines Großvaters, zu einem Familienskandal gemacht. Obwohl meine Großmutter aus der Nähe von Freudenthal und nicht aus Bratislava stammte, begann er, wenn die Rede auf sie kam, mißmutig den alten Schüttelreim zu deklamieren: »Zum Vesuv ging a Bratislavaer Gojte, damit sie dort gratis Lava erbeute.« Man pflegte nur den notwendigsten Kontakt. Die Eltern meines Großvaters, die aus Tarnów stammten, waren dort geblieben, wo die Einwanderung sie angespült hatte: auf der »Mazzesinsel«, ganz nah beim Augarten, in einer dieser grauen Gassen, wo es auch im Sommer kühl und feucht ist und die Stiegenhäuser nach Moder und Kohl riechen. »Fischhändler und Fromme«, sagte mein Großvater verächtlich, »geschmacklos, billig und doch ordinär.« Er zog nach Döbling, in den Bezirk der Ärzte und Rechtsanwälte, der Notare und Opernsängerinnen, der Hausherren und Seidenfabrikanten. Daß er sich nur den Döblinger Rand, nah beim Gürtel, leisten konnte, fiel nicht ins Gewicht. Denn trotzdem blieb es Döbling.
Als die Tante Gustl ihren Vater von ihrer bevorstehenden Heirat unterrichtete, vertraute sie darauf, daß der laute, furchterregende Skandal von einst inzwischen zu einem kleinen, depressiven Zusammenbruch geschrumpft sein würde, denn die Tante Gustl war von Jugend an äußerst abgebrüht. »Is er a Jud?« fragte ihr Vater, und er muß der Tante Gustl in diesem Moment herrlich schwach und hilflos erschienen sein. Sie trug den neuen Fuchs mit den blinkenden Äuglein um die Schultern, den der rasend verliebte Verlobte ihr erst kürzlich verehrt hatte, und sie triumphierte, innen wie außen. »Er is ka Jud, er is a Bankdirektor«, antwortete sie mit einer Wendung, die in meiner Familie sprichwörtlich geworden ist und seither auf Menschen angewendet wird, die man für harmlose Trottel hält. Denn ein solcher war, wie sich bald herausstellte, der herzensgute, jung verstorbene Adolf »Dolly« Königsberger, auch »Königsbee« genannt.
Nach ihrer Hochzeit entfaltete sich die Hybris der Tante Gustl zu voller fleischiger Blüte. Als erste unzweideutige Maßnahme wechselte die Frau Direktor Königsberger zum Kartenspielen das Kaffeehaus, denn hinsichtlich der Kaffeehäuser gab es Klassenunterschiede. Weder im ›Bauernfeind‹ noch im ›Zögernitz‹ ward sie je mehr gesehen, man munkelte, sie säße an den Kartentischen der Ringstraße, dort, wo die Hofratsgattinnen und Fabrikantenwitwen vom guten Leben zu solcher Fülle angeschwollen waren, daß ihre mehrreihigen Perlenketten fast horizontal auf den weißgepuderten Dekolletés ruhten. Noch war die Tante Gustl nicht so üppig, doch sie hatte die Anlage dazu.
Auch ließ sie sich nur noch selten bei ihren Eltern in der kleinen Gasse beim Augarten sehen. Statt dessen ging sie am Arm des feschen, dummen Dolly in die Oper und ins Theater, und sie fuhr nach Baden zur Kur. Sie suchte Anschluß an das Großbürgertum, sie spielte mit verarmten Baronessen Rummy und Würfelpoker, sie bezähmte ihren Ehrgeiz und ließ die Baronessen aus taktischen Gründen manchmal gewinnen. Sie versuchte so listig wie brutal, gleich zwei Klassen nach oben zu gelangen, anstatt, wie mein Großvater, den einstufigen Aufstieg von der »Mazzesinsel« nach Döbling, vom eingewanderten Buchhalter (Vater) zum eingeborenen Spirituosenhändler (Sohn) als menschenmögliches Maximum zu akzeptieren. Aber am meisten erboste meinen Großvater, daß sie nun ein protziges edelsteinbesetztes Kreuz um den Hals trug, »den göttlichen Mühlstein«, wie er es nannte. Sie trug es übrigens wirklich seit dem ersten Tag als Frau Direktor Königsberger und nicht erst, wie in meiner Familie später mit böser Absicht behauptet wurde, seit dem Einmarsch der Nazis.
Die Tante Gustl beugte sich also prüfend über meinen Vater, so daß ihr Kreuz knapp über seiner kleinen Nase baumelte, und sagte: »Schaut aus wie der Zahlkellner vom ›Bauernfeind‹.« Mein Vater sah sie mit seinen babyblauen Augen, die diese Farbe sein Leben lang behalten sollten, an, griff nach dem Kreuz und riß es ab.
Mein Großvater hat sich dann geweigert, die kaputte Kette zu bezahlen, weil er es für unmöglich hielt, daß ein Säugling eine Kette abreißen konnte, an der nicht zumindest ein Glied schon schadhaft gewesen war. Sie solle froh sein, daß das Kind ihn abgerissen und sie den Mühlstein nicht im Kaffeehaus verloren habe, sagte er zu seiner Schwester, denn woher wolle sie wissen, wie ehrlich ihre Christen seien. Andererseits, höhnte er: Ein solches Trumm hätte sie wahrscheinlich überall aufschlagen hören.
Später, wenn die Rede auf die Tante Gustl kam, sagte er immer: »Ja, ja, eine Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied.« Gemessen an den üblichen Standards meines Großvaters war das eine fast skandalös abgedroschene Formulierung. Mehr sagte er nicht, denn er sprach nicht gern über die Tante Gustl, nachdem sie in der Nazizeit einmal grußlos an ihm vorübergegangen war. Dabei soll das goldene Kreuz auf ihrer Brust gut sichtbar gewesen sein, hieß es in meiner Familie später immer.
Die ersten Jahre im Leben meines Vaters verliefen weitgehend normal. An der Hand seiner schönen, strengen Mutter ging er jeden Tag ins Kaffeehaus, wurde zwischen die Kartenpartnerinnen meiner Großmutter gesetzt, die ohnehin nichts anderes wahrnahmen als ihre Bridgekarten und, aus den Augenwinkeln, den Zahlkellner, und wurde angeherrscht, wenn er mit den Beinen baumelte. Zwischen den einzelnen Spielen, wenn sich die Aufmerksamkeit zweier Spielerinnen vorübergehend ganz dem tänzelnden Zahlkellner zuwenden konnte, während diejenige, die die Abrechnung führte, unkonzentriert ihre winzigkleinen Zahlen schrieb, zischte meine Großmutter gelegentlich: »Sitz gerade!«
Mein Vater war ein stilles, freundliches Kind. Bevor er sprechen konnte, konnte er Bridge spielen. Der Familienlegende nach soll sein erstes Wort »Rubber« gewesen sein. Die in höchstem Maße unkindliche Konzentration, mit der mein Vater stundenlang dem Lauf der Karten folgte, war erstaunlich und wäre in jeder anderen Familie aufgefallen. In dieser Familie dagegen wäre alles andere als Katastrophe empfunden worden.
Im Alter von vier Jahren besaß mein Vater ein eigenes Paket Karten. Als er ein Jahr später die ersten Versuche unternahm, den Bridgepartnerinnen meiner Großmutter verstohlen Tips zu geben, indem er bei bestimmten ausgespielten Karten die Augen verdrehte, wurde sein Bruder gezwungen, nachmittags auf den Kleinsten achtzugeben. Mein Onkel nahm also meinen Vater widerwillig in die nahe gelegenen Beserlparks, die kleinen, zerzausten Grünflächen mit. Während mein Onkel mit seinen Freunden auf ein Fetzenlaberl eintrat, saß mein Vater am Boden und legte Patiencen. Manchmal gelang es ihm, ein anderes Kind für seine Karten zu interessieren, und dann schnapsten sie miteinander. Natürlich ging es immer um irgendeinen Einsatz. Mit seinem hinreißenden, babyblauen Lächeln streifte mein Vater, der immer Sieger blieb, am Ende des Spieles Murmeln, Groschen, Manner-Toffees ein. Ab sechs Jahren veranstaltete er regelmäßig Schnapsturniere im Beserlpark, an denen vor allem Mädchen gern teilnahmen, die noch dazu um ein, zwei Jahre älter waren. Dem strikten Ausschluß von Mädchen aus allen Beserlpark-Bubenspielen war mein Vater immer verständnislos gegenübergestanden. Von Anfang an mochte er Mädchen gern. Er war mit allen Mädchen, denen er das Kartenspielen beibrachte, gleichermaßen geduldig und freundlich. Daß er sich damit bei den anderen Jungen lächerlich machte, scheint ihm gar nicht aufgefallen zu sein. Strahlend lud er alle, die interessiert waren, zu seinen Kartenturnieren ein und bat sie zuerst, ihre Einsätze offenzulegen. Die älteren Buben, die Freunde meines Onkels, verhöhnten ihn und seine Karten nur. Als er aber an Kinderschätzen schon ziemlich begütert war und seine Tasche von den Murmeln ausgebeult, versuchten sie, ihm etwas abzugewinnen. Als ihnen das nicht gelang, bewunderten sie ihn für kurze Zeit beinahe. Am Ende hielten sie ihn, in einem höheren Sinn wahrscheinlich zu Recht, für einen Schuft. Sie verprügelten ihn mit Nachdruck und nahmen ihm seine Gewinne mit Gewalt wieder ab.
Als mein Vater und mein Onkel nach einem solchen Tag nach Hause gingen, fürchteten sie das Geschrei meiner Großmutter. Sie würde meinen Onkel beschuldigen, daß er nicht gut genug auf seinen Bruder aufgepaßt hatte, und ihn einen »überflüssigen Nichtsnutz« und »gefährlichen Tunichtgut« nennen, und sie würde meinen Vater grob an den Schultern rütteln, weil er sich schmutzig gemacht hatte. Sie würde schimpfen, er sei »dreckig wie ein Rohrspatz«. Sie würde meinen Großvater beschimpfen, der ihr mit diesen beiden Söhnen »die Pest um den Hals gehängt« habe. Meine Großmutter war im häuslichen Zorn sehr kreativ. Ganz am Ende ihres Lebens, als sie kaum noch ihre Kinder und Enkel und am allerwenigsten die zahllosen verschiedenen Tabletten unterscheiden konnte, die sie einnehmen mußte, als sie nur noch die Wut auf die Welt, die sie zu verlassen sich anschickte und der sie selbst das noch ankreidete, am Leben erhielt, gelangte ihre Kunst der verrenkten Injurie zum Höhepunkt. Sie beschimpfte auf das übelste die geistliche Schwester, die sie trotz aller Gemeinheiten und Sekkierereien vorbildlich pflegte, die sie fütterte, wusch und ihr die Bettpfanne unterschob. Mein Vater, dessen angeborene Harmoniesucht im Alter übertriebene Ausmaße annahm, führte die Schwester unter gemurmelten Entschuldigungen aus dem Raum. Noch vor der Tür sprach er bittend auf sie ein, kletzelte dabei mit der einen Hand an den Nagelhäutchen der anderen, blickte zu Boden wie ein Schulbub, kurzum, er war ein Bild betretenen Jammers. Zurück bei meiner Großmutter, sagte er vorwurfsvoll: »Aber Mutter, bei allem, was sie für dich tut!«
»Was tut sie für mich?« fauchte meine Großmutter.
»Sie wäscht dich, sie versorgt dich, sie ist gut zu dir«, sagte mein gepeinigter Vater, dem die Bosheit meiner Großmutter der Nonne gegenüber genauso unangenehm war wie die Notwendigkeit, seine Mutter an ihre körperlichen Gebrechen erinnern zu müssen.
»Gut ist sie?! Was weißt denn du«, fauchte meine Großmutter, »sie ist eine Schlange im Wolfspelz!«
In diese Richtung wiesen die Aussichten der beiden Jungen, als sie nach Hause gingen. Mein Vater weinte, denn er haßte körperliche Auseinandersetzungen wie nichts sonst auf der Welt. Er kam überhaupt anderen Buben oder Männern höchst ungern nahe, was später von vielen teils bedauert, teils heftig kritisiert wurde, weil diese Scheu die einzige, allerdings erhebliche Einschränkung seines erstaunlichen Fußballtalents darstellte. Während er nun neben meinem Onkel ging, der ihn im stillen verfluchte – mein Onkel hat nie viel gesprochen, oft nicht einmal dann, wenn er gefragt wurde –, hielt er den Kopf gesenkt und sah auf seine Füße. Bei jedem Schritt schlappte ein abgerissenes Lederriemchen seiner Sandalen auf das Kopfsteinpflaster. Seine Knöchel waren zerschrammt. Der Saum seiner Hosen war eingerissen. Sein rechtes Knie war blutig, das linke blau. Aber das schlimmste war, daß er seine Karten verloren hatte, alle, bis auf eine. Die meisten hatten die Jungen, die ihn verprügelt hatten, demonstrativ zerrissen, weniger aus Sadismus, sondern um ihrer grimmigen Anordnung, daß im Beserlpark nie mehr Karten gespielt werde, letzten Nachdruck zu verleihen. Den Rest, darunter die hübschen Schnapskarten mit den Eicheln und den Schellen, hatte er im Stich lassen müssen, als er sich endlich losreißen und davonrennen konnte. Zur Ehre meines Onkels muß man sagen, daß er seinen kleinen Bruder so heldenhaft verteidigt hatte, wie es in seinen Kräften stand. Aber mein Onkel war schon als Kind besonders klein und schmächtig und er blieb es auch. Noch auf seinem Hochzeitsbild gleicht er eher dem zwölfjährigen Frank Sinatra als einem hochdekorierten Dschungelkämpfer, der er erstaunlicherweise damals wirklich war.
Meinem Vater war nur eine einzige Karte geblieben. Er hatte sie in Panik und ohne nachzudenken an sich gerissen und selbst unter all den Tritten und Knüffen nicht mehr losgelassen. Sie war, als er auf dem Heimweg seine Faust öffnete, kaum mehr als ein angstfeuchter Knödel. Auseinandergefaltet zeigte sich aber, daß er die Herz-Königin hatte retten können. Er hielt das für ein gutes Zeichen, denn bis zu diesem, seinem achten Lebensjahr war mein Vater Optimist.
Als sie nach Hause kamen, war nichts wie sonst. Schon im Stiegenhaus begegnete ihnen die glutäugige Tante Gustl, ein seltener Gast. Grußlos rauschte sie auf einer Parfumwolke dem Haustor entgegen, doch warf sie ihnen von dort noch einen letzten Blick zu, der fast menschlich war. In der Küche saß die Mutter und sah aus, als wäre sie endgültig eingefroren. Sie schaute die beiden eine Weile an, dann erst begann sie mechanisch zu schimpfen. Irgendwie hat ihr dabei aber die Kraft gefehlt, es war, als schimpfe sie aus Pflichtbewußtsein, um eine Tradition aufrechtzuerhalten, die es seit einer halben Stunde nicht mehr gab. Sogar an diesem Tag hat sie geschimpft, sagte man in meiner Familie später so anerkennend wie ein wenig schaudernd, grinste dann und nickte dazu.
Auch mein Großvater war zu Hause, er lief nervös auf und ab, sein plötzlich überflüssig gewordenes Auftragsbuch, mit dem er bis vor wenigen Tagen von Kaffeehaus zu Kaffeehaus, von Greißler zu Greißler, von Wirtshaus zu Wirtshaus gegangen war, um die Nachbestellungen an Wein und Spirituosen aufzunehmen, gedankenlos und nur noch aus Gewohnheit unter dem Arm. Äußerlich war er wie immer, gepflegt, feucht gekämmt, in einem frisch gebügelten Maßhemd mit Monogramm, immer ein bißchen ein Stutzer, ein Lebemann. Doch seine nervöse Unruhe übertraf das übliche Maß bei weitem.
Von diesem Tag an hat mein Onkel, der bisher davon nichts wissen wollte, ganz von selbst die Verantwortung für meinen kleinen Vater übernommen. Er zog ihm die kaputten Schuhe aus, wusch ihm die Knie und legte ihn schlafen.
Am übernächsten Tag schon mußte der Umzug sein, man ließ ihnen nicht viel Zeit. Herr Hermann, ein Mann, der mit Frau und Sohn im Erdgeschoß wohnte, hatte es ihnen höflich und korrekt mitgeteilt. Herr Hermann war früher Fußballspieler gewesen. Mein Großvater, einer der glühendsten Fußballanhänger, die es je gegeben hat, hatte viele seiner Spiele gesehen. Josef Hermann, den man »Pepi« rief, hatte noch im »Wunderteam« gespielt, zwar nur als Verteidiger, aber immerhin. In den Sportzeitungen, die mein Großvater im Kaffeehaus süchtig konsumierte, standen damals Sätze wie: »Nun hat man Pepi Hermann immer als nützlich, als brav, als ehrlich, als fair bezeichnet, aber er hat gerade im Sonntagsspiel wieder gezeigt, daß er einer der stärksten Taktiker ist, über die wir überhaupt verfügen.« Es waren jedoch weniger diese Sätze als Pepi Hermanns mauergleiche Unüberwindlichkeit im eigenen Strafraum, die ihn in den Kenneraugen meines Großvaters zu einem mittelgroßen Fußballgott machte.
Nach dem Ende seiner Laufbahn lebte Herr Hermann zurückgezogen. Anders als mein Großvater, der jedes Wochenende mit der Straßenbahn auf die Hohe Warte zum Match fuhr, ging er nur noch ganz selten, bei besonderen Anlässen, ins Stadion, meistens, wenn ihn die Funktionäre des »First Vienna Footballclub« liebedienerisch auf die Ehrentribüne einluden. Wahrscheinlich mußte Herr Hermann aufs Geld schauen. Herrn Hermanns Frau war kränklich, sein Sohn zum Fußball untalentiert. »Ob der auch schon spielt«, hatte er indigniert im Stiegenhaus meinem Großvater auf dessen Frage geantwortet, »und wie der spielt! – Nur wissen Sie was: Der spielt Geige!« Dieser Hermann-Pepi, wie er im Wiener Jargon verkehrt herum genannt wurde, hatte die Nachricht gebracht, und er brachte sie am selben Tag auch Herrn Eisenstein, der ein paar Häuser weiter in einem Souterrain das Ledergeschäft betrieb. Herr Eisenstein war, jedenfalls in den Augen meines achtjährigen Vaters, sehr alt, aber sehr lustig. Nicht nur, daß man bei ihm als letztem immer noch Geld ausborgen konnte, wenn es zu Hause ausgegangen und jede andere Quelle versiegt war – Herr Eisenstein war seit langem ein ebenso beflügelter wie aussichtsloser Verehrer meiner schönen kühlen Großmutter. Es wird behauptet, daß er der einzige war, der sie manchmal zum Lachen bringen konnte. Nein, was mein Vater dem Herrn Eisenstein niemals vergessen hat, war, daß er ihm einmal, zumindest theoretisch, anhand von ein paar Lederflicken demonstrierte, wie ein Fußball genäht wird.
Die Welt war mit einem Schlag zu einem Abenteuer geworden, zu einem Glücksspiel, das er noch nicht kannte. Versonnen saß mein Vater hoch oben auf dem Wagen, der Möbel und ein paar Kisten durch die Stadt zog, weit weg von den Beserlparks am Gürtel hin in eine Gegend, wo es wunderbare große Wiesen gab, in den krummen Gassen aber nach Kohl und Moder roch. Schon hatte er den Gesichtsausdruck des unsportlichen Hermann-Buben vergessen, wie der mit seinem Geigenkasten plötzlich in der Wohnung stand, verlegen und doch auch mit einem kleinen, stechenden Selbstbewußtsein, das an diesem Tag zum ersten Mal zu bemerken war. Und bald würde er auch die paar düsteren Monate mit seiner Großmutter in der Wohnung beim Augarten vergessen, den beengten Raum, das Gejammere der alten Frau, die erst kürzlich verwitwet war – »immerhin, für den Großvater noch ein Glück«, kommentierte man in meiner Familie später immer –, er vergaß den unangenehmen Geruch, der aus ihren vielen schwarzen Röcken stieg, und das Gelächter, das sich ihm aufdrängte, wenn er daran dachte, daß sie, so dick, schwarz und asthmatisch, die fünf Stöcke nicht mehr hinunter- und hinaufsteigen und daher die Wohnung kaum mehr verlassen konnte. Er durfte noch ab und zu in den Augarten, scharf bewacht von seinem Bruder. Bald wurde es dazu zu kalt. Er vergaß das Geflüster der Eltern am Abend, die nicht mehr ins Kaffeehaus gingen, und die tränenreichen Besuche seiner großen Schwester Katzi, die ihm seit jeher weniger als Schwester, sondern als bildschöne, ferne und zärtliche Göttin erschienen war. Nur daß sein Bruder, mein Onkel, ihn immer zu Katzis dickem Verlobten hingestoßen hatte, damit er ihn um Taschengeld für sie beide anbettelte, das vergaß er nie. Doch das meiste vergaß er für viele Jahrzehnte, manches auch für immer, denn mein Vater pflegte die weniger geglückten Dinge im Leben blitzschnell zu vergessen, oder er machte daraus einen geistreichen Witz.
Am Tag vor der Reise ließ meine Großmutter ihre beiden Söhne im Atelier »Purr & Kubla« fotografieren. Sie war so kühl und kerzengerade wie immer. Die Kinder trugen Anzüge und perfekt gebundene Kinderkrawatten, auf die Hemden hatte ihnen mein Großvater heimlich ihr Monogramm sticken lassen, eine Eigenmächtigkeit und völlig unnötige Ausgabe, die meine Großmutter mit den üblichen Vorwürfen geahndet hatte. Die abstehenden Ohren meines Vaters waren leider durch nichts zu kaschieren, mein Onkel, dessen Ohren ordentlich anlagen, wie meine Großmutter mit Genugtuung bemerkte, sah kaum älter aus, dabei war er schon fünfzehn. Der Fotograf behandelte meine Großmutter ausgesucht. Wegen ihrer klaren, korrekten, dialektfreien Sprache hielt man sie für eine Deutsche, das würde noch oft so sein, zur Zeit war es von Vorteil. Nur deshalb hatte sie überhaupt einen Termin bekommen, und weil die Frau Direktor Königsberger Stammkundin war, sonst wäre das, so kurz vor Weihnachten, wohl kaum möglich gewesen. Sie zeigte keine große Dankbarkeit.
»Purr & Kubla« war ein bekanntes Atelier, sie fertigten schöne starre Bilder an. Also muß es an der Eile und dem eingeschobenen Termin gelegen haben, vielleicht war der Meister auch wegen des majestätischen Anblicks meiner Großmutter oder wegen der bewegten Zeiten nicht ganz bei der Sache, jedenfalls sehen die beiden Buben auf den Fotografien so aus, als hätte man sie zu Tode erschreckt. Auch ein bißchen unscharf sind diese letzten Bilder.
Am nächsten Tag fuhr man zum Westbahnhof. Man nahm ein Taxi, wieder eine völlig unnötige Ausgabe, und das in diesen Zeiten, doch hat meine Großmutter sich diesmal nur mechanisch widersetzt. Den Moment des Abschieds von den Eltern in der Halle hat mein Vater sofort und für immer vergessen, denn am Bahnsteig warteten schon Scharen von anderen Kindern, und scheinbar nur auf ihn. Er begann sofort mit ihnen zu spielen, ein zutrauliches Strahlen im Gesicht. Plötzlich wurden einige grob, sie rupften am Quastl seiner warmen Zipfelmütze, »diesn Wollknäul, der da drang’hängt is, den wolltns ma runterreißn«, erzählte er später, er wehrte sich, er weinte, dann schrie er gellend, endlich drängte mein Onkel die schlimmsten Sekkierer weg. Schließlich, im Zug, war das Quastl dennoch verschwunden, abgerissen, zurückgeblieben, irgendwo am Bahnsteig am Westbahnhof. Mein Vater lachte schon wieder. Der Zug zischte. Er saß in einem Abteil neben einem hübschen kleinen tränenverschmierten Mädchen und zog lockend die Karten mit den Schellen und den Eicheln aus der Tasche. Das Mädchen hatte noch nie geschnapst. Sie hatte auch keine Einsätze zu bieten, keine Murmeln, keine Knöpfe, keine Manner-Toffees. Nach kurzer Überlegung spielte mein Vater trotzdem mit ihr. Sie war hübsch genug. Zwar gewann er Spiel um Spiel – »was willst da groß erwarten«, würde er später in vergleichbaren Fällen sagen, wo er sich für Schönheit vor Talent entschieden hatte –, doch schenkte er ihr am Ende sogar ein Manner-Toffee, quasi zum Trost. Draußen zog die Heimat vorbei. Die Betreuer waren sorgsam, die älteren Kinder, darunter mein Onkel, zornig und bedrückt. Mein Vater hat davon nichts bemerkt. In einem fernen Bahnhof reichten unwahrscheinlich freundliche Frauen den Kindern Obst und Schokolade durch die Fenster herein. Sie sprachen ein komisches Deutsch. Mein Vater war begeistert und winkte wie wild. Die Frauen lächelten zurück.
Glühend vor Fieber erwachte mein Vater in einem Krankenhaus. Schwestern mit hohen weißen Hauben sprachen zu ihm, sie rüttelten ihn, sie schrien ihn an, doch er verstand sie nicht. Alle Kinder waren verschwunden, auch mein Onkel, sein Bruder, seine Karten sowieso. Mein Vater war zum ersten Mal in seinem Leben allein und tief verzweifelt. Er schluchzte babyblaue Tränen. Er biß vor Nervosität auf seinen Lippen herum. Wenn die Schwester das sah, schlug sie ihm im Vorbeigehen mit der flachen Hand auf den Mund. Als er ihr ängstlich von einem kleinen Bedürfnis berichtete, wandte sie sich verständnislos ab. Mein Vater pinkelte ins Bett. Das sollte nicht das Schlimmste bleiben. Das Schlimmste wurde von der Schwester bald am Geruch entdeckt. Dann saß er, achtjährig, auf einem kleinen Kindertopf, zwischen den hohen Betten. Die Holzpantoffeln der bösen Schwester klapperten auf dem Steinfußboden hin und her, die langen Bettenreihen entlang. Sie ließ ihn zur Strafe auf dem Topf sitzen. Seine nackten Füße wurden eiskalt. Hundert Jahre später, es war schon ganz finster, wurde er von einer Nachtschwester beim Kontrollgang dort gefunden. Sie schüttelte den Kopf, machte ein paar freundliche Geräusche und legte ihn wieder ins Bett. Sie wärmte ihm sogar noch kurz mit ihren Händen die kleinen Füße.
Mein Vater hatte auch als Erwachsener ungewöhnlich kleine Füße. »Die besten Fußballer haben kleine Füße«, sagte er gern, und dann zogen wir Kinder immer gleich die Schuhe aus und verglichen unsere Füße mit seinen. Mein Bruder hatte schon als Zehnjähriger größere Füße als mein Vater, davon nahm eines seiner vielen angeblichen Kindheitstraumata seinen Ausgang. Als er als Student im ersten philosophischen Proseminar eine Arbeit über das Verhältnis von Nützlichkeit und Schönheit schrieb, brachte es mein Bruder fertig, einen Absatz über die durch Bandagen herbeigeführten Fußverstümmelungen bei asiatischen Frauen unterzubringen. »Wer je die völlig verkrüppelten Füße japanischer Geishas gesehen hat, wird einsehen, daß der Versuch, Schönheitsideale gewaltsam zu erzwingen, direkt in den Totalitarismus führt«, formulierte er flammend als Neunzehnjähriger, »wir Menschen sind alle gleich, doch wir sehen nicht gleich aus. Jeder dient der Gesellschaft auf seine Weise. Der Fuß dient zum Gehen und Laufen, wenn er das nicht mehr kann, ist er nutzlos geworden. Darüber hinaus hat er, etwa hinsichtlich seiner Größe und Form, keine wie immer geartete Aussagekraft über den Wert eines Menschen.« – »Sehr gut!« merkte sein Professor am Rand handschriftlich an; er verstand nichts von Fußball und war einer der wenigen, die meinen Bruder nicht auf seinen Namen und das naheliegende Verwandtschaftsverhältnis ansprachen.
Meine Schwester hatte mittelgroße Füße, sie behauptete daraufhin, ein mittelguter Fußballer zu werden. »Das ist doch nichts für Mädchen«, sagte mein Vater und schüttelte verständnislos den Kopf, »nimm lieber deinen Schläger und geh an die Wand.«
Wie mein Vater feststellen mußte, arbeitete die Nachtschwester, eine junge Inderin, ausschließlich nachts. Am nächsten Tag war die böse Schwester wieder da, das Klappern der Holzpantoffeln zeigte es schon von weitem an. Sie brachte Essen, das mein Vater nicht wollte. Er drehte den Kopf weg. Sie hielt seinen Kopf mit einer Hand am Kinn fest, zwängte ihm mit den Fingern den Mund auf und schob das Essen, einen braunen Brei, hinein. Mein Vater würgte. Sie stieß mit der Gabel nach, als ob sie eine Gans stopfe. Er schluckte. Beim fünften Mal erbrach er sich. Sie fragte ihn: »Did you like the food?« Er starrte sie an, ohne zu verstehen. Sie fragte ihn: »How are you, you little brat?« Sie fragte: »How are you doing?« Sie sagte: »Say: Very well, thank you.« Er starrte sie an. Sie schrie: »Say! Say: Very well, thank you!« Mein Vater blickte in den braunen Brei vor sich auf der Bettdecke und auf ihrer Gabel. Ihm war schlecht. Gleich würde er wieder weinen müssen. Er sagte leise: »Very well, thank you.«
Am nächsten Tag kam die Visite, kamen viele Ärzte mit Brillen und freundlichen Gesichtern, begleitet von einer summenden weißen Schwesternschar. Ein Arzt beugte sich über meinen Vater, griff ihm an die Stirn und auf die Wangen, fragte: »How are you doing?« Ganz hinten stand »seine« böse Schwester. Mein Vater konnte ihren Blick fühlen. »Very well, thank you«, flüsterte er.
»Scarlet fever«, sagte der Arzt zum anderen, »look at him. No doubt.«
»Scarlet fever«, sagte er freundlich zu meinem Vater, »that’s what you caught.«
»Very well, thank you«, flüsterte mein Vater. Der Arzt lachte und tätschelte ihm den Kopf. »Good boy«, sagte er.
Der Satz wurde symptomatisch für sein Leben. Mit diesem Satz begrüßte er erschöpft seine Pflegeeltern, nachdem er mit vielen anderen Kindern stundenlang auf einem Platz gestanden war und gewartet hatte, daß auch ihn jemand mitnahm. Mein Onkel hat das Verfahren später einen »Kinderbazar« genannt, »ohne Kritik«, wie er sagte, »aber trotzdem«. Dabei war er selbst es gewesen, der die Prozedur für meinen kleinen Vater in die Länge gezogen hatte, weil er sich erst strikt weigerte, ihn allein gehen zu lassen. Die meisten Paare, die da kamen, wollten einzelne Kinder, am liebsten kleine Mädchen. Den kleinen Buben mit den babyblauen Augen hätte auch so mancher genommen, doch niemand wollte zwei auf einmal, noch dazu, wo der zweite schon fünfzehn und nicht mehr schulpflichtig war. Ein jüdischer Schneider, der einen Lehrling suchte und ein bißchen jiddisches Deutsch sprach, überzeugte meinen Onkel schließlich. Der Schneider, den die durchscheinende Schmächtigkeit und die dünnen Finger meines Onkels an seine eigenen Anfänge als Schneiderlehrling erinnerten und der dringend eine Hilfskraft brauchte, machte ihm klar, daß sein kleiner Bruder am sichersten sei, wenn er zu einer Familie aufs Land käme. Er bot an, so lange zu bleiben und zu dolmetschen, bis eine geeignete Familie gefunden sei.
Der geeignete Mann war herzlich, aber linkisch. Er war »sehr vom Land«, wie mein Vater wohl über jeden anderen gesagt hätte, aber über seinen Pflegevater sagte er niemals etwas, das nur im geringsten ironisch gewesen wäre. Die geeignete Frau war härter als ihr Mann, von diesem schnippischen Selbstbewußtsein, das aus dem Ärger über die eigene Unsicherheit kommt. Der Mann dagegen war weich und freundlich, seine individuellen Sturheiten würden sich erst später erweisen. Er beugte sich zu meinem todmüden, eben erst genesenen Vater und fragte ihn, ob er denn nun seinem Bruder good-bye sagen und dann mit ihnen nach Stopsley kommen wolle. »Very well, thank you«, sagte mein Vater.
Mein Vater verlor völlig den Überblick über die Anwendung dieses Satzes, er konnte nicht mehr sagen, wann er gelogen und wann er wahr war. Im Zweifel hätte er den Satz und sich selbst immer für wahrhaftig gehalten. Sich einzugestehen, daß der Satz oft gelogen war, hätte die Erkenntnis nach sich gezogen, daß es eine Inkongruenz zwischen Sein und Sagen, zwischen Innen und Außen gab. Aber mein Vater liebte sein Leben lang die Kongruenz und die Harmonie. Also besänftigte er mit diesem Satz nicht nur eine fragende Umgebung, sondern am allermeisten sich selbst. Neun Jahre später, nach seiner Rückkehr, als er bei einer alten kranken Frau Professor Stunden nahm, um wieder Deutsch zu lernen, suchte er in ihren geduldigen, monotonen Lehrerinnen-Sätzen konzentriert nach der geeigneten, der perfekten Übersetzung, die, um perfekt zu sein, ja keine wörtliche sein muß, er suchte nach dem deutschen Parallelsatz für sein wirkliches oder angebliches Wohlbefinden. Einmal brachte während seiner Deutsch-Stunde die Nachbarin Lebensmittelmarken vorbei, mit denen wurde die pensionierte Frau Professor für die Nachhilfestunden der Nachbarinnen-Töchter bezahlt. Die Nachbarin läutete, die müde alte Frau Professor öffnete die Tür, nahm die Lebensmittelmarken entgegen, mein Vater spitzte die Ohren. »Und sonst?« fragte die Nachbarin. »Alles bestens, danke«, sagte die Frau Professor und schloß schnell die Tür. So hat mein Vater seine Wendung gefunden, eine noch vielfältiger verwendbare als die englische. In guten wie in schlechten Zeiten war er von nun an bestrebt, daß immer »alles bestens« sei. Er lernte so zu fragen (»Und? Alles bestens?«), daß andere Antworten praktisch ausgeschlossen waren. Als er zu meinem Bruder ins Krankenhaus eilte, der sich am Schul-Skikurs das Bein gebrochen hatte, fand er ihn heulend im Krankenbett vor, heulend zeigte mein Bruder auf sein eingegipstes Bein, das steil in einer Schlaufe hing. Mein Vater nickte mitfühlend, warf einen Blick auf die drallen Salzburger Schwestern, auf die Reste des goldgelben Schnitzels, die noch am Nachttisch standen. »Aber sonst, doch alles bestens?« fragte er.
Chuzpe
Jahrelang hatte man nichts von ihr gehört, da rief eines Tages die Tante Gustl an und sagte mit anklagendem Ton, sie liege nun im Sterben. »Ich verlang nix«, sagte sie herrisch, »ich brauch nix. Ich will dich nur noch einmal sehen.«
»Um Himmels willen«, sagte mein Vater erschrocken, »ich komm sofort. Kann ich dir etwas mitbringen? Hast auf irgend etwas Lust?«
»Ich sag doch, ich brauch nix. Lust hab ich seit Ewigkeiten auf gar nix mehr. Komm einfach her«, befahl die Tante Gustl.
»Eine Kleinigkeit«, flehte mein Vater, der grundsätzlich mit leeren Händen keine Besuche machte, aber gleichzeitig immer panische Angst hatte, das Falsche zu bringen, »eine Süßigkeit?«
»Willst mich umbringen?«, fragte die Tante Gustl empört, »ich bin nur noch Haut und Knochen!«
»Na eben«, rief mein Vater, »du mußt doch essen!«
»Was brauch ich essen, wenn ich geh sterben?« fragte die Tante Gustl herausfordernd und lenkte dann gnädig ein: »Einen Apfelstrudel, wo du so liebenswürdig sein willst.«
Wie sich herausstellte, war meines Vaters Vetter, Tante Gustls umfassend mißratener Sohn Ferdinand, genannt Nandl, wieder einmal im Gefängnis. Diesmal war er, zum Gaudium der Lokalblätter, mit zwanzig Metern Gummischnur und zwei Topfenkolatschen in den Hosentaschen beim Ladendiebstahl erwischt worden. »Was wollte Dieb mit Gummischnur?« fragte sich schmunzelnd der »Kurier«, der im folgenden detailliert die Fettflecken beschrieb, die die Kolatschen links und rechts im Oberschenkelbereich von Nandls Hose hinterlassen hatten. Daß man Nandl wegen dieser Flecken an der Supermarktkasse gefilzt hat, ist allerdings ein böswilliges Gerücht, das in meiner Familie bloß zum Beweis der sich sozusagen durchgeschwitzt habenden Dummheit erzählt wurde. Nein, Nandl wurde gefaßt, weil man ihn kannte.
Wegen seiner unzähligen Vorstrafen brachte ihm die Gummi- und Kolatschengeschichte umstandslos sechs Monate ein. Meinem Vater zufolge war Nandl der dümmste Verbrecher des Landes. Er hatte sich auf Scheckbetrügereien spezialisiert, die er so plump ausführte, daß er meistens innerhalb von Tagen verhaftet wurde. Mein Vater behauptete, daß bei jedem gefälschten Scheck, der auftauchte, und bei allen Schecks, die als gestohlen gemeldet wurden, als erstes überprüft werde, ob Ferdinand K. gerade im Gefängnis oder »draußen« sei. So, behauptete mein Vater, beginne in Österreich ausnahmslos jede Ermittlung in Sachen Scheckbetrug – mit der Überprüfung, ob Nandl als Täter in Frage komme oder nicht.
In einer typischen Formulierung hieß es in meiner Familie immer, »Nandls Schicksal ist angeboren«, denn Nandl sei zweifellos das Opfer eines Vererbungsdesasters: Zwar sei er so groß und gutaussehend wie sein Vater Dolly und könne so charmant und verführerisch sein wie seine Mutter, wenn sie auf etwas aus war (das war sie meistens), doch habe er Dollys begrenzten Verstand in der fatalen Kombination mit Gustls krimineller Energie geerbt. »Optisch geht er als Heiratsschwindler durch«, hatte meine Großmutter schon in Nandls Jugend, bevor er das erste Mal straffällig geworden war, bemerkt, »doch sogar dazu ist er zu dumm.« Das »sogar« bezog sich darauf, daß meine Großmutter im allgemeinen von Frauen eine noch schlechtere Meinung hatte als von Männern.
»Kriminelle Energie«, fragte meine Schwester, während sie sich die Nägel lackierte, »ist die Tante Gustl denn kriminell?« Gerade in diesem Augenblick wurde das Thema gewechselt. Mein Bruder, der sich, seit er studierte, den Traditionen und Ritualen der Familie, besonders aber ihren Glaubens-, das heißt ihren Anekdotengrundsätzen heftig widersetzte, begann nämlich, eine Verteidigungsrede auf Dolly Königsbee zu halten. Dolly sei nicht beknackt, sondern im Gegenteil genial gewesen. »Er war nicht beschränkt, seine Genialität war es«, dozierte mein Bruder, »beschränkt auf ein einziges Gebiet, die Sprache.« Er stützte den Kopf in die Hand, wobei ihm seine »Johnny ohne« beinahe die Locken über dem Ohr angesteckt hätte.
»Sitz gerade«, bat mein Vater, »und rauch nicht soviel.« Mein Onkel schüttelte nur den Kopf. Er hielt meinen Bruder für »temporär querulantisch«, doch hätte er das nie laut gesagt. »Wie kann man sein genial, wenn man is sogar zu bleed fir Redensarten?« fragte mein Großvater jedes Mal aufs neue verständnislos. »Aber Opa«, sagte mein Bruder dann herablassend, »du glaubst doch nicht, diese Fehler waren zufällig?«
Dolly Königsbee war in den Anekdotenschatz meiner Familie eingegangen, weil es kaum eine Redewendung und kein Fremdwort gab, das er nicht verdreht und verunstaltet hatte. Sein Verhängnis war, daß er bei gleichzeitig hundsmiserablem Gedächtnis Fremdwörter liebte, er liebte sein »Lexikon der wichtigsten Redensarten«, sein »Handbuch geschliffener Sprache« und seine »Zitatensammlung der Antike«. Im Gegensatz zu seiner Frau war er nicht im geringsten eitel, doch er fand, es stehe einem Bankdirektor gut an, ab und zu ein klassisches Zitat einzuflechten, wenn er zu seinen Mitarbeitern sprach. Er hielt das für kultiviert und er glaubte, sein Beispiel rege seine Mitarbeiter zur individuellen Weiterbildung an. »Pater semper imperfectus«, pflegte er ihnen mit väterlichem Lächeln zu raten, »der Mensch lernt nie aus.«
Deshalb liebte man in meiner Familie den Dolly Königsbee. Dutzende seiner grotesken Fehlbildungen waren im familiensprachlichen Umlauf, neue wurden hinzuerfunden; wenn ein Politiker oder ein Fußballer etwas verdrehte, was in den »Aufgelesen«- oder »Zitiert«-Rubriken der Zeitungen vermerkt wurde, johlte man in meiner Familie: »Das könnt’ vom Königsbee sein!« Die Pointenschleuder Königsbee hatte sich vom Menschen Adolf »Dolly« Königsberger völlig entkoppelt. Sprach man vom netten, aber hilflosen Vater Nandls, hieß er »Dolly«, sprach man vom gepiesackten Gatten der Tante Gustl, war er der »arme Dolly«, doch daneben existierte eine kultisch verehrte Kunstfigur namens Königsbee.
Die ältere Generation, die den früh verstorbenen Bankdirektor noch persönlich gekannt hatte, versuchte sogar seine rührend zufriedenen Mundwinkel aufzusetzen, wenn sie einen Satz mit der Wendung »wie der Königsbee gesagt hätte« begann; die jüngere Generation hatte damit zu kämpfen, daß dieser Einleitungssatz irgendwann wegfiel, weil die Urheberschaft allen hinreichend bekannt schien. So unterlief es meiner Schwester in ihrer Kindheit immer wieder, daß sie Formulierungen wie »um den Preis fleischen« oder »mit der Kirche ins Dorf fallen« verwendete oder Mitschüler als »Phariseure« beschimpfte, wie es innerhalb der Familie üblich war. Mein Bruder dagegen profitierte später sogar vom Königsbee: Er gab seinem berühmten Aufsatz über den Sportfunktionär Felix Popelnik, den er als KZ-Aufseher enttarnte, den Titel »Wie Felix aus der Asche?« – in Wahrheit ein klassischer Königsbee.
Sobald eine bestimmte Menge an zufällig passenden Königsbee-Zitaten gefallen war oder wenn gar ein Außenstehender dabeisaß, dem man das Phänomen Königsbee gänzlich neu erklären konnte, rollte in meiner Familie automatisch eine Art Best-of-Version ab. »Drei Wochen lang hab ich mich kastriert und trotzdem kein Deka abgenommen«, kicherte mein Vater. »In diese Suppe mußt dir selbst hineinspucken«, erwiderte prompt meine Mutter. »Das ist doch seine Dämone«, setzte mein Onkel fort. »Ja, ja, aber immer in der Maske des Biedermeiers«, fügte seine Frau, die Tante Ka, hinzu. »Ihr seid in allen Satteln ungerecht«, klagte schauspielernd mein Bruder. »Und Schlangen im Wolfspelz«, ergänzte mit konzentriert gerunzelter Stirn meine Schwester, doch da gab ihr meine Mutter unter dem Tisch einen Tritt.
»Der Königsbee war ein Genie«, schloß mein Bruder die hundertmal geübte Familienvorstellung befriedigt, »das hab ich verbal schon immer gesagt und alles andere ist letztlich primär.«
Die Tante Gustl thronte, gestützt von Pölstern, geschminkt und frisiert im Bett und stach gierig nach dem Apfelstrudel. Das Essen im Pflegeheim der Barmherzigen Schwestern ist seit jeher nicht berühmt. Trotzdem erstarrte sie beim ersten Bissen expressiv. »Was ist d-a-s?« fragte sie angewidert.
»Apfelstrudel«, antwortete mein Vater erschrocken.
»Von wo?!«
»Von der ›Aida‹«, sagte mein Vater.
»Wie kannst du nur«, sagte sie verächtlich, schüttelte den Kopf und aß langsam weiter. Rätselhaft ist bis heute, warum unter allem, was die Tante Gustl sich später noch an Quälereien für ihn ausgedacht hat, ausgerechnet das meinen Vater am meisten geärgert hat. »Ich brauch nix, ich verlang nix«, äffte er sie noch Jahre nach ihrem Tod grimmig nach, »aber der Apfelstrudel muß sein vom ›Demel‹, auch wenn ich lieg im Sterben.«
Die Tante Gustl hatte den Plan gefaßt, zum »endgültig letzten Mal« etwas für ihren Sohn zu tun. Dabei sollte ihr mein Vater helfen, denn vorerst konnte sie nicht einmal aufstehen. Sie brauchte Strumpfhosen (»von Palmers natürlich, wo denkst du hin, bei denen von der Gazelle zwickt’s im Schritt!«), sie brauchte eine neue Bluse, sie brauchte jemanden, der ihr dunkles Kostüm in die Putzerei trug und wieder abholte, jemanden, der die Perlen zum Juwelier brachte, denn die Schließe war kaputt, und sie brauchte vor allem einen Termin beim Doktor Schneuzl. Der Doktor Schneuzl war ein Sektionschef im Justizministerium, mit dessen Vater der Dolly, Gott hab ihn selig, vor hundert Jahren Tennis gespielt hatte, damals, als der Dolly dem Hofrat Schneuzl ganz außertourlich den Kredit für den Tennis-Club im Prater … du weißt schon … der Doktor Schneuzl würde etwas tun können, vielleicht, man wird sehen, man muß es versuchen.
Mein Vater wand sich. Mit Strumpfhosen kannte er sich nicht aus. Er würde meine Mutter bitten müssen. Meine Mutter würde ihn wütend fragen, ob sein »Familienwahn«, wie sie es nannte, nun schon so weit gehe, daß er mit seiner »übertriebenen Kümmerei« nicht einmal vor dem »alten Scheißgesicht« haltmache, ob im Sterben oder nicht. »Ich bitte dich, die Kinder!« würde mein Vater entsetzt sagen, sobald meine Mutter lustvoll »das alte Scheißgesicht« ausgerufen hätte, »ich bitte dich«, würde sie ihn nachäffen, »aber daß sich dein Vater im Grab umdreht, das läßt dich kalt!« Mit fortschreitendem Alter hatte mein Großvater, der seine Ablehnung anderer Menschen bis dahin durch Ignoranz, maximal durch hämische Bemerkungen erkennen hatte lassen, einen offensiven Haß auf seine Schwester Gustl entwickelt, der seinen Höhepunkt im inflationären Gebrauch von »altes Scheißgesicht« fand. Schließlich sagte er nie mehr »Gustl«, wenn er über sie sprach, er verwendete längst nicht mehr sein früheres, ironisches »die Frau Direktor-Direktor«, was sich auf den doppelten Doktor des armen, jung verstorbenen Dolly bezog. Den hatte er zärtlich »Doktor Dolly-Dolly« genannt, denn er mochte den Dolly gern – »ein anständiger Mensch, im Gegensatz«, hatte mein Großvater damals schon gesagt, aber das war, als Seitenhieb auf die Gustl, vor dem Krieg das äußerste. Später sagte er über seine Schwester ausschließlich »das alte Scheißgesicht«. Wir hielten das für senilen Wahnsinn, vor allem, weil er sich weigerte, einen Grund dafür zu nennen. »Den Grund nehm ich ins Grab, und dort wird er gut liegen«, soll er einmal zu meinem Bruder gesagt haben, aber das erwähnte mein Bruder leider erst lange nach unseres Großvaters Tod, weshalb die Authentizität dieser Aussage von einigen in meiner Familie bezweifelt wird.
An diesem Punkt seiner Gedanken war mein Vater angelangt, als die altersfleckige braune Gustl-Hand über die Bettdecke auf ihn zukroch, ihn packte und beschwichtigend ein wenig Apfel auf seinem Handrücken verrieb. »Schau, mein Lieber«, gurrte sie, »ich weiß, ich mach dir Umständ’, aber er ist doch mein einziges Kind, und du bist doch mein Lieblingsneffe, und wenn du mir dieses eine Mal, dieses einzige Mal nur hilfst, dann werd ich dir alles vererben.«
»Gott soll abhüten!« rief mein Vater aus und hob abwehrend die Hände, und wenn er nicht gerufen und die Hände gehoben hat, dann zeigten zumindest seine Körperhaltung und sein Gesicht den Ausdruck schockiertester Ablehnung. Zum kausalen Zusammenhang von Geben und Nehmen hatte mein Vater sein ganzes Leben lang eine schwer gestörte Beziehung. Es bereitete ihm geradezu Magenschmerzen, wenn er annehmen hätte müssen, man hielte ihn für berechnend. So tat er zwar den meisten Verwandten und Freunden (Ausnahme: meine Mutter) liebend gern jeden Gefallen, wies kleine Aufmerksamkeiten aber mit einem entrüsteten »deshalb hab ich’s aber nicht gemacht« zurück. Gleichzeitig überschlug er sich fast vor Dankbarkeit, wenn jemand etwas für ihn tat (Ausnahme: meine Mutter). Am liebsten arbeitete er unbedankt, so behielt er den Respekt vor sich und den anderen. Er schenkte auch nicht gerne, oder jedenfalls nicht gerne groß, denn man hätte denken können, er wolle etwas. Nein, er beobachtete das Geben und Nehmen anderer Menschen am liebsten aus sicherer Entfernung. Er sah schon bei den geringsten Anlässen moralisch knebelnde Abhängigkeitsverhältnisse herandräuen, sah Nepotismus, wo noch lange keiner war, und er zog tiefe Befriedigung daraus, diesen Systemen nicht anzugehören, ihnen vielmehr großräumig und vorausblickend auszuweichen. Er hat dabei nie bemerkt, daß er in diesem entscheidenden Punkt sein Lebensziel, nämlich ein guter, echter, ein typischer Österreicher zu sein, katastrophal verfehlt hat.
Der obszöne Wink mit dem Zaunpfahl ihres Erbes – »was hat denn die schon groß zu vererben«, höhnte vorhersehbar meine Mutter – hatte jedenfalls die Tante Gustl bereits ans Ziel gebracht. Einen Dienst, für den einem das Erbe angeboten wurde, konnte mein Vater nicht ausschlagen, denn das mußte ein großer, dem Anbieter wirklich am Herzen liegender Dienst sein. Den Lohn, das sogenannte Erbe aber mußte er unbedingt ausschlagen, denn man hätte ihn ja sonst für berechnend gehalten. So einfach funktionierte mein Vater manchmal. »Wie du willst«, schnurrte die Tante Gustl zufrieden. Wie gesagt, war sie von Jugend an abgebrüht. »Aber das eine oder andere Stückl wirst dir doch aussuchen wollen. Denk an deine Kinder.«
Das erste und bisher einzige Mal zu helfen versucht hatte die Tante Gustl ihrem mißratenen Sohn Anfang der Fünfziger. Nandl war der Teschek einer berühmten Bande von Stoffbetrügern gewesen, die sich im ›Weißkopf‹ traf. Das ›Weißkopf‹ gehörte Vickerl Weißkopf, einem hervorragenden Koch und hundselendigen Geschäftsmann, der auf unklare Weise den Krieg überlebt hatte. Die einen behaupteten, er sei in irgendeinem Nebenlager von den Russen befreit worden, die anderen, er sei in russischer Kriegsgefangenschaft gewesen. Um in russische Kriegsgefangenschaft zu gelangen, hätte er eigentlich erst einmal der deutschen Wehrmacht angehören müssen, aber für solche Feinheiten hatte man in den Nachkriegsjahren keine Zeit. Irgend etwas mit den Russen war es jedenfalls gewesen, die saßen auch immer bei ihm im Lokal herum, er hatte nie Schwierigkeiten, Wodkalieferungen zu bekommen, offenbar verstand er auch ein wenig von der Sprache. Vickerl Weißkopf galt als »klasser Bursch«, nicht zuletzt deshalb, weil er von seinen sogenannten Kriegserlebnissen kein Aufhebens machte. Der Grund, warum das ›Weißkopf‹, ein düsteres, holzgetäfeltes Lokal mit Rauchglasspiegeln und gelblichen Kristallustern, trotz ständiger Überfüllung so wenig Ertrag abwarf, lag, jedenfalls meinem Vater zufolge, darin, daß Vickerl Weißkopf so gerne kochte und mit seinen Freunden Wodka soff, daß er darüber komplett das Geschäft vergaß. »Du weißt ja, wie die Leut’ sind«, sagte mein Vater später immer wieder vorwurfsvoll, »die kommen rein, fressen die Hühnerleber und das gehackte Ei, was der Vickerl automatisch auf’n Tisch g’stellt hat, saufen an Gratis-Wodka oder zwaa und geh’n wieder, ganz ohne Konsumation.«
»Anständig wär g’wesen«, sagte mein Vater vorwurfsvoll, »zumindest eine Hauptspeise zu bestellen, das Paprikahendl zum Beispiel war beim Vickerl wirklich herrlich!«
»Aber meistens hat er dann vergessen zu kassieren«, warf mein Onkel relativierend ein.
Das ›Weißkopf‹ war der Treffpunkt aller klassen Burschen. Hier saß zum Beispiel, meist allein und mit einem seligen Lächeln, jener Heinrich H., der mit etwas handelte, was man im ›Weißkopf‹ grinsend die »falschen Ikonen« nannte. H. war in Dachau befreit worden. Manchmal, wenn er sehr betrunken war, erzählte er überfallsartig wüste Geschichten von Erschießungslisten, auf denen er sich schon befunden, und den haarsträubenden Zufällen, auf Grund derer er ein ums andere Mal doch wieder überlebt hatte. »Geh, sei net so deppert«, sagten die Leute dann angewidert zu ihm und rückten noch mehr von ihm ab. »Gott hat mich gerettet«, rief H. mit sich überschlagender Stimme, öffnete ungeschickt seinen Vertreterkoffer, holte eine der geschmacklos bemalten Madonnen heraus und küßte sie theatralisch. Dann kicherte er und versank wieder in Agonie.
Heinrich H. war erfolgreich. Er war manchmal wochenlang unterwegs, schlug sich, immer in Anzug und Krawatte, von Wien über den Semmering ins Wechselgebiet und bis tief in die Steiermark durch und drehte der Landbevölkerung seine billigen ungarischen Heiligenfiguren mal als kostbare Antiquitäten, mal als wundertätige Reliquien an. Nach Kriegsende scheint es einen großen Bedarf an christlichen Kultgegenständen gegeben zu haben. H. führte auch Kruzifixe in verschiedenen Größen, »geeignet für jeden Herrgottswinkel«. Er verstand sich auf Dialekte. Er sprach sich gut mit denen, die man im ›Weißkopf‹ nur herablassend »die G’scherten« nannte. Besonders gut verstand er sich auf die Bäuerinnen. Er sah den religiösen Wahn in ihren Augen und er sah die Gier in den Augen der Bauern, von denen sich manche noch jahrelang nicht verzeihen konnten, während »der gaunz schlecht’n Zeid« verzweifelten Juden die Tür gewiesen zu haben. Auf ihren der Welt abgewandten Höfen waren sie nicht sicher gewesen, ob nicht auch der schamlos billige Erwerb von jüdischen Wertsachen irgendwie strafbar sei, und hatten daher lieber nichts gekauft.
Das ›Weißkopf‹ war nun eigentlich kein Stammlokal ausschließlich zwielichtiger Figuren, eher war es so, daß in den ersten Jahren, wo, wie mein Vater sagte, »ja kaner was zum Fressen g’habt hat«, die meisten Leute der Not gehorchend den seltsamsten Professionen nachgingen. Nachdem Nandl Königsberger verhaftet worden war, kostete es Vickerl Weißkopf jedoch große Mengen an Wodka und anderer »russisch« genannter Überzeugungsarbeit, um einen größeren Imageschaden von seinem Lokal abzuwenden – denn daß die Stoffbetrüger-Bande hier ein und aus gegangen war, ließ sich kaum abstreiten. In Wahrheit waren die Stoffbetrüger, zwei Brüder namens Karli und Joschi sowie ein Dritter, der »der Hilfssheriff« genannt wurde, gar keine richtigen Gangster, sondern eher die Spaghettiwesternhelden ihrer Zeit, harmlose Wiener Möchtegern-Capones, drei gutaussehende, vielleicht etwas zu gelackte junge Männer, die ihre niedrige Herkunft mit viel Frechheit, Pose und Pomade vergessen machen wollten. Sie waren coole Strizzis, denen neben dem unanstrengenden Broterwerb vor allem die Hetz wichtig war. Die Idee zu den Stoffbetrügereien scheint auch eher einem Gelage im ›Weißkopf‹ entsprungen zu sein denn einem kühl planenden, kriminellen Hirn. Sie pflegten jedenfalls mit mehreren Ballen Anzugstoff zu den abgelegensten Höfen am Land zu reisen. Joschi, Karli und der »Hilfssheriff« bedienten sich hierzu eines Chevrolets, ein Umstand, der allein ihnen nicht wenig Bewunderung eingetragen hat, in dieser noch weitgehend automobilfreien Zeit. Das Auto gehörte natürlich nicht ihnen, sie borgten es von einer Freundin Karlis, die wiederum einige höhere Militärs der Alliierten recht gut gekannt haben soll, wie mein Großvater mit vielsagend gehobenen Augenbrauen erzählte.
Zu zweit fuhren sie, meist gegen Abend, auf einem einsamen Hof in der Buckligen Welt, im Schneeberggebiet oder im Traisental vor und simulierten einen Notfall. Sie behaupteten, ihnen wäre Geld und Benzin ausgegangen, so böte sich dem Bauern die unwiederbringliche Gelegenheit, einen Ballen besten Stoffs um einen Spottpreis zu erwerben. »So etwas kommt nie wieder«, schmeichelten sie, drängten die Bäuerin zum Kofferraum, schoben ihr den Stoff zur Prüfung zwischen Daumen und Zeigefinger. Ihr Stoff sah zumindest immer aus wie erste Qualität, täuschend ähnlich dem, was sie selbst mit unnachahmlicher Eleganz trugen. Hatte der Bauer endlich eingewilligt, die Bäuerin aus dem Strumpf das Geld geschält, bedankten sie sich überschwenglich. Sie nahmen mit halb erleichterten, halb unglücklichen Gesichtern den geringen Geldbetrag entgegen, stiegen ein, ließen den Motor an, winkten, stutzten, stellten ihn wieder ab und stiegen noch einmal aus. Ob man denn auch einen geeigneten Schneider habe? So einen herrlichen Stoff sollte man vielleicht nicht dem erstbesten Pfuscher aus Kirchschlag oder Türnitz überlassen! Ganz zufällig hätten sie in der Gegend noch ein wenig zu tun, sie würden morgen noch einmal herauffahren und den Schneider ihres Vertrauens mitbringen – nach dieser Hilfe in letzter Sekunde doch eine Selbstverständlichkeit, ich bitte Sie. Am nächsten Morgen erschienen alle drei. Der »Hilfssheriff« soll über ein erstaunliches Talent im professionell wirkenden Maßnehmen verfügt haben, er besaß ein Nadelkissen, das er ans Handgelenk klemmen konnte, eine respekteinflößende Schneiderschere und er hatte sich von »Knize am Graben« ein paar jener Vorkriegs-Formblätter besorgt, in die die Maße einzutragen waren. Höflich erkundigte er sich nach dem Namen und schrieb ihn als erstes auf, »Herr Oberhuber« oder »Herr Unterberger, so so, sehr gern«, anschließend die Maße – »am Oberarm samma ein bisserl stärker, gell«. Auf den vorgedruckten Formblättern befand sich die flott hingetupfte Zeichnung eines schlanken, eleganten Mannes im Anzug. War der »Hilfssheriff« besonders guter Laune oder waren staunende Kinder dabei, skizzierte er manchmal sogar auf der Stoffrückseite mit Kreide den Zuschnitt. So ein Maßanzug ist natürlich nicht ganz billig, das sahen die Bauern ein. Von dem stark überhöhten Preis verlangte der »Hilfssheriff« bloß eine Anzahlung, »man kennt sich ja inzwischen«, ergänzte der ewig lächelnde Joschi dann gern. Daraufhin packten die drei gewandten Herren aus der Stadt die Anzahlung und den Stoff wieder ein und fuhren ab. Im ›Weißkopf‹ spuckte man später vor Lachen den Wodka auf den Tisch, wenn sie wieder und wieder schilderten, wie der Bauer ungelenk seine Arbeitskluft abgelegt hatte, um zwischen dem Mist- und dem Heuhaufen vermessen zu werden.
Nandl stieß zu den Stoffbetrügern, weil er so fesch war. Einmal, während eines der berüchtigten Feste, die Mitte Oktober vorgeblich zum Gedenken an die russische Revolution gefeiert wurden, zwangen ein paar Betrunkene den Nandl im Morgengrauen, mit dem Oberkellner das Gewand zu tauschen. Das Ergebnis war verblüffend. Der Oberkellner erbleichte. Vickerl Weißkopf hatte Mühe, ihm zu versichern, daß er seine Arbeit behalten dürfe – weder könne der Nandl Teller tragen, ohne alles zu verschütten, noch sei ihm ernstlich die Abrechnung anzuvertrauen. Nandl Königsberger sah im Frack aus wie ein Stummfilm-Star. Dazu trug er sein halb schüchternes, halb dümmlich-dreistes, insgesamt also irgendwie subalternes Lächeln, so daß Joschi und Karli fatalerweise beschlossen, ihn zu ihrem Chauffeur zu machen. Eigentlich haben sie ihn gar nicht gebraucht. Sie wollten vor allem ihre Inszenierung verbessern, um das Publikum, das im ›Weißkopf‹ saß und mit Geschichten versorgt sein wollte, zu bedienen: »Eine gute Nachred’ ist die halbe Miete«, wie es im ›Weißkopf‹ hieß. Außerdem gingen ihre Geschäfte besser – sie lebten ja bei Gott nicht von den Stoffbetrügereien allein, sondern schmuggelten inzwischen Zigaretten und Nylonstrumpfhosen nach Ungarn, und sie konnten als Team für dieses und jene Halblegale engagiert werden –, und wessen Geschäfte besser gehen, der schafft sich ein Statussymbol an. Nandl bekam einen Anzug, einen pomadisierten Seitenscheitel und eine Schirmkappe und wurde auf den Chevrolet eingeschult. Das hätte jahrelang gutgehen können. Nandl hatte nichts anderes zu tun als die Türen zu öffnen und zu schließen, die Hand an die Kappe