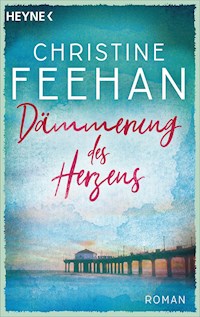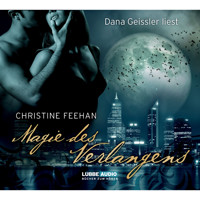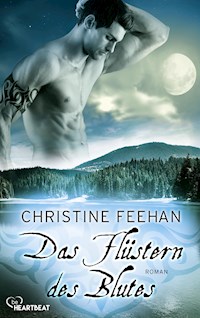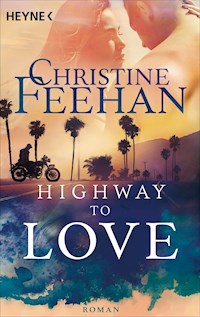9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Blut ist ihr Schicksal – doch in den Schatten der Karpaten lauert eine Wahrheit, die selbst das Herz einer Vampirin erzittern lässt. Shea O’Halloran kennt das Gefühl, fremd im eigenen Körper zu sein. Als brillante Chirurgin mit einer seltenen Blutkrankheit lebt sie zwischen zwei Welten – immer auf der Flucht vor dunklen Jägern und den eigenen Dämonen. Doch als zwei Männer ihr eine unglaubliche Wahrheit eröffnen, gerät ihr Leben endgültig aus den Fugen: Sie sei eine Vampirin. Shea weigert sich zu glauben, was ihr Blut längst weiß. Getrieben von Angst und einer Sehnsucht, die sie nicht versteht, flieht Shea in die rauen Karpaten. Dort trifft sie auf Jacques – einen Mann, der zwischen Wahnsinn und Qual gefangen ist. Seine Augen sind voller Dunkelheit, seine Berührung verheißt Gefahr und Trost zugleich. Ein uraltes Band aus Schmerz und Verlangen verbindet sie, doch Jacques’ Vergangenheit ist ein blutiges Rätsel. Inmitten uralter Legenden, tödlicher Feinde und einer Liebe, die alles zu verschlingen droht, muss Shea herausfinden, wer sie wirklich ist. Für Leserinnen, die die düsteren Abgründe von J.R. Ward lieben und sich nach einer Romanze sehnen, die Herzklopfen und Gänsehaut zugleich schenkt. Ein Vampirroman voller knisternder Spannung, telepathischer Verlockung und der Suche nach Erlösung – in einer Welt, in der Blut mehr als Leben bedeutet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Brief an meine Leser
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Über dieses Buch
Shea O’Halloren leidet an einer seltsamen Krankheit, für die es keine Erklärung zu geben scheint - bis sie eines Tages zwei Männern begegnet, die eine Antwort auf ihre Fragen haben. Denn Shea, so behaupten sie, ist eine Vampirin.Auf der Flucht vor den beiden Männern und ihrer merkwürdigen Offenbarung reist Shea in die Karpaten. Sie trifft dort einen Mann, dessen düsterer Charme sie sogleich in seinen Bann zieht. Seine stechenden Augen kommen ihr bekannt vor. Verzweifelt sucht sie seine Nähe und ahnt, dass auch in ihm ein dunkles Geheimnis schlummert …
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
CHRISTINE FEEHAN
Dunkle Machtdes Herzens
Aus dem amerikanischen Englischvon Britta Evert
Für meinen Vater Mark King, der mich gelehrt hat,dass es auf der Welt viele Arten von Helden gibt.Für meine Agentin Helen,die immer an meine Karpatianer geglaubt hat.Ganz besonders möchte ich auch Allison Luce undmeiner Tochter Billie Jo Feehan danken,die sich in Jacques verliebte undmir viele hilfreiche Ideen lieferte.Und natürlich meinem Sohn Brian,der die Action-Szenen sehr,sehr oft für mich lesen musste.
Brief an meine Leser
Meinen Roman Dark Desire (Dunkle Macht des Herzens) nannte ich zunächst Dark Madness (Dunkler Wahnsinn). Ich glaube, der ursprüngliche Titel sagte aus, wie ich mich fühlte, als ich an diesem Buch arbeitete.
Ich hatte gerade Dark Prince (Mein dunkler Prinz) beendet und war absolut sicher, dass Gregori, eine der Romanfiguren, hervortreten und auf einer eigenen Geschichte bestehen würde, und ich war mehr als bereit, über seine Abenteuer zu berichten. Ich wusste, dass diese Geschichte sehr spannend sein würde, und freute mich schon darauf. Stattdessen rückte Gregori in den Hintergrund, und Jacques drängte sich vor. Sein Buch wollte ich mit Sicherheit nicht schreiben. Er entsprach in keiner Weise dem Helden, der mir vorschwebte. Aber so sehr ich mich auch bemühte, Gregoris Buch zu schreiben, Jacques bestand darauf, dass seine Geschichte erzählt werden müsse.
Schließlich gab ich nach und hörte ihm zu. Was Jacques mir zu sagen hatte, schockierte mich. Er wollte, dass ich über einen Helden schrieb, der völlig gestört war.
Ich machte mich an die mühevolle Aufgabe, ein erstes Kapitel zu verfassen. Ich schreibe seit meiner Kindheit, und es ist immer das erste Kapitel eines Buchs, das die Dinge in Bewegung bringt. Wenn es nicht stimmig ist, kann sich die Geschichte einfach nicht entfalten. Immer wieder skizzierte ich aus jedem erdenklichen Blickwinkel dieses erste Kapitel, doch nichts funktionierte. Ich reiste mit einer Freundin nach New Orleans, aber so sehr ich mich auch bemühte, aus Jacques wurde einfach kein sympathischer Held. Er war verrückt, und alles, was er tat, war einfach furchtbar. Ich hatte starke Zweifel, ob ich ihn zum Leben erwecken könnte.
Ich fuhr gerade mit der Fähre nach Algier, als mir die Geschichte wie aus heiterem Himmel zuflog – und da stand ich nun ohne Computer! Auf einmal wusste ich, wie ich schildern konnte, was mit Jacques passiert war, wie ich mir und meinen Lesern nahebringen konnte, was in ihm vorging und welche Qualen er durchlitt, als er aller Hoffnung beraubt war und nur noch kraft seines Willens durchhielt. Sowie ich fühlte, was Jacques empfand, und ihn in all seinem Elend vor mir sah, wusste ich, dass ich auf dem richtigen Weg war.
Von nun an träumte ich Tag und Nacht von Jacques. Er war eine Persönlichkeit, die mich fesselte und nicht mehr losließ. Nachdem ich eine emotionale Verbindung zu ihm aufgebaut hatte, entwickelte sich die Geschichte so rasant, dass es mich selbst erstaunte. Die ersten vierzig Entwürfe hatte ich im Lauf von etlichen Monaten geschrieben; für den Rest des Buchs brauchte ich nur noch einige Wochen. Am Ende liebte ich Jacques geradezu und konnte kaum aufhören. Seine Story war aufregend, emotional und sehr unvorhersehbar, die beste Art Buch, die es für mich zu schreiben gibt.
Meine Freude am Schreiben beruht zum Teil auf den überraschenden Wendungen in einem Roman, die ich selbst nicht absehen kann.
Als ich erfuhr, dass mein Verlag das Buch kaufen wollte, sträubte sich etwas in mir dagegen, die Geschichte aus der Hand zu geben. Jacques hatte sehr viel durchgemacht, und als ich den ersten Band aus dieser Reihe, Dark Prince (Mein dunkler Prinz), verkaufte, wurden derartige Themen noch nicht so häufig veröffentlicht wie heute. Der Dorchester-Verlag ging ein großes Risiko ein, als er mein Buch auf den Markt brachte. Jetzt wollte man sichergehen, dass Jacques’ Geschichte romantisch und spannend wäre, eine Geschichte, die der Leser trotz der dunklen Abgründe in Jacques’ Charakter genießen könnte. Meine Lektorin bat mich, den Titel zu ändern, was kein Problem für mich war, aber dann trat sie mit der Bitte an mich heran, das erste Kapitel umzuschreiben, und das war ein Problem! Ich wusste, dass das Buch ohne dieses sehr kontroverse erste Kapitel einfach undenkbar war. Zum Glück hatte ich eine Lektorin, die bereit war, sich meine Argumente anzuhören, und das Buch letzten Endes in seiner ursprünglichen Fassung akzeptierte.
Noch heute bin ich sehr bewegt, wenn ich Dark Desire (Dunkle Macht des Herzens) in die Hand nehme und Jacques’ Geschichte lese. Ich hoffe, Sie entwickeln dieselbe Nähe zu den Figuren meines Romans und spüren die Liebe und Hingabe, die es ihnen ermöglicht, Jacques zu retten.
Kapitel 1
Da war Blut, Blut, das sich in ganzen Strömen ergoss. Da war Schmerz, ein wahres Meer von Schmerzen, in dem er unterging. Würde es nie ein Ende nehmen? Tausend Wunden und Verbrennungen und dazu höhnisches Gelächter, das ihm sagte, dass es bis in alle Ewigkeit so weitergehen würde. Er konnte nicht glauben, dass er so hilflos war, dass er seiner unvorstellbaren Stärke und Kraft beraubt und in dieser elenden Verfassung war. Er schickte einen Hilferuf nach dem anderen in die Nacht hinaus, aber niemand von seinen Leuten kam, um ihm beizustehen. Die Qualen marterten ihn unablässig. Wo waren sie, seine Freunde, seine Verwandten? Warum kamen sie nicht zu ihm und beendeten das? Hatten sie ihn bewusst diesen Schlächtern überlassen, die ihre Messer und Fackeln so lustvoll einsetzten? Jemand, den er kannte, hatte ihn verraten, aber die Erinnerung wurde von den endlosen Schmerzen verwischt und verblasste allmählich.
Diese Folterknechte hatten es irgendwie geschafft, ihn gefangen zu nehmen und zu lähmen, sodass er zwar fühlen, sich aber nicht rühren, nicht einmal seine Stimme einsetzen konnte. Er war völlig wehrlos und den menschlichen Wesen, die seinen Körper in Stücke rissen, hilflos ausgeliefert. Er hörte ihre hämischen Bemerkungen und ihre unablässigen Fragen; er spürte ihren Zorn, als er sich weigerte, die Schmerzen, die sie ihm zufügten, oder auch nur ihre Gegenwart anzuerkennen. Er wünschte sich den Tod, sehnte sich danach, und seine Augen, die kalt wie Eis waren, ruhten, unverwandt und ohne zu blinzeln, auf ihren Gesichtern. Es waren die Augen eines Raubtiers, das wartete, beobachtete und Vergeltung verhieß. Es machte sie rasend, aber dennoch wollten sie ihm nicht den endgültigen Todesstoß versetzen.
Zeit bedeutete ihm nichts mehr, so sehr hatte sich der Fokus seiner Welt verengt, aber irgendwann spürte er die Gegenwart eines anderen Wesens in seinem Bewusstsein – es war weiblich und jung, doch weit entfernt. Er hatte keine Ahnung, auf welche Weise er unabsichtlich mit ihr in Verbindung getreten war und sein Bewusstsein mit ihrem verschmolzen hatte, sodass sie seine Foltern am eigenen Leib erfuhr, jede glühend heiße Brandwunde, jeden Schnitt des Messers, unter dem sein Blut zusammen mit seiner Kraft verströmte. Er versuchte, sich zu erinnern, wer sie sein mochte. Sie musste ihm nahe stehen, wenn sie in sein Bewusstsein eintreten konnte. Sie war genauso hilflos wie er, empfand die Schmerzen wie er und litt seine Qualen. Er versuchte, sich vor ihr zu verschließen, weil das Bedürfnis, sie zu beschützen, alles andere überlagerte, aber er war viel zu geschwächt, um seinen Geist abzuschalten. Die Schmerzen ergossen sich wie ein reißender Strom aus seinem Körper und flossen direkt zu dem weiblichen Wesen, das in sein Bewusstsein eingedrungen war.
Ihre Qual traf ihn wie ein lähmender Schlag. Schließlich war er Karpatianer. Seine erste Pflicht vor allem anderen und zu jeder Zeit war es, eine Frau zu beschützen, auch um den Preis seines eigenen Lebens. Dass er in diesem Punkt scheitern sollte, verstärkte seine Verzweiflung und das Gefühl des Versagens. Im Geist erhaschte er flüchtige Bilder von der Frau; er sah eine kleine, zerbrechliche Gestalt, die sich vor Schmerzen krümmte und sich verzweifelt bemühte, bei Sinnen zu bleiben. Sie war ihm fremd, und doch sah er sie in Farbe, etwas, das ihm seit Jahrhunderten nicht passiert war. Er konnte weder sie noch sich selbst in Schlaf sinken lassen, um sie beide vor dem Grauen zu bewahren. Er konnte nur Bruchstücke ihrer Gedanken auffangen, als sie verzweifelt um Hilfe rief und gleichzeitig zu begreifen versuchte, was mit ihr geschah.
Blut trat aus seinen Poren. Rotes Blut. Er konnte deutlich sehen, dass sein Blut rot war. Diese Tatsache war von großer Bedeutung, aber er war zu mitgenommen und verwirrt, um erkennen zu können, was es bedeutete und warum es wichtig war. Seine Gedanken wurden unzusammenhängend und verschwommen, als würde sich ein dichter Schleier über sein Bewusstsein senken. Er konnte sich nicht erinnern, wie es ihnen gelungen war, ihn gefangen zu nehmen. Er strengte sich an, um das Gesicht desjenigen aus seinem eigenen Volk zu »sehen«, der ihn verraten hatte, aber das Bild ließ sich nicht mehr heraufbeschwören. Es gab nur noch Schmerzen, schreckliche, endlose Schmerzen. Er konnte keinen Laut von sich geben, obwohl sein Inneres in Millionen Fragmente zerbarst, und er war unfähig, sich daran zu erinnern, was oder wen er zu beschützen versuchte.
Shea O’Halloran lag behaglich auf ihrem Bett und las im Schein der Lampe ihr medizinisches Journal. Innerhalb weniger Sekunden überflog sie eine Seite nach der anderen und speicherte das Gelesene in ihrem Gedächtnis, wie sie es seit ihrer Kindheit tat. Im Augenblick absolvierte sie gerade ihre Assistenzzeit am Krankenhaus, als jüngste Assistenzärztin, die es je gegeben hatte, und das war ziemlich anstrengend. Sie beeilte sich, den Text zu Ende zu lesen, um noch ein wenig Schlaf zu finden, solange sie konnte.
Der Schmerz traf sie völlig unerwartet und mit solcher Gewalt, dass sie vom Bett geschleudert wurde und ihr Körper sich vor Krämpfen schüttelte. Sie versuchte, zu schreien und blindlings nach dem Telefon zu tasten, aber sie konnte nur hilflos auf dem Boden liegen und sich vor Schmerzen krümmen. Schweißperlen traten auf ihre Haut, scharlachrotes Blut drang aus ihren Poren. Der Schmerz ließ sich mit nichts vergleichen, was sie je erlebt hatte: als würde jemand ihr Fleisch mit einem Messer aufschlitzen, sie verbrennen, sie unbarmherzig foltern. Es ging immer weiter – Stunden, Tage, sie wusste es nicht. Niemand kam, um ihr zu helfen, und es würde auch niemand kommen. Sie war allein, und sie lebte so zurückgezogen, dass sie kaum echte Freunde hatte. Irgendwann, als ein so grauenhafter Schmerz durch ihren Körper schoss, als hätte man ihr ein faustgroßes Loch in die Brust gerissen, verlor sie das Bewusstsein.
Als er glaubte, seine Folterer wären fertig mit ihm und würden sein Leiden beenden, indem sie ihn töteten, stellte er fest, was die wahre Hölle war. Unerträgliche Schmerzen. Hasserfüllte Gesichter über ihm. Ein zugespitzter Holzpfahl, der über sein Herz gehalten wurde. Ein Atemzug der Zeit, eine Sekunde. Jetzt würde es aufhören. Es musste aufhören. Er fühlte, wie das spitze Ende des dicken Pfahls tief in sein Fleisch gestoßen wurde und durch Muskeln und Sehnen ein klaffendes Loch in seine Brust riss. Der Hammer fiel schwer auf das Ende des Pfahls und trieb ihn noch tiefer hinein. Der Schmerz überstieg jede Vorstellungskraft. Die Frau, die seine Wahrnehmungen teilte, verlor das Bewusstsein – ein Segen für sie beide. Noch immer fühlte er jeden Schlag, das schwere Holzstück, das sein Fleisch auseinanderriss und durch seine Eingeweide drang, während das Blut aus ihm hervorschoss wie eine Fontäne und der Verlust ihn noch mehr schwächte. Er spürte, wie ihn jede Kraft verließ, und fühlte sich so sehr seiner Stärke beraubt, dass er überzeugt war, sterben zu müssen. Er hieß den Tod willkommen, ja er sehnte sich nach ihm. Aber es sollte nicht sein. Er war Karpatianer, ein Unsterblicher, der nicht leicht zu töten war. Einer, dessen Willen stark und unbeugsam war. Ein Wille, der sich gegen den Tod auflehnte, obwohl sein Körper schon darum bettelte, dass sein Leiden und sein Dasein ein Ende nehmen mögen.
Seine Augen fanden die beiden Menschen. Sie waren über und über mit seinem Blut bespritzt. Er nahm seine letzte Kraft zusammen und fing ihren Blick mit seinen hypnotischen Augen ein. Wenn er sie doch nur lange genug in seinem Bann halten könnte, um das Böse, das sie ihm antaten, auf sie selbst zu lenken! Plötzlich fluchte einer von ihnen und riss seinen Gefährten zurück. Rasch bedeckten sie seine Augen mit einem Tuch, außerstande, die dunkle Verheißung in den tiefen Abgründen seines Leides zu ertragen, und voller Angst vor seiner Macht, obwohl er so wehrlos vor ihnen lag. Sie lachten, als sie ihn in dem Sarg anketteten und ihn aufrichteten. Er hörte sich selbst vor Schmerzen schreien, aber der Schrei war nur ein Echo in seinem Bewusstsein, scharf und bitter, als wollte es ihn verhöhnen. Er zwang sich, jeden Laut zu unterdrücken. Sie konnten ihn nicht hören, aber darauf kam es nicht an. Noch war ihm ein Rest von Würde geblieben, ein Rest von Selbstachtung. Sie würden ihn nicht besiegen. Er war Karpatianer. Er hörte, wie Erde auf den Sargdeckel fiel, als sie ihn in der Wand des Kellers vergruben. Eine Schaufel Erde folgte auf die andere. Die Dunkelheit war undurchdringlich. Die Stille traf ihn wie ein Schlag.
Er war ein Geschöpf der Nacht. Die Dunkelheit war sein Zuhause. Doch jetzt, in all seiner Qual, war sie sein Feind. Es gab nur den Schmerz und die Stille. Früher hatte er immer selbst bestimmt, wie lange er im Dunkel, in der heilenden Erde bleiben wollte. Jetzt war er ein Gefangener, eingesperrt, und das Erdreich war nicht greifbar. Dass die Erde so nahe war, hätte ihn trösten sollen, doch das Holz des Sargs verhinderte, dass sein Körper berührte, was seinen Wunden irgendwann einmal Heilung gebracht hätte.
Hunger drang langsam in seine Welt der Qualen ein. Die Zeit verging und verlor jede Bedeutung. Nur der schreckliche, unablässige Hunger zählte, der immer stärker wurde, bis er ihn vollständig beherrschte. Schmerzen und Hunger, etwas anderes existierte nicht mehr für ihn.
Nach einiger Zeit stellte er fest, dass er sich in Schlaf versetzen konnte. Aber dass diese Gabe zurückgekehrt war, bedeutete nichts mehr. Er konnte sich an nichts erinnern. Das hier war sein Leben. Schlafen. Aufwachen, wenn ein neugieriges Wesen ihm zu nahe kam. Der rasende Schmerz, der ihn verzehrte. Sein Herzschlag. Die Anstrengung, genügend Kraft aufzubringen, um sich Nahrung zu beschaffen. Das Angebot war dünn gesät. Selbst Insekten lernten es, den Ort der Dunkelheit und das bösartige Geschöpf, das dort hauste, zu meiden.
In den endlosen Augenblicken, die sich in seinen qualvollen Stunden des Wachens dahinschleppten, konnte er hören, wie er seinen Namen flüsterte. Jacques. Er hatte einen Namen. Er war vorhanden. Er existierte. Er lebte in der Hölle. Er lebte in der Dunkelheit.
Stunden wurden zu Monaten, Monate zu Jahren. Er konnte sich an keine andere Lebensweise, an kein anderes Dasein erinnern. Es gab keine Hoffnung, keinen Frieden, keinen Ausweg, nur Dunkelheit, Schmerzen und quälenden Hunger. Die Zeit, die verging, bedeutete in der Enge seiner Welt nichts.
Seine Handgelenke waren gefesselt, sodass er kaum Bewegungsfreiheit hatte, aber jedes Mal, wenn ein Wesen nahe genug kam, um ihn zu wecken, kratzte er in dem vergeblichen Versuch herauszukommen an den Wänden seines Sargs. Seine Willenskraft kehrte zurück, sodass er irgendwann Beute anlocken konnte, aber es reichte kaum zum Überleben. Es war unmöglich, seine Macht und Stärke zurückzugewinnen, ohne die ungeheure Menge Blut zu ersetzen, die er verloren hatte. Jedes Mal wenn er aufwachte und sich rührte, strömte frisches Blut aus seinen Wunden. Ohne das Blut, das er brauchte, um seinen Verlust auszugleichen, konnte sein Körper nicht genesen. Es war ein grauenhafter, endloser Kreislauf, ein Albtraum, der bis in alle Ewigkeit andauern würde.
Dann begannen die Träume. Sie weckten ihn, wenn er Hunger litt, einen Hunger, den er nicht stillen konnte. Eine Frau. Er erkannte sie und wusste, dass sie dort draußen war, lebendig, frei, ohne Fesseln, nicht in der Erde begraben, sondern imstande, sich ungehindert zu bewegen. Sie war außerhalb seines geistigen Zugriffs, und doch war er ihr sehr nah. Warum kam sie nicht? Er konnte kein Gesicht heraufbeschwören, keine Vergangenheit, nur das Wissen, dass sie irgendwo da draußen war. Er rief nach ihr. Bettelte, flehte und tobte. Wo war sie? Warum kam sie nicht zu ihm? Warum ließ sie zu, dass seine Qualen andauerten, wenn schon ihre Anwesenheit in seinem Bewusstsein das furchtbare Gefühl von Isolation lindern konnte? Was hatte er getan, das schrecklich genug war, um eine solche Strafe zu verdienen?
Zorn fand den Weg in seine Welt, sogar Hass. In dem Mann entstand ein Monster, das gefährlich und tödlich war. Es wuchs, indem es sich von dem Schmerz nährte, und entwickelte einen unbeugsamen Willen. Fünfzig Jahre, hundert Jahre – was bedeutete es schon, wenn er bis zu den Pforten der Hölle vordringen musste, um Rache zu nehmen? Dort war er bereits, ein Gefangener in jedem wachen Moment.
Sie würde zu ihm kommen. Er gelobte es. Er würde seine ganze Willenskraft einsetzen, um sie zu finden. Und wenn er sie erst einmal gefunden hatte, würde er wie ein Schatten im Hintergrund ihres Bewusstseins lauern, bis er vertraut genug mit ihr war, um ihr seinen Willen aufzuzwingen. Sie würde zu ihm kommen, und er würde seine Rache haben.
Hunger nagte jedes Mal an ihm, wenn er wach wurde, sodass Schmerz und Hunger miteinander verschmolzen und eins wurden. Sich darauf zu konzentrieren, den Weg zu der Frau zu finden, nahm ihm allerdings ein wenig von seiner Qual. Seine Konzentration war so ausschließlich, dass es ihm tatsächlich gelang, die Schmerzen für kurze Zeit abzublocken. Anfangs nur einige Sekunden, dann Minuten. Jedes Mal, wenn er aufwachte, richtete er seine Willenskraft darauf, sie zu finden. Es gab nichts anderes zu tun. Monate oder Jahre, es kümmerte ihn nicht. Sie konnte ihm nicht ewig entkommen.
Als er das erste Mal an ihr Bewusstsein rührte, war es nach all den unzähligen fruchtlosen Versuchen ein solcher Schock, dass er den Kontakt sofort wieder verlor. Und bei der spontanen freudigen Erregung, die ihn befiel, schoss ein hellroter Strahl Blut rund um den Pfahl hervor, der tief in seinem Körper steckte, und beraubte ihn seiner verbliebenen Kraft. Er schlief lange Zeit, um sich davon zu erholen. Eine Woche vielleicht. Einen Monat. Es gab keinen Grund, die Zeit zu messen. Jetzt hatte er eine Richtung gefunden, auch wenn die Frau immer noch weit entfernt von ihm war. Die Entfernung war so groß, dass es seine ganze Konzentration erforderte, sie über Raum und Zeit hinweg zu erreichen.
Jacques versuchte es erneut, als er aufwachte. Diesmal war er unvorbereitet auf die Bilder, die er aus ihrem Bewusstsein empfing. Blut. Eine kleine menschliche Brust, die weit geöffnet war. Ein pulsierendes Herz. Ihre Hände tauchten tief in die offene Brusthöhle ein und waren mit Blut bedeckt. Andere waren bei ihr, und sie lenkte ihr Handeln mit ihrem Geist. Es schien ihr nicht bewusst zu sein, dass sie es tat. Ihre ganze Aufmerksamkeit konzentrierte sich auf ihre ungeheure Aufgabe. Die Leichtigkeit, mit der sie die anderen dirigierte, wies darauf hin, dass ihr diese Tätigkeit vertraut war. Die Bilder waren eindringlich und grauenhaft, und er wusste, dass sie an dem Verrat beteiligt gewesen war, dass sie zu jenen gehörte, die ihn gefoltert hatten. Fast hätte er den Kontakt verloren, aber sein unbeugsamer Wille hielt durch. Dafür würde sie büßen, wirklich leiden. Der Körper, den sie quälte, war so klein, dass er einem Kind gehören musste.
Der Operationssaal war schwach erleuchtet, genauso, wie Dr. O’Halloran es am liebsten hatte; nur auf den kleinen Körper auf dem Operationstisch fiel helles Licht. Ihr ungewöhnlich scharfes Gehör schnappte Stimmen vom Gang auf: Eine der Schwestern tröstete gerade die Eltern des Patienten. »Sie haben Glück, dass Dr. O’Halloran heute Abend Dienst hat. Sie ist die Beste, die es gibt. Sie hat eine Gabe. Wirklich. Auch wenn es kaum noch Chancen gibt, schafft sie es, ihre Patienten zu retten. Ihr kleiner Junge könnte nicht in besseren Händen sein.«
»Aber er sah furchtbar aus!« Das war die völlig verängstigte Mutter, die jetzt schon zu trauern schien.
»Dr. O’Halloran ist dafür bekannt, wahre Wunder zu wirken. Haben Sie Vertrauen. Sie gibt einfach nicht auf, bis sie ihre Patienten zurückgeholt hat. Wir haben manchmal das Gefühl, dass sie sie mit ihrem Willen dazu bringt weiterzuleben.«
Shea O’Halloran konnte im Moment keine Ablenkung gebrauchen, schon gar nicht eine Krankenschwester, die den Eltern versicherte, dass sie dieses Kind mit dem zerschmetterten Brustkorb, dessen Innenorgane heillos durcheinandergeraten waren, retten würde. Nicht, nachdem sie die letzten achtundvierzig Stunden mit Forschungsarbeiten verbracht hatte und ihr Körper förmlich nach Schlaf und Nahrung schrie. Sie blockte alle Geräusche, alle Stimmen ab und konzentrierte sich völlig auf ihre Aufgabe. Sie würde diesen kleinen Jungen nicht verlieren. Auf gar keinen Fall. So einfach war das für sie. Sie ließ sich nie eine andere Wahl, ließ niemals zu, dass ein anderer Gedanke in ihr Bewusstsein drang.
Sie hatte ein gutes Team und wusste, dass sie und die anderen hervorragend miteinander arbeiteten, wie das gut geölte Laufwerk einer Maschine. Sie brauchte nie hinzuschauen, um sich zu vergewissern, ob ihre Anweisungen befolgt und ihre Wünsche erfüllt wurden, die anderen waren immer für sie da. Wenn sie in der Lage war, Patienten zu retten, wo ihre Kollegen scheiterten, war es nicht allein ihrem Können zu verdanken.
Sie beugte sich tiefer über den kleinen Jungen und verdrängte in ihrem Denken alles bis auf den Wunsch, dass dieses Kind am Leben blieb. Als sie eine Hand ausstreckte, um das Instrument zu nehmen, das die Schwester ihr reichte, traf sie etwas wie ein Schlag. Ein jäher Schmerz befiel sie und schoss wie ein schreckliches Feuer durch ihren Körper. Eine derartige Qual hatte sie schon einmal erlebt, vor ein paar Jahren. Sie war nie dahintergekommen, was damals mit ihr los gewesen war. Die Schmerzen hatten nach vierundzwanzig Stunden einfach aufgehört. Jetzt, da das Leben eines Kindes an einem seidenen Faden hing und gänzlich von ihrem Können abhing, konnte sie sich nicht den Luxus leisten, in Ohnmacht zu fallen.
Der Schmerz packte sie, wühlte in ihrem Inneren und nahm ihr den Atem. Shea rang um ihre Selbstbeherrschung, wobei ihr die jahrelange Übung darin, sich ständig fest im Griff zu haben, gute Dienste leistete. Genauso wie sie es mit jeder anderen Ablenkung machte, verdrängte sie den Schmerz aus ihrem Bewusstsein und konzentrierte sich auf das Kind.
Die Krankenschwester, die am nächsten bei ihr stand, warf der Ärztin einen betroffenen Blick zu. In all den Jahren, die sie mit Dr. O’Halloran arbeitete, einer Frau, die sie bewunderte, fast vergötterte, hatte sie nie erlebt, dass die Chirurgin unkonzentriert wirkte, nicht einmal eine Sekunde lang. Jetzt hatte Shea wie erstarrt dagestanden – nur ein paar Herzschläge lang, aber der Schwester war es trotzdem aufgefallen, weil es so ungewöhnlich war. Dr. O’Hallorans Hände hatten gezittert, und ihr war der Schweiß ausgebrochen.
Die Schwester hob automatisch eine Hand, um den Schweißfilm von der Stirn der Ärztin zu tupfen. Zu ihrem Entsetzen waren auf dem Tuch Blutflecken zu sehen. Bluttropfen drangen aus Dr. O’Hallorans Poren. Die Schwester tupfte noch einmal Sheas Stirn ab, wobei sie versuchte, das Tuch vor den anderen zu verbergen. Etwas Derartiges hatte sie noch nie erlebt.
Dann war Shea wieder sie selbst und sofort völlig auf ihre Arbeit konzentriert. Die Schwester schluckte all ihre Fragen hinunter und machte sich ebenfalls an die Arbeit. Die Bilder der Instrumente, die Dr. O’Halloran brauchte, tauchten in so rascher Abfolge vor ihrem geistigen Auge auf, dass ihr keine Zeit blieb, über dieses eigenartige Phänomen nachzudenken. Sie hatte sich seit langem daran gewöhnt zu wissen, was die Ärztin benötigte, noch bevor sie danach fragte.
Shea spürte eine ungewohnte Präsenz in ihrem Bewusstsein, etwas Dunkles und Bösartiges, das nach ihr ausschlug, bevor sie es ausschließen konnte. Dann konzentrierte sich ihre Aufmerksamkeit wieder vollständig auf den Jungen und die zerfetzte Masse, die sein Brustkorb jetzt war. Er würde nicht sterben. Das würde sie nicht zulassen. Kannst du mich hören, Kind? Ich bin hier bei dir, und ich werde dich nicht sterben lassen, gelobte sie insgeheim. Es war ihr ernst. Es war ihr immer ernst. Es war, als würde ein Teil von ihr mit ihren Patienten verschmelzen und sie am Leben erhalten, bis ein modernes technisches Gerät diese Aufgabe übernehmen konnte.
Jacques schlief eine Weile. Es war ihm gleichgültig, wie lange sein Schlaf dauerte. Auf ihn warteten Hunger und Schmerzen. Und das Herz und die Seele einer verräterischen Frau. Er hatte die ganze Ewigkeit, um alles an Kraft zu sammeln, was ihm geblieben war, und nun, da er den geistigen Pfad zu ihr kannte, konnte sie ihm nicht mehr entkommen. Er schlief den Schlaf der Unsterblichen, indem er die Tätigkeit seiner Lungen und seines Herzens einstellte, während er in seinem Grab lag, dem Erdreich ganz nah, das sein Körper so dringend brauchte, um zu genesen. Aber es war für ihn hinter der dünnen Schicht Holz unerreichbar. Als er aufwachte, schabte er geduldig an den Wänden seines Sargs. Irgendwann würde er an die heilende Erde herankommen. Es war ihm gelungen, ein kleines Loch in das Holz zu bohren, um winzige Beutetiere zu sich zu locken. Er konnte warten. Die Frau würde ihm nicht entkommen. Sie war das Einzige, woran er festhielt.
Er quälte sie. Ob Tag oder Nacht – für ihn war es ohne Bedeutung. Er merkte keinen Unterschied mehr, obwohl es früher einmal so wichtig gewesen war. Er lebte für den Versuch, seinen allgegenwärtigen Hunger zu lindern. Er lebte für Rache. Für Vergeltung. Er lebte dafür, der Frau in den Stunden des Wachens das Leben zur Hölle zu machen. Er verstand sich allmählich ganz gut darauf, für einige Minuten Besitz von ihrem Bewusstsein zu ergreifen. Sie völlig zu durchschauen, war unmöglich. In ihrem Denken gab es Dinge, die für ihn kaum Sinn ergaben, und die wenigen Augenblicke, die er sich wach halten konnte, ohne das kostbare Blut zu verlieren, das ihm noch geblieben war, ließen ihm nicht genug Zeit, sie zu verstehen.
Manchmal fürchtete sie sich. Er konnte ihre Furcht spüren. Konnte ihr Herz schlagen hören, sodass sich sein eigenes dem schrecklichen Rhythmus anpasste. Dennoch blieb ihr Geist auch im Zentrum des Sturms ruhig und empfing in rascher Folge Informationen, die sie so schnell verarbeitete, dass er kaum mithalten konnte. Zwei Fremde jagten die Frau und quälten sie. Er sah auch ein Bild von sich selbst, sein dichtes Haar, das strähnig um sein verwüstetes Gesicht fiel, seinen Körper, den brutale Hände geschunden hatten. Er sah deutlich den Pfahl, der tief in sein Fleisch getrieben worden war. Das Bild tauchte einen Moment lang im Bewusstsein der Frau auf, gefolgt von dem flüchtigen Eindruck von Kummer, und dann verlor er den Kontakt wieder.
Shea würde ihre Gesichter nie vergessen, ebenso wenig wie ihre Augen und den Geruch von Schweiß, den sie ausströmten. Einer von ihnen, der größere von beiden, konnte nicht die Augen von ihr lassen. »Wer sind Sie?« Sie starrte die beiden unschuldig an. Sie wusste, dass sie jung und harmlos aussah, zu klein, um Schwierigkeiten zu machen.
»Jeff Smith«, sagte der größere barsch, während er sie förmlich mit Blicken verschlang. »Und das ist mein Partner Don Wallace. Wir möchten Sie bitten, mit uns zu kommen und ein paar Fragen zu beantworten.«
»Ist das denn wirklich erforderlich? Ich bin Ärztin, meine Herren. Ich kann nicht einfach alles stehen und liegen lassen. In einer Stunde muss ich operieren. Vielleicht könnten Sie Ihre Fragen stellen, wenn meine Schicht vorüber ist.«
Wallace grinste sie an. Er hielt sich wohl für charmant, aber Shea fand, dass er wie ein Hai aussah. »Können wir leider nicht, Doc. Es geht hier nicht nur um ein paar Fragen, sondern um ein ganzes Komitee, das sich mit Ihnen unterhalten will.« Er lachte leise. Auf seiner Stirn bildete sich ein dünner Schweißfilm. Er genoss es, Schmerzen zu bereiten, und Shea O’Halloran war bei Weitem zu kühl, zu hochmütig.
Shea achtete darauf, dass ihr massiver Schreibtisch zwischen ihr und den Männern blieb. Langsam und scheinbar unbeteiligt wandte sie sich zu ihrem Computer um, tippte den Befehl ein, ihre Dateien zu löschen, und drückte auf die Enter-Taste. Dann griff sie nach dem Tagebuch ihrer Mutter und steckte es in ihre Handtasche. Ihre Bewegungen wirkten unbefangen und natürlich. »Sind Sie sicher, dass Sie die richtige Person vor sich haben?«
»Sie sind doch Shea O’Halloran, und Ihre Mutter ist Margaret ›Maggie‹ O’Halloran aus Irland?«, entgegnete Jeff Smith wie eingeübt. »Geboren in Rumänien, Vater unbekannt?« Leichter Hohn lag in seiner Stimme.
Sie heftete die volle Kraft ihrer smaragdgrünen Augen auf ihn und beobachtete unbewegt, wie er sich innerlich wand, als plötzliches Begehren in ihm wach wurde. Smith war für ihre Reize weit empfänglicher als sein Partner. »Sollte mich das beunruhigen, Mr. Smith? Ich bin, wer ich bin. Mein Vater hat nichts damit zu tun.«
»Nein?« Wallace trat näher an den Schreibtisch. »Sie brauchen also kein Blut? Lechzen nicht danach? Trinken es nicht?« Seine Augen glühten vor Hass.
Shea brach in Gelächter aus. Ihr Lachen war leise und sinnlich, ein Klang, dem man ewig hätte lauschen mögen. »Blut trinken? Soll das ein Scherz sein? Für solchen Unsinn habe ich keine Zeit.«
Smith leckte sich die Lippen. »Sie trinken kein Blut?« Ein Anflug von Hoffnung schwang in seiner Stimme mit.
Wallace sah ihn scharf an. »Schau ihr nicht in die Augen«, knurrte er. »Das solltest du mittlerweile wissen.«
Sheas Augenbrauen fuhren in die Höhe. Wieder lachte sie leise und einladend, als wollte sie Smith auffordern, mit einzustimmen. »Ich brauche gelegentlich eine Transfusion. Das ist nichts Ungewöhnliches. Haben Sie noch nie von Hämophilie, der Bluterkrankheit, gehört? Gentlemen, Sie verschwenden meine Zeit.« Ihre Stimme senkte sich ein wenig, wurde weich und melodisch. »Sie sollten jetzt lieber gehen.«
Smith kratzte sich am Kopf. »Vielleicht haben wir die Falsche erwischt. Schau sie doch an! Sie ist Ärztin. Sie sieht nicht so aus wie die anderen. Die anderen sind groß und stark und haben dunkles Haar. Sie ist klein und zierlich und rothaarig. Und sie geht bei Sonnenlicht aus.«
»Halt ’s Maul«, fuhr Wallace ihn an. »Sie ist eine von ihnen. Wir hätten sie knebeln sollen. Sie beeinflusst dich mit ihrer Stimme.« Er musterte Shea von oben bis unten, und ihr lief ein Schauer über die Haut. »Sie wird schon reden.« Er grinste verschlagen. »Jetzt habe ich Ihnen Angst gemacht. Wurde auch Zeit. Sie werden kooperieren, O’Halloran, auf die harte Tour oder auf die leichte. Mir ist, ehrlich gesagt, die harte lieber.«
»Das kann ich mir denken. Was wollen Sie denn eigentlich von mir?«
»Beweise, dass Sie ein Vampir sind«, zischte Wallace.
»Sie machen wohl Witze. Es gibt keine Vampire, außer in Filmen und Schauergeschichten«, gab sie zurück. Sie brauchte unbedingt Informationen, egal, aus welcher Quelle, und auch wenn es bedeutete, sich mit Männern abzugeben, die so krank waren wie diese beiden.
»Ach was? Ich habe einige kennengelernt.« Wieder grinste Wallace bösartig. »Vielleicht waren Freunde von Ihnen dabei.« Er warf einige Fotos auf den Schreibtisch und starrte Shea herausfordernd an. Seine Erregung war förmlich mit Händen greifbar.
Ohne eine Miene zu verziehen, griff Shea nach den Fotos. Ihr Magen schnürte sich zusammen, und Übelkeit stieg in ihr hoch, aber ihre Selbstbeherrschung ließ sie nicht im Stich. Die Fotos, acht Stück, waren durchlaufend nummeriert. Sämtliche Opfer trugen Binden vor den Augen, Knebel und Handschellen und wurden in verschiedenen Stadien der Folter gezeigt. Don Wallace war ein Schlächter. Sie berührte das Bild mit der Nummer zwei leicht mit einer Fingerspitze. Tiefes Mitleid regte sich in ihr. Es war ein Junge, nicht älter als achtzehn.
Rasch, bevor ihr Tränen in die Augen stiegen, überflog sie die restlichen Fotos. Nummer sieben war ein Mann mit einer Mähne tiefschwarzer Haare – der Mann, der durch ihre Träume geisterte! Es bestand kein Zweifel. Ein Irrtum war ausgeschlossen. Sie kannte jede Linie seines Gesichts, den schön geschnittenen Mund, die dunklen, ausdrucksvollen Augen, das lange Haar. Jäher Schmerz packte sie. Einen Moment lang fühlte sie seine Qualen, die seinen Körper und seinen Geist folterten und jeden normalen Gedanken vertrieben, bis nur noch Raum für Schmerzen, Hass und Hunger blieb. Zart, fast liebevoll strich sie mit dem Daumen über das verzerrte Gesicht. Ihre Berührung war wie eine Liebkosung, aber der Schmerz und der Hass in ihm wurden nur noch stärker, und der Hunger schien alles andere zu verzehren. Die Empfindungen waren so stark und ihrem Wesen so fremd, dass sie das seltsame Gefühl hatte, irgendetwas oder -jemand würde ihr Bewusstsein teilen. Verwirrt legte Shea die Fotos auf den Schreibtisch zurück.
»Sie beide waren es, die vor einigen Jahren in Europa diese ›Vampirmorde‹ begangen haben, nicht wahr? Sie haben all diese unschuldigen Menschen getötet.« Shea sprach ganz ruhig.
Don Wallace leugnete es nicht. »Und jetzt habe ich Sie erwischt.«
»Wenn Vampire so mächtig sind, wie ist es Ihnen dann gelungen, so viele von ihnen umzubringen?« Ihr Tonfall war bewusst sarkastisch, um ihn zum Weiterreden zu provozieren.
»Unter ihren Männern besteht eine große Rivalität.« Wallace lachte kurz. »Sie haben nichts füreinander übrig. Sie brauchen Frauen, und sie teilen nicht gern. Sie arbeiten gegeneinander und liefern manchmal einen ihrer eigenen Leute aus. Stark sind sie trotzdem. Und wenn sie noch so viel leiden, sie reden nicht. Was in mancher Hinsicht ganz gut ist, weil sie Menschen mit ihren Stimmen praktisch hypnotisieren können. Aber Sie werden reden, Doc. Ich habe alle Zeit der Welt für Sie. Wussten Sie, dass ein Vampir Blut schwitzt, wenn er Schmerzen leidet?«
»Das würde ich mit Sicherheit wissen, wenn ich ein Vampir wäre. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht Blut geschwitzt. Mal sehen, ob ich das richtig mitbekommen habe. Vampire greifen nicht nur Menschen, sondern auch andere Vampire an. Die Männer unter ihnen verraten einander an Schlächter wie Sie, weil sie Frauen brauchen. Ich dachte, sie müssten eine Frau einfach nur beißen, um sie in einen Vampir zu verwandeln.« Shea zählte spöttisch einen Punkt nach dem anderen an den Fingern ab. »Sie wollen mir einreden, dass ich eines dieser Fantasiewesen bin und so mächtig, dass ich allein mit meiner Stimme einen starken Mann wie ihn hier versklaven kann.« Sie zeigte bewusst auf Jeff Smith und schenkte ihm ein liebenswürdiges Lächeln. »Gentlemen, ich bin Ärztin. Ich rette jeden Tag Leben. Ich schlafe in einem Bett, nicht in einem Sarg. Ich bin ganz und gar nicht stark, und ich habe noch nie in meinem Leben Blut gesaugt.« Sie sah Don Wallace an. »Sie hingegen geben zu, Männer gefoltert und verstümmelt und sogar ermordet zu haben. Und offensichtlich hat Ihnen das noch dazu sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube nicht, dass Sie beide von der Polizei oder irgendeiner anderen offiziellen Behörde sind. Ich denke vielmehr, Sie sind die Monster.« Sie heftete ihre smaragdgrünen Augen wieder auf Jeff Smith und fragte leise: »Glauben Sie wirklich, dass ich eine Gefahr für Sie bin?«
Er schien von ihrem lockenden Blick magisch angezogen zu werden. Noch nie hatte er eine Frau so sehr begehrt. Er blinzelte, räusperte sich und warf einen verstohlenen Blick auf Wallace. Smith war dieser gierige, kalte Ausdruck auf dem Gesicht seines Partners noch nie aufgefallen. »Nein, nein, natürlich sind Sie keine Gefahr, weder für mich noch für sonst jemanden.«
»Verdammt, Jeff, schnappen wir sie uns und verschwinden von hier!«, knurrte Wallace, überwältigt von dem Drang, Shea zu zeigen, wer hier das Sagen hatte.
Grüne Augen glitten über Smith und verharrten auf seinem gebannten Blick. Sie konnte sein Verlangen spüren und fachte es an; sie schürte es mit Fantasiebildern, dass sie seine Annäherungsversuche begrüßen würde. Sie hatte schon in sehr jungen Jahren gelernt, dass sie in das Bewusstsein anderer eindringen und ihr Denken manipulieren konnte. Anfangs hatte es sie geängstigt, eine solche Macht auszuüben, aber es war ihr im OP von Nutzen und auch jetzt, da sie bedroht wurde.
»Warum verwandeln sie nicht einfach menschliche Frauen in Vampire, Don? Das wäre doch sinnvoll. Und warum hat uns der Vampir auf einmal nicht mehr geholfen? Wir haben die Gegend ziemlich hastig verlassen, und du hast mir immer noch nicht gesagt, was schiefgegangen ist«, bemerkte Smith misstrauisch.
»Wollen Sie damit sagen, dass einer dieser männlichen Vampire Sie tatsächlich bei Ihrem Vorhaben, andere Vampire zu töten, unterstützt hat und Sie deshalb so erfolgreich waren?«, hakte Shea ungläubig nach.
»Der Typ war bösartig und rachsüchtig. Den jungen Burschen hat er gehasst, aber den hier hat er ganz besonders verabscheut.« Smith tippte auf das Foto des Mannes mit den langen schwarzen Haaren. »Er wollte, dass er gefoltert wird und es richtig spürt.«
»Halt die Klappe«, fuhr Wallace ihn an. »Bringen wir’s hinter uns. Sie ist dem Syndikat über hunderttausend Dollar wert. Man will sie genau unter die Lupe nehmen.«
Shea lachte leise. »Wenn ich wirklich einer Ihrer legendären Vampire wäre, müsste ich Ihrem ›Forschungsteam‹ eigentlich viel mehr wert sein. Ich fürchte, Ihr Partner ist Ihnen gegenüber nicht ganz ehrlich, Mr. Smith.«
Die Wahrheit stand Wallace ins Gesicht geschrieben. Als Smith sich angriffslustig zu ihm umdrehte, setzte Shea sich blitzschnell in Bewegung. Sie sprang aus dem Fenster, landete wie eine Katze auf ihren Füßen und lief um ihr Leben. Sie ließ keine persönlichen Dinge zurück, um die sie sich Sorgen machen musste, keine Erinnerungsstücke. Das Einzige, was sie bedauerte, war der Verlust ihrer Bücher.
Als er ihre Angst spürte, empfand Jacques das Verlangen, sie zu beschützen. Der Drang war genauso stark wie sein Wunsch, sich zu rächen. Was er auch getan hatte – und er gab offen zu, dass er es nicht mehr wusste –, eine derartig grausame Strafe konnte er unmöglich verdient haben. Wieder überwältigte ihn der Schlaf, aber zum ersten Mal seit Monaten hatte er weder seine Schmerzen an ihren Körper weitergegeben noch ihren Geist für einige Sekunden in Besitz genommen, um sicherzugehen, dass sie seinen brodelnden Zorn und die Vorahnung von Vergeltung spürte. Diesmal hatte er sie nicht bestraft. Nur er hatte das Recht, ihrem Bewusstsein ebenso wie ihrem zarten, bebenden Körper Angst einzuflößen. Sie hatte sein Bild mit einer Mischung aus Verwirrung und Bedauern betrachtet. Glaubte sie, dass er tot war und sie von seiner Seele, die keine Ruhe fand, verfolgt wurde? Was ging in dem Kopf einer Verräterin vor?
Die Zeit schleppte sich endlos dahin. Aufwachen, wenn sich ein Lebewesen in seine Nähe verirrte. An dem verrottenden Holz kratzen und scharren. Irgendwann wurde das Tuch über seinen Augen mürbe und zerfiel schließlich. Er hatte keine Ahnung, wie lange er schon hier war. Es spielte keine Rolle. Dunkelheit und Einsamkeit umgaben ihn. Seine einzige Gefährtin war die Frau in seinem Bewusstsein. Die Frau, die ihn verraten und im Stich gelassen hatte. Manchmal rief er nach ihr, befahl ihr, zu ihm zu kommen. Drohte ihr, flehte sie an. So pervers es auch war, er brauchte sie. Er war kaum noch zurechnungsfähig, das war ihm klar. Aber diese vollständige Isolation brachte ihn um den letzten Rest Verstand. Ohne den Kontakt zu der Frau würde er untergehen und seinen unbeugsamen Willen verlieren. Und er hatte einen Grund, am Leben zu bleiben: Rache. Er verlangte nach der Frau ebenso, wie er sie hasste und verabscheute. So gestört ihre Beziehung auch war – er brauchte die Augenblicke geistiger Nähe zu ihr.
Sie war ihm jetzt räumlich näher und nicht mehr durch einen Ozean von ihm getrennt. Sie war so fern gewesen, dass er die Distanz kaum hatte überwinden können. Aber jetzt war sie viel näher gerückt. Er verdoppelte seine Anstrengungen, indem er zu jeder Tages- und Nachtzeit nach ihr rief und sich bemühte, sie am Schlafen zu hindern.
Wenn es ihm gelang, Schmerzen und Hunger zu überwinden und sich einfach ruhig zu verhalten und wie ein Schatten in ihrem Bewusstsein zu verharren, war er unwillkürlich fasziniert von ihr. Sie war offensichtlich intelligent, sogar brillant. Ihr Verstand funktionierte wie eine Maschine und verarbeitete Informationen mit unglaublicher Geschwindigkeit. Sie schien in der Lage zu sein, Emotionen völlig beiseite zu schieben; vielleicht war sie gar nicht imstande, Gefühle zu haben. Er ertappte sich dabei, ihren Verstand, ihre Denkweise zu bewundern, die Art, wie sie sich gänzlich auf ihre Arbeit konzentrierte. Sie befasste sich in ihren Forschungen mit einer Krankheit und schien wie besessen von dem Verlangen zu sein, ein Heilmittel zu finden. Vielleicht war das der Grund, warum er sie oft in einem schwach erleuchteten Raum vorfand, blutbespritzt, die Hände tief in einem menschlichen Körper vergraben. Sie führte Experimente durch. Es entschuldigte nicht die abgrundtiefe Schlechtigkeit dieser Frau, aber er musste ihre Zielstrebigkeit anerkennen. Sie war imstande, ihr Bedürfnis nach Schlaf oder Nahrung über einen langen Zeitraum hinweg zu ignorieren. Er spürte, was sie brauchte, doch sie konzentrierte sich so ausschließlich auf das, was sie gerade tat, dass sie anscheinend nicht bemerkte, wonach ihr Körper verlangte.
In ihrem Leben schien es kein Lachen zu geben, keine echte Nähe zu anderen. Das kam ihm eigenartig vor. Jacques war sich nicht sicher, wann dieser Gedanke ihn zu irritieren begonnen hatte, aber dass es so war, stand fest. Sie hatte niemanden. Sie konzentrierte sich gänzlich auf ihre Arbeit. Die Gegenwart eines anderen männlichen Wesens in ihrem Leben hätte er natürlich nicht geduldet; er hätte versucht, jeden anderen zu töten, der in ihre Nähe kam. Er redete sich ein, dass er das tun würde, weil jeder Mann, mit dem sie näher zu tun hatte, zwangsläufig Teil der Verschwörung gegen ihn, Jacques, sein müsste. Es ärgerte ihn, dass er immer öfter den Wunsch verspürte, mit ihr zu reden, aber sie hatte eine faszinierende Persönlichkeit. Und sie war alles für ihn. Seine Rettung. Sein Verderben. Ohne ihre Nähe, ohne den Kontakt zu ihrem Bewusstsein hätte er völlig den Verstand verloren, und das wusste er. Ohne es zu ahnen, teilte sie ihr seltsames Leben mit ihm und gab ihm etwas, worauf er sich konzentrieren konnte: eine Art Gemeinschaft. In gewisser Weise war es eine Ironie des Schicksals. Sie nahm an, dass er in der Erde eingesperrt und sie vor seiner Rache sicher war. Aber sie selbst hatte das Monster geschaffen, und jetzt, da seine Kraft mit jedem Kontakt zu ihr größer wurde, hielt sie es am Leben.
Er fand sie wieder, einen Monat später, vielleicht ein Jahr, er wusste es nicht, und es kümmerte ihn auch nicht. Ihr Herz schlug laut vor Angst, genauso wie seins. Vielleicht hatte ihn die ungeheure Intensität ihrer Emotionen geweckt. Der Schmerz war qualvoll, der Hunger unerträglich, und trotzdem mühte sich sein Herz ab, in einem Rhythmus mit ihrem zu schlagen, aber er fand nicht genug Luft zum Atmen in seinen Lungen. Sie fürchtete um ihr Leben. Irgendjemand jagte sie. Vielleicht wandten sich die anderen, die sich an ihrem Verrat beteiligt hatten, jetzt gegen die Frau. Er riss sich zusammen und wartete, indem er den Schmerz und den Hunger abblockte, wie er es im Lauf der Jahre gelernt hatte. Niemand würde ihr etwas zuleide tun. Sie gehörte ihm. Er allein hatte zu entscheiden, ob sie lebte oder starb, niemand sonst. Wenn es ihm gelang, den Feind durch ihre Augen zu »sehen«, könnte er ihn zerstören. Er spürte, wie seine Kraft zunahm, und sein Zorn steigerte sich bei der Vorstellung, jemand könnte ihm die Frau nehmen, so sehr, dass es ihn erstaunte.
Das Bild, das er empfing, war klar und deutlich. Sie befand sich in irgendeiner Unterkunft. Rings um sie herum lagen Kleidungsstücke und Möbel in wildem Durcheinander, als hätte es einen Kampf gegeben. Oder hatte jemand ihre Habseligkeiten durchsucht? Sie lief durch die Zimmer und schnappte sich unterwegs ein paar Sachen. Jacques erhaschte einen flüchtigen Blick auf üppiges rotes Haar; es war seidig, weich und leuchtend. Er wünschte sich, dieses Haar zu berühren. Seine Finger in seine dichte Fülle zu tauchen. Es ihr um den Hals zu wickeln und sie damit zu erwürgen. Sein Gesicht darin zu vergraben. Dann war das Bild verschwunden. Seine Stärke verpuffte, und er sank kraftlos in seinem Gefängnis in sich zusammen, außerstande, sie zu erreichen, ihr zu helfen oder dafür zu sorgen, dass sie in Sicherheit war. Das machte seine Qualen und seinen Hunger noch schlimmer. Und es vergrößerte ihre Schuld.
Er verharrte regungslos und ließ sein Herz langsamer schlagen, bis es ihm gerade noch möglich war, zu denken und sich zu einem letzten Versuch aufzuraffen. Wenn sie überlebte, würde er sie hierher bringen. Er würde keine weiteren Anschläge auf ihr Leben zulassen. Ob sie am Leben blieb oder starb, lag allein bei ihm. Komm zu mir, komm her zu mir. In die Karpaten, die entlegene, wilde Bergregion, wo du sein solltest, wo deine Heimat ist, wo dein Volk lebt. Komm zu mir. Er sandte den Ruf zu ihr und unterlegte ihn mit einem starken Zwang, so stark, wie es ihm nur möglich war.
Es war getan. Mehr konnte er nicht tun, ohne sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. Und so knapp vor dem Ziel würde er keine unnötigen Risiken eingehen.
Sie hatten sie gefunden. Und wieder einmal lief Shea O’Halloran um ihr Leben. Seit ihr bewusst war, dass man Jagd auf sie machte, war sie vorausschauender geworden. Sie hatte an verschiedenen Orten Bargeld hinterlegt und sich einen Truck mit Vierradantrieb angeschafft, in dem sie notfalls leben konnte. Alles Lebensnotwendige hatte sie in dem Wagen verstaut, sodass sie nur ihre Handtasche schnappen und weglaufen musste. Wohin diesmal? Wo konnte sie hingehen, um ihre Verfolger abzuschütteln? Sie fuhr sehr schnell, um den Leuten zu entkommen, die sie sezieren wollten wie ein Insekt, den Leuten, in deren Augen sie kein menschliches Wesen war.
Ihr blieb nicht mehr viel Zeit zum Leben, das wusste sie. Ihre Kräfte ließen allmählich nach. Die schreckliche Krankheit forderte ihren Tribut, und sie war von einer Möglichkeit, dieses Leiden zu heilen, noch genauso weit entfernt wie am Anfang. Höchstwahrscheinlich hatte sie die Krankheit von ihrem Vater geerbt. Dem Vater, den sie nie gesehen, nie gekannt hatte, dem Vater, der ihre Mutter noch vor Sheas Geburt im Stich gelassen hatte. Wie oft hatte sie das Tagebuch ihrer Mutter gelesen! Ihr Vater hatte ihrer Mutter die Liebe gestohlen, das Leben selbst, sodass sie zu einem Schatten ihrer selbst geworden war. Ihr Vater hatte sich nicht im Geringsten für ihre Mutter oder sie selbst interessiert.
Sie fuhr in die allgemeine Richtung der Karpaten, dem Geburtsort ihres Vaters. Das Land des Aberglaubens und der Legenden. Die seltene Blutkrankheit, an der sie litt, mochte durchaus dort ihren Ursprung haben. Bei dem Gedanken hob sich ihre Stimmung plötzlich. Shea konzentrierte sich so ausschließlich auf alle Informationen, über die sie verfügte, dass sie ihre Furcht vergaß. Dort, in den Karpaten, musste der Ursprung sein. So viele Vampirgeschichten nahmen dort ihren Ausgang. Sie erinnerte sich mühelos an jedes Detail jeder Geschichte, die sie je gehört oder gelesen hatte. Vielleicht war sie endlich auf der richtigen Spur. Die Hinweise hatten sich die ganze Zeit im Tagebuch ihrer Mutter befunden. Shea ärgerte sich, dass es ihr nicht früher aufgefallen war. Sie hatte eine so starke Aversion gegen ihren Vater und etwaige Angehörige von ihm entwickelt, dass sie nie auf den Gedanken gekommen war, ihre eigenen Wurzeln zu untersuchen, um die Antworten zu finden, die sie brauchte. Das Tagebuch ihrer Mutter. Sie kannte jeden Eintrag auswendig.
Heute Abend bin ich ihm begegnet. In dem Moment, als ich ihn sah, wusste ich, dass er der Eine ist. Groß, gut aussehend, faszinierende Augen. Seine Stimme ist schöner als alles, was ich je gehört habe. Er empfindet dasselbe für mich. Ich weiß, dass es so ist. Es ist natürlich falsch – er ist verheiratet –, aber es gibt für uns keine andere Möglichkeit. Wir können nicht ohne einander sein. Rand – das ist sein Name, fremdartig wie er selbst, wie sein Akzent. Er stammt aus den Karpaten. Wie habe ich je ohne ihn leben können?
Seine Frau Noelle hat vor zwei Monaten einen Sohn zur Welt gebracht. Ich weiß, dass er bitter enttäuscht war. Aus irgendeinem Grund ist es ihm wichtig, ein Mädchen zu bekommen. Er ist die ganze Zeit bei mir, auch wenn ich oft allein bin. Er ist in meinem Bewusstsein und spricht mit mir, flüstert mir zu, wie sehr er mich liebt. Er leidet an einer seltsamen Blutkrankheit und kann nicht in die Sonne gehen.
Er hat sehr eigenartige Gewohnheiten. Wenn wir miteinander schlafen – und es ist jedes Mal unvorstellbar schön! –, erfüllt er meinen Geist und mein Herz ebenso wie meinen Körper. Er sagt, es liegt daran, dass ich über übersinnliche Fähigkeiten verfüge, genau wie er, aber ich weiß, dass mehr dahintersteckt. Es hat etwas mit seinem Verlangen zu tun, mein Blut zu trinken. Da! Ich habe aufgeschrieben, was ich nicht laut aussprechen kann. Es klingt furchtbar, grauenhaft, aber es ist ungeheuer erotisch, seinen Mund auf mir zu spüren, mein Blut in seinem Körper. Ich liebe ihn so sehr! Es bleibt kaum jemals ein Mal zurück, es sei denn, er will mich als sein Eigentum zeichnen. Seine Zunge lässt Wunden schnell heilen. Ich habe es gesehen, es ist wie ein Wunder. Er ist ein Wunder.
Noelle, seine Frau, weiß von mir. Er hat mir gesagt, dass sie ihn nicht gehen lassen will und dass sie gefährlich ist. Es ist wahr. Ich weiß es, weil sie mir gedroht hat, mich umzubringen. Ich hatte schreckliche Angst. Ihre Augen glühten rot, und ihre Zähne blitzten wie die eines Tiers, aber Rand kam, bevor sie mir etwas tun konnte. Er war außer sich vor Zorn. Ich weiß, dass er die Wahrheit spricht, wenn er sagt, dass er mich liebt; ich konnte es daran merken, wie er mit seiner Frau sprach, als er ihr befahl zu gehen. Wie sehr sie mich hasst!
Ich bin so glücklich! Ich bin schwanger. Er weiß es noch nicht. Ich habe ihn seit zwei Nächten nicht gesehen, aber ich bin mir sicher, dass er mich nie im Stich lassen würde. Wahrscheinlich versucht seine Frau zu verhindern, dass er sie verlässt. Ich hoffe, das Kind ist ein Mädchen. Ich weiß, wie verzweifelt er sich eine Tochter wünscht. Ich werde ihm geben, was er immer gewollt hat, und Noelle wird für ihn Vergangenheit sein. Ich weiß, dass ich Schuldgefühle haben sollte, doch das kann ich nicht, wenn es für uns beide so offensichtlich ist, dass er zu mir gehört.
Wo ist er? Warum kommt er nicht zu mir, wenn ich ihn so sehr brauche? Warum hat er sich aus meinem Bewusstsein zurückgezogen?
Shea schreit ständig. Die Ärzte sind beunruhigt wegen ihrer eigenartigen Blutwerte. Sie braucht täglich Transfusionen. Gott, ich hasse sie! Sie hält mich in dieser leeren Welt fest. Ich weiß, dass er tot ist. An dem Tag, als Noelle bei mir war, kam er für ein paar wundervolle Stunden allein zu mir zurück. Er sagte mir, dass er sie verlassen würde. Ich glaube, er hat es versucht. Er ist einfach verschwunden, aus meinem Inneren, aus meinem Leben. Meine Eltern glauben, er hätte mich verlassen, weil ich schwanger war. Sie meinen, er hätte mir übel mitgespielt, aber ich weiß, er ist tot. Ich spüre seine furchtbaren Qualen, sein Leid. Er würde zu mir kommen, wenn er könnte. Und er wusste nichts von dem Kind. Ich würde ihm folgen, aber ich muss mich um seine Tochter kümmern. Wenn seine Frau ihn ermordet hat – und ich bin sicher, dass sie dazu imstande wäre! –, wird er durch mich und unser Kind weiterleben.
Ich habe Shea nach Irland gebracht. Meine Eltern sind tot, und ich habe ihren Besitz geerbt. Ich hätte ihnen das Kind überlassen, aber jetzt ist es zu spät. Ich kann Rand nicht folgen. Ich kann Shea nicht allein lassen, wenn so viele Leute ihretwegen Fragen stellen. Ich habe Angst, dass man versuchen wird, sie umzubringen. Sie ist wie er. Sie bekommt leicht einen Sonnenbrand. Sie braucht Blut wie er. Die Ärzte haben so viel über sie getuschelt und mich so merkwürdig angeschaut, dass ich Angst bekam. Ich wusste, dass ich mit ihr verschwinden musste. Ich werde niemandem erlauben, deiner Tochter auch nur ein Haar zu krümmen, Rand. Gott steh mir bei, ich habe keine Empfindungen mehr. Ohne dich bin ich innerlich tot. Wo bist du? Hat Noelle dich ermordet? Wie soll ich ohne dich leben? Nur deine Tochter hält mich davon ab, dir zu folgen. Bald, mein Liebling, sehr bald werde ich bei dir sein.
Shea atmete langsam aus. Natürlich. Es war da, direkt vor ihrer Nase. Sie braucht Blut wie er. Sie hatte die Blutkrankheit von ihrem Vater geerbt. Ihre Mutter hatte geschrieben, dass Rand tatsächlich ihr Blut getrunken hatte, wenn sie miteinander geschlafen hatten. Wie viele Leute waren verfolgt worden und hatten einen Pfahl durchs Herz gejagt bekommen, nur weil niemand ein Heilmittel für ihre schreckliche Krankheit gefunden hatte? Sie wusste, was für ein Gefühl es war, an etwas Derartigem zu leiden, sich selbst zu verabscheuen und in ständiger Furcht vor Entdeckung zu leben. Sie musste ein Mittel finden, auch wenn es für sie selbst schon zu spät war.
Jacques schlief lange Zeit, entschlossen, seine Kräfte neu erstehen zu lassen. Er wachte nur auf, um rasch etwas Nahrung zu sich zu nehmen und sich zu vergewissern, dass die Frau am Leben und in der Nähe war. Er unterdrückte sein Hochgefühl, um nicht noch mehr Blut zu verlieren. Jetzt brauchte er seine ganze Kraft. Sie war so nahe, dass er sie spüren konnte. Sie war nur wenige Meilen von ihm entfernt. Zweimal »sah« er ihre Hütte durch ihre Augen. Sie richtete sich darin ein, indem sie all das tat, was Frauen für erforderlich hielten, um eine heruntergekommene Unterkunft in ein Heim zu verwandeln.
Später begann Jacques in regelmäßigen Zeitabständen zu erwachen, um seine Stärke zu testen und Tiere anzulocken, um sich mit dringend benötigtem Blut zu versorgen. Er verfolgte die Frau bis in ihre Träume, rief unablässig nach ihr und hielt sie wach, obwohl ihr Körper dringend Schlaf brauchte. Sie war sehr zerbrechlich, halb verhungert und geschwächt durch den Nahrungsmangel. Sie arbeitete Tag und Nacht, und ihr Denken wurde beherrscht von Problemen und möglichen Lösungen. Er ignorierte all das, um sich nur auf sie zu konzentrieren, damit sie so müde wurde, dass er sie leicht seinem Willen unterwerfen konnte.
Jacques war geduldig. Er hatte gelernt, Geduld zu haben. Er wusste, dass er ihr immer näher kam. Jetzt hatte er Zeit. Es gab keinen Grund zur Eile. Er konnte es sich leisten, seine Kräfte wachsen zu lassen. Aus seinem dunklen Grab heraus stellte er ihr nach, und jedes Mal, wenn er an ihr Bewusstsein rührte, wurde die Verbindung zwischen ihnen stärker. Im Grunde wusste er gar nicht, was er mit ihr machen würde, wenn er sie erst einmal in den Händen hatte. Er würde sie nicht gleich töten; er hatte sich so lange in ihrem Bewusstsein bewegt, dass es manchmal so schien, als wären sie eins. Aber leiden würde sie mit Sicherheit. Wieder versetzte er sich in Schlaf, um das verbliebene Blut in seinen Adern zu schonen.
Sie war an ihrem Computer eingeschlafen, und ihr Kopf ruhte auf einem Stoß Papier. Selbst im Schlaf arbeitete ihr Verstand. Jacques hatte viel über sie erfahren. Sie hatte ein fotografisches Gedächtnis. Er lernte Dinge von ihr, die er entweder vergessen oder vielleicht nie gewusst hatte. Oft verbrachte er einige Zeit mit Lernen, bevor er sie wieder seinen Quälereien aussetzte. Sie war für ihn eine Quelle des Wissens, Wissens über die Außenwelt.
Sie war immer allein. Sogar die flüchtigen Einblicke in lange zurückliegende Erinnerungen zeigten ein kleines Kind, das von anderen isoliert war. Er hatte das Gefühl, sie gut zu kennen, obwohl er eigentlich nichts Persönliches über sie wusste. Ihr Geist war erfüllt von Formeln und Daten, Instrumenten und Chemikalien. Sie dachte weder über ihr Aussehen noch über die anderen Dinge nach, die seiner Erfahrung nach für eine Frau wichtig waren. Sie dachte nur an ihre Arbeit. Alles andere wurde rasch beiseite geschoben.
Jacques setzte seine ganze Willenskraft ein und konzentrierte sie auf die Frau. Du wirst jetzt zu mir kommen. Nichts kann dich aufhalten. Wach auf und komm zu mir. Ich ruhe mich aus und warte. Er legte alles, was ihm an Stärke geblieben war, in den Befehl. In den vergangenen zwei Monaten hatte er sie mehrmals gezwungen, in seine Richtung zu gehen, sich durch den dunklen Wald in die Nähe seines Kerkers zu bewegen. Sie hatte jedes Mal getan, was er verlangte, aber ihr Drang, ihre Arbeit zu vollenden, war so stark gewesen, dass sie irgendwann kehrtgemacht hatte. Diesmal war er überzeugt, genug Kraft zu besitzen, um sie seinem Willen zu unterwerfen. Sie spürte seine Gegenwart in ihrem Inneren, registrierte es, wenn er an ihr Bewusstsein rührte, aber sie hatte keine Ahnung, dass sie miteinander verbunden waren. Sie hielt ihn für einen Traum – oder vielmehr für einen Albtraum.
Jacques lächelte bei dem Gedanken. Aber in dem Aufblitzen seiner weißen Zähne verriet sich keine Erheiterung, nur ein Aufflackern von Wildheit, wie die dunkle Vorahnung von einem Raubtier, das bereit ist, seine Beute zu reißen.
Shea schrak auf und blinzelte, um das Zimmer wieder klar sehen zu können. Überall lag ihre Arbeit herum; der Computer lief, und die Dokumente, die sie studiert hatte, waren an der Stelle, wo ihr Kopf gelegen hatte, ein bisschen zerknittert. Schon wieder der Traum. Würde er nie aufhören, sie nie in Ruhe lassen?
Mittlerweile war ihr der Mann aus dem Traum vertraut, sein dichtes, tiefschwarzes Haar und der leichte Zug von Grausamkeit, der um seinen sinnlichen Mund lag. In den ersten Jahren hatte sie in dem Albtraum seine Augen nicht sehen können, als wären sie von irgendetwas bedeckt, aber seit zwei Jahren starrte er sie finster und drohend an.
Shea strich ihr Haar zurück und spürte die winzigen Schweißperlen, die ihr auf die Stirn getreten waren. Einen Moment lang befiel sie das seltsame Gefühl von Orientierungslosigkeit, das sie immer nach dem Traum erfüllte, als hielte etwas einen Herzschlag lang ihr Bewusstsein fest, um es dann langsam und widerwillig freizugeben.
Es wurde Jagd auf sie gemacht, das wusste Shea. Der Traum mochte nicht real sein, aber der Umstand, dass man sie verfolgte, war es. Diese Tatsache durfte sie nie aus den Augen verlieren, nie vergessen. Sie würde niemals wieder in Sicherheit sein, es sei denn, sie fand Heilung für sich selbst und die Hand voll anderer, die an derselben seltenen Krankheit litten. Sie wurde gejagt, als wäre sie ein Tier ohne Gefühle oder Verstand. Für ihre Jäger zählte es nicht, dass sie sechs Sprachen fließend beherrschte, dass sie eine erfahrene Chirurgin war und unzählige Leben gerettet hatte.
Die Worte auf dem Papier vor ihr verwischten sich und liefen ineinander. Wie lange war es her, seit sie richtig geschlafen hatte? Sie seufzte, fuhr sich mit einer Hand durch ihr dichtes, taillenlanges, seidiges Haar und schob es zurück, um es dann auf gut Glück zu packen und mit dem erstbesten Band, das ihr in die Finger kam, zusammenzuhalten.