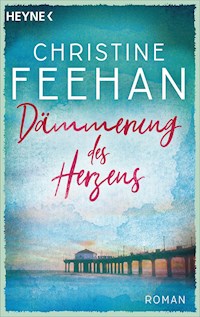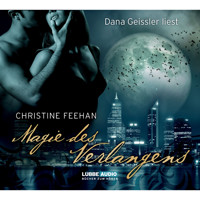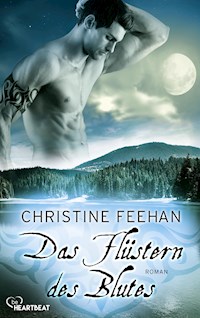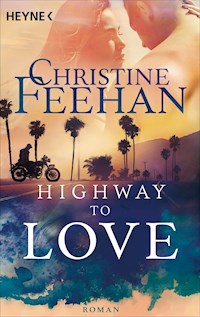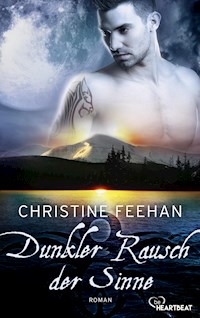
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Karpatianer
- Sprache: Deutsch
Er ist der dunkle Hüter seines Volkes. Doch nach Jahrhunderten seelenloser Einsamkeit treibt ihn plötzlich ein unstillbarer Hunger. Als Lucian der zierlichen Polizistin Jaxon Montgomery begegnet, weiß er, dass er sie besitzen muss. Doch mit jedem Kuss folgt Jaxon Lucian ein Stückchen weiter an den dunklen Abgrund seiner Leidenschaft ...
Dunkel, gefährlich und extrem heiß - Dunkler Rausch der Sinne ist der neunte Band der umfangreichen NEW YORK TIMES und SPIEGEL-Bestsellerserie Die Karpatianer.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 617
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Über dieses Buch
Er ist der dunkle Hüter seines Volkes. Doch nach Jahrhunderten seelenloser Einsamkeit treibt ihn plötzlich ein unstillbarer Hunger. Als Lucian der zierlichen Polizistin Jaxon Montgomery begegnet, weiß er, dass er sie besitzen muss. Doch mit jedem Kuss folgt Jaxon Lucian ein Stückchen weiter an den dunklen Abgrund seiner Leidenschaft …
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
CHRISTINE FEEHAN
Dunkler Rauschder Sinne
Aus dem amerikanischen Englischvon Britta Evert
Dieses Buch wurde für Jonathan Carl Woods Jr. geschrieben.
Wir hätten uns keinen besseren Schwiegersohn wünschen können.
Ehemann unserer Tochter Manda, Vater unserer Enkeltochter Skyler, Beschützer derer, die wir lieben.
Du bist alles, was ein Mann sein sollte, hast alles, was einen Mann zum Helden macht.
Du wirst für immer in unseren Herzen sein.
Prolog
LucianWalachei, 1400
Das Dorf war viel zu klein, um der Armee Widerstand zu leisten, die es zu überrollen drohte. Nichts hatte den Vormarsch der Osmanen aufhalten können. Alles auf ihrem Weg war zerstört, jedermann ermordet, brutal abgeschlachtet worden. Leichen staken auf spitzen Pfählen und wurden als Beute für Aasfresser zurückgelassen. Blut floss in Strömen. Niemand wurde verschont, weder kleine Kinder noch die Alten. Die Angreifer folterten, brandschatzten und massakrierten. Sie ließen nichts als Feuer, Tod und Ratten zurück.
In dem Dorf herrschte Totenstille; nicht einmal die Kinder wagten zu weinen. Die Menschen starrten einander nur voller Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit an. Niemand würde ihnen helfen, nichts würde das Massaker verhindern. Sie würden zugrunde gehen, so wie die Bewohner all der anderen Dörfer, die diesem furchtbaren Feind zum Opfer gefallen waren. Sie waren zu wenige und hatten nur ihre bäuerlichen Waffen, um sich gegen die vorrückenden Horden zur Wehr zu setzen. Sie waren hilflos.
Plötzlich tauchten wie aus dem Nichts zwei Krieger aus der nebelverhangenen Nacht auf. Sie bewegten sich wie eine Einheit, in vollständiger Übereinstimmung, in einem Rhythmus und mit der Anmut eines Raubtiers, geschmeidig und völlig lautlos. Sie waren beide groß und breitschultrig, mit wallendem Haar und Augen, in denen der Tod lag. Einige Leute behaupteten, sie könnten die roten Flammen der Hölle in den Tiefen jener eisigen schwarzen Augen lodern sehen.
Erwachsene Männer gingen ihnen aus dem Weg; Frauen wichen hastig in den Schatten zurück. Die Krieger blickten weder nach links noch nach rechts, sahen aber alles. Eine Aura von Macht umgab sie wie eine zweite Haut. Als der Dorfälteste zu ihnen trat, blieben sie stehen und verharrten so regungslos wie die Berge, ein Stück oberhalb der verstreuten Hütten, von wo sie auf das leere, grasbewachsene Land starrten, das sich zwischen ihnen und dem Wald erstreckte.
»Was gibt es Neues?«, fragte der Dorfälteste. »Wir haben von den Gemetzeln überall im Land gehört. Jetzt sind wir an der Reihe. Und nichts kann diese Todesflut aufhalten. Wir können nirgendwo hingehen, Lucian, haben keinen Ort, wo wir unsere Familien verstecken können. Wir werden kämpfen, aber wie alle anderen werden wir besiegt werden.«
»Wir sind heute Nacht in großer Eile, alter Mann, denn wir werden an einem anderen Ort gebraucht. Es heißt, unser Prinz wäre erschlagen worden. Du warst immer ein guter, braver Mann. Gabriel und ich werden tun, was wir können, um euch zu helfen, bevor wir weiterziehen. Der Feind kann bisweilen sehr abergläubisch sein.«
Seine Stimme war klar und schön und weich wie Samt. Wer dieser Stimme lauschte, konnte nicht anders, als das zu tun, was Lucian befahl. All jene, die sie vernahmen, hatten den Wunsch, sie immer wieder zu hören. Seine Stimme allein konnte verzaubern, verführen – und töten.
»Geht mit Gott«, wisperte der Dorfälteste dankbar.
Die beiden Männer wanderten schweigend und in vollkommener Übereinstimmung weiter. Sowie sie vom Dorf aus nicht mehr zu sehen waren, nahmen sie in ein und demselben Moment eine andere Gestalt an und verwandelten sich in Eulen. Mit kräftigen Flügelschlägen erhoben sie sich weit über die Baumgrenze und hielten nach der schlafenden Armee Ausschau. Einige Meilen vom Dorf entfernt hatten Hunderte Männer ihr Lager aufgeschlagen.
Nebel senkte sich in dicken weißen Schwaden auf die Erde. Von einem Augenblick auf den anderen herrschte völlige Windstille, sodass kein Lufthauch die undurchdringlichen Dunstschleier bewegte. Ohne Vorwarnung stießen die Eulen vom Himmel herab, ihre messerscharfen Klauen direkt auf die Augen der Wachtposten gerichtet. Die Vögel schienen überall zu sein und stets gleichzeitig zuzuschlagen, sodass sie wieder verschwunden waren, ehe jemand den Posten zu Hilfe kommen konnte. Schreie des Entsetzens und der Qual zerrissen die Stille. Die Soldaten fuhren hoch, packten ihre Waffen und suchten in dem dichten weißen Nebel nach dem Feind. Sie sahen nur ihre eigenen Wachtposten. Leere Höhlen klafften dort, wo einmal ihre Augen gewesen waren, und Blut strömte über ihre Gesichter, als sie blindlings davonrannten.
Im Zentrum der Heerschar war ein lautes Knacken zu hören, dann noch eines. Ein Schlag folgte blitzschnell auf den nächsten, und zwei Reihen Soldaten sanken mit gebrochenem Genick auf den Boden. Es war, als hielten sich in dem dichten Nebel unsichtbare Feinde verborgen, die rasch von einem zum anderen liefen und ihnen mit bloßen Händen die Hälse umdrehten. Chaos brach aus. Viele rannten schreiend in den nahen Wald. Aber wie aus dem Nichts tauchten Wölfe auf und schnappten mit ihren mächtigen Kiefern nach den fliehenden Soldaten. Männer stürzten in ihre eigenen Speere, als wäre es ihnen so befohlen worden. Andere rammten ihre Speere in ihre Kameraden, außerstande, sich diesem Zwang zu widersetzen, so sehr sie auch dagegen ankämpften. Blut und Tod und Panik beherrschten den Ort. Die Nacht schien kein Ende zu nehmen, bis es schließlich keinen Ort mehr gab, um sich vor dem unsichtbaren Grauen zu verbergen, vor dem Phantom des Todes, vor den wilden Tieren, die die Armee angriffen.
Am Morgen rückten die Dorfbewohner an, um sich dem Kampf zu stellen – und fanden nur Tote vor.
LucianKarpaten, 1400
In der Luft hing der Geruch von Tod und Verwüstung. Ringsum hoben sich vor dem Himmel die brennenden Ruinen menschlicher Siedlungen ab. Das uralte Volk der Karpatianer hatte versucht, seine Nachbarn zu retten, doch der Feind hatte zugeschlagen, als die Sonne am höchsten stand. Zu dieser Tageszeit war ihre Macht am schwächsten, und sehr viele von ihnen waren, genau wie die Menschen, vernichtet worden – Männer, Frauen, Kinder. Nur diejenigen, die weit von ihrer Heimat entfernt gewesen waren, hatten dem tödlichen Schlag entgehen können.
Julian, jung und stark und doch kaum mehr als ein Junge, betrachtete aus traurigen Augen das Bild, das sich ihm bot. So wenige von seiner Art waren geblieben. Und Vladimir Dubrinsky, ihr Prinz, war tot, ebenso Sarantha, seine Gefährtin. Es war eine Katastrophe, ein Schlag, von dem sich ihr Volk vielleicht nie mehr erholen würde. Julian stand hoch aufgerichtet da, das Gesicht umrahmt von langem, blondem Haar, das ihm über die Schultern fiel.
Dimitri trat zu ihm. »Was machst du hier? Du weißt, wie gefährlich es ist, hier unter freiem Himmel zu stehen. Es gibt so viele, die uns vernichten wollen. Wir haben Anweisung, in der Nähe der anderen zu bleiben.« Er stellte sich schützend neben seinen Freund.
»Ich kann selbst auf mich aufpassen«, erklärte Julian eigensinnig. »Und was machst du hier eigentlich?« Er packte den Arm des älteren Jungen. »Ich habe sie gesehen. Ich bin sicher, dass sie es waren. Lucian und Gabriel. Sie waren es.« Ehrfurcht schwang in seiner Stimme mit.
»Das kann nicht sein«, wisperte Dimitri und schaute in alle Richtungen. Er war aufgeregt und verängstigt zugleich. Niemand, nicht einmal die Erwachsenen, sprachen die Namen der zwei Jäger laut aus. Lucian und Gabriel. Sie waren eine Legende, ein Mythos, nicht die Wirklichkeit.
»Aber ich bin mir sicher. Ich wusste, sie würden kommen, sobald sie erfahren, dass der Prinz tot ist. Was sollten sie sonst tun? Bestimmt wollen sie zu Mikhail und Gregori.«
Der ältere Junge schnappte nach Luft. »Gregori ist auch hier?« Er folgte Julian durch den dichten Wald. »Er wird uns erwischen, wenn wir herumspionieren, Julian. Er weiß alles.«
Der blonde Junge zuckte die Achseln. Ein verschmitztes Lächeln spielte um seine Mundwinkel. »Ich werde sie aus der Nähe sehen, Dimitri. Ich habe keine Angst vor Gregori.«
»Solltest du aber. Und ich habe gehört, dass Lucian und Gabriel in Wirklichkeit Untote sind.«
Julian brach in Gelächter aus. »Wer hat dir denn das erzählt?«
»Ich habe gehört, wie sich zwei Männer darüber unterhalten haben. Sie sagten, niemand könnte es überleben, so lange wie die beiden zu jagen und zu töten, ohne auf die dunkle Seite zu wechseln.«
»Die Menschen haben Krieg und dabei ist unser Volk aufgerieben worden. Sogar unser Prinz ist tot. Überall sind Vampire. Jeder tötet jeden. Ich glaube nicht, dass wir uns wegen Gabriel und Lucian Gedanken machen müssen. Wenn sie wirklich Vampire wären, wären wir alle tot. Niemand, nicht einmal Gregori, könnte im Kampf gegen sie bestehen«, wandte Julian ein. »Sie sind so mächtig, dass niemand ihnen etwas anhaben kann. Sie waren dem Prinzen immer treu ergeben. Immer.«
»Unser Prinz ist tot. Vielleicht werden sie seinem Nachfolger Mikhail gegenüber nicht so loyal sein.« Dimitri plapperte offenbar nach, was er von den Erwachsenen gehört hatte.
Julian schüttelte verärgert den Kopf und ging weiter, wobei er jetzt darauf achtete, kein Geräusch zu machen. Stück für Stück arbeitete er sich durch das dichte Unterholz, bis das Haus in Sichtweite war. Weit in der Ferne stieß ein Wolf einen hohen, klagenden Ton aus. Ein zweiter Wolf antwortete, dann noch einer. Diese beiden schienen viel näher zu sein. Julian und Dimitri nahmen eine andere Gestalt an. Sie wollten es sich nicht entgehen lassen, die legendären Persönlichkeiten zu sehen. Lucian und Gabriel waren die größten Vampirjäger in der Geschichte ihres Volkes. Es war weithin bekannt, dass niemand sie besiegen konnte. Die Nachricht, dass sie in der Nacht allein eine ganze feindliche Armee vernichtet hatten, war ihrer Ankunft vorausgeeilt. Niemand wusste genau, wie viele Gegner sie im Lauf der vergangenen Jahrhunderte geschlagen hatten, aber die Zahl musste ungeheuer hoch sein.
Julian, der die Gestalt eines kleinen Murmeltiers angenommen hatte, huschte näher an das Haus heran. Während er sich dem kleinen Vorbau näherte, hielt er nach Eulen Ausschau. Obwohl er noch jung war, besaß Julian schon das unglaubliche Hörvermögen des alten Karpatenvolkes. Dieses scharfe Sinnesorgan setzte er jetzt ein, um jedes Wort zu verstehen, das gewechselt wurde. Dort im Haus befanden sich die vier bedeutendsten lebenden Karpatianer, und dieses Zusammentreffen wollte er auf keinen Fall verpassen. Er nahm kaum wahr, dass Dimitri sich zu ihm gesellte.
»Du hast keine Wahl, Mikhail«, sagte eine leise Stimme. Die Stimme war unglaublich schön, samtweich, herrisch und doch sanft. »Du musst die Last der Verantwortung tragen. Deine Herkunft verpflichtet dich dazu. Dein Vater hatte eine Vorahnung seines Todes, und seine Befehle waren eindeutig. Du musst die Herrschaft übernehmen. Gregori wird dir in dieser Zeit großer Not beistehen, und wir werden tun, worum dein Vater uns gebeten hat. Aber für die Rolle des Herrschers sind nicht wir bestimmt, sondern du.«
»Du bist einer vom alten Stamm, Lucian. Einer von euch sollte über unser Volk herrschen. Wir sind so wenige; unsere Frauen sind für uns verloren, unsere Kinder dahin. Was sollen unsere Männer ohne Frauen tun?« Julian erkannte Mikhails Stimme. »Sie haben keine andere Wahl, als die Morgendämmerung zu suchen oder zu Untoten zu werden. Gott weiß, dass schon jetzt etliche von ihnen genau das tun. Ich verfüge noch nicht über die Weisheit, unser Volk in so schlimmen Zeiten wie diesen zu führen.«
»In dir fließt das Blut unserer Vorfahren, und du hast die Macht. Mehr noch, unser Volk glaubt an dich. Uns fürchten die Leute, unsere Macht und unser Wissen und alles, was wir verkörpern.« Lucians Stimme war von bezwingender Schönheit. Julian liebte ihren Klang, hätte ihr bis in alle Ewigkeit lauschen mögen. Kein Wunder, dass die Erwachsenen Angst vor Lucians Macht hatten. Selbst Julian, so jung er war, erkannte, dass diese Stimme eine Waffe war. Und Lucian redete im Augenblick ganz normal. Wie mochte es sein, wenn er den Menschen in seiner Umgebung Befehle erteilen wollte? Wer würde die Kraft haben, einer solchen Stimme zu widerstehen?
»Wir bieten dir ein Bündnis an, Mikhail, so wie wir Verbündete deines Vaters gewesen sind, und wir werden tun, was in unserer Macht steht, um dir alles Wissen weiterzugeben, das dir bei deiner schweren Aufgabe von Nutzen sein kann. Gregori, wir wissen, dass auch aus dir ein großer Jäger geworden ist. Ist dein Band zu Mikhail stark genug, um dir durch die dunklen Tage zu helfen, die bevorstehen?« So sanft Lucians Stimme auch klang, sie forderte eine aufrichtige Antwort.
Julian hielt den Atem an. Gregori war vom selben Geblüt wie Gabriel und Lucian. Die Dunklen. Alle Karpatianer mit dieser Abstammung waren von jeher die Beschützer ihrer Art gewesen, diejenigen, die die Untoten zur Verantwortung zogen. Gregori war schon jetzt sehr mächtig. Es schien kaum möglich, dass er sich zu einer Antwort zwingen ließ, und doch tat er es.
»Solange Mikhail lebt und solange es mich gibt, werde ich für seine Sicherheit und die der Seinen sorgen.«
»Du wirst unserem Volk dienen, Mikhail, und unser Bruder wird dir dienen, so wie wir deinem Vater gedient haben. So ist es bestimmt. Gabriel und ich werden gegen die Bedrohung kämpfen, die die Untoten für die Menschen und für unsere eigene Rasse darstellen.«
»Es sind so viele«, erwiderte Mikhail.
»Du hast Recht. Überall herrschen Krieg und Tod, und unsere Frauen sind so gut wie ausgerottet worden. Die Männer brauchen Hoffnung für die Zukunft, Mikhail. Diese Hoffnung musst du ihnen geben, sonst haben sie keinen Grund, weiter in der endlosen Dunkelheit auszuharren. Wir brauchen Frauen, Gefährtinnen für unsere Männer. Unsere Frauen sind das Licht in dieser Dunkelheit. Unsere Männer sind wie Raubtiere, dunkle, gefährliche Jäger, die im Lauf der Jahrhunderte immer tödlicher werden. Wenn wir keine Gefährtinnen finden, werden sich alle in Vampire verwandeln, und wenn die Männer ihre Seelen verlieren, wird unsere Rasse aussterben. Es wird Verwüstungen von einem Ausmaß geben, wie wir es uns nicht vorstellen können. Das zu verhindern ist deine Pflicht, Mikhail, und es ist eine gewaltige Aufgabe.«
»Ebenso wie die eure«, sagte Mikhail leise. »So viele Leben zu nehmen und einer von uns zu bleiben ist keine geringe Leistung. Unser Volk hat euch viel zu verdanken.«
Julian, der immer noch die Gestalt eines Murmeltiers hatte, verbarg sich schnell wieder im Unterholz, um nicht von den Männern des alten Stamms entdeckt zu werden. Hinter ihm raschelte es im Buschwerk, und er drehte sich um. Zwei hochgewachsene Männer standen regungslos und stumm vor ihm. Ihre Augen waren dunkel und leer, ihre Gesichter so unbewegt, als wären sie in Stein gemeißelt. Ein feiner Nebel schien vom Himmel zu fallen und sich über ihn und Dimitri zu senken. Julian hielt den Atem an und riss die Augen weit auf. In diesem Moment tauchte Gregori vor den beiden Jungen auf und schob sich beinahe beschützend vor sie. Als Julian den Kopf zur Seite legte, um an ihm vorbeizuspähen, waren die mystischen Jäger so spurlos verschwunden, als wären sie nie da gewesen, und die beiden Jungen fanden sich allein mit Gregori vor.
LucianFrankreich, 1500
Die Sonne versank in einem Strahlenkranz leuchtender Farben, die allmählich dem Schiefergrau der Nacht wichen. Tief unten im Erdboden fing ein Herz an zu schlagen. Lucian ruhte in der fruchtbaren, heilkräftigen Erde. Die Wunden aus dem letzten schweren Kampf waren verheilt. Im Geist überprüfte er die Umgebung rings um seine Ruhestätte, nahm aber nur die Bewegungen von Tieren wahr. Erdbrocken wurden in die Luft geschleudert, als er aus dem Boden auftauchte und tief einatmete. In dieser Nacht würde sich seine Welt für alle Zeiten ändern. Gabriel und Lucian waren Zwillinge. Sie sahen gleich aus, dachten gleich, kämpften gleich. Im Lauf der Jahrhunderte hatten sie auf allen möglichen Gebieten Kenntnisse erworben, und dieses Wissen teilten sie miteinander.
Alle Männer des Karpatenvolks verloren, je älter sie wurden, ihre Empfindungen und die Fähigkeit, Farben zu sehen. Sie bewegten sich in einer dunklen, düsteren Welt, in der nur ihr Gefühl für Ehre und Treue verhinderte, dass sie zu Vampiren wurden, während sie auf die Gefährtin ihres Lebens warteten. Gabriel und Lucian hatten einen Pakt geschlossen. Sollte sich einer von ihnen in einen Vampir verwandeln, würde der andere seinen Zwillingsbruder jagen und vernichten, bevor er die Morgendämmerung und damit seinen eigenen Untergang erlebte. Lucian wusste bereits seit einiger Zeit, dass Gabriel mit seinem inneren Dämon rang und allmählich von der Dunkelheit verzehrt wurde, die sich in ihm ausbreitete. Die ständigen Kämpfe forderten ihren Tribut. Gabriel war dicht davor, auf die dunkle Seite zu wechseln.
Lucian atmete noch einmal die reine Nachtluft ein. Er war entschlossen, Gabriel am Leben zu halten, seine Seele zu retten. Es gab nur eine Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen. Wenn er Gabriel davon überzeugen konnte, dass er, Lucian, sich den Reihen der Untoten angeschlossen hatte, blieb Gabriel nichts anderes übrig, als ihn zu jagen. Das würde Gabriel davon abhalten, mit einem anderen als Lucian zu kämpfen. Sie beide waren einander an Macht ebenbürtig, also würde Gabriel ihn niemals besiegen können, und dadurch ebenso wie durch die Tatsache, ein bestimmtes Ziel zu verfolgen, würde Gabriel standhaft bleiben können.
Lucian erhob sich in die Lüfte und suchte sein erstes Opfer.
LucianLondon, 1600
Die junge Frau stand an der Straßenecke, ein starres Lächeln auf den Lippen. Die Nacht war kalt und dunkel, und sie fröstelte. Irgendwo da draußen in der Dunkelheit trieb sich ein Mörder herum. Er hatte bereits zwei Frauen umgebracht, das wusste sie. Sie hatte Thomas angefleht, sie heute Abend nicht hinauszuschicken, aber er hatte sie brutal ins Gesicht geschlagen und zur Tür hinausgestoßen. Sie verschränkte die Arme vor der Brust und bemühte sich verzweifelt, den Eindruck zu erwecken, als hätte sie Spaß an dem, was sie tat.
Ein Mann kam die Straße herauf. Ihr stockte der Atem, und ihr Herz klopfte laut. Er trug einen dunklen Mantel und einen Hut und schwenkte einen Stock in der Hand. Er schien der Oberschicht zu entstammen und in diesem Elendsviertel der Stadt Zerstreuung zu suchen. Die Frau warf sich in eine verführerische Pose und wartete. Der Mann ging direkt an ihr vorbei. Sie wusste, dass Thomas sie verprügeln würde, wenn sie den Fremden nicht ansprach und anzulocken versuchte, aber sie brachte es einfach nicht fertig.
Plötzlich blieb der Mann stehen und drehte sich um. Er umkreiste sie langsam und musterte sie von oben bis unten, als wäre sie ein Stück Fleisch. Sie versuchte ihn anzulächeln, aber irgendetwas an ihm jagte ihr Angst ein. Er zog ein Bündel Geldscheine aus der Tasche und hielt es ihr vor die Nase. Sein Lächeln wirkte bösartig, als wüsste er, dass sie Angst hatte. Er zeigte mit seinem Stock auf die Hintergasse.
Sie ging mit ihm. Es widerstrebte ihr, aber sie hatte ebenso viel Angst davor, ohne Geld zu Thomas zurückzukommen, wie davor, mit dem Fremden zu gehen.
Er war brutal und zwang sie dort in der Gasse zu allen möglichen Dingen. Er fügte ihr absichtlich Schmerzen zu, und sie ließ es über sich ergehen, weil sie wusste, dass ihr nichts anderes übrig blieb. Kaum war er fertig, schubste er sie auf den Boden und trat mit der Spitze seines eleganten Schuhs nach ihr. Als sie aufblickte und die glatte Klinge in seiner Hand sah, wusste sie, dass er der Mörder war. Zum Schreien blieb keine Zeit. Sie würde sterben.
Da erschien unvermittelt ein anderer Mann hinter ihrem Mörder. Er schien ihr das schönste männliche Wesen, das sie je gesehen hatte, groß und breitschultrig, mit langem, dunklem Haar und eiskalten schwarzen Augen. Er tauchte wie aus dem Nichts auf, so nah bei ihrem Angreifer, dass sie sich nicht vorstellen konnte, wie er das geschafft hatte, ohne von ihr oder dem Mörder gesehen worden zu sein. Der Mann streckte einfach seine Hände aus, packte den Mörder am Kragen und drückte zu.
Lauf! Lauf weg! Sie hörte die Worte klar und deutlich in ihrem Kopf und zögerte nicht einmal lange genug, um ihrem Retter zu danken. Sie rannte davon, so schnell sie konnte.
Lucian wartete, bis er sicher war, dass sie seinem Befehl gehorcht hatte, bevor er sich über den Hals des Mörders beugte. Es war unumgänglich, dass er das Blut seines Opfers trank und eindeutige Beweise für Gabriel zurückließ.
»Hier also finde ich dich, genau, wie ich es erwartet hatte, Lucian. Du kannst dich nicht vor mir verstecken«, hörte er Gabriels leise Stimme in seinem Rücken.
Lucian ließ den Leichnam zu Boden fallen. Im Lauf der vielen, endlos langen Jahre war das Ganze zu einer Art Katz-und-Maus-Spiel geworden, das niemand außer ihnen beherrschte. Sie kannten einander so gut, hatten ihre Kämpfe so oft einträchtig ausgefochten, dass sie ahnten, was der andere dachte, noch bevor es diesem selbst bewusst war. In den vergangenen Jahren hatten sie einander viele nahezu tödliche Wunden zugefügt, nur um voneinander abzulassen und in der Erde Heilung zu finden.
Lucian drehte sich mit einem langsamen, unfrohen Lächeln, das die harten Linien seines Mundes milderte, zu seinem Zwillingsbruder um. »Du siehst müde aus.«
»Diesmal warst du zu gierig, Lucian. Du hast deine Beute getötet, bevor du dich an ihr sättigen konntest.«
»Vielleicht war es ein Fehler«, gab Lucian leise zu, »aber mach dir um mich keine Sorgen. Ich bin mehr als imstande, mich mit frischem Blut zu versorgen. Niemand kann mich besiegen, nicht einmal mein Bruder, der mir einmal geschworen hat, mir diesen kleinen Gefallen zu tun.«
Gabriel schlug schnell und gnadenlos zu, genau wie Lucian es erwartet hatte. Und wieder fochten sie einen tödlichen Kampf aus, einen Kampf, den sie in vielen Jahrhunderten eingeübt hatten.
LucianParis, Gegenwart
Gabriel beugte sich angriffslustig vor. Hinter ihm beobachtete seine Gefährtin aus bekümmerten Augen den hochgewachsenen, eleganten Mann, der langsam näher kam. Er sah aus wie das, was er war, ein dunkles, gefährliches Raubtier. Seine schwarzen Augen funkelten bedrohlich. Augen des Todes. Er bewegte sich mit animalischer Anmut, fließend und geschmeidig.
»Bleib zurück, Lucian«, warnte Gabriel ihn leise. »Du wirst meine Gefährtin nicht in Gefahr bringen.«
»Dann musst du tun, was du mir vor vielen Jahrhunderten geschworen hast. Du musst mich vernichten.« Die Stimme war samtweich und zart wie ein Lufthauch, sanft und doch gebieterisch.
Gabriel spürte den unterschwelligen Zwang, der auf ihn ausgeübt wurde, noch während er mit einem Satz auf seinen Bruder losging. Das verzweifelte »Nein!« seiner Gefährtin gellte ihm in den Ohren, als er in letzter Sekunde mit den Krallen seiner Hand die Kehle seines Zwillingsbruders aufriss. Erst in diesem Moment erkannte er, dass Lucian beide Arme weit ausgebreitet hatte, als würde er den tödlichen Schlag willkommen heißen.
Kein Vampir würde so etwas je tun. Niemals! Die Untoten kämpften bis zum letzten Atemzug gegen alles und jeden in ihrer Nähe. Das eigene Leben zu opfern, entsprach nicht dem Wesen eines Vampirs.
Die Erkenntnis kam zu spät. Scharlachrote Blutstropfen spritzten aus der Wunde. Gabriel versuchte seinen Bruder zu erreichen, aber Lucians Macht war zu groß. Gabriel war außerstande sich zu rühren und sah sich durch Lucians Willen gezwungen, wie angewurzelt stehen zu bleiben. Seine Augen weiteten sich vor Überraschung. Lucian hatte so viel Macht. Gabriel war einer vom alten Stamm und mächtiger als fast jeder andere auf Erden – und Lucian ebenbürtig, hätte er bis zu diesem Augenblick gesagt.
»Du musst dir von uns helfen lassen«, sagte Francesca, Gabriels Gefährtin, leise. Ihre Stimme war kristallklar und begütigend. Sie war eine große Heilerin. Wenn jemand Lucians Tod verhindern konnte, dann sie. »Ich weiß, was du vorhast. Du willst es hier und jetzt zu Ende bringen.«
Lucians weiße Zähne blitzten. »Gabriel hat jetzt dich und ist dadurch in Sicherheit. Bisher war das meine Aufgabe, aber jetzt ist sie beendet. Ich brauche Ruhe.«
Blut tränkte seine Kleider und lief an seinen Armen hinunter. Er versuchte nicht, es zu stillen, stand einfach nur da, groß und sehr aufrecht. Kein Vorwurf lag in seinen Augen oder seiner Stimme.
Gabriel schüttelte den Kopf. »Du hast es für mich getan. Vierhundert Jahre lang hast du mich getäuscht. Du hast mich vor dem Töten bewahrt, vor dem Weg auf die dunkle Seite. Warum? Warum hast du auf diese Weise dein Seelenheil aufs Spiel gesetzt?«
»Ich wusste, dass irgendwo eine Gefährtin auf dich wartet. Jemand, der es wissen musste, teilte es mir vor langer Zeit mit, und ich wusste, dass er mir keine Unwahrheit sagen würde. Du hast deine Empfindungen nicht so schnell verloren wie ich. Bei dir hat es Jahrhunderte gedauert. Ich war noch sehr jung, als ich aufhörte, Gefühle zu haben. Aber du hast deinen Geist mit meinem verbunden, und so konnte ich deine Lebensfreude teilen, konnte mit deinen Augen sehen. Du hast mir bewusst gemacht, was ich selbst niemals haben würde.« Lucian taumelte.
Gabriel, der nur darauf gewartet hatte, dass Lucian schwächer werden würde, nutzte diesen Moment aus, um zu seinem Bruder zu springen und mit seiner Zunge über die klaffende Wunde, die er geschlagen hatte, zu lecken und sie zu verschließen.
Seine Gefährtin war an seiner Seite. Sehr behutsam nahm sie Lucians Hand in ihre. »Du glaubst, dass dein Dasein keinen Sinn mehr hat.«
Lucian schloss müde die Augen. »Über zweitausend Jahre lang habe ich gejagt und getötet, Schwester. Meine Seele ist ausgehöhlt. Wenn ich jetzt nicht gehe, bin ich später vielleicht nicht mehr in der Lage dazu, und dann wäre mein geliebter Bruder gezwungen, zumindest den Versuch zu machen, mich zu vernichten. Es wäre keine leichte Aufgabe. Er darf sich nicht in Gefahr bringen. Ich habe meine Pflicht getan. Lasst mich in Frieden ruhen.«
»Es gibt eine andere«, sagte Francesca leise zu ihm. »Sie ist nicht wie wir. Sie ist eine Sterbliche. Zur Zeit ist sie noch jung und leidet schrecklich. Ich kann dir nur sagen, dass ihr, wenn du sie nicht findest, ein Leben von solcher Qual und Verzweiflung bevorsteht, wie nicht einmal wir mit all unserem Wissen es uns ausmalen können. Für sie musst du leben. Für sie musst du aushalten.«
»Willst du damit sagen, dass es eine Gefährtin für mich gibt?«
»Ja, es gibt sie und sie braucht dich sehr.«
»Ich bin kein sanftmütiger Mann. Ich habe zu lange getötet, um mir ein anderes Dasein vorstellen zu können. Eine Sterbliche an mich zu binden wäre, als würde man sie dazu verurteilen, mit einem Monster zu leben.« Obwohl er diese Einwände erhob, wehrte Lucian sich nicht, als Gabriels Gefährtin begann, seine tiefe Wunde zu versorgen. Gabriel füllte den Raum mit dem Duft wohltuender Kräuter und stimmte den Gesang der Heilung an, der so alt wie die Zeit selbst war.
»Ich werde dich jetzt heilen, mein Bruder«, sagte Francesca sanft. »Das Ungeheuer, für das du dich hältst, wird imstande sein, die Frau vor den Monstern zu beschützen, die sie sonst zerstören würden.«
Gabriel ritzte eine Ader an seinem Handgelenk auf und presste die offene Wunde an den Mund seines Zwillingsbruders. »Ich biete dir mein Leben freiwillig gegen deines an. Nimm, was du brauchst, um zu genesen. Wir werden dich tief in der Erde ruhen lassen und über dich wachen, bis du deine Kraft wiedergewonnen hast.«
»Deine erste Pflicht gilt deiner Gefährtin, Lucian«, erinnerte Francesca ihn freundlich. »Dir bleibt nichts anderes übrig, als sie zu finden und zu beschützen.«
Jaxon, fünf Jahre altFlorida, USA
»Guck mal, Onkel Tyler«, rief Jaxon Montgomery stolz und winkte von dem hohen Holzturm, auf den sie gerade geklettert war.
»Du spinnst, Matt.« Russell Andrews schüttelte den Kopf und schirmte seine Augen gegen die Sonne ab, als er auf den Nachbau eines hohen Gerüstes starrte, wie es von der Navy-Spezialeinheit SEAL für die Ausbildung von Rekruten verwendet wurde. »Jaxx kann sich den Hals brechen, wenn sie da runterfällt.« Er blickte zu der zierlichen Frau, die auf einem Liegestuhl lag und ihren neugeborenen Sohn knuddelte. »Was sagst du dazu, Rebecca? Jaxx ist gerade mal fünf, und Matt lässt sie das Training für Spezialeinheiten absolvieren.«
Rebecca Montgomery lächelte geistesabwesend und sah ihren Ehemann an, als wollte sie wissen, welche Meinung er dazu hatte.
»Jaxon ist phantastisch«, sagte Matt sofort, während er nach der Hand seiner Frau griff und sie an seine Lippen zog. »Sie liebt diesen Kram. Sie macht so etwas praktisch, seit sie laufen kann.«
Tyler Drake winkte dem kleinen Mädchen zu, das ihn gerufen hatte. »Ich weiß nicht, Matt. Vielleicht hat Russell Recht. Sie ist so klein. In Aussehen und Statur schlägt sie nach Rebecca.« Er grinste. »Natürlich haben wir in der Hinsicht Glück gehabt. Alles andere hat sie von dir. Sie ist ein verwegener kleiner Draufgänger, genau wie ihr Daddy.«
»Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist«, sagte Russell stirnrunzelnd. Er konnte seine Augen nicht von dem Kind lassen. Seine Kehle war wie zugeschnürt. Seine eigene kleine Tochter war sieben, und er würde sie niemals auch nur in die Nähe des Turms lassen, den seine Kameraden Matt Montgomery und Tyler Drake in Matts Garten aufgestellt hatten. »Weißt du, Matt, man kann ein Kind auch zu schnell erwachsen werden lassen. Jaxon ist immer noch ein Kleinkind.«
Matt lachte. »Dieses ›Kleinkind‹ kann Frühstück für ihre Mutter machen und es ihr im Bett servieren und dem Kleinen die Windeln wechseln. Sie kann seit ihrem dritten Lebensjahr lesen, und damit meine ich, richtig lesen. Sie liebt körperliche Herausforderungen. Auf dem Übungsplatz gibt es kaum etwas, das sie nicht schafft. Ich habe sie im Kampfsport unterrichtet, und Tyler macht mit ihr Überlebenstraining. Sie findet das alles ganz toll.«
Russells Miene verfinsterte sich. »Ich fasse es nicht, dass du Matt auch noch ermutigst, Tyler. Er hört auf keinen anderen als auf dich. Die Kleine vergöttert euch beide, und keiner von euch hat auch nur einen Funken Gespür für ihre Bedürfnisse.« Mannhaft verkniff er sich die Bemerkung, dass Rebecca als Mutter eine Niete war. »Ich hoffe stark, dass du sie nicht im Ozean schwimmen lässt.«
»Möglicherweise hat Russell Recht, Matt.« Tyler klang ein wenig besorgt. »Jaxon ist eine Kämpfernatur mit dem Herzen einer Löwin, aber vielleicht muten wir ihr zu viel zu. Und ich hatte keine Ahnung, dass du sie für Rebecca kochen lässt. Das könnte gefährlich sein.«
»Irgendjemand muss es machen.« Matt zuckte mit seinen breiten Schultern. »Jaxon weiß, was sie tut. Und sie weiß genau, wer sich um Rebecca kümmern muss, wenn ich nicht zu Hause bin. Noch dazu haben wir jetzt den kleinen Mathew Junior. Und zu deiner Information, Jaxon schwimmt wie ein Fisch.«
»Hör dich doch an!«, rief Russell erzürnt. »Jaxon ist ein Kind – eine Fünfjährige! Rebecca! Um Himmels willen, du bist schließlich ihre Mutter.« Wie gewöhnlich reagierte keiner der beiden auf etwas, das sie nicht hören wollten. Matt behandelte Rebecca wie eine Porzellanpuppe, und weder er noch seine Frau schenkten ihrer Tochter viel Beachtung. Aufgebracht wandte sich Russell an Matts besten Freund. »Tyler, sag doch auch etwas!«
Tyler nickte langsam. »Du solltest sie nicht zu sehr unter Druck setzen, Matt. Jaxon ist ein außergewöhnliches Kind, aber eben ein Kind.« Seine Augen ruhten auf dem kleinen Mädchen, das ihnen strahlend zuwinkte. Ohne ein weiteres Wort stand er auf und schlenderte zu dem Turm, wo das Mädchen immer noch nach ihm rief.
Jaxon, sieben Jahre altFlorida, USA
Die Schreie, die aus dem Zimmer ihrer Mutter kamen, waren grauenhaft. Rebecca war vor Kummer und Schmerz wie von Sinnen. Bernice, Russell Andrews’ Ehefrau, hatte ihr vom Arzt Beruhigungsmittel verschreiben lassen. Jaxx hielt sich die Ohren zu, um die entsetzlichen Klagelaute zu dämpfen. Mathew Junior brüllte schon seit einer ganzen Weile in seinem Zimmer, aber es war offensichtlich, dass seine Mutter nicht nach ihm sehen würde. Jaxon wischte sich die Tränen ab, die unablässig über ihr Gesicht strömten, hob das Kinn und lief über den Flur in das Zimmer ihres Bruders.
»Nicht weinen, Mattie«, murmelte sie liebevoll. »Du musst keine Angst haben. Ich bin ja hier. Mommy ist wegen Daddy sehr unglücklich, aber wenn wir fest zusammenhalten, schaffen wir das. Du und ich. Wir müssen Mommy helfen.«
Onkel Tyler war mit zwei anderen Offizieren zu ihnen nach Hause gekommen, um Rebecca mitzuteilen, dass ihr Ehemann nicht wiederkommen würde. Irgendetwas war bei ihrer letzten Mission furchtbar schiefgegangen. Seither hatte Rebecca nicht mehr aufgehört zu schreien.
Jaxon, acht Jahre alt
»Wie geht es ihr heute, Süße?«, fragte Tyler leise und bückte sich, um Jaxon einen Kuss auf die Wange zu geben. Er legte einen Blumenstrauß auf den Tisch und wandte sich dem kleinen Mädchen zu, das er seit dem Tag ihrer Geburt liebte.
»Sie hat keinen besonders guten Tag gehabt«, gab Jaxon widerstrebend zu. Sie sagte »Onkel« Tyler immer die Wahrheit über ihre Mutter, aber sonst niemandem, nicht einmal »Onkel« Russell. »Ich glaube, sie hat wieder zu viele von diesen Tabletten genommen. Sie mag nicht aufstehen, und wenn ich ihr etwas über Mathew erzählen will, starrt sie mich bloß an. Er braucht endlich keine Windeln mehr, und ich bin so stolz auf ihn, aber sie redet kein Wort mit ihm. Wenn sie ihn in den Arm nimmt, drückt sie ihn so fest, dass er anfängt zu weinen.«
»Ich muss dich etwas fragen, Jaxx«, sagte Onkel Tyler. »Es ist sehr wichtig, dass du mir ehrlich antwortest. Deine Mutter ist die meiste Zeit krank, und du musst dich um Mathew und den Haushalt kümmern und zur Schule gehen. Ich habe daran gedacht, dass ich vielleicht einziehen und ein bisschen helfen könnte.«
Jaxons Augen leuchteten auf. »Bei uns einziehen? Aber wie denn?«
»Ich könnte deine Mutter heiraten und dein Vater werden. Natürlich nicht dein richtiger Daddy wie Matt, aber dein Stiefvater. Ich glaube, es würde deiner Mutter helfen, und ich wäre gern für dich und den kleinen Mathew da. Aber nur, wenn du es willst, Süße. Sonst rede ich gar nicht erst mit Rebecca darüber.«
Jaxon lächelte ihn an. »Deshalb hast du also die Blumen mitgebracht! Glaubst du, sie sagt ja?«
»Ich denke, ich kann sie überreden. Du kommst doch nur hier raus, wenn ich dich zum Training mitnehme. Du wirst übrigens langsam ein richtiger Scharfschütze.«
»Scharfschützin, Onkel Tyler«, verbesserte Jaxon ihn mit einem spontanen übermütigen Grinsen. »Und neulich im Karatekurs habe ich Don Jacobson in den Hintern getreten.«
Jaxon ertappte sich immer nur dann beim Lachen, wenn Onkel Tyler sie auf den Trainingsplatz der Spezialeinheiten mitnahm und sie Soldaten spielten. Mädchen oder nicht, Jaxon wurde allmählich ein ernst zu nehmender Gegner, und das erfüllte sie mit Stolz.
Jaxon, dreizehn Jahre alt
Das Buch war ein Thriller und passte gut zu der stürmischen Nacht. Äste schlugen ans Fenster, und Regen prasselte aufs Dach. Als Jaxon das Geräusch zum ersten Mal hörte, glaubte sie, sie hätte es sich eingebildet, weil das Buch so spannend war. Dann erstarrte sie, und ihr Herz fing an zu hämmern. Er machte es schon wieder. Sie wusste es. So leise wie möglich kroch sie aus dem Bett und öffnete ihre Zimmertür.
Die Geräusche, die aus dem Zimmer ihrer Mutter kamen, waren gedämpft, aber sie konnte sie trotzdem hören. Ihre Mutter weinte und flehte. Und dann war da dieses unverkennbare Geräusch, das Jaxon nur zu gut kannte. Sie nahm Karateunterricht, solange sie sich erinnern konnte, und sie wusste, wie es sich anhörte, wenn jemand geschlagen wurde. Sie lief zum Zimmer ihres Bruders, um zuerst nach ihm zu schauen. Zu ihrer Erleichterung schlief er tief und fest. Wenn Tyler so war wie jetzt, hielt sie Mathew möglichst von ihm fern. Manchmal schien er ihren Bruder richtig zu hassen. Seine Augen wurden kalt und böse, wenn sie auf dem kleinen Jungen ruhten, vor allem, wenn Mathew weinte. Tyler mochte es nicht, wenn jemand weinte, und Mathew war noch so klein, dass er über jeden noch so winzigen Kratzer weinte – oder wenn Tyler ihn finster anstarrte.
Jaxon holte tief Luft und stellte sich vor die Schlafzimmertür. Sie konnte es einfach nicht fassen, wie Tyler ihre Mutter und Mathew behandelte. Sie liebte Tyler. Sie hatte ihn schon immer geliebt. Er verbrachte ganze Stunden damit, aus Jaxon einen Soldaten zu machen, und alles an ihr sprach auf das körperliche Training an. Ihr gefielen die schwierigen Aufgaben, die er ihr stellte. Sie konnte in Rekordzeit auf nahezu unbezwingbare Klippen klettern und durch schmale Tunnel rutschen. Draußen auf dem Schießstand oder beim Nahkampf war sie in ihrem Element. Jaxon konnte mittlerweile sogar Tylers Spur aufnehmen, etwas, das nur die wenigsten Männer in seiner Einheit schafften. Darauf war sie besonders stolz. Tyler schien viel Freude an ihr zu haben und behandelte sie immer sehr liebevoll. Sie hatte geglaubt, dass er ihre Familie mit derselben unverbrüchlichen Treue liebte wie sie. Jetzt war sie völlig durcheinander und sehnte sich nach einer Mutter, mit der sie über all das hätte reden können. Jaxon kam allmählich dahinter, dass sich hinter dem unbekümmerten Charme ihres Stiefvaters das zwanghafte Bedürfnis verbarg, seine Welt und die Menschen, die in ihr lebten, zu beherrschen. Rebecca und Mathew entsprachen nicht seinen hohen Anforderungen, und das ließ er die beiden bitter büßen.
Jaxon holte tief Luft und stieß die Tür lautlos einen Spalt weit auf. Sie stand völlig regungslos da, wie Tyler es ihr für gefährliche Situationen beigebracht hatte. Tyler drückte ihre Mutter an die Wand und quetschte ihr mit einer Hand die Kehle zu. Rebeccas Augen quollen hervor und waren vor Entsetzen weit aufgerissen. »Es war so leicht, Rebecca. Er hielt sich immer für so gut, dachte, niemand könnte ihm etwas anhaben, aber ich habe es geschafft. Und jetzt habe ich dich und seine Kinder, genau wie ich es ihm gesagt habe. Ich stand über ihm und sah zu, wie er starb, und ich lachte. Er wusste, was ich mit dir machen würde – dafür habe ich gesorgt. Du warst schon immer so nutzlos. Ich sagte ihm, ich würde dir eine Chance geben, aber du hast es einfach nicht geschafft, stimmt’s? Er hat dich genauso verwöhnt, wie es vor ihm dein Daddy gemacht hat. Rebecca, die kleine Prinzessin. Du hast immer auf uns herabgeschaut. Du hast immer geglaubt, du wärst etwas Besseres als wir, nur wegen all deines Geldes.« Er beugte sich so weit vor, dass seine Stirn an Rebeccas stieß, und feiner Speichel besprühte ihr Gesicht, als er jedes einzelne Wort hasserfüllt hervorstieß. »All dein tolles Geld würde jetzt an mich fallen, wenn dir etwas zustieße, ist es nicht so?« Er schüttelte sie wie eine Stoffpuppe, was bei einer so zarten Erscheinung wie Rebecca nicht schwer war.
In diesem Moment wusste Jaxon, dass Tyler Rebecca umbringen würde. Er hasste sie, und er hasste Mathew. Obwohl sie seine Worte aus dem Zusammenhang gerissen gehört hatte, war Jaxon intelligent genug, um zu erfassen, dass Tyler offensichtlich ihren Vater ermordet hatte. Beide waren Navy-SEALs und bestimmt nicht leicht zu töten, aber ihr Vater hatte mit Sicherheit nicht erwartet, von seinem besten Freund verraten zu werden.
Sie konnte sehen, dass Rebecca mit Blicken versuchte, sie zum Gehen zu bewegen. Rebecca hatte Angst um Jaxon, Angst, dass Tylers Zorn sich gegen sie richten würde, wenn sie sich einmischte.
»Daddy?« Jaxon sprach das Wort bewusst unbefangen in die unheilschwangere Stille. »Irgendwas hat mich geweckt. Ich habe schlecht geträumt. Kannst du ein bisschen bei mir am Bett sitzen? Es macht dir doch nichts aus, Mommy?«
Es dauerte ein paar Augenblicke, ehe die Anspannung aus Tylers starren Schultern wich. Seine Finger lockerten langsam ihren Griff um Rebeccas Hals. Sie bekam wieder Luft in die Lungen, kauerte sich aber immer noch wie gelähmt vor Entsetzen an die Wand und versuchte, den Husten zu unterdrücken, der in ihrer rauen Kehle kratzte. Ihr Blick ruhte verzweifelt auf Jaxon und warnte ihre Tochter wortlos vor der drohenden Gefahr. Tyler war völlig verrückt, ein Killer, und es gab kein Entkommen vor ihm. Er hatte sie gewarnt, was passieren würde, wenn sie versuchte, ihn zu verlassen, und Rebecca wusste, dass sie nicht genug Kraft hatte, um ihre Kinder zu retten. Nicht einmal den kleinen Mathew.
Jaxon lächelte Tyler kindlich vertrauensvoll an. »Tut mir leid, dass ich gestört habe, aber ich habe wirklich etwas gehört, und der Traum war so real. Wenn du bei mir bist, fühle ich mich immer sicher.« Ihr Magen krampfte sich bei dieser furchtbaren Lüge schmerzhaft zusammen, und ihre Handflächen waren schweißnass, und doch gelang es ihr, überzeugend die großäugige Unschuld zu spielen.
Tyler warf Rebecca über die Schulter einen harten Blick zu, als er Jaxons Hand nahm. »Geh zu Bett, Rebecca. Ich setze mich zu Jaxon. Gott weiß, dass du es nie getan hast, nicht einmal, wenn sie krank war.« Seine Hand war kräftig, und sie konnte immer noch die Anspannung in seinem Inneren spüren, aber Jaxon fühlte ebenso die Wärme, die er immer ausstrahlte, wenn sie zusammen waren. Was ihren Stiefvater auch sonst beherrschen mochte, schien zu verschwinden, sowie er körperlichen Kontakt zu Jaxon hatte.
Während der nächsten zwei Jahre versuchten Jaxon und Rebecca ihre wachsende Unruhe wegen Tylers geistiger Verfassung vor Mathew Junior zu verbergen, indem sie das Kind so oft wie möglich von Tyler fernhielten. Der Junge schien wie eine Art Katalysator zu wirken und den Mann, der früher einmal so warmherzig gewesen war, völlig zu verändern. Tyler beklagte sich häufig darüber, dass Mathew ihn anstarrte, also gewöhnte Mathew sich an, den Blick abzuwenden, wenn sein Stiefvater mit ihm in einem Raum war. Tyler sah den Jungen immer nur kalt und unbewegt oder aber hasserfüllt an. Er behandelte Rebecca, als wäre sie eine Fremde. Nur Jaxon schien es zu gelingen, Zugang zu ihm zu finden. Diese schreckliche Verantwortung machte ihr Angst. Sie konnte sehen, wie das Böse in »Onkel« Tyler immer mehr Macht gewann.
Nach einer Weile überließ Rebecca es völlig ihrer Tochter, mit der Situation fertig zu werden. Sie blieb in ihrem Zimmer und schluckte die Tabletten, mit denen Tyler sie versorgte. Wenn Jaxon ihr zu sagen versuchte, dass sie Angst habe, Tyler könne Mathew etwas antun, zog Rebecca sich die Decke über den Kopf und wiegte sich leise wimmernd hin und her.
In ihrer Verzweiflung versuchte Jaxon, Russell Andrews und den anderen Mitgliedern aus Tylers Team begreiflich zu machen, dass irgendetwas mit ihm nicht stimmte. Die Männer lachten bloß und erzählten Tyler, was sie über ihn gesagt hatte. Er war so wütend, dass Jaxon überzeugt war, er würde die gesamte Familie umbringen. Obwohl sie diejenige war, die mit seinen Kollegen gesprochen hatte, gab er Rebecca die Schuld und behauptete immer wieder, sie hätte Jaxon gezwungen, Lügen über ihn zu verbreiten. Er schlug Rebecca so übel zusammen, dass Jaxon sie ins Krankenhaus bringen wollte, aber Tyler weigerte sich. Rebecca musste wochenlang im Bett bleiben und konnte danach das Haus nicht mehr verlassen.
Jaxon verbrachte einen Großteil ihrer Zeit damit, eine Phantasiewelt für Tyler zu schaffen und sich den Anschein zu geben, als wäre sie der Meinung, dass bei ihnen zu Hause alles in Ordnung war. Sie achtete darauf, dass ihr Bruder ihm nicht in die Quere kam, und lenkte seinen Zorn von ihrer Mutter ab, so gut sie konnte. Sie verbrachte immer mehr Zeit mit Tyler auf dem Trainingsgelände und lernte alles, was es über Waffen, Selbstverteidigung, Verstecken und Spurenlesen zu wissen gab. Es waren die einzigen Gelegenheiten, bei denen sie wusste, dass ihre Mutter und ihr Bruder wirklich in Sicherheit waren.
Die anderen SEALs beteiligten sich bereitwillig an ihrer Ausbildung, und Tyler wirkte in diesem Umfeld völlig normal. Rebecca hatte sich so sehr aus der Wirklichkeit zurückgezogen, dass Jaxon sich nicht traute, mit Mathew wegzulaufen, da sie ihre Mutter hätte zurücklassen müssen. Sie war überzeugt, dass Tyler Rebecca ohne zu zögern töten würde.
Klein-Mathew und Jaxon hatten ihre eigene geheime Welt, die sie mit keinem zu teilen wagten. Sie lebten in ständiger Angst.
Jaxon, ihr fünfzehnter Geburtstag
Plötzlich wusste sie es, ganz unvermittelt, als sie in ihrer Klasse saß. Sie konnte sie fühlen, diese überwältigende Vorahnung von Gefahr. Ihr war bewusst, dass sie um Atem rang, aber ihre Lungen funktionierten nicht. Jaxon rannte aus dem Klassenzimmer und stieß dabei Bücher und Hefte von ihrem Tisch, sodass alles hinter ihr auf den Boden flatterte. Der Lehrer rief ihr etwas nach, aber Jaxon beachtete ihn nicht, sondern lief einfach weiter. Der Wind schien an ihr vorbeizufegen, als sie durch die Straßen hetzte und jede Abkürzung nahm, die ihr einfiel.
Als sie sich dem Haus näherte, wurde Jaxon abrupt langsamer. Ihr Puls raste. Die Haustür stand weit offen, wie eine Einladung zum Hereinkommen. In ihrem Inneren wurde es dunkel. Sie spürte den fast unwiderstehlichen Drang stehen zu bleiben und umzukehren, empfand ihn so stark, dass sie einen Moment lang wie gelähmt war. Mathew war heute nicht zur Schule gegangen, weil er sich nicht wohlfühlte. Der kleine Mathew, der ihrem Vater so ähnlich war und Tyler von einem Moment auf den anderen in rasende Wut versetzen konnte. Ihr Mathew.
Jaxons Mund war trocken und der Geschmack von Furcht so ausgeprägt, dass sie Angst hatte, sich übergeben zu müssen. Ihr Magen krampfte sich zusammen, und das Hämmern in ihrem Kopf verstärkte sich, bis es beinahe ihre gut geschulten Instinkte übertönte. Sie zwang sich, ihren rechten Fuß zu bewegen, einen Schritt zu machen. Es fiel ihr so schwer, als würde sie durch Treibsand gehen. Sie musste ins Haus hineinschauen. Sie musste es tun. Die Notwendigkeit, es zu tun, war stärker als ihr Selbsterhaltungstrieb. Ein Geruch wehte ihr entgegen, ein Geruch, der ihr fremd war, aber ihr Instinkt sagte ihr sofort, was es war. »Mom?« Sie sprach das Wort in lautem Flüsterton aus, als wäre es ein Talisman, der ihre Welt wieder in Ordnung bringen und die Wahrheit und das Wissen, das in ihrem Inneren schrie, vertreiben könnte.
Sie schaffte es, ihren Körper vorwärtszubewegen, indem sie sich an die Hausmauer klammerte und Stück für Stück weiterschob. Sie kämpfte gegen alle ihre Instinkte an, gegen das Widerstreben, das zu sehen, was sie dort drinnen erwartete. Eine Hand fest an ihren Mund gepresst, um nicht zu schreien, wandte sie langsam den Kopf und spähte vorsichtig ins Haus.
Das Wohnzimmer sah genau wie immer aus. Vertraut, tröstlich. Aber nichts konnte ihre Angst beschwichtigen. Stattdessen empfand sie blankes Entsetzen.
Jaxon zwang sich weiterzugehen. Sie sah einen verschmierten hellroten Blutstreifen auf der Klinke von Mathews Zimmertür. Ihr Herz schlug so schnell, dass sie Angst hatte, es könnte zerspringen. Jaxon schob sich weiter an der Wand entlang, bis sie direkt vor Mathews Zimmer stand. Sie sprach ein inbrünstiges Gebet, als sie langsam die Tür aufstieß.
Der grauenhafte Anblick sollte sich für immer unauslöschlich in ihr Gedächtnis einprägen. Die Wände waren mit Blut bespritzt, die Bettdecken in Blut getränkt. Mathew lag dort der Länge nach auf der Seite und sein Kopf hing im rechten Winkel von der Matratze hinunter. Seine Augenhöhlen waren leer, das Lachen in seinen Augen für immer verschwunden. Sie konnte die Stichwunden an seinem Körper nicht zählen.
Jaxon betrat dass Zimmer nicht. Sie konnte es nicht. Etwas viel Stärkeres als ihr Wille hielt sie davon ab. Einen Moment lang stand sie wie erstarrt, bevor sie auf den Boden sackte, ihr Körper geschüttelt von einem stummen Schrei.
Sie war nicht da gewesen, um ihn zu beschützen, um ihn zu retten. Es wäre ihre Pflicht gewesen. Sie war die Starke, und doch hatte sie versagt, und Mathew mit seinen schimmernden Locken und seiner Liebe zum Leben hatte den endgültigen Preis bezahlt. Jaxon wollte sich nicht bewegen, glaubte nicht, dass sie dazu imstande war. Aber dann war ihr Denken wie ausgelöscht, und sie schaffte es, sich an der Wand hochzuziehen und zum Zimmer ihrer Mutter weiterzugehen. Sie wusste bereits, was sie dort vorfinden würde. Sie redete sich ein, dass sie darauf vorbereitet wäre.
Diesmal stand die Tür weit offen. Jaxon zwang sich, ins Zimmer zu schauen. Rebecca lag zusammengekrümmt auf dem Boden. Sie erkannte ihre Mutter nur an dem zerzausten blonden Haar, das sich wie eine Gloriole um den zerschmetterten Schädel ausbreitete. Der Rest ihres Körpers war bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt und voller Blut. Jaxon konnte den Blick nicht abwenden. Ihre Kehle schnürte sich schmerzhaft zusammen. Sie bekam keine Luft mehr.
Da hörte sie ein Geräusch, im Grunde nur die Andeutung eines Geräuschs, aber es reichte aus, ihr jahrelanges Training auf den Plan zu rufen. Sie machte einen Satz zur Seite und wirbelte gleichzeitig herum. Ihr Stiefvater stand vor ihr. Seine Hände und Arme waren feucht von Blut, sein Hemd mit Blutstropfen übersät. Er lächelte; sein Gesicht war heiter, und seine Augen wirkten warm und freundlich.
»Sie sind jetzt weg, Süße. Wir brauchen uns ihr Gewinsel nie mehr anzuhören.« Tyler streckte eine Hand aus, offensichtlich in der Erwartung, dass Jaxon sie nehmen würde.
Jaxon trat vorsichtig einen Schritt zurück. Sie wollte Tyler nicht beunruhigen. Offenbar war ihm nicht bewusst, dass er über und über mit Blut bespritzt war. »Ich sollte eigentlich in der Schule sein, Onkel Tyler.« Ihre Stimme klang nicht einmal in ihren eigenen Ohren unbefangen.
Seine Miene verfinsterte sich. »Du hast mich nicht mehr Onkel Tyler genannt, seit du acht Jahre alt warst. Warum sagst du nicht mehr Daddy zu mir? Deine Mutter hat dich gegen mich aufgehetzt, stimmt’s?« Er kam näher.
Jaxon blieb ganz ruhig stehen, einen arglosen Ausdruck auf ihrem Gesicht. »Niemand könnte mich je gegen dich aufhetzen. Das geht gar nicht. Und du weißt doch, dass Mom nichts von mir wissen will.«
Tyler entspannte sich sichtlich. Er war nahe genug, um sie anzufassen. Jaxon konnte das nicht zulassen; ihre mühsam aufrechterhaltene Selbstbeherrschung würde in sich zusammenbrechen, wenn er sie mit Händen berührte, an denen das Blut ihrer Familie klebte.
Sie schlug ohne Vorwarnung zu, indem sie ihm ihre Faust direkt in die Kehle rammte und ihm brutal in die Kniescheibe trat. Gleich darauf drehte sie sich um und rannte los. Sie schaute nicht zurück. Sie wagte es nicht. Tyler war darauf trainiert zu reagieren, auch wenn er verletzt war. Auf jeden Fall war sie verglichen mit ihrem Stiefvater sehr klein. Ihr Schlag mochte ihn momentan betäuben, würde ihn aber niemals außer Gefecht setzen. Mit etwas Glück hatte sie ihm mit ihrem Tritt die Kniescheibe gebrochen, aber sie bezweifelte es. Jaxon rannte durch das Haus zur Tür. Rebecca hatte es immer gefallen, im geschützten Bereich des Marinestützpunkts zu leben, und Jaxon war jetzt dankbar dafür. Sie schrie aus voller Kehle, als sie über die Straße zum Haus von Russell Andrews rannte.
Bernice, Russells Frau, kam besorgt herausgelaufen. »Was ist denn, Liebes? Hast du dir wehgetan?«
Auch Russell kam und legte einen Arm um Jaxons schmale Schultern. »Ist deine Mutter krank?« Im Grunde glaubte er nicht daran, dafür kannte er Jaxon zu gut. Sie war immer ein sehr beherrschtes Kind gewesen, das jede Lage im Griff hatte und selbst in Notfällen nicht den Kopf verlor. Wenn Rebecca krank gewesen wäre, hätte Jaxon den Arzt angerufen. Im Moment war sie so blass, dass sie wie ein Geist aussah. Grauen spiegelte sich in ihren Augen, und ihr Gesicht war verzerrt vor Entsetzen. Russell blickte über die Straße zu dem stillen Haus, dessen Tür weit offen stand. Der Wind blies, und die Luft war kalt und frisch. Aus irgendeinem Grund überlief ihn beim Anblick des Hauses eine Gänsehaut.
Russell wandte sich zur Straße um. Jaxon hielt ihn am Arm fest. »Nein, Onkel Russell, geh nicht allein dahin. Du kannst ihnen nicht mehr helfen. Sie sind tot. Ruf die Militärpolizei.«
»Wer ist tot, Jaxon?«, fragte Russell ruhig, der wusste, dass Jaxon ihn nicht belügen würde.
»Mathew und meine Mutter. Tyler hat sie getötet. Er hat Mom gesagt, dass er auch meinen Vater umgebracht hat. Er war in letzter Zeit so seltsam und so gewalttätig. Er hat Mutter und Mathew gehasst. Ich habe versucht, es euch zu sagen, aber keiner wollte mir glauben.« Jaxon vergrub das Gesicht in den Händen und schluchzte. »Ihr wolltet nicht auf mich hören. Keiner wollte auf mich hören.« Ihr war schlecht, und im Geist sah sie immer wieder die Szene im Haus vor sich, so intensiv, dass sie glaubte, den Verstand zu verlieren. »Da war so viel Blut! Er hat Mathew die Augen herausgedrückt. Wie konnte er so etwas tun? Mathew war doch noch ein kleiner Junge!«
Russell drückte sie Bernice in die Arme. »Kümmere dich um sie, Schatz. Sie steht unter Schock.«
»Er hat alle getötet, meine ganze Familie. Er hat mir alles genommen. Ich konnte sie nicht retten«, sagte Jaxon leise.
Bernice drückte sie liebevoll an sich. »Keine Angst, Jaxon, jetzt bist du bei uns.«
Jaxon, sechzehn Jahre alt
»Hallo, meine Schöne.« Don Jacobson beugte sich vor und zerzauste Jaxons wilde blonde Mähne. Er gab sich Mühe, nicht zu besitzergreifend zu wirken. Jaxon zerriss jeden in der Luft, der versuchte, ihr näher zu kommen. Sie hatte um sich herum eine Mauer errichtet, die so hoch war, dass niemand in ihre Welt einzudringen vermochte. Seit dem Tod ihrer Familie hatte Don sie nur lachen sehen, wenn sie mit Bernice und Andrew Russell und ihrer Tochter Sabrina zusammen war. Sabrina war zwei Jahre älter als Jaxon und über die Frühlingsferien nach Hause gekommen. »Wohin so eilig? Unser Master-Chief hat mir erzählt, dass deine Zeiten besser als die seiner neuen Rekruten sind.«
Jaxon lächelte zerstreut. »Meine Zeiten sind jedes Mal, wenn er eine neue Gruppe bekommt, besser als die der Rekruten. Ich trainiere mein ganzes Leben lang, und ich muss wohl gut sein, sonst hätte Master-Chief mich längst rausgeschmissen. Ein Jammer, dass bei den SEALs keine Frauen zugelassen sind. Es ist das Einzige, wofür ich mich eigne. Ich habe vorzeitig meinen Schulabschluss gemacht und jede Menge Empfehlungen fürs College bekommen, aber ich habe keine Ahnung, was ich machen soll.« Sie fuhr sich nachlässig mit einer Hand durchs Haar und zerstrubbelte es noch mehr. »Ich bin zwar jünger als die meisten anderen College-Studenten, aber ehrlich gesagt, ich fühle mich so viel älter als sie, dass ich manchmal schreien könnte.«
Don sehnte sich danach, sie in die Arme zu nehmen, sie zu trösten. »Du warst schon immer was Besonderes, Jaxx. Lass dich von den anderen nicht aus dem Konzept bringen.« Er wusste, dass ihr Problem in Wirklichkeit darin bestand, dass sie das Trauma ihrer Familientragödie nicht überwinden konnte. Wie sollte sie auch. Er bezweifelte, ob irgendjemand das schaffen würde. »Und wohin willst du jetzt?«
»Sabrina ist zu Hause, und wir wollen heute Abend ins Kino gehen. Ich habe versprochen, mich diesmal nicht zu verspäten.« Jaxon schnitt ein Gesicht. »Ich bin immer zu spät dran, wenn ich vom Training komme. Anscheinend schaffe ich es einfach nicht, rechtzeitig hier rauszukommen.« Das Trainingsgelände war der einzige Ort, an dem sie so ausgelastet war, dass sie an nichts anderes denken konnte. Sie trainierte mit vollem Körpereinsatz, um so die Dämonen eine Weile in Schach zu halten.
Jaxon hatte sich schon so lange nicht mehr sicher gefühlt, dass sie sich kaum noch erinnern konnte, wie es war, eine Nacht durchzuschlafen. Tyler Drake war immer noch irgendwo da draußen und hielt sich versteckt. Sie wusste, dass er in der Nähe war; manchmal spürte sie sogar, dass er sie beobachtete. Nur Russell glaubte ihr, wenn sie ihm das erzählte. Russell kannte sie mittlerweile. Jaxon hing nicht irgendwelchen Phantastereien nach, und sie neigte auch nicht zu Hysterie. Sie besaß einen sehr ausgeprägten sechsten Sinn, der sie jedes Mal warnte, wenn Gefahr drohte. Sie hatte jahrelang Seite an Seite mit Tyler trainiert. Wenn sie eine Spur als ihm zugehörig zuordnete, glaubte Russell Andrews ihr bedingungslos.
»Was schaut ihr euch an?«, fragte Don. »Ich habe seit einer Ewigkeit keinen guten Film mehr gesehen.« Er hoffte unverkennbar auf eine Einladung, die beiden Mädchen zu begleiten.
Jaxon schien es nicht zu bemerken. Sie zuckte die Achseln. »Ich weiß nicht. Sabrina wollte den Film aussuchen.« Ihr Herz fing an zu hämmern. Es war verrückt. Sie stand hier draußen im Freien mit einem Jungen, den sie ihr Leben lang kannte, und doch fühlte sie sich weit entfernt von allem und jedem und sehr allein. Dunkelheit breitete sich in ihrem Inneren aus, begleitet von einem namenlosen Grauen.
Don fasste sie nicht an, obwohl sie so still und blass geworden war, dass er Angst um sie hatte. »Jaxon? Fehlt dir was? Was ist los?«
»Irgendetwas stimmt nicht.« Sie flüsterte die Worte so leise, dass er sie kaum verstand.
Jaxon schoss an Don vorbei und stieß ihn zur Seite. Don, der sie in dieser Verfassung nicht allein lassen wollte, rannte ihr nach. Jaxon war immer so kühl und reserviert, dass Don kaum glauben konnte, sie so aus der Fassung geraten zu sehen. Sie warf keinen Blick in seine Richtung, sondern rannte direkt zum Haus ihrer Pflegeeltern. Nach dem Tod ihrer Mutter und ihres Bruders und dem mysteriösen Verschwinden ihres Stiefvaters hatten Russell und Bernice Andrews Jaxx aufgenommen und ihr ein liebevolles Zuhause gegeben. Russell und seine Kollegen der Spezialeinheit hatten Jaxons Training fortgesetzt, da ihnen klar war, dass sie die körperliche Betätigung brauchte, um die Erinnerungen an ihre traumatische Vergangenheit abzuschwächen. Dons Vater war Mitglied dieses Teams und sprach häufig mit seinem Sohn über die Tragödie. Niemand konnte mit absoluter Sicherheit sagen, ob Tyler Drake Matt Montgomery tatsächlich getötet hatte, wie er vor Rebecca behauptet hatte, aber es bestanden kaum Zweifel daran, dass er Rebecca und Mathew junior umgebracht hatte.
Don hatte ein mulmiges Gefühl im Magen, als er neben Jaxon herrannte. Es war nicht einfach, mit ihr mitzuhalten; er war gut in Form und viel größer als sie, aber er kam trotzdem ins Schwitzen. Jaxons Gesichtsausdruck verriet ihm, dass sie irgendetwas wusste, das er nicht wusste. Etwas Schreckliches. Er wünschte, er hätte ein Handy. Als er um eine Ecke lief, entdeckte er eine Militärpatrouille.
»He, Sie da, folgen Sie uns! Kommen Sie schon, irgendwas stimmt nicht!« Er brüllte es aus voller Überzeugung und ohne zu fürchten, er könnte sich zum Idioten machen. Wenn Jaxon Montgomery sich einer Sache sicher war, konnte man ihrem Urteil vertrauen.
In der Auffahrt blieb Jaxon abrupt stehen und starrte zur Haustür. Sie stand einen Spalt offen. Don wollte sich an ihr vorbeidrängen, aber sie hielt ihn am Arm fest. Sie zitterte. »Geh nicht da rein. Er könnte noch drinnen sein.«
Don versuchte einen Arm um sie zu legen. Er hatte Jaxon noch nie so aufgewühlt gesehen. Sie sah sehr zerbrechlich aus und krank vor Kummer. Sie stieß ihn von sich, während ihr Blick forschend durch den Garten wanderte, um das Terrain zu sondieren. »Fass mich nicht an, Don. Komm mir nicht einmal in die Nähe. Wenn er auf die Idee kommt, du könntest mir etwas bedeuten, wird er dich umbringen.«
»Du weißt doch nicht mal, was da drinnen los ist, Jaxx«, protestierte er. Aber ein Teil von ihm wehrte sich dagegen, hineinzugehen und sich zu vergewissern, ob sie Recht hatte. Etwas Böses schien von dem Haus auszugehen.
Die Militärpolizisten kamen die Auffahrt herauf. »Wehe, ihr Kids verplempert unsere Zeit! Was ist hier los? Wisst ihr, wer in dem Haus wohnt?«
Jaxon nickte. »Ich. Und die Andrews. Seien Sie vorsichtig. Ich glaube, Tyler Drake war hier. Ich glaube, er hat wieder gemordet.« Plötzlich gaben ihre Beine unter ihr nach, und sie kauerte sich auf den Rasen.
Die beiden MPs wechselten einen Blick. »Im Ernst?« Jeder hatte von Tyler Drake gehört, dem ehemaligen SEAL, der angeblich seine Familie umgebracht und sich der Verhaftung entzogen hatte und der sich immer noch irgendwo versteckt hielt. »Warum sollte er hierher zurückkommen?«