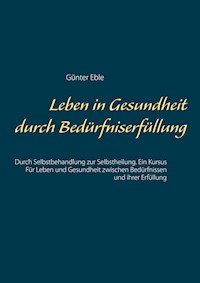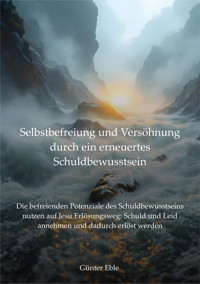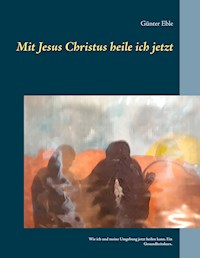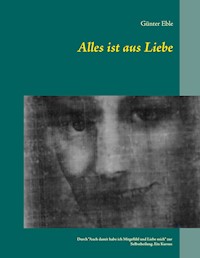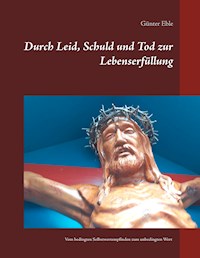
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Mich-wohl-Fühlen und Mich-wertvoll-Fühlen sind die Gradmesser für meine Lebensqualität und meine Lebenserfüllung. Zunächst sind beide Gefühle eins und undifferenziert. Sie stellen sich im Zusammenhang mit der Erfüllung von lebensdienlichen Bedürfnissen wie Nahrung, Geborgenheit, Mitgefühl, zärtlicher Kontakt u.a. ein. Bedürfnisse sind nur im Spannungsfeld von Mangelerleben und Bedürfnisstillung zu erfahren und zu erfüllen. Mangelerleben - in Form von Not, Leid, Schuld und Tod - ist lebensnotwendig. Dabei fühle ich mich aber weder wohl noch wertvoll. Deshalb versuche ich ein solches Erleben zu vermeiden. Da das aber unmöglich ist, weil ja nur über den Mangel und seine Anzeichen wie Not, Leid, Schuld und Tod mir meine unerfüllten Bedürfnisse bewusst werden, erleben ich misslingende Vermeidung als Scheitern und werte mich dafür als Versager ab. Das ist aber ungefähr so sinnvoll, wie sich für seine Körperausscheidungen zu verurteilen; was viele tatsächlich zumindest auf einer Gefühlsebene - als "schmutzig" - auch tun. Alles Mangelerleben und alle damit verbundene Not sind so notwendig wie Hunger und Durst, um mich am Leben zu halten. Von daher ist es gerecht und angemessen, mich in meiner armseligen Not genauso wertzuschätzen und so wertvoll zu fühlen, wie wenn ich mich im Wohlgefühl meiner Bedürfniserfüllung erlebe. Meine höchste Form der Wertschätzung ist die Liebe. Deshalb ist es sinnvoll, gerade in meiner Not, meiner Krankheit, meinem Leid, meinem Verlustschmerz (z.B. bei Tod) mitfühlend meine Liebe zu wecken und mich mit ihr in Kontakt zu bringen. Dadurch schaffe ich es dann immer mehr, mein Mich-wertvoll-Fühlen von den wechselnden und bedingten Lebensumständen meines Mich-wohl-Fühlens - nämlich von wechselnd erfolgreicher Bedürfniserfüllung - unabhängig zu machen. Auf diese Weise helfen mir Leid, Krankheit, Schuld und der schmerzliche Verlust durch Tod immer mehr in die fühlende Einsicht meines unermesslichen zeitlosen göttlichen Wertes zu kommen, der von allen vorläufigen und bedingten Lebensumständen unabhängig ist. Gerade Leid, Schuld und Tod zu nutzen, um immer gewisser in diese fühlende Einsicht meines unverlierbaren unermesslichen Wertes zu kommen, ist Gegenstand, Kursus und mögliche Heilwirkung dieses Buches. Durch die Anwendung der im Anhang beschriebenen Selbstbehandlung lässt sich dieser Entwicklungs- und Heilungsprozess verstärken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 598
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meinen LehrerInnen und PatientInnen
Ein Kurs, um das bedingte Selbstwertempfinden zu entwickeln, zu stärken und so zur Erfahrung seines zeitlosen, unverlierbaren und unschätzbaren Wertes zu kommen.
Mit praktischen Anleitungen
Inhalt
Einleitung
Um was es geht
Definitionen des Lebens
3.1 Aufnahme, Wandlung, Ausscheidung – Formen von Leben und Tod
Leben ist Bewegung
4.1 Was mich bewegt ist das, was ich bewege
4.2 Bewegung und Trägheit
4.3 Bewegung und Ruhe
4.4 Selbstwertempfinden und Bewegung
4.5 Selbstbehandlung durch Selbstannahme zur Bewegung (Berührungsakupunktur)
Leben als der Atem Gottes
5.1 Atmung und Selbstwertempfinden
5.2 Selbstbehandlung durch Selbstannahme zur Atmung (Berührungsakupunktur)
Leben ist Kommunikation
6.1 Durch Mit-Teilung gemeinschaftlich machen
6.2 Kommunikation ist Beziehung
6.3 Kommunikation ist immer auch innere Beziehung
6.4 Beobachtung aller Kommunikation
6.5 Kommunikation mit meinem Inneren – Intuition
6.6 Wozu ich die intuitive Kommunikation brauche
6.7 Wie ich die Kommunikation mit meiner Intuition entwickeln kann
6.8 Kommunikation mit dem Unkonkreten
6.9 Kommunikation und Selbstwert
6.10 Selbstbehandlung durch Selbstannahme zur Kommunikation (Berührungsakupunktur)
Leben als Resonanz und Spiegelung
7.1 Resonanz-, Beziehungs- und Bindungsfähigkeit
7.2 Wie und wodurch ich Resonanz erfahre
7.3 Notwendigkeit der Resonanz (Berührungsakupunktur)
7.4 Resonanz und Selbstwertempfinden
7.5 Selbstbehandlung durch Selbstannahme meines Resonanzbedürfnisses (Berührungsakupunktur)
Leben als Wirkung – mein Leben als Selbstwirksamkeit
8.1 Der Januskopf der Selbstwirksamkeit
8.2 Selbstwirksamkeit, Eifersucht und Kampf
8.3 Denkfreiheit und Selbstwirksamkeit
8.4 Selbstwirksamkeit und Selbstwertempfinden
8.5 Selbstbehandlung durch Selbstannahme meines Selbstwirksamkeitsbedürfnisses (Berührungsakupunktur)
Leben äußert sich im Gestalt-Werden und im Gestalten
9.1 Beginn und Entwicklung meines Gestaltens und meiner Kreativität
9.2 Woraus ich meine Kreativität schöpfe
9.3 Was ich gestalte
9.4 Optimale Nutzung meiner Gestaltungsfähigkeit und Kreativität
9.5 Kreativität und Selbstwertempfinden
9.6 Selbstbehandlung durch Selbstannahme meiner Kreativität (Berührungsakupunktur)
Leben äußert sich in der Natur
10.1 Natur und Selbstwertempfinden
10.2 Selbstbehandlung durch Selbstannahme zu meinem Bedürfnis nach Natur (Berührungsakupunktur)
Leben äußert sich in der Kultur
11.1 Wie die Kultur auch der Erfüllung anderer Bedürfnisse dient
11.2 Identifikation mit meiner Kultur und Selbstwertempfinden
11.3 Selbstbehandlung durch Selbstannahme meines Bedürfnisses nach Kultur (Berührungsakupunktur)
Weitergabe des Lebens – Generativität
12.1 Geschichte der Generativität
12.2 Was ich generiere
12.3 Meine Probleme mit der Generativität
12.4 Generativität im Alter
12.5 Selbstwertempfinden durch Generativität
12.6 Selbstbehandlung durch Selbstannahme meines Bedürfnisses nach Generativität (Berührungsakupunktur)
Abenteuer – Interesse – Sehnsucht
13.1 Wo, wann und wie ich Abenteuer eingehe
13.2 Selbstwertempfinden durch Abenteuer
13.3 Selbstbehandlung zur Selbstannahme des Abenteuerbedürfnisses (Berührungsakupunktur)
Sinn des Lebens
14.1 Wann ich den Sinn vermisse
14.2 Wodurch ich Sinn erhalte
14.3 Sinn und Selbstwertempfinden
14.4 Selbstbehandlung durch Selbstannahme zu meinem Sinnbedürfnis (Berührungsakupunktur)
Die Bedürfnisse nach Anerkennung und Wertschätzung
Anerkennung
16.1 Was ich grundsätzlich anerkennen kann, sind meine Wahrnehmungen
16.2 Anerkennung der Wahrnehmungsfähigkeit
16.3 Anerkennung und Glaube
16.4 Anerkennung des Zweifels
16.5 Anerkennung, dass ich das bin, was ich wahrnehme
16.6 Selbstbehandlung durch Selbstannahme im Umgang mit Anerkennungskonflikten (Berührungsakupunktur)
Wertschätzung
17.1 Was alles Werte sind und wovon sie abhängen
17.2 Wie und wodurch ich meine aktuellen Werte bestimme
17.3 Wie sich mein Wertschätzen auswirkt
17.4 Gegensätzliche Werte – der Unterschied zwischen Materiellem und Immateriellem
17.5 Wert des Wertlosen – Würde
17.6 Wertschätzung und Selbstwertempfinden
17.7 Kampf um das Wertgefühl des Ichs
17.8 Selbstwertgefühl als Gradmesser des In-Beziehung- und Verbunden-Seins
17.9 Selbstwertgefühl als Gradmesser der Verbundenheit mit meiner Umgebung
17.10 Selbstwertgefühl als Gradmesser des Verbundenseins mit mir
17.11 Selbstwertgefühl als Gradmesser des Verbundenseins mit dem Ganzen
17.12 Regulation des Selbstwertgefühls
17.13 Selbstbehandlung durch Selbstannahme nach Wertschätzung und Selbstwertgefühl (Berührungsakupunktur)
Mitgefühl als Wertschätzung
18.1 Wie man die Entwicklung von Einfühlung, Mitgefühl und Empathie erklären kann
18.2 Bedingungen und Zweck meines Mitgefühls und meiner Empathie
18.3 Mögliche Komplikationen des Mitgefühls und der Empathie
18.4 Mitgefühl macht keine Ausnahmen
18.5 Umgang mit inneren Einsprüchen gegen Mitgefühl mit mir selbst
18.6 Umgang mit inneren Einsprüchen gegen Empathie und Mitgefühl
18.7 Wir können nicht anders, als mitfühlend zu sein
18.8 Mitgefühl, Treue und Loyalität
18.9 Selbstwertempfinden und Mitgefühl
18.10 Selbstbehandlung zur Selbstannahme für Mitgefühl (Berührungsakupunktur)
Dankbarkeit als Wertschätzung
19.1 Ursache der Dankbarkeit – Gnade
19.2 Meine Schwierigkeiten mit der Dankbarkeit
19.3 Dankbarkeit durch Wertschätzung – Ich kann für alles auch dankbar sein
19.4 Güte und Dankbarkeit sind eins – wie ich sie empfinden und leben kann
19.5 Meine Dankbarkeit lässt mich meinen und allen Wert empfinden
19.6 Wofür ich leidgeprüften Menschen dankbar bin
19.7 Selbstbehandlung durch Selbstannahme zu Dankbarkeit und Opfer (Berührungsakupunktur)
Was Jesus als zugleich Gott und Mensch wertschätzt
Was ist der Tod?
21.1 Wie mir die Wirklichkeit des Todes erscheinen kann
21.2 Mein Ich und der Tod
21.3 Wie ich mit der Feststellung des Ichs den Tod etabliere
21.4 Wie der Tod mich am Leben hält
21.5 Umgang mit dem Tod
21.6 Sich dem Tod stellen
21.7 Selbsttötung
21.8 Wie stelle ich mich dem Tod eines geliebten Menschen?
Schuld und Tod: Aufbrechen einer Einheit und Ungleichheit
Tot ist auch, was ich nicht leben lasse
23.1 Wann und wodurch ich meine Liebe nicht leben lasse
Jesu Wertvorstellungen zur Aufhebung von Schuld und Tod
Liebe hebt den Tod auf
Mein und dein Wert angesichts von Leben und Tod
Ich bin gekommen, das Schwert zu bringen
Transzendente Erfahrungen – Erfahrungen von woanders her
28.1 Beispiele für (eigene) transzendente Erfahrungen
28.2 Transzendente Erfahrungen und Wertempfinden
Anhang zur Selbstbehandlung
Literatur
Krankheit, Leid, Schuld und Tod erfährt der Mensch als quälende Ereignisse seines realen Lebens und sie erscheinen unausweichlich. In gewisser Weise sind sie das auch, wenn ich den Menschen unter den üblichen Kategorien von Raum, Zeit, Bedingtheit und Identität betrachte. In diesem Kontext erlebt sich der Mensch leidend, schuldig und sterbend, sodass er ständig notwendige Erfüllung seiner verschiedenen Bedürfnisse zu seiner Befriedigung sucht. Die Erfüllung dieser lebensdienlichen Bedürfnisse und die dazu sinnvollen Strategien sind gleichfalls ein Thema dieses Buchs.
Doch die genannten Kategorien und die darin gemachten Erfahrungen sind menschliche Konstrukte, die sowohl interindividuell als auch intraindividuell (bei der gleichen Person) unterschiedlich sind.
So hängt das Erleben von Leid oder Freude nicht von einem objektiven Tatbestand ab, sondern wie ich zu diesem Tatbestand in Beziehung trete. Wenn ich z.B. einige Tage nichts gegessen habe, kann ich furchtbar leiden; oder ich genieße euphorisch meine Freiheit vom Essen-Müssen. Der objektive Nahrungsmangel ist nicht entscheidend. Dies gilt für die Schuld ähnlich: Falls ich jemanden gekränkt habe, kann ich dabei entweder Genugtuung oder (vielleicht später) Schuld empfinden. Das objektive Faktum der Kränkung entscheidet nicht, ob ich Schuld empfinde, sondern wie ich dazu in Beziehung trete.
Leid und Schuld gibt es nicht an sich, sondern sind das Ergebnis meines (letztlich beliebigen) In-Beziehung-Tretens zu den jeweiligen Fakten oder Phänomenen.
Da ich dieses In-Beziehung-Treten grundsätzlich beliebig gestalte, kann ich im Zusammenhang von Leid und Schuld mit einer gewissen Berechtigung von »beliebigen Vorstellungen« sprechen.
Dies gilt auch für den Tod; ich kann ihn als Bedrohung und Erlösung erwarten.
Doch hier gibt es noch weitere wesentliche Aspekte.
Ich mache immer nur die Lebenserfahrungen eines Lebenden. Ich erkläre dann etwas für tot, wenn dieses von mir zuvor für lebendig gehaltene Phänomen nicht mehr den willkürlich definierten Lebenskriterien entspricht.
Wenn ein Mensch nicht mehr die gewohnten Funktionen erfüllt, halte ich ihn für tot; selbst wenn seine Nägel und Haare noch wachsen und sein Mikrobiom (z. B. die Darmflora) wuchert. Dass bei dieser Mikrobiomexpansion Informationen des Verstorbenen mit weiterverbreitet werden, kann ich zumindest nach bisherigen Forschungsergebnissen vermuten.
Der Tod ist Ergebnis von (beliebiger) Wahrnehmung und willkürlicher Bedeutungsgebung; jedoch in sozialer Übereinkunft und insofern bedingt. Was also als Tod erscheint, ist in Wirklichkeit die Beendigung und die Aufhebung einer zuvor erklärten, mit Identität attributierten Einheit, die mit ihrem so genannten Tod aufbricht.
Dieses Aufbrechen ist gleichzeitig die Geburt einer neuen Einheit bzw. neuer Einheiten.
Der so genannte Tod ist somit nicht nur der Beender sondern auch der Lebensspender der unendlichen Vielfalt des Lebens.
In der verlaufenden Zeit ist er ebenso wie Leid und Schuld notwendig, damit das Leben für den Menschen als Leben – nämlich im Erleben seiner Bedürfnisse nach Erfüllung, Gemeinschaft, Geborgenheit, Wertschätzung, Fürsorge, Gesundheit, Mitgefühl, Gleichheit, Gerechtigkeit, Liebe und eben nach Leben selbst – spürbar wird.
In der Erfüllung dieser notwendigen Bedürfnisse erfahre ich mich selbst in meinem Wert; ich bin es wert, dass sie mir erfüllt werden.
Doch gerade über den Mangel bzw. das damit verbundene Leid- und Schuldempfinden sowie des Endlichkeitserlebens, verweisen die notwendigen Bedürfnisse auf den unbedingten Wert, der stets erhalten werden möchte. Nur im Kontrast zum Mangelerleben kann ich mir unter den Umständen der Bedingtheit des kreatürlichen Lebens meines unbedingten, zeitlosen Wertes bewusst werden. Durch die bewusste Annahme von Leid, Schuldgefühlen und Tod (meiner Existenz in wechselnden Erscheinungsformen) kann ich die Bedingtheit meines Wertempfindens aufheben und zur Erfahrung meines und jeden Menschen unbedingten göttlichen Wertes kommen. Leid, Schuld und Tod werden so als hilfreiche Vorstellungen genutzt, um mich an meinen unermesslichen Wert meines zeitlosen LEBENS – jenseits meiner vorläufigen, vergänglichen Eigenschaften und Attribute – zu erinnern.
In den einzelnen Kapiteln werden die Zusammenhänge von Erfüllung meiner jeweiligen Bedürfnisse einerseits und meines Wertempfindens andererseits beschrieben.
Jedes Kapitel schließt mit einer Anleitung zur Selbstbehandlung, die auf die Bahnung der Erfahrung meines bedingungslosen Wertes jenseits aller vorläufigen Lebensumstände von Haben oder Bekommen von Attributen abzielt. Gerade in den schrecklichsten Augenblicken des kreatürlichen Lebens kann die Grenze zum transzendenten Einheitserleben, zur Seinserfahrung, zum Alleins aufgehoben werden und ich fühle mich dabei aufgehoben.
Im Anhang sind weitere Übungen erläutert, die bei der Entwicklung vom bedingten Wertempfinden zum unbedingten Wert hilfreich sind. Jedwede Behandlung ist stets mit der bewussten Stärkung von Selbst-Mitgefühl und Selbst-Liebe und dadurch auch gleichzeitig mit einem diesbezüglichen Wachstumsimpuls verbunden.
Dr. med. Günter Eble, geb. 1947, ist Internist, Arzt für Psychosomatik, Psychotherapie und Palliativmedizin.
Ursprünglich als Therapeut tiefenpsychologisch und analytisch ausgerichtet, bevorzugt er inzwischen hypnosystemische und energiepsychologische Therapieansätze. Seit zwanzig Jahren wirbt er in Kursen und in Vorträgen über Gesundheitsbildung unter besonderer Einbeziehung der spirituellen Gesundheit für eine eigenverantwortliche und an eigenen Ressourcen orientierte Lebensführung.
Er hat in diesem Rahmen eine Reihe von Skripten verfasst, in denen die Selbstwahrnehmung und die Selbstbehandlung durch Selbstannahme, Selbstmitgefühl und Selbstliebe unter Anwendung der Berührungsakupunktur im Mittelpunkt stehen.
1. Einleitung
Wenn unter Gesundheit das körperliche, geistige, seelische und soziale Wohlbefinden verstanden wird, erklären die meisten Menschen diese Elemente zum höchsten Gut und zur Hauptsache. Zunehmend wird jedoch – besonders in der Palliativmedizin – die spirituelle Dimension des Menschseins einbezogen.
Darum möchte ich die Bedingungen des Gesundseins und des Gesundens sowohl aus der Perspektive der Humanmedizin und Psychologie als auch unter religiös-spirituellen Aspekten betrachten. Dabei geht es darum, die Bibel als hilfreiche Sammlung von sinnstiftenden Narrativen zu nutzen. Gerade wenn ich aus einem religiös-spirituellen Blickwinkel schaue, wird das allein auf Wohlbefinden hin ausgerichtete Gesundheitsideal sowohl vom Buddhismus als auch von den christlichen Religionen in Frage gestellt.
Buddha sagt, dass das Leben als Leid zu durchschauen sei. Jesus lehrt, das Kreuz auf sich zu nehmen und gerade das Leid, die Armut, die Krankheit, die Schuld (Sünde) und sogar den Tod als Mittel zu erkennen, um erlöst zu werden.
Sünde bedeutet sowohl Absonderung und Trennung von der Gemeinschaft-Einheit als auch Entwertung.
Vor diesem Hintergrund scheint es im Leben etwas noch Wichtigeres zu geben, als sich auf Wohlbefinden und Gesundheit im üblichen Verständnis zu konzentrieren. Es geht im Wesentlichen darum, sich einer bergenden Wertegemeinschaft zugehörig bzw. sich wertvoll zu fühlen. Dass dabei das Mich-Wertvoll-Fühlen den höchsten Stellenwert hat, lässt sich daran ablesen, dass ich bereit bin, alles dafür zu tun, um mich im Rahmen meiner Wertvorstellungen wertvoll fühlen zu können; selbst mein Leben dafür zu opfern (Märtyrer, Soldaten, Menschen, die ihr Leben riskieren, um andere zu retten usw.).
Umgekehrt gibt es Menschen, die nicht mehr leben wollen, wenn sie glauben, ihren Wert (Würde, Ehre) verloren zu haben (Samurai, Vergewaltigungsopfer, vom Partner Verlassene).
Selbst Kranke und besonders Menschen mit seelischen oder mit entstellenden Krankheiten glauben oft, dass sie durch ihre Krankheit ihre Würde und ihren Wert eingebüßt hätten.
Alle Konflikte werden ausgetragen, um damit einen Wert bzw. Werte zu erhalten. Es geht im Kampf ausnahmslos um Werte – welche auch immer. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um materielle oder ideelle Werte handelt. Im Kampf um diese Werte werden die fürchterlichsten Opfer mit unvorstellbarem Leid, Verletzungen, Kränkungen und Toten gebracht. Selbst zwischen Freunden, Partnern, Eltern, Kindern, Geschwistern und erst recht zwischen erklärten Feinden tobt dieser Wertverteilungskampf; und die Gesundheit i. S. des umfassenden Wohlbefindens wird dabei aufs Spiel gesetzt.
Allein die Tatsache, dass der Mensch so um seinen Wert bzw. sein Sich-wertvoll-Fühlen kämpft, beweist, dass er diesen Wert hat. Andernfalls könnte er keinen Mangel daran spüren.
Dieser Wert wird aus zwei Quellen gespeist:
Einmal ist es der vom Schöpfer gegebene Wert, mit dem jeder gleichermaßen auf die Welt kommt. Dieser Wert ist an keine Bedingungen geknüpft, unverdient (da es noch keine Gelegenheit gab, sich etwas zu verdienen), unermesslich und unverlierbar.
Die andere Quelle des Werts bzw. des Werterlebens ist das Wertgefühl, das aus der liebevollen, fürsorglichen Beziehung und dem Austausch zwischen Mutter (bzw. Betreuungsperson) und Kind aufkommt.
Im sich gegenseitigen Bereichern des wertschätzenden und liebevollen Miteinanders bilden sich mein Selbstbewusstsein und mein Selbstwertempfinden immer persönlicher heraus.
Dieser Wert scheint jedoch nicht bedingungslos zu sein, da die Qualität des wertschätzenden Miteinanders schwankt und von vielen Bedingungen abhängig ist.
Je froher, sicherer, harmonischer und liebevoller das Miteinander ist, desto stärker ist das Selbstwertgefühl; je bedrückender, unsicherer, unharmonischer und enttäuschender sich das Miteinander gestaltet, desto geringer ist das Selbstwertgefühl.
Der absolute Wert, um den es geht, ist das (ewige bzw. zeitlose) Leben selbst.
Aus diesem absoluten Wert des Lebens sind entsprechend der unendlichen Vielfalt der Erscheinungen des Lebens unendlich viele Werte abgeleitet, die jeder Mensch kraft seines Bewusstseins unerschöpflich in einzigartiger Weise erfährt und schafft.
Dabei ist die Bewusstseinshaltung entscheidend. Durch Haltungen der Neugier, des Interesses, der Sehnsucht, des Anerkennen- und Wertschätzen-Wollens sowie der Sinngebung, des Mitgefühls und der Dankbarkeit, schöpft der Mensch ein erfülltes Leben lang immer neu Wertvolles aus den Beziehungen zur Umgebung, zur Natur, zur Kultur, zu sich selbst und zum Schöpfer. Ich erfahre dies, indem ich in Resonanz trete, selbstwirksam bin, gestalte, offen, anerkennend, wertschätzend, mitfühlend und liebevoll bin.
Leid, Schuld und Tod helfen mir dabei, nicht ständig meine Erfüllung in demselben gewohnten als wertvoll Erlebten finden zu wollen und mich mit dieser Ausrichtung nur auf die in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen hin zu orientieren.
Meine Trauer erkennt das Wertvolle des Gewesenen der Vergangenheit jetzt an und nimmt es mit in die Zukunft, ohne dabei in die Vergangenheit zurück bzw. etwas festhalten zu wollen.
Die wertvollsten Erfahrungen meines Lebens sind die, in denen mir Freude, Friede und Liebe zeitlos und bedingungslos erscheinen. Sie werden zum Ziel meiner Sehnsucht und lassen alle anderen wertvollen Erfahrungen als flüchtige Reflexionen des zeitlosen, eigenschaftslosen und damit unbeschreiblichen göttlichen Jetzt aufscheinen. Werden und Vergehen – sei es durch Leid, Schuld oder Tod – aller bestimmten, an Bedingungen geknüpften Werte weisen auf den unbedingten Wert hin und werden durch ihr Vergehen gleichzeitig zum Fenster, das den Durchblick auf den absoluten, transzendenten Wert ermöglicht.
Mit Hilfe der Selbstbehandlung und der im Anhang beschriebenen Anleitung soll die Entwicklung vom bedingten Selbstwertempfinden zum bedingungslosen Werterleben gebahnt werden. Schlüssel hierzu sind Selbstannahme, (Selbst-)Mitgefühl und Selbstliebe.
Nach den jeweils abgehandelten Themen, die gleichzeitig wesentliche Bedürfnisse beschreiben, sind so genannte Annahmesätze formuliert, die unter gleichzeitiger Berührung bzw. Klopfen der im Anhang angegebenen Akupunkturpunkte laut ausgesprochen werden. Es geht dabei um einen multifokalen Behandlungsansatz, da die Behandlung sowohl auf der geistigen Ebene (gedanklich und sprachlich), der körperlichen (Selbstberührung) und auf der energetischen Ebene (durch Auslösung von elektrischen Impulsen bei der Berührung) stattfindet. Am wichtigsten dabei ist jedoch, sein Bewusstsein immer wieder auf Annahme, Mitgefühl und Liebe auszurichten.
Dabei haben manche Menschen Hemmungen, sich zur Selbstliebe zu bekennen und sie für sich in Anspruch zu nehmen.
Jesus erklärt die Liebe zum wichtigsten Gebot: »Du sollst den Herrn deinen Gott lieben … Doch ein anderes Gebot ist diesem gleich: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.«
Damit erklärt er die alles gleichmachende Liebe, die Gott, mich selbst und den Nächsten gleichermaßen umfasst.
Liebe ist der stärkste Ausdruck des Ja-Sagens und des Annehmens. Da alle Bedürfnisse dem Leben dienen, bejahen alle Bedürfnisse das Leben. Jedes Bedürfnis und jede Erfahrung der Bedürfniserfüllung sind so in bestimmter Weise ein Ausdruck von Liebe zum Leben.
In der Liebe sind alle Bedürfnisse vereint. Von daher können die einzelnen Bedürfnisse auch nicht eindeutig voneinander abgegrenzt werden und so gibt es zwischen ihnen immer wieder Überschneidungen. Das führt sowohl dazu, dass dieselben Bibelzitate bei verschiedenen Bedürfnissen angeführt werden als auch dazu, dass beispielsweise die Schuldproblematik als Restriktion für die Erfüllung unterschiedlicher Bedürfnisse aus verschiedenen Perspektiven beschrieben wird. Das bringt Wiederholungen mit sich. Schließlich läuft es immer wieder darauf hinaus, dass die heilende Selbstbehandlung über die Selbstannahme durch Selbstachtung, (Selbst-)Mitgefühl und Selbstliebe erfolgt.
2. Um was es geht
Das Anliegen ist, das Leben trotz aller Verluste, Not, Krankheit und Tod mit aller Angst, Verzweiflung, Scham, Schmerz und Pein, mit aller Fülle in Geborgenheit froh zu leben und dabei immer sicherer seinen unermesslichen, unverlierbaren Wert zu spüren.
Dabei geht es keinesfalls darum, irgendetwas zu verharmlosen und zu beschönigen.
Im Gegenteil soll das Schreckliche als Schreckliches ausdrücklich wahrgenommen werden.
Es soll aber auch deutlich werden, dass das höchste Gut des Menschen, das Leben in seiner lebendigsten Form nämlich der Liebe, nie beschädigt oder gar beendet werden kann.
Das Leben ist in einem unaufhörlichen Fluss und wie in einem Fluss ist darin alles in Bewegung. Obwohl der Fluss seine Form, Strömungen, Wellen usw. ständig ändert, bleibt es doch der gleiche Fluss.
Und ich sage das von einem expliziten existentialistischen Standpunkt aus: Ich bin hier jetzt.
Damit nehme ich wohl eine Position ein, die von den meisten Menschen unserer Zeit geteilt wird, die von sich als eigenständige und individuelle Person ausgehen.
Gleichzeitig stelle ich mich auch wieder insoweit in Frage, als dass dieses persönliche Ich zwar als subjektive und objektive Tatsache erscheint, dieses lebendige, seiende Ich jedoch selbst innerlich und äußerlich eine fließende Konstruktion von physikalischen, chemischen, biologischen, affektiven, geistigen, sozialen und spirituellen Prozessen ist; andernfalls wäre dieses Ich nicht lebendig. Ich gehe also in Bezug auf mich (und ebenso in Bezug auf die Welt) von zwei unterschiedlichen Positionen aus: Ich stelle mich im wahrsten Sinne des Wortes als derselbe fest und gleichzeitig ist mein Ich in der ständigen lebendigen Veränderung eines fließenden Prozesses innerhalb eines zeitlosen Seins. Mittels meines autobiographischen Gedächtnisses und meiner mir innewohnenden, in neuronalen Netzwerken gespeicherten Geschichtlichkeit, die ich durch meine genetische, epigenetische, physiologische, haltungsmäßige (z. B. aufrecht oder gekrümmt, offen oder skeptisch) und neuronale Verkörperung (Embodyment) auch leibhaftig mit in mein aktuelles Leben hier und jetzt einbringe, bin ich einerseits ein »Vorgefertigter« (Partizip-Perfekt-Passiv) und somit Bedingter. Andererseits bin ich gleichzeitig mit diesem vorgefertigt bedingten Ich in die freie Entscheidung für den gerade im Gegenwartsmoment ablaufenden Prozess (seine Richtung und seine energetische Aufladung) im Hier und Jetzt gestellt.
Die Festlegung meines Ichs bzw. meiner individuellen Identität bedarf notwendig der fortdauernden Anerkennung und Bestätigung durch meine Umgebung – Familie, Freunde, Kollegen, Nachbarn usw. Ohne diese könnte ich meine Identität als dieses individuelle Ich nicht aufrechterhalten. Wären die beschriebenen Bedingungen nicht erfüllt, gäbe es mich als dieses konkrete Ich (das in Wirklichkeit aus vielen kontingenten Teil-Ichs besteht) gar nicht. Auch das Hier und Jetzt ist keinesfalls so eindeutig wie es scheint, da ich mit dem bewussten Teil meines Ichs, mit meinen Vorstellungen, Phantasien und Gedanken meist an einem anderen Ort und in einer anderen Zeit bin. Dazu steht mir ein gewaltiger Möglichkeitsraum offen, der vom Urknall bis zum zeitlichen und räumlichen Ende des Kosmos reicht.
Mein bewusstes Ich im Hier und Jetzt kann also in der Wirklichkeit meiner Phantasie in der Zukunft bei der Explosion der Sonne in Millionen Jahren sein, während mein Körper in der Realität auf einer Parkbank im botanischen Garten sitzt.
Auch wenn meine Realitäten in Wirklichkeit nur Konstruktionen in sozialer Übereinkunft sind, kann ich mein Leben als Person nicht anders leben als von dem angenommenen Standpunkt des Ich-Hier-Jetzt aus.
Es soll im Folgenden darum gehen, sowohl dieses Ich bzw. mein Selbst zu stärken als auch es gleichzeitig transparenter zu machen für die Wirklichkeit, aus der alles hervorgeht; jenseits der beliebigen Konstruktionen. Dabei sollen der so genannte Tod ebenso wie Leid und Schuld als notwendige Entwicklungshelfer dafür bewusst und gezielt nutzbar werden.
Zu diesem Zweck will ich nach der Definition, was ich unter Leben verstehe, den evolutiven Vorgaben folgen und zunächst die Entwicklung eines starken Selbst bzw. Ichs beschreiben. Dieses entsteht beginnend mit meiner Geburt aus der Geborgenheit heraus durch Fürsorge, Kommunikation, Wertschätzung, Mitgefühl und Liebe und reift zu einem zunehmend selbstbewussteren Ich-Bewusstsein heran; um dann schließlich durch das Loslassen des Ichs zu einem transparenteren Bewusstsein zu kommen, in dem die Erfahrung der Einheit möglich ist.
Ich möchte einen Weg beschreiben, auf dem ich vom schwankenden und wechselnden Selbstwertgefühl zum unbedingten Werterleben meines angeborenen unverlierbaren Wertes kommen kann. Das beinhaltet gleichzeitig die Entwicklung vom gegenständlichen Bewusstsein zum Einheitsbewusstsein und zur Seinsfühlung, in der durch jeden Menschen der unendliche Wert des Schöpfers hindurchscheint.
Dabei sollen folgende Prämissen gelten:
Jeder Mensch wird mit einem unermesslichen Wert geboren, den er nie verliert. Jeder Mensch hat eine Ahnung von diesem Wert und möchte ihn fühlen. Dazu braucht er Anerkennung, Wertschätzung, Mitgefühl, Geborgenheit, Fürsorge und Liebe. Ohne ein Mindestmaß davon kann niemand überleben. Erst durch den Wechsel im Wertempfinden (wertvoll – minderwertig) kann der Selbstwert bewusst werden. Es gibt eine Einheits- bzw. Seinserfahrung, die nicht bewusst herbeigeführt, sondern nur zugelassen werden kann. Sie ist jenseits der personalen Ich- oder Selbsterfahrung, die in den Kategorien von Raum, Zeit, Identität und Bedingtheit erlebt wird. Es ist die Erfahrung eines Seins, in dem alle bedingten Erfahrungen mit ihren wechselnden Qualitäten aufgehoben sind und es somit auch kein Leid keine Schuld und keinen Tod gibt, da Leid, Schuld sowie Tod einerseits und Trennung implizierende Wechsel andererseits sich gegenseitig bedingen.
In diesem Kurs kann ausgehend von diesem unbedingten unermesslichen Wert, das Selbstwertempfinden bewusster gemacht und es können mögliche Verletzungen gezielt behandelt und vorhandene Ressourcen gefördert werden (s. Anhang).
Es wird anerkannt, dass ich mir meines unermesslichen Wertes zunächst nur im Widerschein unendlich vieler beliebiger Reflexionen meines bedingten Wertes bewusst werden kann.
So wie alle sichtbaren Dinge auf der Welt letztlich von der Sonne künden, so kündet auch alles im Menschen letztlich von seinem unermesslichen Wert, der selbst dann erhalten bleibt, wenn alles verschwunden ist, was ihn reflektiert; so wie auch das Licht unreflektiert zwar vorhanden aber unerkannt (dunkel) ist. Gleichzeitig gilt, dass alles, was von der Sonne kündet, auch Sonne enthält. Und so ist auch jeder Mensch dieser unermessliche Wert.
Die Vergleichbarkeit endet bei der Vergänglichkeit der Sonne im Gegensatz zu der Zeitlosigkeit des unbedingten Werts.
Wenn ich mit dem unermesslichen Wert geboren werde, verkörpere ich zwar diesen Wert und repräsentiere ihn zumindest für meine Eltern (mit wenigen Ausnahmen); er ist mir selbst aber noch nicht bewusst.
Er wird mir in den glänzenden Augen der Mutter und ihrer Freude über mich widergespiegelt.
Ihre Freude ist meine Freude und ihre Missstimmung ist meine Missstimmung.
In den ersten Lebensmonaten bin ich Gefangener der sozialen Interaktion mit ihr (D. Stern).
Der Wechsel zwischen Wohlgefühl bzw. Freude und Unbehagen bzw. Missstimmung wird zum Motor der Bewusstwerdung meines Wertes.
Die Phasen meiner von der Mutter unabhängigen Wachzeiten werden immer länger und ich erlebe dementsprechend den Wechsel meiner Stimmungen und Gefühle auch losgelöst von ihr.
Ich erprobe die Welt, indem ich sie mir mit allen Sinnen einverleibe und bewertend, urteilend unterscheide in: essbar – nicht essbar, wohlschmeckend – ungenießbar, vertraut – fremd, stärkend – schwächend, bergend – bedrohlich, zugehörig – ausgeschlossen, unterstützend – belastend, erhebend – bedrückend, richtig – falsch, überlegen – unterlegen, gut – böse, bereichernd – beraubend, gerecht – ungerecht bzw. gerechtfertigt – schuldig.
Je nachdem wie meine Bewertung ausfällt, fühle ich mich mehr oder weniger wertvoll bzw. minderwertig.
Dabei lerne ich zu dissoziieren, d. h. die negative Bewertung bzw. das als negativ Bewertete nach außen zu projizieren (»das Unangenehme hat nichts mit mir zu tun, sondern ist von außen verursacht«) und mich selbst dadurch wieder aufzuwerten.
Letztlich ist dies eine Verleugnung, da die Negativbewertung auch eine wirksame Seite von mir ist, die in mir selbst auf mich wirkt, solange ich negativ bewerte.
Mit all diesen Negativbewertungen, die natürlich zur Orientierung und zur sozialen Integration im Leben auch notwendig sind, verdunkele ich mein Wertempfinden und meinen sowie gleichzeitig der anderen Menschen Wert.
Noch fataler schädige ich mich, wenn ich die vergleichende Bewertung als Strategie einsetze, um mir durch die Verurteilung und damit Entwertung anderer, meinen Wert bewusst machen zu wollen. Das hat u. a. zur Folge, dass ich mich minderwertig fühle, wenn ich bei anderen Menschen etwas Wertvolles entdecke.
Gefühle von Neid, Missgunst, Eifersucht, aber möglicherweise auch von Angst, Ärger, Scham und Niedergeschlagenheit informieren mich über die Anwendung dieser Strategie.
Sie wollen mich darauf aufmerksam machen, dass ich mein Wertempfinden derart störend von meiner Reaktion abhängig gemacht habe, dass ich auf einer meist unbewussten Ebene glaube, der Wert eines anderen mindere meinen Wert.
Da mir mein Wert im Vergleich bewusst wird, indem ich Wohlgefühl bzw. Missempfinden in Beziehung setze mit Situationen (bspw. einem Examen oder einer Bewerbung), die durch bestimmte Eigenschaften und Funktionen gekennzeichnet sind, glaube ich, dass der Wert an bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten (zur Ausführung dieser Funktionen) gebunden sei.
Also versuche ich, mir diese wertvollen Eigenschaften und Fähigkeiten anzueignen.
Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden, da dies ja Entwicklung und Bewusstsein fördert. Problematisch ist nur, dass damit der an keine flüchtigen Eigenschaften und Fähigkeiten gebundene, unbedingte, meinem Menschsein implizite Wert verschleiert wird.
Mein persönliches Ich glaubt nun, sich mit all den angesagten wertsteigernden Attributen, Eigenschaften und Fähigkeiten ausstaffieren zu müssen und orientiert sich dabei an ständig wechselnden Wertesystemen oder so genannten Moden. Gerade bei den Moden (z. B. den Kleidermoden) im engeren Sinne werden Vorläufigkeit und Beliebigkeit deutlich bewusst.
Die Bewusstwerdung der Vorläufigkeit und Beliebigkeit dieser das Selbstwertgefühl anregenden Attribute ist schmerzlich, da ich ihre Verluste mit Leid, Schuld (Mangel) und Tod in Verbindung bringe; und gleichzeitig ist dies Voraussetzung dafür, dass gerade durch ihren Verlust mein Blick auf meinen unverlierbaren Wert in der Einheit allen Seins wieder frei wird.
Die Vorstellungen von Leid, Schuld und Tod werden zu Geburtshelfern des Einheitserlebens.
3. Definitionen des Lebens
Leben fungiert als Organisator des Unbelebten und Belebten.
Unbelebtes wird belebt, und Belebtes wird transformiert in anderes Leben und in Unbelebtes.
Auf der materiellen Ebene werden verschiedene chemische Elemente unter der Wirkung von Energie so angeordnet, dass sie eine sich selbst regulierende und sich selbst reproduzierende homöostatische Einheit (z. B. eine Zelle oder ein Lebewesen) bilden. Sie sind einerseits von der Umgebung abgegrenzt, andererseits sind sie aber, sich mit ihr austauschend, im verbindlichen Kontakt mit eben dieser Umgebung.
Vor dem Hintergrund der Evolution wird erkennbar, dass das Leben zunehmend höhere und komplexere Organisationsformen entwickelt. Die aktuelle Organisationsform im Menschen als die vielleicht höchste hat dazu geführt, dass sich der Träger des Lebens seines Lebens selbst bewusst wird. Das erlaubt es, die Richtung des Lebensflusses auch bewusst lenken zu können.
Damit ist gemeint, dass ich als Mensch entscheiden kann, zu welchem Zweck und auf welches Ziel hin ich leben will: als Musiker, Soldat, Elter, Mönch, Aussteiger, ewiger Student oder Entwicklungshelfer. Das geht soweit, dass sich der Mensch das Leben nehmen kann und kollektiv die Lebensgrundlage der Erde zu zerstören vermag.
Im Menschen hat das Leben eine Form entwickelt, in der sich der Mensch von sich entfremdet erscheinen kann. Diese Entfremdung ist eine Erscheinungsform, eine Seite des Todes: das Aufbrechen einer bestehenden Einheit. Doch selbst wenn die Menschheit sich selbst und die Erde zerstören sollte, so bliebe doch die Essenz des bis dahin Gelebten so wirklich, wie längst erloschene Sterne mit ihrem Licht immer noch wirklich Wirklichkeit sind.
Das Leben bleibt mit seiner lebendigen Kraft aufgehoben in seinen Wirkungen.
Leben tritt grundsätzlich in drei verschiedenen Formen in Erscheinung:
Entäußerung und Manifestation aus der unendlichen Fülle der absoluten Potentialität.
Gestaltwerdung entsprechend der jeweils eingegebenen Ordnung (z.B. als Senfbaum).
Rückbildung des Gewordenen mit Eingang in die Einheit.
Übertragen auf den Menschen bedeutet das:
Aufbruch (Geburt) aus der umfassenderen Einheit (Muter-Kind-Einheit im Mutterleib) zur heranwachsenden (Menschens-)Kind-Einheit als selbstständiges Individuum.
Ankunft im Erwachsensein, womöglich als Elter mit erneutem Aufbruch im Neugeborenen.
Heimgang des Alternden mit Transformation in ein anderes Leben (Mikroben) und Unbelebtes (z. B. Wasser, Kohlendioxid, Mineralien) und Einheit mit dem All-Einen und darin zeitlos aufgehoben sein.
3.1 Aufnahme, Wandlung, Ausscheidung – Formen von Leben und Tod
Das Leben und die ihm innewohnende Kraft äußern sich prinzipiell in den drei Funktionen:
Aufnahme, Wandlung (Wachstum) und Ausscheidung (bzw. Ablösung, Rückbau, Trennung).
In jeder dieser Funktionen bzw. den entsprechenden Phasen steckt auch der Tod.
Der Mensch nimmt lebendige Nahrung auf, wandelt sie zu seinem Leben sowohl als Wachsen als auch als Bewegen unter gleichzeitigem Tod der aufgenommenen Nahrung und scheidet durch Bakterien belebte Faeces wieder aus.
Dabei bilden in der Natur solche Ausscheidungen wieder den Nährboden für neues Leben.
In Wirklichkeit werden bestehende Lebensformen immer nur in andere Lebensformen umgewandelt. Bei der Ausscheidung im allgemeinen Sinne geht es nicht nur um eine Entgiftungsfunktion, sondern auch um die Erneuerung gealterter Zellen und um Fortpflanzung (Ovulation, Geburt).
Anschließend garantieren die mütterlichen Ausscheidungen (Stillen) durch die kindliche Aufnahme Leben und Wachstum. Doch es sind nicht nur die materiellen Ausscheidungen, die vom Kind aufgenommen seine Entwicklung und Reifung bestimmen. Alle Äußerungen der Eltern in Form von verbaler und nonverbaler Kommunikation sowie ihre Verhaltensweisen, die letztlich der Lebensbewältigung dienen, werden vom Kind aufgenommen und als etwas ihm Eigenes integriert. Sie werden auch zu eigenen Sichtweisen auf die Welt und auf sich selbst, zu Eigenschaften, zu Fähigkeiten, zu Überzeugungen und zu Bewältigungskompetenzen.
Auch unter diesem Aspekt leben die Eltern gerade durch ihre (Ent-)Äußerungen über ihren materiellen Zerfall hinaus fort.
Ich lebe durch und in dem, was ich aufgenommen, verwandelt und geäußert bzw. entäußert habe.
Schließlich dienen Rückbildung im Alter und Ausscheiden (Sterben) sowohl dazu, dem nachwachsenden Leben Platz zu machen, als auch dazu, ihm einen fruchtbaren Boden zu bereiten.
Damit bin ich nach meinem so genannten Tod sowohl materiell der Humus als auch das, was mich in meinem Ge- und Entäußerten ausmacht und was ich an die Nachkommen weitergegeben habe und immer noch nachwirkend weitergebe (z. B. durch Aufzeichnungen).
Aufnahme – Wandlung – Ausscheidung sind in Wirklichkeit bloß unterschiedliche Ansichten des stets gleichen Lebenskreislaufs, bei dem der Tod nur ein Artefakt durch den Rückblick auf das Gewesene und nun nicht mehr Existierende ist.
4. Leben ist Bewegung
Bewegen ist gleichbedeutend mit Veränderung einer Position oder eines Zustands; räumlich gesehen heißt es Ortswechsel. Auch wenn der örtliche Bezug »Weg« im Wort enthalten ist, so beinhaltet Bewegung doch ebenso in allen anderen Bezügen Beunruhigung bzw. aus der Ruhe bringen. Ob es um materielle, körperliche, emotionale, geistige, energetische oder spirituelle Bewegungen geht, sie beinhalten immer Veränderung, Wechsel, Übergang, Fluss, Ausgleich, Verbindung, Zusammenhang; aber gleichzeitig auch Abwendung von dem einen und Hinwendung zu dem anderen. Damit wird außerdem deutlich, dass die Bewegung sowohl als Verlust (Abwendung) als auch als Gewinn (Hinwendung) definiert und empfunden werden kann. Bewegung ist gleichbedeutend mit Leben und Lebendigkeit.
Nur durch die Bewegung in den genannten Seinserscheinungen bzw. Formationen – Materie, Geist, Emotion, Energie, Spiritualität – erlebe ich mich lebendig. Bewegung ist ein Unruhezustand und gleichzeitig Leben; das heißt aber nicht, dass Ruhe damit Tod bedeutet. Bewegung bedeutet lediglich Unterschiedsbildung, damit mir das Leben allgemein und das, was es im Speziellen ausmacht, bewusst werden können.
Bewegung bzw. die Unterschiedsbildung machen mir bewusst, dass etwas ist. Ohne Bewegung gäbe es zwar eventuell das Sein, jedoch nicht das Bewusstsein davon; sie ermöglicht meine Erkenntnis.
Unter dem Gesichtspunkt der Bedürfniserfüllung geht es darum, dass ich mich von einem als unerfüllt erlebten Ist-Zustand auf einen gewünschten Soll-Zustand hinbewege.
Das setzt einen Spannungsbogen, der auch Motivation genannt wird, voraus.
Motivation ist aus dem Lateinischen von »movere«, d. h. bewegen, abgeleitet.
Der Spannungsbogen beinhaltet einen Grund oder Anlass und ein Ziel oder einen Zweck.
Die Spannung oder Kraft zwischen Anlass und Ziel ist die Motivation. Je größer sie ist, desto mehr bin ich bewegt.
Unser Wissen über den Beginn der Bewegung kann hypothetisch beim Urknall ansetzen.
Ich kann nicht wissen, was vor dem Urknall war; wir definieren jedoch den Urknall als den Beginn jeder bekannten Entwicklung. Ich könnte also den Zustand vor dem Beginn der Bewegung als Ruhe bezeichnen. Beides, Ruhe und Bewegung, sind integrale Komponenten des einen Seins, die in ihrer Verschiedenheit über die Aufspannung von Raum und Zeit mein Bewusstsein von Sein erst ermöglichen. Die absolute Potenzialität ist in ihrer Ruhe gleichsam der Pool aller Möglichkeiten, aus dem heraus alles Aktuelle und Konkrete bewegt und existent wird und in welches es wieder zurückströmt. Alles Leben ist Bewegung und ich habe ständig das Bedürfnis dieses zu fühlen.
Mein motorischer Bewegungsdrang ist bereits im Mutterleib spürbar. Mit der
Geburt kommen meine Atembewegungen und meine Gefühlsbewegungen hinzu; ich schreie und lächele.
Meine Fortbewegungsmöglichkeiten erweitere ich beginnend mit Rollen über Krabbeln bis zum Laufen zunehmend.
Mit dem Erwerb von Sprache entwickele ich mein explizites Denkvermögen und dadurch meine geistige Beweglichkeit.
Alle erwähnten Bewegungsarten haben eine energetische Seite; d. h. es fließt dabei immer Energie, was ich teilweise auch spüren kann (»aufwallend«, »abklingend«).
Beim Laufen, Wandern und beim Sport in jeder Form erfülle ich mir mein motorisches Bewegungsbedürfnis mit positiven Auswirkungen auf mein unmittelbares Wohlbefinden über die Aktivierung des Belohnungssystems. Darüber hinaus profitiere ich aber auch durch ein gestärktes Immunsystem, größere körperliche Fitness und durch Zunahme der neuronalen Verknüpfungen im Gehirn (»Laufen lässt Neuronen sprießen«).
Das Bedürfnis nach gefühlsmäßiger Bewegung schlägt sich besonders im Verlangen nach Zuwendung, Anerkennung, Berührung, Wertschätzung, also allen Formen sozialer Kontakte nieder. Ebenso geht es im Naturerleben, in der Bildenden Kunst, den darstellenden Künsten, der Musik und der Literatur immer um Gefühlsbewegungen.
Der Konsum aller möglichen Rauschdrogen dient genau dem gleichen Zweck. Selbst bei meinem Bedürfnis nach geistiger Bewegung spielen Emotionen eine große Rolle.
Die Freude am Lernen, an geistiger Entwicklung spiegelt dies wider. Alle Wissenschaften und Künste im weitesten Sinne seit der frühen Menschheitsgeschichte künden davon.
Mein Verlangen nach Information, Bildung, Wissen und geistiger Auseinandersetzung findet in den unterschiedlichsten Aktivitäten seinen Ausdruck. Vom Kleinkindalter an spielen Bücher in unserer Kultur eine wichtige Rolle. Doch auch alle anderen Medien und am wichtigsten die persönliche Kommunikation werden zur geistigen Bewegung genutzt.
Bis ins hohe Alter versuche ich meine geistige Beweglichkeit zu erhalten, indem ich überall zuhören und von überall lernen möchte. Notfalls trainiere ich mit Kreuzworträtseln.
Schließlich habe ich noch ein Bedürfnis nach spiritueller Bewegung. Hierbei wird vielleicht der gleichzeitige Wunsch nach Ruhe am offenkundigsten spürbar, da es in der Spiritualität um eine Beendigung des Suchens und die Ankunft in der Aufgehobenheit einer zeitlosen Ruhe geht. Doch bis dahin finde ich mich immer aufs Neue in einer Suchbewegung, die mich eventuell in die fühlende Einsicht des Einsseins, aber auch anderswohin führt.
Die Wege, die ich dabei beschreite, können religiöse Praktiken, Riten, Gebete, Pilgerreisen, Gesänge, Fasten, Kontemplation und Meditation sein.
Der Beginn meines persönlichen Weges ist meist die Liebe und der Wille der Eltern und die Verschmelzung von Spermium und Eizelle. Meine Bewegung besteht dann zunächst lediglich im Wachstum und der Ausdifferenzierung meiner Organe, Schlagen des Herzens, sowie in zunehmenden Muskelbewegungen. Nach der Geburt kommen dann Atembewegungen, (dialogische) emotionale und geistige Bewegungen sowie die eigenständige Lokomotion hinzu.
Bewegung hat damit eine passive (bewegt werdende) und eine aktive (bewegende) Seite.
Es gibt energetische (optische, akustische, elektromagnetische, Wärmebewegung), chemische und emotionale Bewegungsimpulse, die auf mich einwirken. Zu diesen Impulsen trete ich in Resonanz und wirke – bewege mich – dadurch mit. Gleichzeitig gebe ich selbst ständig ebensolche energetischen, chemischen und emotionalen Bewegungsimpulse mit den ihnen innewohnenden Informationen ab, die ihrerseits wiederum die Resonanz bzw. Bewegung meiner Umgebung induzieren.
In Wirklichkeit ist es also so, dass ich immer gleichzeitig als Beweger und Bewegter in Bewegung bin.
4.1 Was mich bewegt ist das, was ich bewege
Was mich bewegt, hängt von meiner Resonanz auf die Bewegung ab. Meine jeweilige Resonanz »bin ich«. Je mehr ich also bewegt werde, desto mehr bin ich das. Lasse ich mich mehr durch Schadenfreude bewegen, bin ich Schadenfreude; lasse ich mich mehr von Mitgefühl und Liebe bewegen, bin ich Mitgefühl und Liebe. Genau das gebe ich als Anregung in meine Umgebung. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass die Umgebung »einstimmig« dazu in Resonanz geht.
Bin ich von meiner Liebe bewegt, wirkt diese Liebe zwar in die Umgebung, kann aber bei manchen Eifersucht oder andere aversive Gefühle auslösen. Ich bewege zwar mit meinen Gefühlen, in diesem Fall meiner Liebe, immer etwas in meiner Umgebung oder gebe einen Impuls an den Anderen, doch wie dessen Bewegung bzw. Resonanz im Einzelnen erfolgt, hängt zunächst von ihm ab. Hier gilt eben genauso: Wovon eine Person bewegt wird, ist auch immer das, was sie (aktiv) bewegt; das bestimmt sie unbewusst und bewusst selbst.
Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass jeder in seiner Bewegung immer gleichzeitig passiv und aktiv ist.
Ich nehme ständig Impulse aus meiner Umgebung auf und setze sie entsprechend meiner Gestimmtheit in meine individuelle Bewegung in der von mir gewünschten Richtung um. Inwieweit dies bewusst oder unbewusst geschieht, ist wieder eine andere Frage.
Beispielsweise erhalte ich einen Impuls durch Katastrophenbilder von Überschwemmungen in Pakistan. Je nach meiner Gestimmtheit und meinen Wertvorstellungen kann ich mitfühlend, gleichgültig, schadenfroh (geschieht den Taliban ganz recht), besserwisserisch (sollten sich früher in Sicherheit bringen) oder verängstigt (jetzt kommen noch mehr Flüchtlinge zu uns) reagieren. Auch wenn es mir nicht bewusst ist, gebe ich die Richtung meiner Gefühlsbewegung vor und erst recht ist es meine Entscheidung, ob ich nichts tue, etwas spende oder gar dorthin fliege, um vor Ort zu helfen.
Meine Entscheidung, mich zu bewegen, ist also nicht unabhängig vom Impuls, doch wie und wohin ich mich ausrichte, ist letztlich meine (meist unbewusste) freie Entscheidung.
Die bewusste freie Entscheidung wird aber fast immer durch gewohnheitsmäßige Reaktions- muster beeinflusst. Als gewohnheitsmäßiger Besserwisser werde ich eher zu eben dieser Reaktion und als ängstlicher Mensch eher zur Angstreaktion bewegt.
Doch auch bei den wie automatisiert ablaufenden Gefühls-, Denk- und Handlungsabläufen behalte ich die Verantwortung dafür.
Gehe ich aus Mitgefühl und Fürsorge irgendwohin, um zu helfen, kann das für viele ein Impuls zu Wertschätzung, Dankbarkeit und Zuneigung sein; für andere ist es ein Grund zu hassen (siehe Hass auf Flüchtlinge und Flüchtlingshelfer).
Aus welchem Blickwinkel ich es auch immer betrachten mag, es bleibt eine Tatsache, dass mich bewegt, was ich bewege; allgemein ausgedrückt: Was einen bewegt, ist das, was er bewegt. Wenn ich es bevorzuge, von meiner Liebe bewegt zu sein, ist es sinnvoll, jeden Impuls von außen zu nutzen, um diesem eine liebevolle, wertschätzende und mitfühlende Richtung zu geben. Der Nutznießer davon bin erst einmal ich. Was dann andere daraus machen, ist deren Sache. Natürlich ist es wünschenswert, dass sie dann dadurch ebenfalls positiv motiviert werden. Meine Bewegung ist jedoch unabhängig davon. Bleibe ich in meiner Liebe, kann mir nichts etwas anhaben.
Das genau meint Jesus, wenn er uns nahelegt, unsere Feinde und die, die uns hassen, zu lieben.
Das ist auch der Hintergrund der tibetischen Tonglen-Meditation. »Gtong-len« bedeutet »aussenden« und »aufnehmen«. Mit der Ausatmung sende ich Liebe aus und mit der Einatmung stelle ich mir vor, Leid aufzunehmen, es in Liebe umzuwandeln und dann wieder Liebe auszuatmen.
Was mich bewegt, ist das, was ich bewege. Schon mit meiner Absicht, den angenommenen Leidimpuls in Liebe zu wandeln bzw. in eine liebevolle Bewegung umzusetzen, bin ich in der Liebe. »Was du suchst, ist das, was sucht« sagt Franz von Assisi. Damit ist ebenfalls gemeint, dass ich mit meiner Absicht, mit meiner Sehnsucht bereits an dem teilhabe, wonach ich mich sehne. Indem ich die Absicht habe, mich vom Leid aufzumachen, um mich zur Liebe hin zu bewegen, bin ich schon in der Liebe.
Der Spannungsbogen der Motivation, des Bewegungsbedürfnisses vereinigt bereits Leid bzw. Mangel als Ursache mit dem Ziel der Erfüllung.
Mit der Tonglen-Meditation mache ich mir diese Tatsache immer wieder bewusst.
Zwischen Bedürfnis und Erfüllung scheinen nur Raum und Zeit, d. h. hier und dort bzw. jetzt und später eingefügt zu sein, die durch meine Bewegung ausgeglichen und aufgehoben werden.
Bedürfnis, Bewegung und Erfüllung sind in Wirklichkeit eine Einheit; eine Einheit, die so als solche wahrgenommen Frieden und Harmonie bedeuten.
Da die Bewegung als das Verbindungsglied zwischen Bedürfnis und Erfüllung fungiert, erlebe ich die Bewegung selbst oft bereits als eine Erfüllung. Das kann zu der Einstellung führen: Egal wohin, Hauptsache ich bin schneller da; die Bewegung dient somit als Selbstzweck.
Diese Vorstellung würde sie aber in ihrer wahren Bedeutung sowohl überschätzen als auch in gewisser Weise unterschätzen. Die Überschätzung wäre, dass es letztlich ausschließlich um die Bewegung gehe; andererseits wäre die Unterschätzung die fehlende Einsicht in die unverzichtbare Vermittlerfunktion zwischen hier und dort, jetzt und später sowie zwischen unerfülltem Mangel und Bedürfniserfüllung.
Wenn aber der Mangel notwendige Voraussetzung für die Bewegung zu der Erfüllung hin und damit notwendige Voraussetzung zumindest für die Wahrnehmung der Erfüllungssehnsucht ist, kann ich so den Mangel als zurzeit noch unverzichtbare Bedingung zur (Selbst-)Wahrnehmung und damit als Hilfe ansehen.
4.2 Bewegung und Trägheit
Physikalisch ist Trägheit die Eigenschaft von Objekten, im aktuellen Bewegungsprozess bzw. in Ruhe zu verharren. Im Zusammenhang mit Bedürfnissen bedeutet sie Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, Schwerfälligkeit, Starrheit, geringe Lebendigkeit und ähnliche eher negativ besetzte Vorstellungen, die der Erfüllung von Bedürfnissen zuwiderlaufen. Unter dem Aspekt des Beharrens in einer vorgegebenen Bewegung hat die Trägheit natürlich auch einen Nutzen. Solange keine Veränderung notwendig oder sinnvoll ist, spart die Trägheit Energie.
Sie unterstützt gleichzeitig die Einhaltung einer eingeschlagenen Richtung, hält auf der Bahn und verleiht meinem Leben damit Konstanz. Ohne diese Trägheit könnte jeder neu auftretende Impuls zu einer Richtungs- und Geschwindigkeitsänderung und so unter dem Aspekt von Bedürfniserfüllung und Zielverfolgung zu einer Umorientierung führen.
Um zum Ziel zu kommen, ist neben der Bewegung auch ein gewisses Beharrungsvermögen (Trägheit) notwendig. Die Gewichtung von Beweglichkeit im Sinne von Flexibilität, Schnelligkeit und Veränderungsbereitschaft einerseits sowie Beharrlichkeit, Spurtreue, Bedächtigkeit und Langsamkeit auf der anderen Seite sind sowohl interkulturell als auch interindividuell verschieden. Auch bei mir selbst kann ich unterschiedliche Phasen feststellen: Mal bewege ich mich mehr in der Nähe des quirligen Pols, mal eher träge.
Natürlicherweise spielen dabei viele ständig wechselnde soziale, psychische, körperliche und energetische Faktoren eine Rolle. Wenn ich z. B. erschöpft oder krank bin, ist Trägheit eher eine Lösung als ein Problem.
Etwas anderes ist es, wenn meine Trägheit Folge eines Bedürfnis- oder eines Zielkonflikts ist.
Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine Seite in mir sich in Richtung Aufgabenerfüllung bewegen möchte, sich eine andere selbstzweiflerische Seite in mir aber nicht die Kompetenz zutraut und mich vor dem Versagen bewahren möchte. Eine Seite sagt: »Ja, mach und bewege dich« und die andere sagt: »Lass es lieber«. Die resultierende aus beiden Strebungen ist Trägheit, möglicherweise bis hin zur Lähmung bzw. völligen Blockade.
Eine andere symptomatische Auswirkung des Ambivalenzkonflikts, der sich aus der Blockade ergibt, ist der Schmerz. Dieser Schmerz verstärkt nun wiederum seinerseits Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, Trägheit und Niedergeschlagenheit.
4.3 Bewegung und Ruhe
Bewegung und Ruhe sind beides unverzichtbare Bedürfnisse. Tatsache ist, dass alles Lebendige in Bewegung bzw. im Fluss ist. Solange ich lebe, laufen in mir aufeinander abgestimmte körperliche, geistige, gefühlsmäßige und energetische Prozesse ab, die in – relativer – Ruhe immer wieder harmonisiert werden. Das ist notwendig, da jeder Gedanke ein Bewegungsimpuls auf allen Ebenen ist, der sich auf der geistigen, auf der emotionalen, auf der körperlichen und auf der energetischen Ebene gleichzeitig abspielt.
Bei sprunghaften Gedanken entstehen so eine große Unruhe und ein Durcheinander der normalen Prozesse bzw. Bewegungsabläufe, die mit hohem Energiebedarf einhergehen.
Das kann sich in vielen unangenehmen Symptomen äußern, die letztlich alle auf das hinweisen, was ich in einer solchen Situation am meisten benötige: Ruhe.
Paradoxerweise kann ich diese Ruhe dann durch körperliche Bewegung finden, indem ich beispielsweise laufe; oder durch verbale Bewegung: indem ich rede. Die Beruhigung kommt dadurch zustande, dass ich damit meiner Bewegung den durcheinander geratenen Gedanken wieder eine zentriertere Richtung gebe: Beruhigung durch Konzentration.
Das Tor aus der Bewegung in die Ruhe finde ich immer im Jetzt. Im Gegenwartsmoment fallen Bewegung und Ruhe zusammen. Dieses Jetzt hat keine zeitliche Ausdehnung und damit im Raum-Zeit-Kontinuum keinen bestimmten Ort.
Es ist einerseits sowohl nicht lokalisiert als auch in seiner Dauer andererseits zeitlos – ewig.
Gleichzeitig ist es überall und nirgends.
Dieses Tor finde ich durch Achtsamkeit und Konzentration. Das beinhaltet, dass ich mich auf das Beobachten konzentriere.
Mit der Beobachtungshaltung hebe ich eine Voraussetzung der Bewegung auf, nämlich woanders hin zu wollen. Ich beobachte bzw. mache mir bewusst, was immer ich gerade erfahre. Was immer auch von dieser Erfahrung von außen bedingt ist und wie bewegend sie jeweils sein mag, sie ist als meine Erfahrung ein Teil von mir, den ich mit meiner bewusst beobachtenden Seite begleite.
Durch die beobachtende Seite bin ich ständig im Hier und Jetzt gegenwärtig.
Bei aller Bewegung bleibe ich somit gleichzeitig in der Ruhe, vorausgesetzt, dass ich nicht verurteile (»so ist es falsch«), sondern auf das Beobachten beschränkt bleibe.
Mit jeder Verurteilung würde der Beobachter in mir zum Auftraggeber, der etwas anderes wollte. Damit erzeuge ich dann Bewegung und falle aus der Ruhe. Deshalb sagt Jesus: »Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet.« Jede Verurteilung und jedes Richten bedeutet Beunruhigung für mich; auch ohne dass mir das von einem richtenden Gott als Schuldstrafe auferlegt wird.
Damit soll keinesfalls behauptet werden, dass ich alles so lassen sollte, wie es ist.
Es geht darum, jedem Impuls, etwas anders haben zu wollen, jeder verurteilenden Bewegung gleichzeitig eine Beobachterposition gegenüber einzunehmen bzw. zu bewahren.
Man kann möglicherweise der Meinung sein, dass es gar nicht anders geht, als das Schlechte, beispielsweise einen Mörder, zu verurteilen. Hier ist es sinnvoll, zwischen dem Schutz der Gesellschaft und meinem inneren Umgang mit dem Mörder zu unterscheiden. Die juristische Verurteilung mit der Folge der Gefängnisstrafe ist ein Akt des Schutzes der Gemeinschaft.
Dabei kann ich in meiner inneren Positionierung gegenüber dem Mörder Mitgefühl haben, da er ja selbst nicht nur wegen der Haft Opfer seiner eigenen Tat ist. Idealerweise gelingt es mir dann vielleicht zunehmend, die Verurteilung durch Mitgefühl abzulösen. Darüber hinaus ist es sogar möglich, dass ich mitfühlen kann, was den Mörder zu seinem Handeln bewegt hat.
Dabei geht es nicht darum, ihn zu entschuldigen – was ja voraussetzt, dass ich ihn vorher verurteilt habe –, sondern ihn zu verstehen. Wie die Gesellschaft und ich dann faktisch mit dem Mörder umgehen, ist eine ganz andere Frage.
Es geht darum, den Zugang zu meiner Ruhe bei gleichzeitiger Bewegung durch mein zunehmendes Mitgefühl immer leichter zu machen.
Zusammenfassend möchte ich die neben dem Mitgefühl hilfreichen Voraussetzungen für die innere Ruhe nennen: Achtsamkeit in einer Beobachterposition meinem bewegten Erleben gegenüber sowie die Konzentration auf den Gegenwartsmoment bzw. den Augenblick.
Das kann ich am besten in der Meditation üben. Je geübter ich darin bin, desto leichter kann ich der mitfühlende Beobachter in jedem Augenblick sein und dies auch zunehmend in meinem Alltag verwirklichen.
Ich kann mir das wie den Mittelpunkt bzw. die Nabe eines sich drehenden Rads vorstellen:
Alle Punkte auf dem Rad bewegen sich wie meine ständig wechselnden Wahrnehmungen.
Der beobachtende Mittelpunkt bleibt unbewegt wie die Nabe in Ruhe.
4.4 Selbstwertempfinden und Bewegung
Wie sehr ein positives Selbstwertgefühl mit Bewegung verbunden ist, habe ich bereits als Säugling erfahren bzw. kann es beim Säugling beobachten. Je freudiger er ist, desto heftiger bewegt er sich mit Strampeln und Armbewegungen und desto bewegter ist seine Mimik.
Dieser Zusammenhang von Bewegungsdrang, Lebendigkeit, Lebensfreude und positivem Selbstwertempfinden ist bei Kindern, Jugendlichen und (jung gebliebenen) Erwachsenen durchgängig spürbar. Hüpfen, Springen und Tanzen sind geradezu Ausdruck eines starken und wertvollen Selbstempfindens. Es gibt sogar Situationen, in denen eine solche überschäumende Lebensfreude aufkommt, dass ich sie tanzend in Bewegung umsetzen muss.
Da immer der ganze Mensch mit allen seinen Erscheinungsformen – Geist, Gefühlen, Körper und Energie – bewegt ist, kann ich dann z. B. durch den Tanz meine Lebensfreude und damit mein Selbstwertgefühl steigern.
Tänze werden von den Menschen seit Urzeiten genau zu diesem Zweck eingesetzt; gerade auch in Lebenssituationen, in denen dies besonders wichtig oder wünschenswert ist.
Zur Hochzeit (Hochzeitstanz), zu anderen Festen (Sonnentanz der Indianer), vor Kriegszügen (Maoris, Indianer), zu spirituellen Zwecken (Tempeltanz) bzw. um sich in Ekstase zu versetzen und zur Angstbewältigung (Beschwörungstanz) werden Tänze ausgeführt.
Es wird zur Initiation (als Frau oder als Krieger), zur Begrüßung, zur Ehrung von Toten bzw. von Ahnen getanzt. Immer geht es um Würdigung, Wertschätzung und damit um Steigerung des Wertempfindens.
Alle Sportarten zielen auf die Steigerung des Selbstwertgefühls ab. Beim Wettkampfsport mit den strahlenden stolzen Siegern ist dies ganz offensichtlich. Wer sich in welcher jeweiligen (vorgegebenen) Art und Weise am besten bewegen kann, erhält die Goldmedaille.
Doch auch dem einsamen Jogger oder Walker im Wald geht es darum; auch wenn nicht jeder zum so genannten »runners high« kommt. Je ausgelassener Bewegungen sind, desto mehr Selbstwertgefühl drücken sie aus und desto mehr sind sie geeignet, ein daniederliegendes Selbstwertgefühl zu stabilisieren. Menschen gestikulieren, laufen hin und her, schaukeln, wippen oder zittern, um wieder ruhiger zu werden.
Umgekehrt ist die Bewegungslosigkeit, die Lähmung, die Starre oder das Gefesselt-Sein mit Hilflosigkeits- und Minderwertigkeitserleben verbunden. Alle möglichen Fahrgeschäfte (Riesenrad, Achterbahn, Schiffschaukel usw.) sowie Autofahren bewirken über die Freude eine Steigerung des Selbstwertgefühls.
Der Kultstatus, den z. B. Autorennfahrer wie Sebastian Vettel oder Michael Schumacher haben, zeigt, wie Wertschätzung und Bewegung miteinander verbunden sind.
Allein die Identifikation des Fans mit seinem stolzen Bewegungshelden hebt das eigene Selbstwertgefühl. Dies gilt entsprechend für Fußball-, Radsport-, Tennis- oder Footballfans.
Prozessionen, Wallfahrten und Pilgern haben noch einen zusätzlichen spirituellen Faktor mit dem gleichen Ziel der Stärkung des Selbst. Entsprechend dem zu Grunde gelegten Menschenbild erfasst eben auch die Bewegung den ganzen Menschen alle Seiten der Person: Gefühl, Geist, Körper und Energie.
Nur auf dem Boden dieser Äquivalenz ist die Wirkung der körperlichen Bewegung auf das Selbstwertgefühl und umgekehrt mein Bewegungsdrang, wenn ich mich wertvoll fühle (mein verliebtes Herz hüpft vor Freude; ich tanze vor Glück), verständlich.
Im sozialen Zusammenhang hat der Selbstwert-Bewegungs-Komplex nochmals eine weitere Bedeutung. In solchen Begriffen wie »Frauenbewegung«, »Arbeiterbewegung« und »Jugendbewegung« kommt dies zum Ausdruck.
Der Selbstwert des Individuums erhält seine Aufwertung durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinschaft, die sich im wachsenden kollektiven Selbstbewusstsein auf den Weg gemacht hat, ihren bestimmten identifikatorischen Wert in Anspruch zu nehmen.
Selbstwertempfinden kann sich nur in der Kommunikation und im Austausch mit der aktuellen Umgebung entwickeln. Entwicklung selbst ist Bewegung.
Verallgemeinernd lässt sich sagen, dass jede Bewegung auch dem Zweck dient, meinen Wert und den jedes Menschen und vielleicht sogar jeder Kreatur zu fühlen und zu erkennen.
Um dies als wertvolle Erfahrung zu meiner unverlierbaren Gewissheit werden zu lassen, ist es notwendig, dass ich im Gegensatz dazu Lähmung, Erstarrung und Ohnmacht leidvoll erlebe, woraus ich durch »bewegte und bewegende Gefühle« von Mitgefühl, Trauer und liebevoller Zuwendung wieder erlöst werde. Je häufiger und bewusster ich diese leidvollen Erfahrungen, die ich implizit aufgrund meiner kulturellen Prägung mit Schuld gleichsetze, als Vorlauf zur anschließenden Erlösung erlebe, desto vertrauensvoller kann ich auch den Tod, den ich mit absoluter Bewegungslosigkeit und Ohnmacht verbinde, als Vorlauf zur endgültigen Erlösung erwarten.
4.5 Selbstbehandlung durch Selbstannahme zur Bewegung (Berührungsakupunktur)
Auch in meiner Trägheit habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch bei meinen Bewegungsschmerzen habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch bei meinen Bewegungsstörungen habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch wenn ich gelähmt bin, habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch bei meiner Bewegungsunruhe habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch bei meiner Sprunghaftigkeit habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch in meiner Unbeweglichkeit habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch wenn ich unruhig bin, habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch mit meiner Beweglichkeit habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch mit meiner Bewegungsfreude habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch mit meiner Flexibilität habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch mit meiner Schnelligkeit habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch mit meiner gelassenen Langsamkeit habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch mit meiner guten Balance von Bewegung und Beharrlichkeit habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch wenn es mir schwerfällt, mich zu bewegen, habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch wenn ich erstarre, habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch wenn ich meine Bewegtheit unterdrücke, habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch wenn ich mich zurückhalte, habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch wenn ich mich kraftlos fühle, habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch wenn ich mich verkrampfe, habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch wenn ich mich verkrieche, habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch wenn ich mich isoliere, habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch wenn ich mich keiner Bewegung anschließen möchte, habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch wenn ich mich aus meiner Erstarrung löse, habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch wenn ich mir Raum nehme, habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch wenn ich mich breitmache, habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch wenn ich mit Leidenden mitgehe, habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch wenn ich mit Schwachen mitgehe, habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
Auch wenn ich mit Sterbenden mitgehe, habe ich Mitgefühl mit mir und liebe mich.
5. Leben als der Atem Gottes
Die Quelle des Lebens ist ein verborgener Schatz, der entdeckt sein möchte.
Atemluft und Atmung sind von der ersten bis zur letzten Lebensstunde unverzichtbar.
Das menschliche Leben begann nach der Schöpfungsgeschichte damit, dass Gott dem Menschen seinen Atem einhauchte. Der Atem Gottes ist das, was uns als Menschen lebendig macht, beseelt und am Leben hält. In vielen Kulturen haben Atem und Seele eine gemeinsame Schnittmenge; man spricht auch von der Atemseele.
Im griechischen Pneuma sind die Bedeutungen »Hauch«, »Luft« und »Geist« enthalten.
Das lateinische Wort »spiritus« (»spiro« heißt »ich atme«) bedeutet ebenfalls »Lebensatem«, Hauch und »Geist«. Ebenso hat im Lateinischen »anima« beide Bedeutungen.
Das chinesische »Qi« oder »Chi« bedeutet »Energie«, »Atem«, »Luft«. Das altindische Wort »atma« bringt »Hauch«, »Seele« und »Selbst« zum Ausdruck; die zeitlose unveränderbare Essenz des Geistes.
Tatsache ist, dass ich durch meinen Atem in einer permanenten, austauschenden Verbindung mit meiner Umgebung stehe. Ich nehme mit der Atemluft meine Umgebung in mich auf, tausche in mir Sauerstoff gegen Wasserdampf und Kohlensäure aus und gebe dies in die Umgebung zurück.
Wenn ich mir also meinen Atem bewusst mache, erfahre ich, dass ich in der Welt bin und gleichzeitig die Welt in mir ist. Ich atme ein und die Außenwelt wird Teil meiner Innenwelt; ich atme aus, und meine Innenwelt wird Teil meiner Außenwelt.
Was ich von meiner Außenwelt in mich aufnehme, Sauerstoff, dient der Bildung von Energie, die im Adenosintriphosphat (ATP) gespeichert wird. Die Atmung befeuert gewissermaßen meine Lebensvorgänge, wie das auch in den östlichen Bedeutungen von »Prana« im Sanskrit und »Chi« im Chinesischen – die Lebensenergie – zum Ausdruck kommt.
Mit dem Atmen wiederhole ich ständig die Belebung durch die Schöpfung, indem ich aus der Atmosphäre (»Lufthülle«) nun aktiv entnehme, was mich am Leben hält, und was der Schöpfer durch seinen Atem in Gang gesetzt hat.
Ich kann bei der bewussten Atmung mit jedem Atemzug einmal das Geschenk des Lebens mit Dankbarkeit für die Schöpfung und den Schöpfer feiern, die Freiheit anerkennen und würdigen, dass ich aus eigener Kraft, selbstbestimmt mir die lebenserhaltende Luft nehmen kann.
Diese Anerkennung und Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens und der Freiheit, alles, was ich zum Leben brauche, aus der Umgebung nehmen zu können, kann ich mit der Absicht verbinden, Gutes und Hilfreiches in die Umgebung zurückzugeben.
Mit der Tonglen-Meditation – »aussenden und aufnehmen« – kann das praktisch umgesetzt werden.
Wenn ich beispielsweise Schmerzen oder Angst habe, kann ich mich mit allen anderen, die unter Schmerzen und Angst leiden, verbinden, indem ich mit dem Gedanken einatme: »Ich trage mit allen von Angst (oder Schmerzen) Geplagten die gemeinsame Angst (oder den gemeinsamen Schmerz).« Bei der Ausatmung denke ich: »Mit ihnen allen will ich mich in Mitgefühl und Liebe verbinden.« Mit diesen Gedanken werde ich gleichzeitig mit dem Atem meinen Bedürfnissen nach Fürsorge, Mitgefühl, Gemeinschaft, Wertschätzung und Liebe gerecht oder erkenne sie zumindest an.
Doch auch ohne solche Gedanken hat es eine heilsame bzw. heilende Wirkung im weitesten Sinn der Bedeutung, wenn ich mir meine Atmung, d. h. jeden einzelnen Atemzug bewusst mache.
Das kann ich beispielsweise, indem ich meine Aufmerksamkeit auf die Empfindung des Atemstroms in meiner Nase richte oder auf die Bewegungen des Brustkorbes und der Bauchdecke achte. Das ist in allen Lebenssituationen möglich; selbst wenn ich etwas Gefährliches tue. Ich kann mir in gefährlichen Situationen beispielsweise sagen: »Ich säge jetzt Holz und bin mir bewusst, dass ich atme.«
Man könnte vielleicht der Meinung sein, dass die gleichzeitige Ausrichtung auf die Atmung mich von meiner Handlung ablenken könnte und damit gefährlich wäre.
Das Gegenteil ist der Fall. Der Gedanke an die Gefährlichkeit vergrößert die Angst.
Die Angst lässt mich einen Teil meiner Aufmerksamkeit in die Zukunft lenken. »Was könnte passieren, wenn?« ist eine Projektion in die Zukunft, also weg vom Hier und Jetzt.
Wenn ich mich während meiner Handlungen, wie gefährlich und anstrengend sie auch immer sein mögen, gleichzeitig auf meine Atmung konzentriere, bin ich im Hier und Jetzt; ich atme immer nur jetzt. Sportschützen, die gewissermaßen mit ihrem Ziel eins werden wollen, achten sehr genau auf ihre Atmung. Gerade wenn höchste Konzentration notwendig ist, ist es wichtig, dass die Beziehung und die Bezogenheit zwischen mir und dem Objekt, das außen in meiner Umgebung erscheint, optimal sind. Nichts möge die Beziehung zwischen mir und dem Objekt, beispielsweise der gefährlichen Situation, irritieren oder trüben. Genau diese Haltung oder Einstellung fördere ich mit der gleichzeitigen Konzentration auf die Atmung. Damit bin ich ausschließlich auf die intime Beziehung zwischen mir und diesem Teil Außenwelt ausgerichtet; ich nehme sie in mich auf und gebe mich in sie hinein. Das führt in meinem Gehirn dazu, dass alle ablaufenden Prozesse und Programme auf diese Beziehung zwischen mir und der Umwelt optimal eingestellt und kalibriert werden.
Ich bin mir damit des Kooperationsmusters bewusst, in welchem die Umwelt und ich gleichzeitig im sich wechselseitig gebenden und nehmenden, bereichernden Miteinander verwoben sind.
Ich kann mir vorstellen, dass der Atem des Schöpfers alles in der Atmosphäre gleichsam umhüllt und er uns mit dem Geschenk des Lebens gleichzeitig die Freiheit gibt, lebenslang aus diesem seinem Atem nach Belieben zu schöpfen. Da ich diese Freiheit und diese Verfügbarkeit an lebenserhaltender Luft gewohnheitsmäßig ständig erlebe, gebe ich ihr keine besondere Bedeutung.
Erst in der (Luft-)Not oder in schlechter Luft wird mir der Wert bewusst; je schlimmer die Not, desto unwichtiger wird mir alles andere und ich will nur noch Luft.
Diese Not, in der mein Leben und damit gleichzeitig meine Person als der Träger dieses Lebens am unmittelbarsten vom Tod bedroht sind, ist gleichzeitig das Äquivalent des hohen Werts meines Lebens und meiner Person.
Durch bewusstes Atmen kann ich zunehmend (ohne Not) in die Wertschätzung und Dankbarkeit für den lebensspendenden und lebenserhaltenden Atem der Schöpfung bzw. dem Schöpfer gegenüber kommen, der mich in seinem Atem erhält.
Je intensiver und ausdauernder mir das gelingt – im Idealfall ständig –, desto lebendiger und geborgener fühle ich mich.
5.1 Atmung und Selbstwertempfinden
Der erste Schrei (eine Ausatmung) bei meiner Geburt ist meine erste befreiende Erfahrung meiner Unabhängigkeit bzw. Befreiung von der Umschlossenheit in meiner Mutter und damit gleichzeitig Befreiung zur Empfindung meines Selbst. Es gibt einen Zusammenhang zwischen meiner Atmung und der Qualität meines Selbstwertgefühls. Wohlbefinden ist mit einer tiefen, ruhigen Atmung verbunden, während Stress mit flacher, schneller Atmung einhergeht.