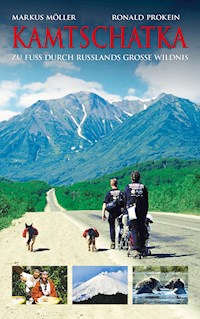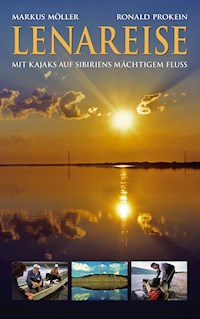Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Guinness-Buch-Rekord: Auf Fahrrädern um die Welt in 161 Tagen. Fast 18.000 Kilometer über Asphalt-, Stein-, Schlamm- und Sandpisten. Geplagt von Mücken, Fieber und Schmerzen durchquerten Markus Möller und Ronald Prokein drei Kontinente, schliefen unter freiem Himmel, in Nobelherbergen und Armenhäusern, in Kirchen und Feuerwehrstationen. Sie gerieten in Handgemenge und Polizeigewahrsam, sprachen mit Botschaftern und Prostituierten, mit Ministern und Unterweltbossen, wurden verwöhnt und bestohlen. Kurz: Ein extremes Rennen. Eine Material-, Kraft- und Nervenprobe hart an der Grenze zur Verzweiflung und eine Flucht nach vorn, weg von einer Kindheit voller Spott und Demütigungen. Doch die Schatten der Vergangenheit fuhren mit ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Christa und Erwin Pro kein
Für Ulrike Wittig und Margarete Möller
ZU DIESEM BUCH
Eines Tages im Mai standen plötzlich die beiden Burschen in der Tür und gaben vor, um die Welt radeln zu wollen. Nicht irgendwie, sondern in Rekordzeit. Natürlich! Quer durch Europa, Asien, Amerika. Sie hatten sich Fahrräder geborgt und einige Wochen trainiert. Das Abenteuer reizte sie. Das Extreme. Sie grübelten über Geldverstecke nach. Von Travellerschecks hatten sie noch nie etwas gehört. Und ein Buch wollten sie schreiben. Irgendwie. Daß sie ein Tagebuch führen müßten, war ihnen schon klar. Also mußten Ratschläge her.
»Registriert vor allem eure Stimmungen, auch eure gegenseitigen Aggressionen ...« Sie lächelten. »Wir kennen uns schon sechzehn Jahre.«
Aber so gut kannten sie sich doch nicht. Nicht sie bestimmten die Gesetze der Reise, sondern umgekehrt. Daheim wurden Wetten abgeschlossen – für und gegen sie. Bei ihnen selbst kam kein Zweifel auf. »Wenn die Technik durchhält, halten auch wir durch.« Konflikte, die durch Nähe entstehen? Unsinn!
Der Schienenfahrzeugschlosser und der Student dachten bald anders darüber. Die Weisheit kam mit der Belastung, die Ausdauer mit dem Willen. War das ein Thema für ein Buch? Reichten für solch ein ehrgeiziges Projekt Tagebuchnotizen aus? Wieder daheim, schrieb jeder die eigene Geschichte auf. Einfach drauflos, ohne Vorsatz. »Nur eins – seid ehrlich!«
Und so wie beim Fahren Blut kam, sollte – bildlich gemeint – auch beim Schreiben Blut kommen. Daß es bei Markus wirklich floß, und zwar aus einem Zwölffingerdarmgeschwür, brachte Unruhe in die »Schreibküche«. Dann aber lag das Manuskript – fast fünfhundert Seiten stark – auf dem Verlagstisch. »Philosophiert nicht und macht keine Kunst!« war der einzige Befehl.
Aus zwei Büchern wurde eins. Die Individualität sollte bewahrt werden. Die besondere Sicht. Daher der Wechsel der Erzählerperspektive. Monatelange Arbeit am Detail. Beschwerlicher als von den beiden gedacht. Und plötzlich ging es nicht mehr um die Fahrt allein. Erinnerungen kamen hinzu, Bilder, Worte, Schmerzen. Das Rennen geriet zu einer Zwischenbilanz. Die abenteuerliche Tour nahm innere Dimensionen an. Und genau darum geht es in diesem Buch.
Die jungen Männer bekamen die Räder, die Ausrüstung und viel Vertrauen mit auf den Weg. Sie machten daraus, was sie konnten. Die Guinness-Buch-Redaktion bestätigte ihnen die Einmaligkeit ihrer Leistung. Nun liegt das Ergebnis dieses Marathons vor, ein »erweitertes« Rennen, das auch für die Mitstreiter an diesem Buch zum Erlebnis wurde und sie – nach all den zahlreichen Stunden – in der Überzeugung stärkte: die meisten Menschen scheitern nicht, sondern geben auf. Und genau in dem Wissen darum, verbirgt sich das Geheimnis des Erfolgs. Ein anderes gibt es nicht.
Warnemünde, im Juni 1995
INHALTSVERZEICHNIS
Abschied
Die erste Grenze
Tüten suppen und Scho ko riegel
Überfall um Mitternacht
Wo ist Walesa?
Dürfen wir nach Rußland?
Wassili
Sturmtage
Ein Konsul in Minsk
Ohne Titel
Schwarz vor Augen
Angst
Wir sitzen fest
Erinnerungen
Aufbruch in die Nacht
Moskau mit Chef und Chauffeur
Neue Erfahrungen
Endstation
Es geht weiter
Graues Rußland
Getrennt durch Ufa
Durch den Ural
»Otkuda wy jedjetje?«
Blitz und Donner
Gejagt
Einst daheim
Steine, Schlamm und Stop!
Weg mit den Schutzblechen
Panik auf dem Feld
Ein Paket von daheim
Wehmut
Interview im Freien
In einem sibirischen Dorf
Am Lagerfeuer
Taiga, Piste und Wodka
Die Einladung
Zwei aus der Heimat
Irkutsk
Entlang des Baikalsees
Echos
Tschüß Rußland! Auf in die Mongolei!
Der Weg nach Ulan Bator
Freunde, Minister und Gangster
Veerspätung
Aufbruch in die Wüste
Die mongolisch-chinesische Grenze
Durch das Reich der Mitte
Der Sturz
Polizeisperre
Ein Unfall
Pekinger Luxus
Durch die Rocky Mountains
Annemarie
Im Nationalpark
Durch die Präne
Ein komisches Gefühl
Die Gang
Bei Carl
Unter dem Tabernakel
Sportstunde
Im Armenhaus
Halloween
Wir werden verdonnert
Chicago
Das Malheur
Durch Indiana und Ohio
Der Maschinenmensch
Zu Gast bei einem Rekordhalter
Durch die Appalachen
Fast beim Präsidenten von Amerika
Highway 1
Finale
Ankunft
Danksagung
Statistik
Wie groß nur ist dieser verdammte Planet? Nimmt das kein Ende? Ich presse die Lippen zusammen, damit diese schwarzen dreckigen Fliegen auf meinem Gesicht nicht in den Mund hineinkriechen. Sie versuchen es durch die Nase.
Drückende Hitze lastet auf der Wüste. Meine rechte Hand rutscht vom Lenker. Krampfhaft wische ich sie am Hosenbein trocken. Schüttelt es mich eigentlich seit fünf, zehn oder fünfzig Kilometern so durch? Ich weiß es nicht. Eine Blutblase platzt. Ich schreie auf und spucke zwei Fliegen aus. Mein Kopf sackt auf die Brust. Die Beine, sie treten noch. Was ist das? Ich sehe vier!
Der leere Wasserkanister in der Vordertasche klappert, der Sattel ächzt, Sand knirscht, Fliegen summen. Ich hasse diese Geräusche und hebe mein Gesicht. Ich hasse diese Gegend, in der ich mich seit Tagen wie in einem Bild an der Wand fühle! Ich reiße den Kopf hoch. Ich hasse diesen ständig blauen Himmel! Und dann, verdammt nochmal, hasse ich dieses ewige Rütteln und Schütteln, hoch und runter, auf und ab! Ein Schrei entringt sich meiner Kehle, die so trocken ist wie diese elende Wüste, grell und lang. Mein Blut pocht im Kopf. Ich springe vom vollbepackten Fahrrad. Es fällt um. Es interessiert mich nicht. Ich weiß nur eins: Dieses braune, gefaltete, gemeine Ding, der sogenannte Weg nach Peking, ist an allem schuld! Ich trete und beschimpfe ihn. Mein Körper vibriert wie bei Schüttelfrost. Ich gehe in die Knie, schleppe mich auf allen vieren zum Fahrrad, krame in der Rahmentasche nach meinem Messer. Wie wild steche ich auf den Sand ein. Meine Hände zittern, sind schweißgebadet. Die Piste soll leiden, genau wie ich. Ich merke noch nicht einmal, daß ich mich an der Klinge schneide. Meine Augen suchen die Gegend ab. Irgendwo in der Ferne sehe ich Ronald. Meine Hände hacken, langsamer werdend, weiter.
Sind wir wirklich so einsam?
ABSCHIED
Rostock. Sonne zwischen dicken Haufenwolken. Stimmengewirr. Kameras klicken. Die Rathausuhr zeigt die elfte Stunde an.
»Okay«, höre ich Ronald flüstern. Wir beginnen zu treten. Sekundenbruchteile später rollen wir an der Menge vorbei. Wie durch Watte hören wir Applaus und daß man uns irgendetwas zuruft. Es ist wie ein Traum. Alles unwirklich und fern. Das also ist der Abschied vom normalen Leben, vom Alltag. Wir fahren in eine Zukunft hinein, die uns Herzklopfen bereitet. Wir lassen die Geborgenheit hinter uns. Daß so viele Freunde und Bekannte zu unserer Verabschiedung kamen, verwirrt uns so nachhaltig, daß wir noch nach zehn Kilometern schweigen. Wir verhalten uns wie Roboter, halten an Ampeln, steigen wieder auf die Sättel. Unsere Beine lassen die Pedale in einem monotonen Rhythmus kreisen. Wir haben, und das wird uns mit jedem Meter bewußt, das Wagnis begonnen. Nun gibt es kein Zurück mehr, es sei denn ...
Die Dörfer hinter Rostock ziehen langsam an Ronald und an mir vorbei. Sie sind mir durch die Ferienreisen mit meinem Vater so vertraut wie die in sattes Grün getauchten Wälder links und rechts der Fahrbahn, wie die braunen Felder, auf denen wir, wenn wir Glück hatten, einen Storch stolzieren sahen. Als Kind kam mir die Welt unendlich groß vor, und sie reichte von Bad Sülze bis nach Thale. Ich erinnere mich der Nächte, in denen ich nicht einschlafen konnte, in denen ich mich aufgeregt im Bett hin und herdrehte, nur weil wir am nächsten Morgen zu einem Tagesausflug nach Berlin aufbrechen wollten, und ich erinnere mich der Tränen und des zugeschnürten Halses, als wir wieder nach Rostock zurückkehrten. Damals freute ich mich, meine Heimat zu verlassen. Ich wollte als Achtjähriger die Welt durch die Augen meines Vaters sehen. Dort, wo er war, schien nichts fremd. Nur neu. Und kehrten wir zurück in die vertraute Welt, bedrückte sie mich. In meinem Kopf schrillte schon die Schulglocke. Die Ferne war einfach schöner.
In diesen Sekunden, die Sonne im Gesicht, spüre ich plötzlich, es ist jetzt umgekehrt. Ich habe Heimweh. Und ich stelle mir die Frage: Warum fahren wir weg von hier, weg von der Heimat, in der wir uns eigentlich geborgen fühlen?
Einige Bauarbeiter am Straßenrand unterbrechen ihre Arbeit und schauen auf. Noch haben wir Kraft zum Winken.
Nach zwanzig Kilometern machen wir unsere erste Erholungspause. Gleich von Anfang an wollen wir uns an einen Rhythmus halten. Eine Stunde Leistung und eine Viertelstunde Kräftesammeln. Das soll der Schlüssel zum Erfolg sein. Vor drei Monaten gab uns Arved Fuchs diesen Tip am Telefon.
Ronald nimmt sein Basecap in die Hand und streicht sich mit der anderen über den kahlrasierten Schädel.
»Endlich sind wir auf der Straße. Ich meine, das war es doch, was wir wollten«, sagt er und kneift dabei wegen der Sonne ein Auge zu. Er hat recht, genau das wollten wir, also bitte. Dieser Abschied setzt uns ärger zu, als wir dachten. Er erinnert mich an einen Morgen im Juni, Jahre zuvor. Mein Vater stand, müde von der Nachtschicht in der Schweißerei, im Rahmen der Wohnungstür und drückte mich an sich. Ich wußte, einen Moment später würde ich die Treppen hinunterrennen müssen, um nicht den Bus ins Wehrlager der Schule zu verpassen. Zwei Wochen, die sich wie zwei Jahre aufblähten.
Die Räder rollen wieder. Was für viele wie eine Kunst aussieht, bei der Masse des Gepäcks das Gleichgewicht zu halten, erschien uns gestern noch ebenso.
Wir standen im Wohnzimmer, die Fahrräder und das Gepäck vor uns und wußten nicht, wie unsere große Ausrüstung in die kleinen, wasserdichten Taschen passen sollte. Und wir stopften aufgeregt Stück für Stück hinein. Alles mußte an seinen richtigen Platz.
Wir verteilten all unsere Sachen nach einem einfachen Plan. Ronald übernahm das Werkzeug und die Video- und Fotoausrüstung an seine Low-Rider, die vorderen Gepäckträger. Ich schnallte mir eine Medizin- und die Verpflegungstasche an die Fronträder.
Dabei war es außerdem wichtig, ein ausgeglichenes Gewicht auf beiden Seiten zu schaffen, und keiner sollte mehr mit sich schleppen als der andere. Hinter die Sättel kam das meiste Gepäck. Die gesamte Kleidung, je zwei Schlafsäcke, dick und dünn, Kocher, Topf, Benzinflaschen, das Zelt, die Isoliermatten, der Wasserfilter und die Taschenlampen preßten wir in die großvolumigen Taschen. Immer wieder gingen wir die Notizen unserer Planung durch. Was konnte noch fehlen? Dabei drehten sich die letzten Wochen um nichts anderes. Unser Erfolg würde auch von dieser Ausrüstung abhängen.
Wir befestigten die Rahmentaschen an der Mittelstange. In ihnen verstauten wir die Grußbotschaften des Rostocker Oberbürgermeisters, ein Messer, Nähzeug, unsere Tagebücher und jede Menge Papierkram, um Grenzen zu passieren und versichert zu sein.
Beim Anblick der vollbepackten Räder beschlichen uns Zweifel, mit diesen Vehikeln schnell voran zu kommen. Sie wirkten wie Motorräder ohne Antrieb.
Ein Fahrrad nach dem anderen, jeweils 35 Kilogramm schwer, schleppten wir zwei Stockwerke nach unten und standen endlich auf der Straße.
Damit legen wir uns hin, dachte jeder von uns. Aber es ging. Wir kamen sogar auf Geschwindigkeit. Ronald stieß ein lautes »Yeäh« aus. Es hallte durch die Nacht. Und wenn wir im Licht eines Autos auf das Tacho sahen, zeigte es tatsächlich zwanzig Stundenkilometer an. Wir fühlten uns befreit von einem Teil unserer Ängste. Unter einer Laterne stoppten wir, stellten die Räder aneinander und setzten uns an den Straßenrand, um stumm unsere Drahtesel zu betrachten. Der Mond schien, und wir hatten das Gefühl, schon unterwegs zu sein. Ein neues Leben stand vor der Tür, und wir wollten sie öffnen, koste es, was es wolle.
Nach jeder Pause wechseln wir die Führung, mal Markus, mal ich. Bei Gegenwind hat es so nur einer schwer.
Tessin liegt hinter uns, bald auch Gnoien. Ein paar Kilometer weiter, auf einem riesigen Bauernhof, wohnen meine Großeltern. Ich muß an den rauchigen Schinken in ihrer Speisekammer denken. Auch erinnere ich mich an den Geruch von frischgebackenem Brot. In unserer Verpflegungstasche sieht es leider anders aus.
Gedankenversunken nehme ich Abschied von der weiten Allee, dem Stallduft und den bunten Gartenzäunen, die mich vor fünfzehn Jahren noch überragten. In diesen Jahren, als ich einer der Kleinsten und Dünnsten in meiner Klasse war, hatte ich immer unglaubliche Angst, meine Eltern zu verlassen. Schon Wochen vor Beginn der Ferien wälzte ich mich im Bett umher und sah der Abfahrt ins Ferienlager mit Grauen entgegen. Wenn dann der Bus mit den fremden Kindern und mir losfuhr und ich nicht aufhören konnte, meinen Eltern zuzuwinken, heulte ich wie ein Schloßhund. Auch meine Mutter weinte. Mir war, als zöge ich in den Krieg. Gleich am ersten Tag schrieb ich einen Brief: »Lieber Papa! Liebe Mama! Das Wetter ist schön. Wir sind an der Ostsee. Doch holt mich ab, ich habe Heimweh!«
An der Kreuzung nach Neukalen fahren wir ein wenig langsamer. Wir erinnern uns an einen heißen Julitag vor knapp zwei Jahren. Damals bogen wir, zu Fuß aus Rostock kommend, hier ein. In unseren Beinen steckten schon 53 Kilometer. Ziel dieses verrückten Vorhabens war es, diese Strecke ohne Pause zurückzulegen.
Dieser Gewaltmarsch führte uns zum ersten Mal an unsere Leistungsgrenzen. Die Hitze ließ die Luft über dem Asphalt flimmern. Ich erbrach mich während des Gehens und zitterte am ganzen Leib. Dabei ging es auch Markus nicht königlich. Seine Waden schmerzten, als wären sie von Messern durchbohrt. Und immer noch 12 Kilometer bis Kleverhof, elf, zehn. Plötzlich hupte ein LKW und blieb neben uns stehen. Verschwommen sahen wir eine Gestalt, die sich aus dem offenen Fenster beugte und sagte: »Los Jungs, springt auf. Wohin wollt ihr denn?« Die letzten Reserven mobilisierend winkten wir wortlos ab.
Nach 65 Kilometern und fast 12 Stunden öffneten wir die Hoftür zum Grundstück meiner Großeltern. Und als wir endlich in der Küche saßen und je eine Flasche Apfelsaft in einem Zug leerten, fragten die alten Leutchen: »Warum ist euer Bus so spät gekommen ...?«
Ohne diesen damaligen Marsch säßen wir jetzt wohl nicht auf Material im Wert von 20000 Mark, um etwas zu wagen, was vor uns noch niemand wagte: eine Gewaltfahrt rund um die Welt. Von Rostock nach Rostock und immer vorwärts.
Vor einem Sportladen in Demmin ziehen wir die Bremsen. Wir brauchen gepolsterte Bikerhosen. Die helle Glocke des Geschäfts schellt, als ich die Tür öffne. Ronald wartet derweil draußen, denn die Räder sind uns heilig. Keine Sekunde wollen wir die Schmuckstücke aus den Augen lassen.
Der hagere Verkäufer schaut mich fragend an ... Kurz darauf sucht er mit kantigen Bewegungen die passenden Größen heraus und fragt: »Wo soll’s denn hingehen? An den Kummerower See?«
»Etwas weiter«, sage ich und lege ihm zwei Hunderter auf den Tisch.
Draußen, mitten auf der Hauptstraße, ziehen wir die neuen Hosen über die Unterwäsche, denn die Hintern schmerzen bereits.
Fünfzehn Minuten sind vorbei. Wir gönnen uns keine Minute länger Pause und steigen auf. Es sitzt sich spürbar besser.
Viele Menschen halten uns für übergeschnappt. Sie glauben nicht daran, daß zwei unbeschriebene Blätter wie wir so eine mörderische Tour durchstehen.
Es gibt Tollkühne, Mutige und Angsthasen. Wir glauben an die Mitte. Tollkühne sind meist Waghalsige, die Risiken auf sich nehmen, ohne darüber nachzudenken. Aber zuviel Angst macht unsicher. Das Beste ist es, seine Angst unter Kontrolle zu halten. Dann kann sie der beste Freund sein, den man haben kann.
Kenner der Szene meldeten ihre Zweifel vor allen Dingen aufgrund unserer mangelnden Erfahrungen mit Fahrrädern an. »In zwei Wochen sind die wieder zu Hause, jede Wette.«
Gewiß, wir können gerade mal einen Schlauch flicken, haben uns ein paar Handgriffe in einer Fahrradwerkstatt abgeguckt, das muß reichen. Pech kann man auch mit der tollsten Ausrüstung haben, und außerdem: Ein Fahrrad ist schließlich kein Auto.
Aufgebockt stehen unsere Räder vor einem Hotel in Anklam. Wir füllen die leeren Trinkflaschen mit Leitungswasser.
Als wir wieder auf die Straße treten, ruft eine Frau vom gegenüberliegenden Haus her aus dem offenen Fenster: »Hallo, gerade habe ich Sie im Fernsehen gesehen. Warten Sie einen Moment!«
Als wir die Flaschen verstauen, fotografiert sie uns dabei fleißig. Dann streicht sie mit ihrem Handrücken über unsere erhitzten Wangen, bevor sie wieder im Hausflur verschwindet.
Ein Telefonat ist noch zu führen: Mit einem Kameramann in Rostock. Seit vier Monaten versuchte er, das ganze Universum – wie er meinte – in Bewegung zu setzen, um uns mit der Kamera zu begleiten. Der Mann ist klein, aber sein Traum ist groß, und jetzt sollte dieser Traum wahr werden. Mit einem Wagen wollte er uns folgen. Das würde uns nicht nur die Sorgen um den Verpflegungsnachschub abnehmen, wir kämen auch problemloser durch bürokratische Schleusen, hätten eine Bezugsperson.
Unsere Spannung wächst mit jedem Rufzeichen. Endlich nimmt unser Hoffnungsträger den Hörer ab. Er macht viele Worte über die Angst der Sender, in Unbekannte zu investieren und arbeitet sich so zu einem klaren »Nein« hin. Wir sind betroffen und für den ersten Augenblick ratlos.
Als Trost will man uns eine Videokamera nach Warschau schicken. Wir hängen den Hörer ein und fühlen uns verlassen. In diesen Sekunden wissen wir, es gibt nur uns. Der eine wird die Garantie für den anderen sein.
An einem Ziegelturm hinter Anklam bauen wir im Abendrot das Zelt auf. Unsere Hälse sind noch wie zugeschnürt, als wir die drei ineinandersteckbaren Aluminiumstangen in die dafür vorgesehenen Tunnel fädeln und uns gegenseitig Mut zusprechen.
Die Stangen werden gebogen und aus dem olivgrünen Stück Stoff formt sich ein Iglu. Das übten wir vorgestern neben dem Rodelberg in Rostock-Evershagen zum ersten Mal.
Einige Minuten später – es dämmert bereits – probieren wir den »Whisperlite«-Kocher aus und reden über unser Heimweh. Das hilft ein wenig.
Ronald fuhr als Matrose mit einem Zerstörer der Bundeswehr schon neun Wochen lang auf dem Atlantik, kennt sich mit dem Gefühl, lange unterwegs zu sein, aus. Ich dagegen brachte es bisher nur auf zwei Wochen, in Afrika.
Wir haben den Kocher angezündet. Benzingeruch liegt in der Luft. Die Nudelsuppe kocht schnell. Während wir, nicht allzu hungrig, mit zwei Löffeln aus einem Topf essen und ab und zu einen Bissen Brot abbeißen, senkt sich Dunkelheit auf uns. Irgendwo schreit ein Käuzchen.
Wir krabbeln in die dünnen Schlafsäcke. Das Licht der Taschenlampe fällt auf die leeren Tagebuchseiten. Meine Finger sind eingeschlafen, so schreibe ich die ersten Worte ziemlich krakelig. Draußen knattert ein Motorrad vorbei. Dann ist es wieder still.
Beide haben wir bisher noch nie ein Tagebuch geführt, dementsprechend allgemein sind auch die ersten Sätze. Wir bekamen den Tip, unsere Aufzeichnungen zu schematisieren – Statistik, Tageserlebnisse und persönliche Gefühle. Jeder schreibt sein eigenes Tagebuch. Dann stellen wir den Wecker, beten und ziehen uns in unsere Gedankenwelt fernab dieses Ortes zurück.
In dieser Nacht träume ich von unserer Ankunft in Rostock. Es ist immer noch Frühling und die Menschen stehen noch immer so da, wie bei unserer Abfahrt. Ich steige vom sauberen Fahrrad und umarme das blonde Mädchen, dessen Bild ich bei mir trage. Der Traum zerfließt, als ich friere und erwache.
DIE ERSTE GRENZE
Das Klingeln des Weckers reißt uns aus dem Schlaf. Ronald kramt nach seiner Uhr. Damit ich überhaupt etwas sehe, setze ich erst einmal meine »Aschenbecher« auf. Ich hasse diese Brille. Schon vor Jahren ließ ich mir deswegen Kontaktlinsen anfertigen. Die Brille ist das Relikt eines anderen Lebens. Immer, wenn ich sie aufsetzte, fühlte ich mich minderwertig. Mädchen schauten mich an wie eine Witzfigur, sagten: »Hallo, Süßer!« Dann gingen sie lachend weiter. Wenn mich eine Faust im Gesicht traf, flog die starke Brille zuerst auf den Boden. Am liebsten lege ich sie heute weit weg von mir. Nur kurz nach dem Erwachen ist das ein Problem, denn ohne Sehhilfe bin ich fast blind.
Wir pellen uns aus den Schlafsäcken, streifen zuerst die Radlerhosen über, dann die grauen Trainingshosen mit der Sponsorenwerbung. Zum Schluß die dicken Vliespullover.
Ronald öffnet die beiden Reißverschlüsse des Vorder- und Hauptzelts und stöhnt: »Wie langweilig! Grauer Himmel!«
Die Schuhe wurden über Nacht klamm. Draußen stehen wir zunächst unschlüssig herum und sammeln uns. Von gestern noch ein wenig gerädert, setzen wir uns auf die Taschen und löffeln die kalten Reste der Nudelsuppe. Dann schiebe ich meine Kontaktlinsen auf die Pupillen. Weil die Hände dreckig sind, brennt es fürchterlich. Nach einiger Zeit spült die Tränenflüssigkeit den Schmutz heraus. Ronald fängt unterdessen an, das Zelt abzubauen.
Bald ist alles verstaut, alles aufgeschnallt, die Fahrräder parken abfahrbereit vor dem Turm in Anklam. Wenige Minuten später sind wir wieder »on the road«. Die Müdigkeit ist verflogen. Richtung Südosten, entlang der B 109, führt uns der Weg nach Pasewalk. Über uns eine Wolke, groß wie der Himmel. Die Welt scheint schwarzweiß gemalt. Ein grauer Schleier überzieht alles. Auf meiner Hand verteilen sich die ersten Regentropfen. Bald fließt Wasser mein Gesicht herab.
Unter einem Baum halten wir, lehnen die Räder an einen Gartenzaun, nehmen die runden roten Säcke und Isoliermatten ab, streifen die Ersatzreifen über den Sattel und öffnen die Hintertaschen, um die regendichte Kleidung herauszuholen. Die knallroten Anzüge aus »Polartec« sollen angeblich keinen Tropfen Wasser durchlassen und den Schweiß nach außen transportieren. Wir fühlen uns im Regenschutz gefangen wie in einer Ritterrüstung. Und warm wird uns auch sogleich.
Der Asphalt glänzt im Regen. Em Wasserfilm zieht sich an den Reifen hoch. Wir haben uns die Kapuzen übergestülpt. Die Tropfen trommeln darauf.
Am Straßenrand – riesige Werbeplakate. Die Marktwirtschaft zieht gen Osten. Autos zischen an uns vorbei. Auf einem großen Femstraßenschild steht »Szczecin«. Wir nähern uns der polnischen Grenze, dennoch will die Zeit nicht vergehen. Besonders während der ersten Tage unserer Tour dehnt sie sich.
Endlich – die Grenzanlagen. Wir folgen einem Reisebus auf polnisches Territorium. Links eine Wechselstube. Der Raum ist winzig. Ein alter Herr lugt über seine Brille. »Wieviel Sie tauschen?«
»Hundert«, antworten wir und verlassen wenig später als Millionäre den Raum.
In Szczecin verstärkt sich der Regen. Wir fahren in Richtung Bydgoszcz und mühen uns außerhalb der Stadt keuchend einen nichtendenwollenden Anstieg empor. Wir schwitzen, sind unter der »Polartec«-Kleidung pitschnaß. Diese scheint genug damit zu tun zu haben, den Regen abzuhalten.
TÜTENSUPPEN UND SCHOKORIEGEL
Leichter Rückenwind schiebt uns durch den polnischen Westen. Wir haben die Sonne wieder und eine gute Stimmung. Während wir über pommersche Hügel rollen, pfeifen wir leise vor uns hin. Die weißen Richtlinien der Straße spulen sich schneller und schneller ab. Es geht voran, obwohl die Anstiege uns zwischendurch zusetzen.
Hinter dem nächsten Hügel finden wir das, woran wir schon den ganzen Tag dachten. Durch hohe Bäume glitzert das Wasser eines Sees wie Kristall. Wir rollen die Abfahrt hinab, stoppen, lehnen die Räder aneinander. Dann kramen wir nach Seife und Handtuch, laufen die Böschung hinunter, überschlagen uns fast und werfen die überflüssige Kleidung von uns. Der Uferschlamm schmatzt unter den Füßen. Wir rennen ms kalte Wasser. Fünf Minuten später steigen wir wieder auf die Sättel. Der Waschgang schraubte die Gefühle eine Stufe höher. Es macht Spaß, unterwegs zu sein, voranzukommen!
Einige Stunden zuvor kauften wir in Recz das erste Mal auf der Reise Lebensmittel ein. Es ergab sich wie selbstverständlich, daß mir die Rolle des Einkäufers zuteil wurde, weil ich es schon seit Jahren durch meinen eigenen Haushalt gewohnt bin. Ronald bewachte unterdessen die Räder.
Geruch von faulen Kartoffeln strömte aus der Baracke, und ich hatte das Gefühl, wieder in der DDR zu sein, als ich den Türknauf in der Hand hielt. Zwei Regale – eins mit polnischen und eins mit westlichen Waren
– unterschieden sich vor allem durch die Preise. Ich leerte den gesamten »Twix«-Behälter in den Einkaufskorb. Von uneingepackter Wurst wollten wir die Finger lassen. Da aber keine Konserven aufzuspüren waren, plünderte ich das Suppenregal. Ein Brot fand ich auch. Bereits hier in Polen bestaunten die Verkäuferinnen meine Kleidung. Mir war das peinlich.
Durch das Schaufenster sah ich Ronald mit einigen Schulanfängern herumkaspern. In ihren Augen flackerte Begehren, als wir die Einkäufe verstauten und sie die vielen Schokoriegel sahen. Aber wir müssen mit dem Geld haushalten. Unsere Sponsoren hatten uns nicht mit Bargeld überhäuft, das kam zumeist aus unserer eigenen Tasche. Und da die Süßigkeiten für uns Wegzehrung waren, mußten wir den Knirpsen gegenüber hart sein. Aber auch ein paar Späße ließen uns zu Freunden werden
– und eine Flasche Cola.
Es ist unglaublich, aber jeder Tritt in die Pedale bringt uns ein Stück weiter nach Hause, obwohl wir eigentlich davon fortfahren.
Auf einem Hügel bremst ein Auto direkt vor uns. Wir müssen anhalten. Zwei Männer entsteigen dem Opel Vectra. Sie tragen helle Anzüge und bunte Krawatten. Ihr Haar ist grau, die Gesichter – braungebrannt und faltig. Einer von ihnen zückt einen Fotoapparat.
»Mensch, Jungs, wir haben euch bei der Abfahrt gesehen!«
Auch zwei ältere Damen in luftigen Blümchenkleidern haben sich aus dem Fond des Opel gezwängt und lächeln uns an.
»Machen Sie hier Urlaub?« fragt Ronald in die Runde.
»So ähnlich. Ich will mir mit meinen Geschwistern meine Heimat ansehen«, antwortet der Dickere der beiden Herren. »Wir haben, das heißt, wir hatten einen hübschen Hof hier ganz in der Nähe.«
»Mit dreiundzwanzig Hektar Land«, ergänzt der andere.
»Und ihr, Jungs, erfüllt ihr euch auch einen Kindheitstraum?« setzt die Frau mit dem schlohweißen Haar nach, während sie unsere Kleidung mustert.
»Wir müssen weiter«, sagt Ronald unruhig. Wenig später zieht das Auto mit den Deutschen an uns vorbei.
»Die vier wollen zurückholen, was ihnen mal gehörte«, schreit Ronald in den Wind. »Nicht zu fassen!«
Gegen viertel neun, nach knapp acht Stunden im Sattel, steuern wir einen Acker in der Nähe von Sadki – 50 Kilometer vor Bydgoszcz – an. Wir schieben die Räder durch die Furchen und erleben eine Mückeninvasion. Immer mehr stechende und sirrende Monster fallen über uns her, saugen unser Blut. Wir wollen ihnen entkommen. Es gelingt uns nicht. Völlig kopflos stellen wir schließlich die Bikes an einen Telegrafenmast. Wir brüllen in die Mückenwolke und schlagen unkontrolliert um uns. Die Viecher stechen uns, verfangen sich zwischen den Wimpern und brennen in den Augen wie Feuer. Irgendwie schaffen wir es, das Zelt und den Kocher aufzustellen, und während die polnische Tomatensuppe zu kochen beginnt, flüchten wir ins Zelt und jagen alle Mücken hinaus.
Endlich ein paar Minuten Ruhe.
ÜBERFALL UM MITTERNACHT
In Bydgoszcz glauben wir zunächst in eine Demonstration geraten zu sein. Männer und Jungen in schwarzen Anzügen, Frauen und Mädchen in schneeweißen Kleidern. Es ist Fronleichnam. Ein sonniger Frühlingstag. Jeder Einwohner des Städtchens scheint unterwegs zu sein, um Jesus zu gedenken. Die Leute singen.
Ein Bürschlein läuft eilig an uns vorbei, hin zu dem Prozessionszug. Sein weißes Gesicht sieht verschlafen aus. Die Backenknochen arbeiten sichtbar an einem Bissen. Ich erinnere mich, wie ich manchmal ebenso zur Schule rannte. Ich war damals 12 Jahre alt und wog lediglich 31 Kilogramm. Ich sah aus, als würden mir meine Eltern nichts zu essen geben. Doch ich konnte so viel in mich hineinschaufeln, wie ich wollte, mein Körper blieb der eines »Spargeltarzans«. Und meine Haut war so weiß wie Kalk. Ich nahm drei Stufen auf einmal und rannte die Treppen des Schulgebäudes hinauf. Während des Laufens entledigte ich mich meiner Jacke und stieß die Tür zum Klassenzimmer auf.
»Mücke hat wieder verschlafen! Hahaha!« tönte es mir entgegen. Erst jetzt bemerkte ich, daß mein Pullover verkehrt herum an mir herunterhing ...
Der Junge ist in diesen Sekunden bei der Prozession angekommen und erhält von einem dicken Mann einen Klaps auf den Hinterkopf.
Ich schrecke aus dem Schlaf. Blaulicht zuckt über das Zelt. Hastig ziehe ich den Zeltverschluß auf. Auch Markus ist wach geworden. Er blickt sich fragend um. Ich muß meine Augen zusammenkneifen. Licht blendet mein Gesicht. Dann senkt sich der Strahl in unser Zelt, leuchtet es aus. Zwei Polizisten fordern mich mit einem Wink auf herauszutreten.
»Passportui?« Ich wühle die beiden grünen Büchlein aus der Rahmentasche des Fahrrads. Dann stehe ich, nur mit einem Turnhemd und kurzer Unterhose bekleidet, fast im »Stillgestanden« vor ihnen. In der Aufregung habe ich nicht daran gedacht, mir etwas Langes überzuziehen. Sofort sind wieder die blutsaugenden Mückenscharen zur Stelle. Überaus genervt klatsche ich um mich. Den Polizisten machen die Mücken scheinbar nichts aus. Gewichtig blättern sie in den Reisepässen und fragen mich ohne Eile über das Woher und Wohin aus.
Nach schier endlosen zehn Minuten reichen sie mir die Pässe zurück, und ich kann ins rettende Zelt springen.
Die Ordnungshüter verschluckt die Dunkelheit.
WO IST WALESA?
Auf der Autobahn nach Warschau regnet es sich ein. Dennoch machen wir nach jeder Stunde Fahrt eine Pause: Das ist uns bereits zur Routine geworden. Eine Stunde Kampf. Fünfzehn Minuten Pause – auflockern, essen, trinken, pinkeln. Fotografieren wir oder hält uns etwas anderes auf, fahren wir fünf oder zehn Minuten länger.
Als es zu regnen aufhört, sehen wir Warschau vor uns. Das Tacho zeigt 745 Kilometer an. Die erste Hauptstadt auf unserer Reise. Für uns bedeutet das, zum Präsidentenpalast zu fahren, um Lech Walesa eine Botschaft des Oberbürgermeisters von Rostock in die Hand zu drücken.
Wir trafen Rostocks Stadtoberhaupt an einem kalten Märztag, stolperten geradewegs in dessen Büro und nahmen in den Ledersesseln Platz. In seinem Blick lasen wir die Frage: Was wollen diese zwei schmutzigen Burschen von mir? Unsere Trainingsanzüge trieften vor Nässe, und an mir klebte noch der Dreck von einem Sturz. Nach unserer Trainingsstrecke hatten wir aufs Geratewohl an die Rathaustür geklopft, und Minuten später saßen wir vor dem Oberbürgermeister und erzählten von einem Traum, der sich im November des Vorjahres in unseren Köpfen festgesetzt hatte. Wir berichteten ihm, wie am 2. Januar das Training begann, wie wir zu den ersten Sponsoren kamen. Wir zeigten Zeitungsausschnitte, in der Hoffnung, die Stadt würde uns mit Geld unterstützen und sagten außerdem, daß es uns am Herzen liege, Rostock in der Welt – nach den Krawallen in Lichtenhagen – ein besseres Image zu verschaffen. Der Oberbürgermeister schien beeindruckt. Doch leider sei die Stadtkasse für so etwas leer, aber eine Botschaft, die könne er uns mit auf den Weg geben. Und als die Stunde der Abfahrt schlug, kam er vor das Rathaus, überreichte uns das Papier und sagte: »Wenn Sie Weihnachten wiederkommen, klopfen sie ruhig bei mir.« Er nahm wie zum Tischgebet unsere Hände und nickte in die Kameras.
Die Sonne verschwindet schon hinter den Häusern, als wir vor dem Präsidentenpalast stehen. Ein Wachhäuschen, riesige Umzäunung, unzählige Zimmer und eine Fassade, die an sozialistische Zeiten erinnert. Unsere Schritte schallen durch die riesige Eingangshalle. Nachdem der Wachmann unser Russisch nicht verstanden hat, sollen wir an einer hausgroßen Tür klopfen. Wir öffnen sie, treten in ein Büro mit dem Bild des Papstes an der Wand. Darunter eine Matrjoschka in Menschengestalt. Sie hat ein rundes, braunes Gesicht, sitzt hinter einem Berg Papierkram und füllt ein Formular aus. Als sie uns wahrnimmt, sagt sie, daß sie Lydia, die Sekretärin des Bürgermeisters, sei. Ich kann mir nicht vorstellen, wie alt sie ist. Etwa vierzig? Oder sechzig? Wir setzen uns auf samtbezogene Stühle. Lydia legt den Kugelschreiber aus der Hand, kommt hinter ihrem schweren Schreibtisch hervor und öffnet das Fenster. Tut sie das etwa, weil wir so stinken? Anschließend brüht sie Tee für uns auf und reicht Kekse dazu, solche mit Schokoladenüberzug.
»Leider, leider ist der Herr Walesa nicht da, meine Jungens, was wollen wir tun?« Ihr schwarzes, zurückgekämmtes Haar schaukelt hin und her. »»Und mein Chef ist auch schon gegangen. Es ist Freitagnachmittag.«
Ihr Lächeln steckt an. Immerhin gibt es Tee und Kekse für die Rostokker Botschaft. »Bitte leiten Sie das Schreiben weiter«, schlägt Ronald vor. Wir geben es ihr. Bevor wir gehen, schiebt sie uns mit einem wehleidigen Blick ihr Stullenpaket herüber.
Die allabendliche Schlacht mit den Mücken soll heute ein Ende haben. Hier, 40 Kilometer hinter Warschau, ziehen wir – beim köstlichen Duft der Wiener Würstchen – an zwei polnischen Zigaretten. Wir rauchen zum ersten Mal in unserem Leben. Der Geruch des Essens verfliegt, blauer Qualm hängt in der Luft und beißt im Rachen. Tränen steigen uns in die Augen, und wir husten, was das Zeug hält. Die Zigarette geht zu Ende, die Asche verglimmt, die Mücken surren wieder herbei. Lydia hat uns einen schlechten Rat gegeben. So verkleiden wir uns wieder zu Stoffballen. Die Notlösung.
DÜRFEN WIR NACH RUSSLAND?
Die Autoschlange hinter Terespol staut sich kilometerlang. Vor ihr liegt Rußland. Genügen Reisepaß, Visa und zwei Einladungen, um in Brest einzufahren? In Rostock sagte uns der russische Konsul: »Nehmen Sie Kontakt mit meinem Außenministerium auf! Ohne dieses läuft nichts.«
Geschockt lasen wir den Bericht von fünf Amerikanern, die mit dem Rad von St. Petersburg nach Wladiwostok fuhren. Sie brauchten ein Visum für umgerechnet 10000 Mark und eine russische Begleitmannschaft. Zwei Wochen vor unserer Abfahrt schickten wir einen Antrag auf zwei russische Visa zu einem speziellen Reisebüro nach Dresden. Garantieren konnte uns niemand etwas. Schließlich ist es ungewöhnlich, daß jemand Rußland per Fahrrad durchqueren will.
In Warschau erreichte uns außerdem ein Fax vom russischen Fahrradsportverein. Eine Einladung. Würde das alles reichen?
Wir stehen vor dem Schlagbaum. Die Leute in den Autos, an denen wir vorbeifahren, kleben förmlich an den Scheiben, um uns anzustarren.
Die Schranke wird hochgelassen. Ein kleiner Uniformierter kommt auf uns zu. Der Pole hat einen winzigen Kopf und lacht vor sich hin. Leider verstehen wir einander überhaupt nicht. So wechselt er ins Russische: »Pasporty, pashaluista.« Erwartungsvoll halten wir ihm die Ausweise hin. Unerträgliche Spannung. Er sagt nichts mehr, zieht nur unsere Visa heraus und gibt die Ausweise zurück. Die Frau im nächsten Häuschen, eine Russin, drückt uns einen Stempel hinein. Wir schweigen, getrauen uns noch nicht, uns zu freuen. Ein letzter Grenzbaum wartet auf uns. Dahinter steht ein hagerer Russe.
»Ah! Radfahrer!« sagt er. »Ich kann auch sagen >Guten Tag< und >Scheiße<. Sie wohin wollen?« Lässig umrundet der Beamte unsere Ausrüstung. Das glatte Gesicht läßt ihn wie einen Zwanzigjährigen wirken, das lichte Haar aber macht ihn viel älter.
»Nach Peking«, antwortet Markus abwartend.
Ein lautes Lachen schießt aus dem Grenzer. Er biegt sich dabei.
»Drei Monate«, schiebe ich nach.
»Njet, Njet!« Er bekommt kaum Luft, während wir ihn verdutzt ansehen. Irgendwann beruhigt er sich und winkt uns durch. Wie? Hat er tatsächlich ostwärts gewunken?
Wie auf Eiern fahren wir die ersten Meter auf weißrussischem Boden, gewärtig, ein lautes »Stop« zu hören. Wir werden immer schneller. Autobahnverkehr saugt uns auf, und die Silhouette Brests ragt in den Abendhimmel. Goldene Wolken ziehen am Horizont, als wir über die Schulter zurückblicken und das Glück kaum fassen können, die Grenze ohne Probleme passiert zu haben. Gleichzeitig fühlen wir die riesige Weite des Landes. Wir fahren in die Dunkelheit hinein.
In Brest, dem Tor zum Osten, brennt keine einzige Laterne. Die Straßen müssen kurz nach dem Krieg genauso ausgesehen haben. Ein tiefer Krater neben dem anderen. Mit den kleinen Fahrradfunzeln entdecken wir sie erst im letzten Moment. In einen hineinzukrachen, könnte das vorläufige Ende der Aktion bedeuten. Wir reißen die Augen weit auf, konzentrieren uns.
In einem düsteren Wald hinter der Stadt schaukeln wir auf einem hügeligen Weg einem Licht entgegen. Hier soll ein Zeltplatz sein. Aber nichts.
Nur strohgedeckte Bauernhäuser. Unsere Vorfreude auf einen sicheren Platz zum Übernachten schwindet. Wie zwei Landstreicher trampeln wir durch das kleine Dorf. In einer offenen Tür stehen ein dicker Mann und ein Mädchen, das mit seinen langen, schwarzen Zöpfen spielt. Wir parken die Räder und nähern uns ihnen, wir grüßen und leuchten unsere Gesichter mit der Taschenlampe an. Vielleicht weckt es Vertrauen zu uns. Und siehe da, die beiden lächeln vorsichtig. Endlich können wir miteinander reden. Dazu müssen wir unsere Russischkenntnisse aus dem Hinterstübchen kramen. Der Bauer ist uns behilflich. Er beauftragt seine Tochter Tamara, uns den Weg zum Zeltplatz zu zeigen. Zu dritt ziehen wir durch einen dunklen Wald. Tamara scheint Angst vor uns zu haben. Fünf Meter Sicherheitsabstand hält sie zu uns ein, stellt unsicher Fragen.
»Warum tragt ihr die Haare so kurz?«
»Wegen der Hygiene«, antwortet Markus freundlich.
»Kommt ihr gut voran auf dem Waldboden?«
»Kein Problem«, sage ich ruhig. Ausgelaugt und müde schieben wir die »Bleiräder« über den holprigen Weg. Plötzlich rutscht mein Lastesel auf einer feuchten Stelle scheppernd zur Seite weg. Tamara stößt einen hellen Schrei aus und springt erschrocken in einen kleinen Brombeerstrauch. Links vor uns taucht plötzlich eine schwarze Wand auf. Es ist der Zaun des Zeltplatzes. Das schlanke Mädchen klettert über das hohe Holztor und öffnet es von innen. Hundegebell ertönt. Der Nachtwächter nähert sich. Tamara scheint ihn gut zu kennen. Er stellt sich uns als Sergej vor und lacht wiehernd wie ein Pferd.
In den letzten Stunden sahen wir nicht auf die Tachoanzeige. Um so überraschter sind wir, als wir 202 Kilometer ablesen. Ein neuer Etappenrekord! Als wir die Uhren vergleichen, gehen unsere eine Stunde nach. Wir sind in einer anderen Zeitzone angekommen.
WASSILI
Ich öffne das Zelt. Frische Waldluft strömt mir entgegen. Ronald liegt im Gras und rekelt sich genüßlich. Außer unserem Iglu entdecke ich kein weiteres Zelt. Wieder allein. Jedenfalls werden wir heute faul sein.
Während Ronald das Essen zubereitet, wechsle ich ein defektes Pedal gegen ein neues aus. Etwas später fließt aus der Dusche, die sich neben dem Speisesaal befindet, warmes Wasser über unsere verschwitzten Körper. Auf der Wiese tollt Tamaras Hund. Sie selbst muß in der Küche arbeiten und hat keine Zeit für uns. Aber Wassili, der Wächter, hat sie.
Wir setzen uns auf die steinigen Stufen zu dem Mann in der speckigen, braunen Jacke und versuchen, unser Schulrussisch anzuwenden. Er nimmt seine Schildmütze ab, streicht sich mit einer Hand durch die lichten Haare und zeigt mit der anderen wehleidig auf seine Knie. Anscheinend hat er Rheuma.
»Ich muß jeden Tag aus dem Dorf hierher fahren.« Sein braungebranntes Gesicht legt sich in tiefe Falten, und er blickt zu dem Lada Niva hinüber, der neben dem Verwaltungsgebäude steht. Ronald nickt anerkennend, Wassili winkt ab: »Nein, nein, der gehört dem Arzt.« Wassili besitzt nur ein Motorrad. Ein rostiges Ding.
»Wie lebt es sich eigentlich jetzt hier?« frage ich.
»Das Geld reicht für Brot und Benzin.«
»Das ist nicht viel«, entgegnen wir.
»Aber besser als der Sozialismus«, posaunt Wassili.
»Hast du nicht Angst, daß in Rußland ein neuer Hitler an die Macht kommt?« fragt Ronald.
»Nun ja, was soll ich sagen? Hitler war ein Schwein und Stalin war ein Schwein. Kann es noch schlimmer kommen?«
Wassili muß nach dem Wasserdruck im Kessel sehen. Schwerfällig erhebt sich der 65-jährige von der Treppe, stemmt sich, die Hände auf die Knie gestützt, hoch und verschwindet im dunklen Flur. Der Mann trägt eine grüne Armeehose, der am Gesäß ein großer Flicken aufgenäht wurde. Seine ehemals braunen Schuhe sind viel zu weit für seine Füße. Er hat keine Socken an.
»Im Kapitalismus wird alles besser gehen«, ruft Wassili aus der Tiefe des Gebäudes.
Ob er wirklich daran glaubt? Ihm fehlen fast alle Zähne, und sein Rükken ist krumm.
STURMTAGE
Seit Stunden keine Kurve, nicht die kleinste Richtungsänderung auf der Autobahn. Dazu nadelfeiner Dauerregen. Das Schlimmste ist: Seit dem Morgen faucht uns der Sturm in die Gesichter. Manchmal können wir kaum die Balance halten. Im Windschatten von Ronald zu fahren ist schwer, aber als erster ist es die reinste Qual. Selbst fluchen können wir nicht, weil der Sturm den Stimmen die Kraft nimmt. Und links einmal treten und rechts einmal treten. Der Körper arbeitet wie eine Maschine.
Ronald wird müde. Ihm fallen nach dem stundenlang anhaltenden Kampf die Augen zu. Er taumelt. Ich muß mit ihm reden, sonst schläft er ein. Auch mir ist schummrig.
»Weißt du noch«, rufe ich ihm zu, »als wir damals mit den Rennrädern von Rostock nach Chemnitz gefahren sind?«
»Ja«, klingt es leise von hinten.
»Wir haben nicht nachgedacht. Sind einfach losgefahren.«
»Ja«, höre ich nur wieder.
»Drei Nächte, fast ohne Pause, kaum was gegessen. Vierhunderteinundneunzig Kilometer. Und so müde waren wir. Aber angekommen sind wir doch, oder?« rufe ich lauter.
»Ja, das stimmt«, ertönt es diesmal endlich deutlicher.
Und die Zeit vor vier Jahren wird wieder lebendig: Der Klingelknopf an dem Haus hing so tief, daß ich meinen Rücken krümmen mußte, um ihn zu erreichen. Während dieser Bewegung durchfuhr mich plötzlich ein stechender Schmerz. Ich schrie auf. In diesem Moment öffnete sich die Tür, und die beiden Mädchen, deretwegen wir so weit gefahren waren, standen da und schrien ebenso. Wir mußten ihnen wie Wegelagerer erschienen sein, wie Waldschrats, dreckig, verschwitzt und mit verzerrten Gesichtern. Aber dann sprangen sie uns freudig entgegen.
Am Nachmittag merken wir, es ist nichts mehr zu essen da. Hunger peinigt uns. Und kein Geschäft weit und breit. Wir fahren auf der Autobahn nach Minsk. Nach einer Ewigkeit taucht vor uns ein kleines Dorf mit Holzhäusern auf. Wir klopfen an einer morschen Tür. Ein weißhaariger Bauer öffnet, seine Frau mit buntem Kopftuch steht hinter ihm.
»Haben Sie Brot?« fragt Ronald höflich.
Er hat keins. Noch nicht. Aber der Brotwagen soll gleich kommen. Was Speck heißt, wissen Ronald und ich nicht. Ich zeige auf ein herumlaufendes Schwein und meinen Mund. Der Weißrusse öffnet die Tür ganz und führt mich in ein karg eingerichtetes Zimmer. Wände und Möbel aus altem Holz ohne Glanz. Im Haus riecht es muffig. In der Küche, auf dem Tisch, steht eine halbgeleerte Flasche Wodka inmitten von Brotkrümeln.
Der alte Mann öffnet ein großes Faß mit schneeweißem Inhalt.
>Salz?< denke ich. Er drückt mir ein rasierklingenscharfes Messer in die Hand und gibt mir zu verstehen, daß ich mich bedienen soll. Ich steche in das Salz. Aha! Darunter steckt der Speck. Ich schneide ein anständiges Stück heraus. Die Bäuerin packt noch ein paar Knoblauchzehen dazu.
»Wieviel Geld?« frage ich. Der Bauer antwortet, ich solle ihm geben, was ich wolle. Ich drücke ihm zwei Mark in die schwielige Hand, umgerechnet 18000 weißrussische Rubel.
So wie die beiden haben wir uns als Kinder nur zu Weihnachten gefreut. Sie winken uns noch lange nach. Wie aber kommen wir zu Brot?
Wieder auf der leeren Autobahn überholt uns ein grüner Armeelaster mit der Aufschrift »Chleb«. Er stoppt jäh. Der Fahrer und unser weißhaariger Bauer springen heraus. Unsere Freude über den Brotwagen ist überaus groß. Wir sacken zwei quaderähnliche Brote ein und zücken einen Zehnmarkschein. Wir haben es nicht kleiner, doch darüber sind die Männer keineswegs traurig. Erst später, als wir den Kurs umrechnen, wird uns klar, daß wir ihnen einen Extramonatslohn gegeben haben. Ist das der Kapitalismus, auf den Wassili baut? Die beiden Männer hätten uns gewiß auch den Kühlergrill des Transporters verkauft, wenn wir ihn gebraucht hätten.
Der neue Tag ist ein Spiegelbild des gestrigen. Kein Ort, kein Mensch, nur das dumpfe Dröhnen der wasserspritzenden Trucks und das Heulen des Windes. Das Trinkwasser ist aufgebraucht. Sollen wir nun die Münder gen Himmel öffnen und den Regen auffangen? Kilometer um Kilometer, Stunde um Stunde vergeht.
Plötzlich sehen wir ein Schild mit einem aufgemalten Wasserhahn. Noch sechs Kilometer. Durst kratzt in der Kehle. Dann aber erreichen wir die so sehr herbeigesehnte Raststätte. Doch außer einer zerschlagenen Pumpe finden wir nichts.
Hinter einem verfallenen Haltestellenhäuschen kommt frierend ein kleiner Junge hervor. Er gibt uns zu verstehen, daß er Andrjuscha heiße und auf seine Eltern vom Kolchos warte. Andrjuscha hält eine gefüllte »Bonaqua«-Flasche in der Hand. Auf die Frage, wieviel sie kosten soll, bekommen wir »Eine Deutschmark« zur Antwort. Die Flasche enthält nicht das Originalwasser, aber Durst macht nicht wählerisch. Der Kleine schnappt sich die Mark und verschwindet wieder hinter dem grünen Bushäuschen, während wir die Flasche leeren.
Einige Kilometer weiter, wir trauen unseren Augen kaum: eine richtige Raststätte. Gierig nach etwas anderem als Wasser und Brot schieben wir die Räder einen Abhang hinauf und lehnen sie gegen den Kiosk.
Welch grandiose Auswahl! Nehmen wir Kuchen oder Kekse, Bananen oder Äpfel, Brot oder Brötchen? Ich kaufe von jedem etwas und dazu eine Kiste mit Brause. Wir setzen uns auf eine Mauer und schlemmen.
Merkwürdig. Ein Stück Brot kann einfach nur ein Stück Brot sein. Es kann aber auch so etwas wie Schinken, Kaviar oder Camembert sein. Der Geschmack richtet sich nicht nach dem Preis und den Zutaten, sondern nach dem Hunger.
Zu all unserem Glück reißt die dunkle Wolkendecke auf, und die Sonne strahlt, wenn auch nur kurz, hindurch.
Als am Abend das Wasser zum Kochen fehlt, zieht Ronald los, um eine Pfütze zu suchen. Mit dem Filter in der Hand verschwindet er hinter dem Hügel. Ich baue indes das Zelt auf und beobachte einen Mann, der über das Feld spaziert. Plötzlich flucht er, weil er seinen Fuß in etwas setzte, das eigentlich uns gehörte.
Als Ronald nach einer dreiviertel Stunde noch immer nicht aufkreuzt, beginne ich, mir Sorgen zu machen. Unbegründet, denn schon sehe ich seinen Kahlkopf hinter dem Hügel hervorkommen. Der Filter pumpte zu langsam, verstopfte nach dreimaligem Ansaugen. Deshalb muß ein Liter Wasser für die Knoblauchsuppe reichen.
Ich erinnere mich der Kochkünste meiner Großmutter. Sie schnitt Brot in kleine Würfel, tat sie zu den weißen Knoblauchzehen. Beides schüttete sie, wie ich, in einen großen Topf mit heißem Wasser. Ich gebe auch etwas Grünes dazu, jungen Sauerampfer und einige Brennesselblättchen. Wo aber frischen Rahm hernehmen? Wir haben nur Salz.
Großmutter legte den Deckel auf und ließ das Ganze solange kochen, bis der Knoblauch sein Aroma in der ganzen Suppe ausgebreitet hatte. Und ich erinnere mich noch sehr gut, daß ich stets die größte Portion haben wollte.
Ich rühre in unserer Suppe, schalte die Benzinzufuhr des Kochers aus. Die kleine Flamme erlischt. Wenig später – wir essen aus demselben Topf – schlürfen wir unser Mahl mit spitzen Lippen. Schon der zweite Löffel kostet Überwindung.
EIN KONSUL IN MINSK
Wenn wir morgens erwachen, sieht jeder von uns – es wird langsam zur Qual – den anderen neben sich. Jeden Tag dieselbe verquollene Fratze. Beide schlucken wir den Groll darüber hinunter. Anstelle eines Mädchens, das man früh um sechs Uhr gernhaben könnte, gähnt einen ein Kahlschädel an. Wir freuen uns bereits auf die ersten Stoppelhaare, die bald wachsen werden. Außerdem überfällt uns jeden Morgen ein »Wo-binich?-Ach-du-Scheiße-hier«-Gefühl. Es hält jedoch nie länger als ein paar Minuten an.