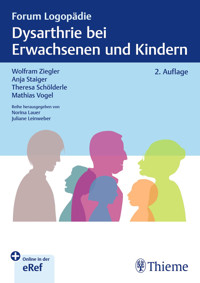
59,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thieme
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Forum Logopädie
- Sprache: Deutsch
„Dysarthrie bei Erwachsenen und Kindern“ bietet Ihnen gebündeltes Wissen zu allen Aspekten dieser neurogenen Sprechstörung und unterstützt Sie dabei, Wissen aufzubauen und Ihre Fähigkeiten zu vertiefen. Das essentielle Handbuch deckt alle wichtigen Themen ab. Übersichtlich und praxisnah werden die Prinzipien und Methoden für die sprachtherapeutische Versorgung von Erwachsenen und Kindern dargestellt – basierend auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft.
- Grundlagen verständlich und kompakt: Bauen Sie eine solide Wissensbasis auf, um dysarthrischen Störungen in allen Facetten zu verstehen.
- Moderne Diagnostik- und Therapiekonzepte: Entdecken Sie die neuesten Ansätze und Methoden zur Diagnose und Behandlung von Dysarthrie bei Erwachsenen und Kindern.
- Praxisrelevante Inhalte State-of-the-art: Profitieren Sie von einer klaren und verständlichen Darstellung der Inhalte, basierend auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft.
Dieses Buch ist ein wertvoller Begleiter für Ihre tägliche Arbeit. Es bietet Ihnen nicht nur verlässliches Wissen, sondern auch praktische Entscheidungshilfen und Anregungen, um dysarthrische Störungen spezifisch zu behandeln.
Jederzeit zugreifen: Der Inhalt des Buches steht Ihnen ohne weitere Kosten digital in der Wissensplattform eRef zur Verfügung (Zugangscode im Buch). Mit der kostenlosen eRef App haben Sie zahlreiche Inhalte auch offline immer griffbereit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 753
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Dysarthrie bei Erwachsenen und Kindern
Reihe herausgegeben von
Norina Lauer, Juliane Leinweber
Wolfram Ziegler, Anja Staiger, Theresa Schölderle, Mathias Vogel
2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage
30 Abbildungen
Forum Logopädie
Herausgegeben von Norina Lauer und Juliane Leinweber
In dieser Reihe sind folgende Titel bereits erschienen:
Achhammer B, Büttner J, Sallat S, Spreer M: Pragmatische Störungen im Kindes- und Erwachsenenalter Bauer A, Auer P: Aphasie im Alltag. Bigenzahn W: Orofaziale Dysfunktionen im Kindesalter, 2. Aufl. Biniek R: Akute Aphasie. Aachener Aphasie-Bedside-Test, 2. Aufl. Bongartz R: Kommunikationstherapie mit Aphasikern und Angehörigen.Grundlagen – Methoden – Materialien. Brockmann M, Bohlender JE: Praktische Stimmdiagnostik. Theoretischer und praktischer Leitfaden. Bühling S: Logopädische Gruppentherapie bei Kindern und Jugendlichen.Cholewa J: Spezifische Sprachentwicklungsstörungen. Modellgeleitete Sprachdiagnostik.Corsten S, Grewe T: Logopädie in der Geriatrie. Costard S: Störungen der Schriftsprache, 2. Aufl. Grande M, Hußmann K: Einführung in die Aphasiologie, 3. Aufl. Huber W, Poeck K, Springer L: Klinik und Rehabilitation der Aphasie – Eine Einführung für Patienten, Angehörige und Therapeuten. Jaecks P: Restaphasie. Jahn T: Phonologische Störungen bei Kindern. Diagnostik und Therapie, 2. Aufl. Knels C: Sprache und Ernährung bei DemenzKotten A: Lexikalische Störungen bei Aphasie. Lauer N: Auditive Verarbeitungsstörungen im Kindesalter, 5. Aufl. Lauer N, Birner-Janusch B: Sprechapraxie im Kindes- und Erwachsenenalter, 3. Aufl. Masoud V: Gruppentherapie bei neurologischen Sprachstörungen. Möller D, Spreen-Rauscher M: Frühe Sprachintervention mit Eltern – Schritte in den Dialog. Nebel A, Deuschl G: Dysarthrie und Dysphagie bei Morbus Parkinson, 2. Aufl. Niebuhr-Siebert: Lese- und Schreiberwerb. Nobis-Bosch R, Rubi-Fessen I, Biniek R, Springer L: Diagnostik und Therapie der akuten Aphasie. Nonn K: Unterstützte Kommunikation in der Logopädie. Rittich E, Tormin S, Bock B: Prävention von Stimmstörungen.Sandrieser P, Schneider P: Stottern im Kindesalter, 5. Aufl. Scharff Rethfeldt W: Kindliche Mehrsprachigkeit. 2. Aufl. Grundlagen und Praxis der sprachtherapeutischen Intervention. Schlenck C, Schlenck KJ, Springer L: Die Behandlung des schweren Agrammatismus. Schnitzler CD: Phonologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb. Schrey-Dern D: Sprachentwicklungsstörungen. Logopädische Diagnostik und Therapieplanung. Sick U: Poltern, 2. Aufl. Spital H: Stimmstörungen im Kindesalter. Stadie N, Hanne S, Lorenz A: Lexikalische und semantische Störungen bei Aphasie. Wachtlin B, Bohnert A: Kindliche Hörstörungen in der Logopädie. Weigl I, Reddemann-Tschaikner M: HOT – Ein handlungsorientierter Therapieansatz für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen, 2. Aufl. Wendlandt W: Sprachstörungen im Kindesalter. Materialien zur Früherkennung und Beratung, 8. Aufl. Wendlandt W: Stottern im Erwachsenenalter. Ziegler W, Staiger A, Schölderle T, Vogel M: Dysarthrie bei Erwachsenen und Kindern.
Vorwort der Herausgeberinnen
Mit der neuen Auflage des Buches zur Dysarthrie liegt, 15 Jahre nach der ersten Auflage, eine umfassende Überarbeitung und sehr umfangreiche Ergänzung zu diesem relevanten Thema vor. Dysarthrien sind die häufigste Form neurogener Kommunikationsstörungen und stellen ein zentrales Behandlungsfeld in der Logopädie und Sprachtherapie dar. Die Störung betrifft nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder, was eine differenzierte Betrachtung und spezifische therapeutische Ansätze erforderlich macht. In der Neuauflage werden daher erstmals auch kindliche Dysarthrien umfassend berücksichtigt.
Dysarthrie ist weit mehr als eine Beeinträchtigung der Artikulation – sie hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Kommunikationsfähigkeit und damit auf die soziale Teilhabe der Betroffenen. Eine fundierte Diagnostik und gezielte therapeutische Intervention sind daher notwendig, um die Lebensqualität von Menschen mit Dysarthrie nachhaltig zu verbessern. Die Bedeutung dieser Störung für die logopädische Praxis zeigt sich auch in der Vielfalt der diagnostischen und therapeutischen Ansätze, die in diesem Buch detailliert beschrieben werden.
Nach der gewohnt fundierten Darstellung der theoretischen Grundlagen zu Sensomotorik und Neuroanatomie werden die Ursachen und die Klassifikation der Dysarthrien differenziert erläutert. Auch der Diagnostikteil wurde intensiv überarbeitet. So werden in dieser Auflage die Bogenhausener Dysarthrieskalen (BoDyS) vorgestellt sowie die KommPaS-Webapp zur digitalen Diagnostik von Sprechstörungen. Zudem wird der Diagnostik kindlicher Dysarthrien ein eigenes Kapitel gewidmet, um den spezifischen Anforderungen dieser Altersgruppe gerecht zu werden.
Der Therapieteil zeichnet sich erneut durch seine umfassende und praxisorientierte Darstellung aus. Neben den Grundlagen der Behandlung sprechmotorischer Störungen werden spezifische Therapiekonzepte ebenso vorgestellt wie zahlreiche Übungen für die unterschiedlichen sprechrelevanten Funktionsbereiche. Die Kombination aus medizinischen, sensomotorischen und kommunikationsorientierten Verfahren bietet sowohl für die Behandlung von Erwachsenen als auch für die Therapie kindlicher Dysarthrien wertvolle Anregungen und praxisnahe Lösungsansätze.
Neben den Autoren Wolfram Ziegler und Mathias Vogel sind mit Theresa Schölderle und Anja Staiger zwei weitere Autorinnen hinzugekommen, die ihre Expertise im Bereich neurogener Sprechstörungen im Kindes- und Erwachsenenalter in das Werk eingebracht haben. Damit ist ein Buch entstanden, das für Lernende, Lehrende und Praktiker*innen, aber auch für Expert*innen im Bereich neurogener Sprach- und Sprechstörungen eine unverzichtbare Quelle darstellt.
Wir freuen uns, dass die zweite Auflage dieses Buches die Reihe Forum Logopädie bereichert, und wünschen ihm eine breite Leserschaft!
Regensburg und Göttingen, Februar 2025
Norina LauerJuliane Leinweber
Vorwort zur 2. Auflage
Dysarthrien sind neurologisch bedingte motorische Störungen des Sprechens. Unter den neurogenen Kommunikationsstörungen sind sie die weitaus häufigsten, mit schätzungsweise 1% Betroffenen in Deutschland. Dazu zählen Menschen aller Altersgruppen - Kinder mit früh erworbener oder genetisch bedingter Hirnschädigung, junge Erwachsene mit unfallbedingten Hirnverletzungen oder entzündlichen Erkrankungen des Gehirns und viele ältere Menschen mit unterschiedlichen Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems. Gemessen an der Bedeutung, die dysarthrische Störungen für die soziale und berufliche Teilhabe haben können, ist die fachliche Auseinandersetzung mit den Grundlagen, der Diagnostik und der Behandlung dieser Störungsbilder in Deutschland und auch international wenig ausgeprägt. Es besteht insbesondere ein Mangel an theoretisch und empirisch fundierten diagnostischen und therapeutischen Standards, was im klinischen Alltag nicht selten zu Verunsicherung in der Diagnosestellung und zu Unsicherheiten im therapeutischen Handeln führt. Mit unserem Buch, jetzt in der zweiten Auflage, wollen wir für eine intensivere Auseinandersetzung mit diesem wichtigen Thema werben, aktuelles Grundlagenwissen vermitteln und Hilfestellungen für die zielgeleitete Untersuchung und eine wissensbasierte Behandlung von Personen mit Dysarthrien anbieten.
Warum eine Neuauflage? Seit der 2010 erschienen Erstauflage gab es in vielen Bereichen Neuerungen und Weiterentwicklungen, die eine Aktualisierung der Inhalte dringend erforderlich gemacht haben. Dies sind einige der neuen Schwerpunkte:
Die jüngeren Fortschritte auf dem Gebiet der kindlichen Dysarthrien - ein Thema, das in unserer ersten Auflage noch sträflich vernachlässigt wurde - sind jetzt zu einem wichtigen Bestandteil des Buches geworden, mit ausführlichen Abschnitten über die Grundlagen, die Diagnostik und die Behandlung dieser Störungen. Damit haben die kindlichen Dysarthrien erstmals in ein deutschsprachiges Lehrbuch Einzug gehalten.
Die diagnostischen Kriterien und die Terminologie in der Klassifikation der neurologischen Erkrankungen, die den Dysarthrien zugrunde liegen, sind einer ständigen Weiterentwicklung unterworfen. Wir orientieren uns in der Neuauflage an den jüngsten Aktualisierungen der jeweiligen Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN).
Mit dem wachsenden Interesse an den Folgen neurodegenerativer demenzieller Erkrankungen sind in den vergangenen Jahren neben den Aphasien zunehmend auch die Dysarthrien, die bei diesen Syndromen auftreten, in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten. Sie werden deshalb auch hier unter diesem Gesichtspunkt neu thematisiert.
Die Bedeutung diagnostischer Verfahren, die spezifisch auf die Erfassung kommunikativer Einschränkungen und die soziale Teilhabe gerichtet sind, hat sich in den vergangenen Jahren weiter verstärkt. In der Neuauflage haben diese Methoden, besonders die im deutschen Sprachraum verfügbaren, mehr Gewicht bekommen.
Schließlich ist die Evidenzbasierung therapeutischer Maßnahmen auch für die Dysarthriebehandlung - wie für alle Bereiche der neurologischen Rehabilitation - zu einem Schlüsselthema geworden. Wir werfen aus dieser Perspektive einen kritischen Blick auf konventionelle und neue Therapiemethoden und bieten Hilfestellungen zur Herleitung wissensbasierter und physiologisch begründeter Vorgehensweisen.
Unsere Sicht auf die Störungsbilder der Dysarthrien gründet auf langjähriger Forschungstätigkeit und umfangreicher therapeutische Erfahrung. Sie speist sich aus Kooperationen mit erfahrenen Therapeut*innen und Neurolog*innen aus vielen Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland und aus dem Austausch mit Kolleg*innen auf nationalen und internationalen Fachtagungen. Besondere Erwähnung verdient hier Hermann Ackermann, mit dem wir in unserer Arbeit über die vielen Jahre hinweg eng und freundschaftlich verbunden waren und der selbst einen wesentlichen Beitrag zur Sichtbarkeit der Neurophonetik in Deutschland und international geleistet hat. In der didaktischen Aufbereitung des umfangreichen Stoffs konnten wir auf Erfahrungen aus vielen Jahren intensiver Interaktion und Diskussion mit Studierenden und Therapeut*innen in Lehre und Fortbildung aufbauen.
Viele unserer eigenen Forschungsergebnisse, die in dieses Buch eingeflossen sind, sind in studentischen Abschlussarbeiten oder in Doktorarbeiten in der Entwicklungsgruppe Klinische Neuropsychologie (EKN) entstanden. Bei den vielen Studierenden und Promovendinnen, die an unseren Dysarthrieprojekten beteiligt waren, möchten wir uns ausdrücklich bedanken. Besonderen Dank schulden wir an dieser Stelle Elisabet Haas, die als Studentin, Doktorandin und EKN-Mitarbeiterin unsere Arbeiten zu den kindlichen Dysarthrien und zur Entwicklung von BoDyS-KiD entscheidend mit vorangetrieben hat.
Grundlage für diese fruchtbare Verknüpfung mit universitärer Lehre war unsere jahrzehntelange enge Verbindung mit dem Institut für Phonetik und Sprachverarbeitung der Ludwig-Maximilians-Universität München, ehemals initiiert durch Hans Tillmann und viele Jahre wissenschaftlich und kollegial begleitet durch Phil Hoole. Mit der tatkräftigen und wohlwollenden Unterstützung durch den heutigen Institutsdirektor, Jonathan Harrington, sind wir 2015 auch Teil dieses Instituts geworden.
Unsere Arbeit war immer getragen durch das kollegiale und freundschaftliche Umfeld in der EKN und der Klinik für Neuropsychologie des Städtischen Klinikums Bogenhausen und die vertrauensvolle Unterstützung der Direktoren unserer Klinik, Yves von Cramon und Georg Goldenberg. Für die langjährige Förderung unserer Forschungsarbeit danken wir vor allem der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), der Studienstiftung des Deutschen Volkes, der Bayerischen Sparkassenstiftung und der ReHa-Hilfe e.V.
München, März 2025
Wolfram ZieglerAnja StaigerTheresa SchölderleMathias Vogel
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Forum Logopädie
Vorwort der Herausgeberinnen
Vorwort zur 2. Auflage
1 Einleitung
1.1 Definition
1.2 Dysarthrie als Gesundheitsproblem
1.3 Zu diesem Buch
2 Sensomotorische Grundlagen
2.1 Funktionskreise des Sprechens
2.1.1 Respiratorischer Funktionskreis
2.1.2 Laryngealer Funktionskreis
2.1.3 Velopharyngealer Funktionskreis
2.1.4 Linguo- und labiomandibulärer Funktionskreis
2.2 Zusammenspiel der Muskeln und Funktionskreise
2.2.1 Anatomische Kopplungen zwischen den Funktionskreisen
2.2.2 Aerodynamische Kopplungen zwischen den Funktionskreisen
2.2.3 Synergistische Organisation der Sprechbewegungen
2.2.4 Im Zusammenspiel der Funktionskreise: Prosodie
2.3 Entwicklung sprechmotorischer Funktionen
2.3.1 Sprechatmung
2.3.2 Phonation
2.3.3 Artikulation
2.3.4 Velopharyngeale Funktionen
2.4 Rolle sensorischer Informationen
2.4.1 Somatosensorisches Feedback
2.4.2 Auditives Feedback
2.4.3 Visuelles Feedback
2.4.4 Sensorische Informationen in der sprachlichen Interaktion
2.4.5 Sensomotorische Kontrolle des Sprechens: Ein Modell
3 Funktionelle Neuroanatomie der Sprechmotorik
3.1 Neuronale Komponenten der Sprechmotorik im Überblick
3.2 Periphere Nerven und Hirnstammmechanismen
3.2.1 Zweites (peripheres) motorisches Neuron: „motorische Endstrecke“
3.2.2 Sensorische Neurone
3.2.3 Formatio reticularis
3.3 Limbisches („emotionales“) Aktivationssystem
3.4 Neokortikales (willkürmotorisches) Kontrollsystem
3.4.1 Sensomotorischer Kortex und erstes (zentrales) motorisches Neuron
3.4.2 Basalganglienschaltkreise
3.4.3 Kortikozerebelläre Schaltkreise
3.4.4 Supplementärmotorische Area
3.5 Sprechmotorische Planung und der „dorsale Strom“
3.6 Entwicklung des neuronalen Netzwerks des Sprechens
4 Ursachen dysarthrischer Störungen
4.1 Schlaganfall
4.2 Schädel-Hirn-Trauma
4.3 Zerebralparese
4.4 Multiple Sklerose
4.5 Parkinson-Syndrome
4.5.1 Parkinson-Krankheit (PK)
4.5.2 Atypische Parkinson-Syndrome
4.6 Huntington-Krankheit
4.7 Dystonien
4.8 Hereditäre Ataxien
4.8.1 Spinozerebelläre Ataxien (SCA)
4.8.2 Friedreich-Ataxie (FRDA)
4.9 Neuromuskuläre Erkrankungen
4.9.1 Motoneuronerkrankungen
4.9.2 Neuromuskuläre Übertragungsstörungen: Myasthenia gravis (MG)
4.10 Häufigkeit von Dysarthrien in Deutschland
5 Dysarthriesyndrome
5.1 Klassifikation der Dysarthrien
5.2 Paretische Dysarthrien
5.2.1 Peripher-paretische (schlaffe) Dysarthrie
5.2.2 Zentral-paretische (spastische) Dysarthrie
5.3 Ataktische Dysarthrie
5.3.1 Ataktische Bewegungsstörung
5.3.2 Merkmale der ataktischen Dysarthrie
5.4 Hypokinetische Dysarthrie
5.4.1 Akinese/Hypokinese/Bradykinese und Rigor
5.4.2 Taxonomie der hypokinetischen Dysarthrie
5.4.3 Merkmale der hypokinetischen Dysarthrie
5.5 Hyperkinetische Dysarthrieformen
5.5.1 Choreatisch-hyperkinetische Dysarthrie
5.5.2 Fokale Dystonien der Sprechmuskulatur
5.5.3 Tremor
5.5.4 Myoklonus
5.5.5 Medikamenteninduzierte Dyskinesen
5.6 Reine und gemischte Dysarthriesyndrome
5.7 Erworbenes neurogenes Stottern (ENS)
5.8 Neurogener Mutismus
6 Diagnostische Fragen: Von der Funktion zur Teilhabe
6.1 Biopsychosoziales Modell der ICF
6.1.1 ICF als Codierungssystem
6.1.2 ICF als Denk- und Handlungsmodell in der sprachtherapeutischen/logopädischen Rehabilitation
7 Anamnese
7.1 Inhalte der Anamneseerhebung
7.2 Durchführung der Anamneseerhebung
8 Diagnostische Verfahren
8.1 Funktionsbezogene Diagnostik
8.1.1 Apparative Methoden
8.1.2 Akustische Analyseverfahren
8.1.3 Auditive Verfahren
8.2 Untersuchung nichtsprachlicher Bewegungsfunktionen
8.2.1 Prüfung nichtsprachlicher Bewegungen des Sprechbewegungsapparates („Mundmotorik“)
8.2.2 Prüfung von Reflexen
8.2.3 Maximalleistungsaufgaben
8.3 Untersuchung kommunikationsbezogener Aspekte von Dysarthrien
8.3.1 Methoden der Verständlichkeitsmessung
8.3.2 Messung der sprechmotorischen Effizienz
8.3.3 Methoden der Natürlichkeitsmessung
8.3.4 Crowdbasierte Methoden in der Diagnostik von Sprechstörungen und die KommPaS-Webapp
8.4 Selbstbeurteilung
9 Dysarthriediagnostik mit Kindern
9.1 Besondere Bedingungen bei der Diagnostik von Kindern mit Dysarthrie
9.1.1 Entwicklungseinflüsse
9.1.2 Mehrfachbehinderung
9.2 Auditive Dysarthriediagnostik mit Kindern
9.2.1 Bogenhausener Dysarthrieskalen – Kindliche Dysarthrien (BoDyS-KiD)
9.3 Beurteilung von Kommunikation und Teilhabe
9.3.1 Messung kommunikationsbezogener Aspekte
9.3.2 Einschätzung der (kommunikativen) Teilhabe
10 Dysarthrietherapie mit Erwachsenen: Konzepte
10.1 Wirksamkeit von Dysarthrietherapie
10.1.1 Wirkebenen
10.1.2 Evidenzbasierung der Dysarthrietherapie
10.2 Therapieziele
10.2.1 Globalziel
10.2.2 Konzepte der Zielfindung
10.2.3 Gemeinsamer Prozess der Zielfindung
10.3 Therapiedauer und -intensität
10.3.1 Orientierung an Physio- und Ergotherapie
10.3.2 Welche Faktoren beeinflussen die Therapiedauer und -intensität?
11 Grundlagen der sprechmotorischen Behandlung
11.1 Motorische Restitution und Kompensation
11.2 Fehlanpassungen
11.3 Motorisches Lernen
11.3.1 Grundsätze motorischen Lernens
11.3.2 Lernabhängige neuronale Plastizität
11.4 Nichtsprachliche Behandlungsansätze
12 Funktionskreisspezifische Übungsbehandlung
12.1 Haltung
12.1.1 Therapierelevante Aspekte
12.1.2 Haltungsverbessernde Maßnahmen
12.2 Sprechatmung
12.2.1 Therapierelevante Aspekte
12.2.2 Behandlungsoptionen
12.2.3 Instrumentelles Feedback und Trainingshilfen
12.2.4 Syndromspezifische Behandlungsaspekte
12.3 Stimme
12.3.1 Therapierelevante Aspekte
12.3.2 Behandlungsoptionen
12.3.3 Syndromspezifische Aspekte
12.3.4 Lee Silverman Voice Treatment (LSVT)
12.4 Artikulation
12.4.1 Grundlegende artikulatorische Behandlungstechniken
12.4.2 Mandibuläres System
12.4.3 Labiomandibuläres System
12.4.4 Linguomandibuläres System
12.4.5 Velopharynx
12.4.6 Syndromspezifische Aspekte
12.5 Funktionskreis übergreifende Interventionen
12.5.1 Sprechtempo
12.5.2 Prosodie und Natürlichkeit
13 Medizinische Maßnahmen
13.1 Pharmakologische Interventionen
13.1.1 Spastik
13.1.2 Ataxie
13.1.3 Dystonie
13.1.4 Morbus Parkinson
13.1.5 Amyotrophe Lateralsklerose
13.1.6 Idiopathische Fazialislähmung
13.1.7 Myasthenie
13.2 Nichtinvasive Verfahren der Hirnstimulation (NIVH)
13.2.1 NIVH bei nicht progredienten neurologischen Erkrankungen
13.2.2 NIVH bei neurodegenerativen Erkrankungen
13.3 Invasive Hirnstimulation
13.3.1 Tiefe Hirnstimulation (THS) bei Parkinson-Krankheit
13.3.2 Tiefe Hirnstimulation (THS) bei essenziellem Tremor und Dystonie
13.4 Neuromuskuläre und funktionelle Elektrostimulation
13.5 Sprechunterstützende Operationsverfahren
13.5.1 Lippen
13.5.2 Gaumensegel
13.5.3 Larynx
13.5.4 Unterkiefer
14 Kommunikationsorientierte Interventionen
14.1 Alltagsorientierte Therapie (AOT)
14.2 Einbeziehen wichtiger Bezugspersonen
14.3 Hörtraining für Bezugspersonen
14.4 Dysarthrietherapie in der Gruppe
14.4.1 Zusammensetzung, Gruppengröße und Sitzungsdauer
14.4.2 Indikation
14.4.3 Übungsinhalte für die Gruppentherapie
14.5 Unterstützte und alternative Kommunikation
14.5.1 Körpereigene Kommunikationsfähigkeiten
14.5.2 Nichtelektronische Kommunikationshilfen
14.5.3 Elektronische Kommunikationshilfen
14.5.4 Gesprächsstrategien
15 Beratung
16 Dysarthrietherapie mit Kindern
16.1 Besondere Bedingungen bei der Therapie von Kindern
16.1.1 Koordinative Strukturen und anatomische Besonderheiten
16.1.2 Motorisches Lernen und Neuroplastizität
16.1.3 Mehrfachbehinderung und Entwicklungsalter
16.1.4 Lebenslange Behinderung und Therapieziele
16.2 Sprachtherapeutische Übungsbehandlung
16.2.1 Artikulationsfokussierte Verfahren
16.2.2 Konventionelle funktionsorientierte Therapie
16.2.3 LSVT und Speech Intelligibility Treatment (SIT)
16.2.4 Kindgerechte Anpassung und praktische Empfehlungen
16.3 Ergänzende Maßnahmen
17 Literatur
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum/Access Code
Access Code
Wichtige Hinweise
Alle Inhalte jetzt kostenlos auch im Internet nutzen !
Schnellzugriff zum Buch
Impressum
1 Einleitung
Zusammenfassung
In diesem Kapitel wird der Dysarthriebegriff erläutert und gegenüber anderen Kommunikationsstörungen abgegrenzt. Das durch Dysarthrien bedingte Gesundheitsproblem wird beschrieben. Am Ende geben wir eine Vorschau auf den Inhalt des Buches.
1.1 Definition
Definition
Dysarthrien sind neurologisch bedingte Störungen von motorischen Prozessen, die die Ausführung von Sprechbewegungen betreffen.
Mit dieser Definition werden alle wichtigen Bestimmungsmerkmale der Dysarthrien genannt:
Es handelt sich um neurogene Störungen, also um Störungen, die nach einer Schädigung des zentralen oder peripheren Nervensystems oder des neuromuskulären Übergangs auftreten. Zu den Dysarthrien zählen demnach nicht Sprechstörungen nach einer Verletzung der Bewegungsorgane selbst, also z.B. der Zunge, des Gaumens, des Kiefers oder des Kehlkopfs, etwa als Folge einer operativen Tumorentfernung, einer Fraktur oder einer angeborenen Missbildung. Bei solchen Sprechstörungen spricht man vielmehr von Dysglossien.
Die Diagnose einer Dysarthrie wird üblicherweise vergeben, wenn ein hirnschädigendes Ereignis vorliegt oder eine neurologische Erkrankung als wahrscheinliche Störungsursache diagnostiziert werden kann. Dies schließt beispielsweise auch kindliche Dysarthrien infolge einer bereits vor, während oder kurz nach der Geburt eingetretenen Hirnschädigung oder einer genetisch bedingten Hirnreifungsstörung ein. Störungen oder Verzögerungen, die während der kindlichen Sprachentwicklung meist ohne erkennbaren Auslöser auftreten, wie beispielsweise kindliche Aussprachestörungen oder das originäre neurogene nichtsyndromale Stottern (mit typischem Beginn im Kindesalter), zählen dagegen nicht zu den Dysarthrien, obwohl sie ebenfalls eine neuronale Grundlage haben ▶ [483].
Es handelt sich um sprechmotorische Störungen, also nicht um Störungen sprachlicher Verarbeitungsprozesse. Damit werden die Dysarthrien gegenüber aphasischen oder kognitiv bedingten Störungen der Sprachproduktion abgegrenzt.
Die Pathomechanismen, die den Dysarthrien zugrunde liegen, sind mit denen der elementaren körpermotorischen Syndrome vergleichbar, also Parese, Ataxie, Akinese, Hyperkinese, Tremor etc. Dies unterscheidet die Dysarthrien von der Sprechapraxie, deren Symptome sich nicht durch solche Störungsmechanismen erklären lassen. Wir charakterisieren die Dysarthrien daher als Störungen sensomotorischer Prozesse der Bewegungsausführung, wohingegen die Sprechapraxie als Störung sprechmotorischer Planungsprozesse gesehen wird ▶ [786].
Der Dysarthriebegriff umfasst die Störungen aller am Sprechen beteiligten Muskelsysteme, also der Atmungsmuskeln, der Kehlkopfmuskeln und der supralaryngealen Muskulatur. Er subsummiert auch Erkrankungen, bei denen einer dieser Funktionskreise herausragend oder ausschließlich betroffen ist, wie z.B. bei einer fokalen Dystonie des Kehlkopfs oder bei Artikulations- oder Stimmstörungen infolge einer Fazialis- oder Rekurrensparese. Zur Verdeutlichung wird bei einer isoliert die Kehlkopfmuskeln betreffenden Störung der Begriff Dysphonie verwendet, ohne dass damit eine Abgrenzung gegenüber den Dysarthrien gemeint ist ▶ [587].
Dysarthrien sind motorische Störungen des Sprechvorgangs. Sie schließen nicht unbedingt auch Störungen nichtsprachlicher Bewegungsfunktionen des Vokaltraktes mit ein (Lachen oder Weinen, Kauen, Schlucken etc.). Umgekehrt kann man aus dem Vorliegen einer nichtsprachlichen Bewegungsstörung, wie einer Schluckstörung oder einer Störung des Imitierens von Mundbewegungen, nicht auf eine Dysarthrie schließen ▶ [739].
1.2 Dysarthrie als Gesundheitsproblem
Dysarthrien sind Kommunikationsstörungen. Das Ausmaß der kommunikativen Beeinträchtigung kann dabei sehr unterschiedlich ausgeprägt sein – von einer kompletten Unfähigkeit, sich mündlich zu äußern (Mutismus) bis zu einer nur leichten Redefluss-, Stimm- oder Artikulationsstörung. Personen mit einer Dysarthrie können dadurch in ihrer Teilhabe eingeschränkt sein, mit Auswirkungen auf fast alle Lebensbereiche: auf Partnerschaft, Familie, Ausbildung, Beruf, Freizeitaktivitäten, Selbstversorgung, Gemeindeleben etc. Wie sehr sie unter ihrem Sprechproblem leiden, hängt nicht allein vom Schweregrad der Dysarthrie ab, sondern vor allem auch von subjektiven, sozialen und beruflichen Faktoren ▶ [505]. Die Behandlungsbedürftigkeit leitet sich daher aus der individuellen Konstellation von Funktionsstörung, Teilhabebarrieren und Kontextfaktoren ab ▶ [163].
Dysarthrien sind die häufigste Form neurologisch bedingter Kommunikationsstörungen. Sie können bei allen neurologischen Erkrankungen auftreten, die eine Schädigung motorischer Areale des zentralen Nervensystems und deren Verbindungsbahnen oder eine Schädigung der beteiligten Hirnnerven beinhalten. Bei einer groben Schätzung, gestützt auf Angaben zur Häufigkeit der wichtigsten neurologischen Erkrankungen, kommt man auf eine Zahl von mehr als 900000 Personen mit Dysarthrie in Deutschland, mit einem sehr hohen Anteil von Kindern. Das entspricht einer Prävalenz von mehr als 1% der Bevölkerung. Damit sind Dysarthrien etwa 10-mal so häufig wie die schlaganfallbedingten Aphasien.
Dysarthrien stellen aufgrund ihres häufigen Auftretens und ihrer Alltagskonsequenzen ein erhebliches gesundheitspolitisches Problem dar. Ihre sachgerechte Diagnostik und Behandlung nehmen daher in der Versorgung neurologischer Patient*innen einen wichtigen Rang ein. Die Anforderungen, die die Therapierenden dabei zu bewältigen haben, sind vielfältig, da diese Personengruppe sehr heterogen zusammengesetzt ist. Personen mit Dysarthrie finden sich in allen Altersgruppen, sie können von ganz unterschiedlichen neurologischen Erkrankungen betroffen sein – chronisch progredienten (z.B. Morbus Parkinson, Amyotrophe Lateralsklerose – ALS), schubweise verlaufenden (z.B. Multiple Sklerose) oder akut auftretenden (z.B. Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma) – und sie werden in verschiedenen Bereichen unseres Gesundheitssystems versorgt, z.B. in Spezialambulanzen, geriatrischen oder neurologischen Akutkliniken, Rehabilitationskliniken, in sozialpädiatrischen und Pflegeeinrichtungen, in der ambulanten Nachsorge oder in niedergelassenen Praxen. Personen mit Dysarthrie haben meist auch zusätzliche Gesundheitsprobleme, etwa aufgrund gleichzeitig bestehender körpermotorischer, sensorischer, kognitiver oder emotionaler Folgen einer akuten oder chronisch fortschreitenden neurologischen Erkrankung. Daraus ergeben sich für die Therapierenden sehr unterschiedliche Herausforderungen und Herangehensweisen in Diagnostik, Therapie und Beratung.
1.3 Zu diesem Buch
Der vorliegende Band beschäftigt sich mit Dysarthrien bei Erwachsenen und Kindern. Das Krankheitsbild wird dabei aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Zum einen sehen wir die Dysarthrien als neurologisch bedingte Funktionsstörungen des Sprechbewegungsapparats. Dazu ist es wichtig, die muskulären Komponenten und Funktionsprinzipien dieses Apparats und die neuronale Organisation sprechmotorischer Kontrollfunktionen zu verstehen, die Möglichkeiten der diagnostischen Prüfung sprechmotorischer Funktionen zu kennen und therapeutische Prinzipien der Reorganisation von Bewegungsfunktionen oder der Kompensation von Funktionsstörungen ableiten zu können. Zum andern betrachten wir die Dysarthrien aber auch als Kommunikationsstörungen. Aus dieser Perspektive geht es darum, das Ausmaß des Verlusts an Aktivitäten und Partizipationsmöglichkeiten zu verstehen und diagnostisch zu erfassen und in der Behandlung den Betroffenen im Rahmen ihrer verbliebenen Fähigkeiten zu einem Höchstmaß an kommunikativer Teilhabe zu verhelfen.
Das Buch gliedert sich in vier Teile. In einem einführenden Grundlagenteil (Kap. ▶ 2 und Kap. ▶ 3) wird physiologisches und neuroanatomisches Grundwissen zum Vorgang des Sprechens vermittelt. In Kapitel 2 geht es um den Sprechbewegungsapparat selbst und einige wichtige Funktionsprinzipien des Sprechens, Kapitel 3 beschreibt die neuronale Organisation der Sprechmotorik und schafft die Grundlagen für das Verständnis der dysarthrischen Pathomechanismen und Syndrome. Dieser erste Teil geht immer wieder auch auf Entwicklungsaspekte ein und bereitet den Boden für das Verständnis kindlicher Dysarthrien. Dabei wird von Anfang an besonderes Augenmerk auf therapeutisch relevante Prinzipien und Zusammenhänge gelegt.
Der zweite Teil des Buches umfasst zwei klinische Kapitel, in denen wichtige neurologische Ursachen dysarthrischer Störungen bei Erwachsenen und Kindern (Kap. ▶ 4) und die unterschiedlichen Pathomechanismen und Syndrome (Kap. ▶ 5) dargestellt werden. Zwischen diesen beiden Kapiteln gibt es viele Querbezüge, da Dysarthriesyndrome und Störungsmechanismen oft eng mit bestimmten neurologischen Erkrankungen verknüpft sind.
Der dritte Abschnitt des Buches befasst sich mit diagnostischen Fragen. Kap. ▶ 6 beschreibt einen am ICF-Konzept der Weltgesundheitsorganisation orientierten Rahmen für die klinische Dysarthriediagnostik, Kap. ▶ 7 und Kap. ▶ 8 stellen daran anknüpfend dann anamnestische Fragestellungen sowie funktions- und kommunikationsbezogene Diagnostikverfahren vor. Dabei werden die bekannten Verfahren hinsichtlich ihrer Tauglichkeit für die klinische Anwendung diskutiert. Kap. ▶ 9 ist schließlich den spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten der Dysarthriediagnostik bei Kindern gewidmet.
Im vierten Teil geht es dann um die Dysarthrietherapie. Es werden zunächst einige Grundlagen therapeutischer Zielsetzung und Handlungsweise skizziert (Kap. ▶ 10, Kap. ▶ 11), und im Anschluss daran werden therapeutische Vorgehensweisen detailliert und in ihrer praktischen Anwendung beschrieben Kap. ▶ 12– ▶ 15). Das Buch schließt mit einem Kapitel über die Therapie kindlicher Dysarthrien (Kap. ▶ 16).
Der begrenzte Umfang dieses Buchs erlaubt es nicht, die anatomischen Grundlagen des Sprechens sehr ausführlich darzustellen. Die Leser*innen können dazu bei Bedarf einen Anatomieatlas zurate ziehen (z.B. ▶ [611]). Außerdem werden auch grundlegende phonetische Sachverhalte vorausgesetzt, wie die Kenntnis des Lautinventars des Deutschen und die wichtigsten Mechanismen der Bildung von Konsonanten und Vokalen. Es gibt mehrere deutschsprachige Bücher, in denen diese phonetischen Grundlagen nachzulesen sind (z.B. ▶ [335]). Das umfangreiche und didaktisch exzellent aufbereitete Lehrbuch von Hixon et al. enthält neben einer anschaulichen Darstellung anatomischer, physiologischer und akustisch-phonetischer Sachverhalte auch zahlreiche Hinweise auf klinische Anwendungen ▶ [282]. Das englischsprachige Standardwerk von Duffy behandelt das Thema Dysarthrie ausführlicher und mit etwas anderen Schwerpunktsetzungen als das vorliegende Buch ▶ [175].
2 Sensomotorische Grundlagen
Zusammenfassung
In diesem Kapitel werden die am Sprechen beteiligten Muskelgruppen in ihren Funktionen und in ihrem Zusammenwirken beschrieben und die Rolle sensorischer Prozesse erörtert. Das Kapitel endet mit der Darstellung eines Modells der sensomotorischen Organisation des Sprechens.
2.1 Funktionskreise des Sprechens
Der Bewegungsapparat des Sprechens ist komplex aufgebaut. Allein der Kehlkopf und die Artikulationsorgane des Mund- und Rachenraums umfassen mehr als 50 Muskelpaare. Dieses komplizierte Bewegungsorgan kontrollieren sprechgesunde Erwachsene mit hoher Geschwindigkeit und Präzision, und zwar ohne darauf bewusst achten zu müssen: Während sie nämlich Zunge, Lippen und Kehlkopf bewegen, ist die Aufmerksamkeit der Sprechenden nicht auf den Sprechvorgang selbst gerichtet, sondern in erster Linie auf die Gesprächsinhalte, die Planung der Äußerungen und die Reaktionen der Gesprächspartner. Gleichzeitig kann man sogar noch ein Auto lenken oder ein Essen zubereiten und dabei Kaugummi kauen oder eine Zigarette zwischen den Lippen halten. Die motorische Funktion des Sprechens ist bei sprechgesunden Erwachsenen also ein hoch automatisierter Vorgang mit einer geringen Fehleranfälligkeit und einem hohen Anpassungspotenzial. Dass dies so perfekt und zugleich so beiläufig gelingt, ist das Ergebnis eines motorischen Lernprozesses, der sich über die gesamte erste Lebensdekade eines Kindes und weit darüber hinaus erstreckt, und der die Steuerung von Sprechbewegungen zu einem routinierten Vorgang macht. Sprechmotorisches Lernen ist sogar ein lebenslanger Prozess, der auch im Erwachsenenalter noch beständig dafür sorgt, dass sich die Bewegungsabläufe des Sprechens an die kontinuierlichen physischen Veränderungen (intern) und die Änderungen der sprachlichen – zum Beispiel der dialektalen – Umgebung (extern) anpassen. Es gibt nicht viele Beispiele vergleichbarer motorischer Virtuosität. Das professionelle Spielen eines Musikinstruments zählt vielleicht dazu, aber anders als beim Musizieren sind beim Sprechen alle Menschen ähnlich virtuos, sofern nicht psychische, organische oder funktionelle Störungen dem entgegenstehen.
Wie kann man diese erstaunliche Fertigkeit analysieren und erklären? Wegen der großen Anzahl beteiligter Muskeln und der komplexen biomechanischen Eigenschaften der Sprechorgane und wegen der Rolle, die aerodynamische Prozesse für den Sprechvorgang spielen, fällt es schwer, umfassende Erklärungsmodelle für die motorische Funktion des Sprechens zu entwickeln. Eine besondere Herausforderung ergibt sich aus der Tatsache, dass das „Ziel“ sprechmotorischer Aktivitäten darin besteht, akustische Signale (Vokale, Konsonanten, Silben) zu generieren, und dass es dabei für jeden Laut und jede Silbe viele unterschiedliche Wege gibt, sie zu erzeugen und zu Wörtern und Sätzen zu verknüpfen.
Um das Verständnis dieser Vorgänge zu erleichtern, zergliedert man den Bewegungsapparat des Sprechens üblicherweise in Funktionskreise, also in Muskelgruppen, denen man annähernd einheitliche Funktionen zuschreiben kann, nämlich Sprechatmung, Phonation und Artikulation.
2.1.1 Respiratorischer Funktionskreis
2.1.1.1 Anatomie und Physiologie
Der Luftaustausch in der Lunge wird durch Vergrößerung (Einatmung) bzw. Verkleinerung (Ausatmung) des Thorakalraums vermittelt. Der wichtigste Einatmungsmuskel ist das Zwerchfell (Diaphragma), das in Ruhe nach oben gewölbt ist und sich bei Kontraktion nach unten abflacht. Dadurch erweitert sich der Thorakalraum und Luft strömt in die Lunge ein. Die motorische Innervation des Zwerchfells erfolgt über den N. phrenicus, der in den Vorderhornzellen der zervikalen Rückenmarksabschnitte C 3–C 5 entspringt ( ▶ Tab. 2.1 ). Der Einatmungsvorgang kann durch die externen Zwischenrippenmuskeln zusätzlich unterstützt werden, deren Kontraktion zu einer Anhebung des Brustkorbs und einer zusätzlichen Vergrößerung des Thorakalraums führt ▶ [282].
Bei der Ausatmung wirken passive und aktive Vorgänge zusammen: Die Ausatmung setzt bei Entspannung des Diaphragmas ein, da die elastischen Rückstellkräfte zu einem Zurückwölben des Zwerchfells nach oben und die Schwerkraft zu einem Absinken des Brustkorbs führen. Dabei entweicht die Luft durch die Atemwege. Bei forcierter Ausatmung werden zusätzlich die internen Zwischenrippenmuskeln aktiv, die den Abstand zwischen den Rippen und damit auch den Thorakalraum aktiv verkleinern. Die inneren und äußeren Zwischenrippenmuskeln werden durch die Nn. intercostales versorgt, deren Ursprung in den thorakalen Rückenmarkssegmenten liegt ▶ [282], ▶ [312] ( ▶ Tab. 2.1 ).
Tab. 2.1
Innervation der Atmungsmuskulatur
▶ [312]
.
Muskeln
Motorische Innervation*
Funktion beim Sprechen
Abdominal
transversus abdominis
obliquus abdominis
rectus abdominis
T2–L3
Ausatmung
Stabilisierung des Abdomens bei Einatmung
Diaphragma
C3–C5
Einatmung (Hauptanteil)
Thorakal
intercostales interni
intercostales externi
intercartilaginei
transversus thoracis
C8–T12
obere externe Zwischenrippenmuskeln:
Einatmung; Atembremse bei der Ausatmung
interne und untere externe Zwischenrippenmuskeln: Ausatmung; Stabilisierung des Thorax gegenüber abdominaler Aktivität
* Vorderhornzellen der Segmente des Zervikal- (C), Thorakal- (T) und Lumbalmarks (L)
2.1.1.2 Metabolische Atmung
Die wichtigste Vitalfunktion der Atmungsmuskulatur besteht darin, den Körper mit Sauerstoff zu versorgen und das Kohlendioxid aus dem Körper abzuführen („metabolische Atmung“). Im Zustand der Ruheatmung, wenn also keine kognitiven Vorgänge, motorischen Aktivitäten oder emotionalen Einflüsse auf das Atmungsmuster einwirken, werden Ein- und Ausatmung fast ausschließlich durch Signale von Chemorezeptoren gesteuert, die an das Atmungszentrum im Hirnstamm gerichtet sind. Bei einem Anstieg des CO2-Gehalts des Blutes wird eine Kontraktion der Inspirationsmuskeln ausgelöst. Den nahezu alleinigen Anteil an diesem Vorgang hat das Zwerchfell. Bei ruhiger Atmung erfolgt die Exspiration rein passiv und nimmt nicht wesentlich mehr Zeit in Anspruch als die Inspiration. Die Atemruhelage wird dabei normalerweise nicht unterschritten, und das bei jedem Atemzug transportierte Luftvolumen beträgt bei Erwachsenen nicht mehr als ca. ½ l ▶ [116] ( ▶ Abb. 2.1).
Atemvolumina.
Abb. 2.1 Das gesamte Lungenvolumen wird hier beispielhaft mit sechs Litern dargestellt, was etwa dem Lungenvolumen eines erwachsenen Mannes entspricht. Bei der Ruheatmung werden, ausgehend von der „Atemruhelage“ (waagrechte gestrichelte Linie) weniger als 10% der gesamten Lungenkapazität ein- und ausgeatmet („Atemzugsvolumen“, grüner Bereich). Bei maximaler Ausatmung kann das „exspiratorische Reservevolumen“ genutzt werden (hellgrauer Bereich), dabei verbleibt ein für die Atmung nicht verfügbares „Residualvolumen“ in der Lunge (dunkelrot). Bei maximaler Einatmung wird das „inspiratorische Reservevolumen“ (hellblau) genutzt. Das gesamte zwischen maximaler Aus- und maximaler Einatmung verfügbare Volumen wird als Vitalkapazität bezeichnet. Beim Sprechen (rechter Teil) sind die Inspirationsphasen deutlich kürzer als in der Ruheatmung und die Exspiration kann in Abhängigkeit von der Phrasenlänge flexibel ausgedehnt werden. Die Inspirationsvolumina sind größer, und in der Exspirationsphase kann die Ruhelage auch unterschritten werden (nach ▶ [209]).
2.1.1.3 Sprechatmung
Die Atmung beim Sprechen ist den Zielen und Erfordernissen der mündlichen Kommunikation angepasst und gehorcht anderen Mechanismen als die Ruheatmung. Der Phonations- und Artikulationsvorgang ist an die Ausatmungsphasen gekoppelt, daher muss der Redefluss immer wieder durch Einatmungspausen unterbrochen werden. Dabei wird die Einatmungstätigkeit mit den prosodischen und den Bedeutungseinheiten des Sprechens koordiniert: Inspirationspausen finden fast immer an Phrasengrenzen statt, selten innerhalb einer Phrase oder gar innerhalb eines Wortes. Die Exspirationsphasen sind beim Sprechen in ihrer Dauer somit sehr viel variabler und können auch erheblich länger sein als in der Ruheatmung, um auch längere Phrasen ohne Unterbrechung durch Inspirationspausen zu produzieren. Außerdem erfolgen die Einatmungen auch rascher, um den Redefluss nur kurz zu unterbrechen, dabei aber dennoch mit einem im Vergleich zur Ruheatmung deutlich höheren Inspirationsvolumen ( ▶ Abb. 2.1).
Zusatzinfo
Die Adaptivität der Sprechatmung
Die Sprechatmung ist ein anschauliches Beispiel für die hohe Adaptivität der Sprechmotorik und die spezifische Organisation der Bewegungsvorgänge für die Zwecke sprachlicher Kommunikation. Die vielen beteiligten Muskeln sind in ihrem Zusammenwirken differenziert aufeinander abgestimmt. Das Kontraktionsmuster passt sich während des Ausatmungsvorgangs dynamisch an die Änderung physikalischer Bedingungen an. Es variiert in Abhängigkeit von der Körperhaltung (Sitzen, Stehen, Liegen), vom Luftverbrauch während des Sprechens (stimmlose Konsonanten sind mit höherem Luftverlust verbunden als stimmhafte), von kommunikativen Erfordernissen (lautes vs. leises Sprechen), von linguistischen Bedingungen (Einatmung an Phrasen- oder Satzgrenzen, Betonungsmuster) oder von kognitiven Anforderungen (Lesen eines Textes vs. freie Rede vs. Nachsprechen etc.; ▶ [209]). Im Dialog tendieren Gesprächspartner*innen dazu, ihre Atmungstätigkeit miteinander zu synchronisieren und an den Sprecherwechsel anzupassen ▶ [679]. Die enge Verknüpfung von motorischem Geschick mit sprachlichen und kommunikativen Fertigkeiten, die sich in dieser Adaptivität der Sprechatmung zeigt, reift im Laufe der Sprachentwicklung erst relativ spät aus: Die für Erwachsene typischen Muster stellen sich erst im Alter von etwa 10–16 Jahren ein (s. Kap. ▶ 2.3.1). Gordon et al. postulieren spezifische Mechanismen in der Organisation des primär-motorischen Kortex, die solche integrativen Prozesse der Steuerung komplexer motorischer Handlungen repräsentieren (s. Kap. ▶ 3.4.1) ▶ [234].
An der Einatmung beim Sprechen sind, anders als bei der Ruheatmung, neben dem Zwerchfell auch die externen Zwischenrippenmuskeln beteiligt. Durch gleichzeitige Kontraktion der abdominalen Muskulatur wird ein festes „Widerlager“ und damit eine Stabilisierung für die Zwerchfellaktivität geschaffen, als Voraussetzung für eine rasche und flexible Einatmungskontrolle.
Die Ausatmung verläuft beim Sprechen in einem komplizierten Zusammenspiel passiver Vorgänge mit aktiver Kontrolle der thorakalen und abdominalen Muskeln. Nach Hixon u. Hoit müssen, außer bei sehr leisem Sprechen, die passiven Ausatmungskräfte fast immer durch zusätzliche Exspirationskräfte unterstützt werden, um den erforderlichen respiratorischen Druck zu erzeugen ▶ [279]. Nach einer tiefen Einatmung muss in der Anfangsphase der Exspiration das Entweichen des Luftstroms durch ein nur langsames Nachlassen der Kontraktion der Inspirationsmuskulatur gebremst werden („Brustkorbhaltekraft“). Im Verlauf der Exspirationsphase sinkt der Beitrag der passiven Rückstellkräfte immer mehr ab und das Ausmaß an aktiver Exspirationskraft muss kontinuierlich erhöht werden, um einen relativ konstanten und ausreichend hohen Atemstrom zu gewährleisten. Dabei werden hauptsächlich die interossealen Abschnitte der internen Zwischenrippenmuskeln und die Bauchmuskulatur tätig.
Bei der Sprechatmung kann, im Unterschied zur Ruheatmung, unter physiologischen Bedingungen die Atemruhelage geringfügig unterschritten werden ( ▶ Abb. 2.1). Die exspiratorische Reserve wird dann genutzt, wenn eine Phrase nicht auf den normalen Exspirationszyklus zu Ende gesprochen werden kann. Auf diese Weise können es gesunde Sprecher*innen in den allermeisten Fällen vermeiden, Bedeutungseinheiten der Rede durch Einatmungspausen zu unterbrechen. Vielen Personen mit Dysarthrie gelingt dies aber nicht mehr: Sie unterschreiten die Atemruhelage sehr häufig und in hohem Maße und müssen oft mitten in einer Phrase oder sogar im Wort einatmen (s. ▶ Tab. 8.4 ).
Sprechen ist also mit einer erheblichen willkürlichen Veränderung des stereotypen Musters der metabolischen Atmung verbunden – die Erfordernisse des Gasaustauschs und der Kommunikation stehen gewissermaßen in Konkurrenz zueinander. Wenn wir unter körperlicher Anstrengung (Treppensteigen, Radfahren) sprechen, diktiert der erhöhte Sauerstoffbedarf eine Anpassung des Sprechatmungsmusters. Bei Patient*innen, die neben einer Dysarthrie noch ein körpermotorisches Problem haben, z.B. beim Gehen, wirken sich solche Anstrengungsfaktoren noch drastischer aus. Bei Gesprächen während des Gehens bleiben sie oft stehen, wenn sie sich selbst äußern wollen; ein Phänomen, das allerdings auch allgemeinere kognitive Ursachen haben und auch bei Menschen mit demenziellen Erkrankungen oder bei gesunden älteren Personen auftreten kann ▶ [414]. Ausführliche Darstellungen der physiologischen und kognitiven Organisation der Sprechatmung finden sich bei Fuchs u. Rochet-Capellan ▶ [209]. Zu den therapeutischen Aspekten gestörter Sprechatmung siehe Kap. ▶ 12.2.
2.1.2 Laryngealer Funktionskreis
2.1.2.1 Anatomie und Physiologie
Der Kehlkopf besteht aus einem Knorpelgerüst mit dem Ringknorpel, dem Schildknorpel und den paarigen Stellknorpeln, sowie aus „Nebenknorpeln“ und dem Kehldeckel (Epiglottis). Der Ringknorpel bildet den oberen Abschluss der Trachea, die Aryknorpel (Stellknorpel) sitzen im hinteren Kehlkopfbereich auf dem Ringknorpel auf, und der Schildknorpel schließt das Kehlkopfgerüst oberhalb des Ringknorpels nach vorne ab. Die Kehlkopfknorpel sind durch die intrinsischen Kehlkopfmuskeln miteinander verbunden und gegeneinander beweglich. Die Mm. thyroarytaenoidei, die sich zwischen dem Schildknorpel und den beiden Stellknorpeln erstrecken, bilden den muskulären Anteil der Stimmlippen ( ▶ Tab. 2.2 ). Die beiden Muskeln sind von elastischen Bindegewebsschichten umkleidet, die sich über den Muskelkörpern verschieben lassen („Randkantenverschiebung“).
Die extrinsischen Kehlkopfmuskeln verbinden den Kehlkopf mit knöchernen Strukturen des Schädels, des Thorax und des Schultergürtels und bilden die „Aufhängung“ des Vokalisationsorgans im Hypopharynx. Eine ausführliche und anschaulich illustrierte Darstellung der laryngealen Anatomie und Physiologie findet sich in Sataloff oder in Anatomie-Atlanten ▶ [590], ▶ [611].
Die Adduktionsbewegung der Stimmlippen wird durch Kontraktion der Mm. cricoarytaenoideus lateralis und interarytaenoideus vollzogen, wobei die Aryknorpel gekippt und zusammengeführt und damit die Stimmlippen in ihrem hinteren Anteil aneinandergelegt werden. Im medialen Stimmlippenanteil kann die Adduktion durch Kontraktion des M. thyroarytaenoideus unterstützt werden (mediale Kompression). Die Öffnungsbewegung (Abduktion) wird durch Kontraktion des M. cricoarytaenoideus posterior bewirkt. Ferner können die Stimmlippen in ihrer Länge, Steifheit und Spannung durch Aktivierung der Mm. thyroarytaenoideus und cricothyroideus verändert werden ▶ [774]. Die motorische Innervation dieser Muskeln erfolgt über Äste des Vagusnervs (N. X), nämlich den N. recurrens und den N. laryngeus superior externus, die beide ihren Ursprung im X. Hirnnervenkern, dem Ncl. ambiguus, haben ( ▶ Tab. 2.2 ).
Tab. 2.2
Innervation der Larynxmuskulatur: motorische Nerven und Kerne
▶ [312]
,
▶ [624]
.
Muskeln
Motorische Innervation1
Funktion beim Sprechen
Intrinsische Kehlkopfmuskeln
M. thyroarytaenoideus
M. interarytaenoideus
M. cricoarytaenoideus lateralis
M. cricoarytaenoideus posterior
N. recurrens (Ncl. X)
SL2-Adduktion, -Spannung
SL-Adduktion
SL-Adduktion
SL-Abduktion
M. cricothyroideus
N. laryngeus superior externus
(Ncl. X)
Dehnung und Spannung der SL
Extrinsische Kehlkopfmuskeln
M. thyrohyoideus
M. sternothyroideus
M. sternohyoideus
Ansa cervicalis (C1, C2)
Stabilisierung des Schildknorpels, vor allem bei extremen Tonhöhen- und Lautstärkeänderungen; Kehlkopfabsenkung und -anhebung
1 motorische Hirn- bzw. Spinalnerven; Ncl. X: nucleus ambiguus; C1, C2: Vorderhornzellen der Zervikalmarksegmente 1, 2.
2 SL: Stimmlippen
2.1.2.2 Vitalfunktionen
Eine wichtige Vitalfunktion der Kehlkopfmuskulatur besteht darin, durch Kontraktion der Adduktoren, Anheben des Kehlkopfs und Absenken der Epiglottis einen Verschluss zu bilden und dadurch die unteren Atemwege vor dem Eindringen von Partikeln zu schützen. Dies geschieht reflektorisch, z.B. während des Schluckvorgangs. Die laryngeale Sphinkterfunktion ist auch als „Widerlager“ bei Austreibungsvorgängen und zur Druckerzeugung beim Abhusten von vitaler Bedeutung.
2.1.2.3 Phonation
Beim Sprechen dient die laryngeale Muskulatur der Erzeugung und Modulation des Stimmtones oder eines Flüstergeräusches. Bei der stimmhaften Phonation werden die Stimmlippen adduziert – in der Regel ohne zusätzliche mediale Kompression – und durch den Aufbau eines Exspirationsdruckes unterhalb der Glottis wird eine periodische Stimmlippenschwingung in Gang gesetzt. Bei jedem Schwingungszyklus entsteht an der Glottis ein kurzzeitiger Luftstoß, der durch seine periodische Wiederholung die Luftsäule im Ansatzrohr zu einer obertonreichen Schwingung anregt, dem „primären Stimmschall“ oder „Glottisschall“.
Die aktiven Anteile an der Kontrolle dieses Vorgangs bestehen in der Aufrechterhaltung eines möglichst konstanten Exspirationsdruckes durch die Atmungsmuskulatur und der Anpassung der Adduktionsstellung sowie der Länge und Spannung der Stimmlippen. Der Schwingungsvorgang selbst ist das Resultat rein aerodynamischer Gesetze und passiver elastischer „Rückstellkräfte“ der Kehlkopfmuskeln, weshalb man auch von der „myoelastisch-aerodynamischen Theorie der Phonation“ spricht ( ▶ Abb. 2.2). Die Frequenz der Stimmlippenschwingungen, die sich in der ▶ Grundfrequenz des Sprachsignals (f0) und der wahrgenommenen Stimmtonhöhe äußert, hängt in komplizierter Weise von der Spannung und der Steifheit der Stimmlippen und auch von der Länge des schwingungsfähigen Stimmlippenanteils ab: Durch Aktivierung des M. cricothyroideus erhöhen sich Spannung und Steifheit der Stimmlippen, was zu einer Erhöhung der Schwingungsfrequenz und der wahrgenommenen Stimmlage führt. Auch eine Aktivierung des M. thyroarytaenoideus kann unter bestimmten biomechanischen Bedingungen zu einer Erhöhung der Grundfrequenz führen ▶ [774].
Myoelastisch-aerodynamisches Modell der stimmhaften Phonation.
Abb. 2.2 Zur Initiierung stimmhafter Phonation werden die Stimmlippen adduziert und während der gesamten Phonationsphase in einer relativ konstanten Adduktionsposition gehalten. Gleichzeitig wird ein relativ konstanter exspiratorischer Anblasedruck erzeugt und aufrechterhalten. Durch den Druck wird der Glottisschluss durch eine vertikal von unten nach oben verlaufende Verschiebung der elastischen Gewebsschichten der Stimmlippen gesprengt (Randkantenverschiebung) und es entweicht Atemluft, wodurch der subglottale Druck wieder absinkt. Dabei bewirken aerodynamische Kräfte sowie die myoelastischen Rückstellkräfte der adduzierten Stimmlippen, dass sich die Glottis wieder schließt. Dieser Vorgang wiederholt sich bei Männern etwa 100-mal, bei Frauen etwa 200-mal pro Sekunde, je nach Länge und Spannungszustand der Stimmlippen. Der dabei erzeugte periodische Luftstrom ist die Quelle des primären Sprachschalls („Glottisschall“).
Die Effizienz des Phonationsvorgangs und damit die Qualität des Stimmklangs hängen von der Balance zwischen subglottalem Druck einerseits und dem Adduktionszustand der Glottis und den Spannungsverhältnissen der Stimmlippen andererseits ab. Die Stimme kann durch ein hochfrequentes Rauschen überlagert und dadurch eine eher behauchte Qualität annehmen, und sie kann aufgrund eines unregelmäßigen oder veränderten Schwingungsverhaltens der Stimmlippen durchgehend oder phasenweise rau oder auch etwas gepresst erscheinen. Solche Stimmqualitätsvarianten zählen zu den stimmlichen Erkennungsmerkmalen von Personen, können in schwererer Ausprägung aber auch Zeichen einer funktionellen oder organischen Stimmstörung sein ▶ [774].
2.1.2.4 Der Kehlkopf als Artikulationsorgan
Beim Sprechen wechseln sich stimmhafte Laute (Vokale, stimmhafte Konsonanten) und stimmlose Konsonanten in rascher Folge ab. Um dies zu realisieren, müssen wir die Glottisadduktion sehr schnell und zielgenau unterbrechen und ebenso rasch wieder in die für die stimmhafte Phonation erforderliche Stimmlippenposition zurückfinden. Die Adduktoren zeichnen sich durch schnelle Muskelfasern aus, was diesen raschen Wechsel begünstigt ▶ [590]. Die kurzen Entstimmungsbewegungen werden vermutlich höchst ökonomisch und adaptiv ausgeführt: Da bei der Bildung stimmloser Konsonanten, vor allem der Plosive, durch die artikulatorische Engebildung der Luftstrom gebremst wird, genügt meist eine nur geringfügige Öffnung der Glottis, um den Schwingungsvorgang aus rein aerodynamischen Gründen kurz zum Erliegen zu bringen. Eine ebenso geringfügige erneute Adduktion führt zum Wiedereinsetzen des Stimmtones, wenn die orale Konstriktion wieder gelöst wird und sich die Luftstromrate wieder erhöht. Wir nutzen also das komplexe Zusammenspiel von Luftdruck und Luftstromgeschwindigkeit, um die Unterscheidung zwischen stimmhaften und stimmlosen Konsonanten während des Sprechvorgangs möglichst rasch und ökonomisch zu realisieren. Während der kurzen stimmhaften Phasen des Sprechens ist es zudem erforderlich, die Spannung der Stimmlippen so zu regulieren, dass die Stimme nicht übermäßig rau, gepresst oder behaucht klingt, und auch die Höhe des Stimmtons muss punktgenau kontrolliert werden, sodass keine inadäquaten Tonhöhensprünge entstehen und die Tonhöhe innerhalb jeder Phrase einem linguistisch und pragmatisch angemessenen Verlauf folgt (s. Kap. ▶ 2.2.4).
Merke
Der Kehlkopf artikuliert beim Sprechen also mit. Er ist immer in Aktion und eng mit der Aktivität aller anderen Sprechmuskeln koordiniert. Die dynamische Kontrolle der Phonation während des Sprechens unterliegt daher ganz anderen Anforderungen als beispielsweise während einer Vokalhalteaufgabe, bei der über einen längeren Zeitraum eine konstante Adduktionsspannung aufrechterhalten werden muss. Solche Unterschiede sollten in der ▶ Dysarthriediagnostik beachtet werden.
Zusatzinfo
Stimmlage, Stimmqualität und Stimmstabilität bei Dysarthrie
Wegen der komplizierten Biomechanik des Phonationsvorgangs und der vielen interagierenden respiratorischen und laryngealen Faktoren treten bei den meisten Personen mit Dysarthrie Beeinträchtigungen des Phonationsvorgangs auf. In der Diagnostik der dysarthrischen Stimmstörungen spielen ▶ drei Kriterien eine zentrale Rolle (s. ▶ Tab. 8.3 ):
Sprechstimmlage
Stimmqualität
Stimmstabilität
Stimmlage: Zu geringer oder zu hoher Anblasedruck resultieren in einer sehr leisen oder zu lauten Stimme, und im Verbund mit Störungen der Kontrolle der Stimmlippenspannung kann die Sprechstimmlage erhöht oder zu tief sein ▶ [774].
Stimmqualität: Störungen der Balance zwischen dem respiratorischen Druck und den laryngealen Adduktions- und Spannungsverhältnissen führen zu Veränderungen der Stimmqualität. Beispielsweise wird bei hohem subglottalem Druck und gleichzeitig geringer Spannung der Stimmlippen der Schwingungsvorgang sehr unregelmäßig und die Stimme klingt rau. Bei unvollständigem Glottisschluss, etwa durch Schwäche oder Rigidität der Adduktoren (Kap. ▶ 5.2, Kap. ▶ 5.4.3), entsteht neben dem harmonischen Glottisschall ein Luftstromgeräusch, das als Behauchtheit der Stimme wahrgenommen wird. Im Gegensatz dazu führt eine übermäßig starke Adduktionskraft („Hyperadduktion“), eventuell auch mit zusätzlicher medialer Kompression durch erhöhte Aktivität des M. thyroarytaenoideus, zu relativ langen Verschlussphasen der Glottis innerhalb der Schwingungszyklen und dadurch zum Eindruck einer gepressten Stimme ▶ [774].
Stimmstabilität: Wenn sich die Luftstromverhältnisse oder die Spannung der Kehlkopfmuskulatur im Verlauf einer Äußerung, von Silbe zu Silbe oder sogar innerhalb der Dauer eines stimmhaften Segments ändern, kommt es zu raschen Änderungen von Tonhöhe und/oder Lautstärke, wobei es zu einem plötzlichen Aussetzen der stimmhaften Phonation oder zu einem Wechsel in der Stimmqualität kommen kann. In der Dysarthriediagnostik spricht man dann von einer Beeinträchtigung der ▶ Stimmstabilität.
Störungen von Stimmqualität und Stimmstabilität haben einen starken Einfluss darauf, wie Personen mit Dysarthrie von ihren Kommunikationspartner*innen wahrgenommen werden. Stark ausgeprägte Stimmstörungen vermitteln einen Eindruck von sehr unnatürlichem Sprechen und machen das Zuhören anstrengend ▶ [341], ▶ [387]. Sie können auch negative Einstellungen naiver Hörer*innen gegenüber Personen mit Dysarthrie evozieren, sowie ungerechtfertigte Zuschreibungen eingeschränkter kognitiver Fähigkeiten ▶ [604].
2.1.3 Velopharyngealer Funktionskreis
2.1.3.1 Anatomie und Physiologie
Das Gaumensegel (Velum) bildet den Abschluss des Nasalraums gegenüber dem Oral- und Pharyngealraum ( ▶ Abb. 2.3). Es besteht aus dem weichen Gaumen und der Uvula (Zäpfchen). Ein flaches Sehnenstück dient als Einrahmung des weichen Gaumens und als Ansatzstelle der velaren Muskeln. Der velopharyngeale Mechanismus beruht auf dem Zusammenwirken von fünf Muskelpaaren, einem intrinsischen und vier extrinsischen ( ▶ Tab. 2.3 ). Diese werden danach eingeteilt, ob sie das Velum anheben oder senken.
Vokaltrakt (schematisch).
Abb. 2.3 Mit Artikulationsorganen und Resonanzräumen.
Tab. 2.3
Innervation der velopharyngealen Muskulatur
▶ [312]
.
Muskeln
Motorische Innervation*
Funktion beim Sprechen
M. levator veli palatini
Plexus pharyngeus (Ncl. X)
Anhebung des Gaumensegels
M. tensor veli palatini
N. mandibularis (Ncl. Vmot)
Versteifung des Gaumensegels
M. palatopharyngeus
N. accessorius, (Ncl. X)
Verengung des Pharynx
M. palatoglossus
N. glossopharyngeus (Ncl. X)
Absenken des Gaumensegels
Uvula
Plexus pharyngeus (Ncl. X)
Versteifung des Gaumensegels
* Ncl. X: nucleus ambiguus; Ncl. Vmot: nucleus motorius nervi trigemini
Der M. uvulae ist der einzige intrinsische Muskel des Velums. Seine Kontraktion versteift das Velum, wodurch es gegen die Kräfte der extrinsischen velaren Muskeln stabilisiert wird und damit schnelle und präzise Bewegungen ermöglicht. Die Uvula wird durch den pharyngealen Ast des Vagusnervs über den Plexus pharyngeus innerviert, der seinen Ausgang im Ncl. ambiguus hat.
Der M. levator veli palatini gilt als hauptverantwortlicher Muskel für den Verschluss der velopharyngealen Pforte. Bei Kontraktion dieses Muskels hebt sich das Velum an und verlagert sich nach superior und posterior. Die motorische Innervation erfolgt über den kranialen Abschnitt des N. accessorius spinalis (XI), der zusammen mit dem N. vagus (X) und dem N. glossopharyngeus den Plexus pharyngeus bildet. Die sensorische Innervation läuft vorrangig über Fasern des N. trigeminus (V), N. facialis (VII) und N. glossopharyngeus (IX).
Dem M. tensor veli palatini werden entsprechend seinem komplizierten Verlauf mehrere Funktionen zugeschrieben: Er spannt den vorderen Teil des Velums und hebt oder senkt es. Motorisch innerviert wird er vom mandibulären Ast des N. trigeminus (Vmot).
Der M. palatopharyngeus bildet mit seinen langen dünnen inneren Fasern den muskulären Anteil der hinteren Gaumenbögen. Er zieht vom Velum herab, wobei seine äußeren Fasern mit dem M. constrictor pharyngis verflochten sind, bevor sie an den pharyngealen Wänden enden. Eine Kontraktion dieses Muskels führt zu einem Einrücken der pharyngealen Wände und damit einer Verengung des Pharynx. Die neuronale Versorgung geschieht durch den kranialen Teil des N. accessorius (XI) über den Plexus pharyngeus.
Die Fasern des M. palatoglossus beginnen im Velum und ziehen zu beiden Seiten herab, wo sie seitlich in die Zungenränder einmünden und so die vorderen Gaumenbögen formen. Der M. palatoglossus kann sowohl das Öffnen des velopharyngealen Sphinkters als auch die Anhebung der Hinterzunge unterstützen. Die Innervation ist die gleiche wie die des M. palatopharyngeus.
Der M. constrictor pharyngis superior zählt nicht mehr zu den velaren Muskeln, ist aber am velaren Funktionsmechanismus beteiligt. Er besteht aus mehreren Faserbündeln, von denen vor allem der pterygopharyngeale Abschnitt aktiv am velopharyngealen Verschluss beteiligt ist. Die Fasern verlaufen breit gefächert horizontal an der Oberfläche des Pharynx in Höhe des Velums, der Zunge und des Unterkiefers. Ihre Kontraktion lässt die seitliche und hintere Rachenwand hervortreten. Die Innervation erfolgt durch den N. vagus (X) über den Plexus pharyngeus.
2.1.3.2 Vitalfunktion
Die wesentliche Funktion des Gaumensegels besteht darin, die Verbindung von Mund- und Nasenraum zu öffnen oder zu verschließen, um damit so unterschiedliche Vorgänge wie die Nasenatmung, Saugen und Schlucken, Husten und Würgen oder die Belüftung des Mittelohres zu unterstützen.
2.1.3.3 Sprechen
Die Gaumensegelfunktion beim Sprechen beinhaltet eine Anhebung bei der Artikulation oraler Sprachlaute und eine Absenkung bei der Artikulation der nasalen Laute; im Deutschen sind das die drei Konsonanten /m/, /n/ und /η/. Die Gaumensegelanhebung bewirkt, dass der nasale Resonanzraum akustisch vom Mundraum „entkoppelt“ und damit die nasale Resonanz unterdrückt wird. Je nach dem Grad der Absenkung des Velums und dem Grad der Kieferöffnung wird der Sprachschall durch nasale Resonanz beeinflusst. Bei verschlossenem Mundraum und abgesenktem Gaumensegel (wie etwa bei /m/ oder /n/) dominiert der nasale Klang. Im Übrigen hebt sich das Gaumensegel nicht nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip; die Bewegungen werden vielmehr sehr effizient dosiert. Der Grad der Anhebung variiert mit den verschiedenen Lautklassen in der Reihenfolge Nasale – offene Vokale – geschlossene Vokale – Plosive/Frikative – orale Konsonantenfolgen. Durch Auswahl geeignet gestaffelter sprachlicher Übungsaufgaben kann man diesen Mechanismus für die Therapie ▶ velopharyngealer Funktionsstörungen nutzen.
Gaumensegelbewegungen zeigen auch ein ausgeprägtes Koartikulationsverhalten: So zeigt zum Beispiel der Vokal /a/ in „Mann“ aufgrund der nasalen Konsonanten in seiner Umgebung selbst eine starke Nasalierung und einen deutlichen Kontrast zum Vokal /a/ in „Bass“.
Eine ausführliche Darstellung der Anatomie und Physiologie des velopharyngealen Mechanismus findet sich in Perry ▶ [533]. Durch ▶ Echtzeit-Magnetresonanztomografie lassen sich Gaumensegelbewegungen während des Sprechens in Echtzeit im Sagittalschnitt beobachten (vgl. www.mpinat.mpg.de/626786/real-time-mri#Oropharyngeal).
2.1.4 Linguo- und labiomandibulärer Funktionskreis
Die Funktion der „primären Artikulatoren“, also der Zunge und der Lippen, zeichnet sich dadurch aus, dass sie beim Sprechen in enger Kooperation mit der Unterkiefermuskulatur koordiniert werden. Zunge und Unterlippe sind mechanisch mit dem Unterkiefer (Mandibula) verbunden, sodass sich jede Unterkieferbewegung unmittelbar auf diese Organe überträgt und umgekehrt die Bewegungen des Unterkiefers durch sensorische Informationen über die Lage und Bewegung von Zunge und Lippen beeinflusst werden. Die Bewegungsfunktionen von Zunge und Unterkiefer bzw. von Lippen und Unterkiefer werden dadurch im Sprechvorgang flexibel aufeinander abgestimmt. Wir sprechen daher von einem linguomandibulären und einem labiomandibulären Funktionskreis ▶ [290], ▶ [710] (s. ▶ Abb. 2.3). Die Bewegungen von Lippen, Zunge und Unterkiefer während des Sprechvorgangs lassen sich durch magnetresonanztomografische Verfahren in Echtzeit darstellen (vgl. Kap. ▶ 8.1.1; www.mpinat.mpg.de/626786/real-time-mri#Oropharyngeal).
2.1.4.1 Kiefermuskulatur
Die Kiefermuskulatur hat ihre primäre Funktion bei der Nahrungsaufnahme, nämlich beim Saugen des Neugeborenen und beim Kauen. Die größte Bewegungsauslenkung des Unterkiefers besteht in einer Rotation um das Kiefergelenk, die zu einer Anhebung bzw. Absenkung des Unterkiefers beim Mundschluss bzw. der Mundöffnung führt. Die Anhebung wird durch eine Kontraktion dreier Muskeln bewirkt:
des kräftigen M. masseter, der vom Jochbein zum Kieferknochen zieht,
des vom Schläfenbein zum Unterkiefer ziehenden M. temporalis,
des von der Schädelbasis zum vertikal aufsteigenden Teil des Kieferknochens ziehenden M. pterygoideus medius.
Diese Muskulatur ist auch in Ruhe aktiv, um eine Kieferabsenkung durch die Schwerkraft zu verhindern. Der Unterkiefer kann auch seitlich bewegt und nach vorne verschoben werden. Für diese Bewegungen ist neben den genannten Muskeln der M. pterygoideus lateralis verantwortlich. Dieser Muskel kann daneben auch die durch die Schwerkraft begünstigte Kieferöffnung aktiv unterstützen. Weitere, weniger kräftig ausgebildete Kiefersenker sind die Mm. geniohyoideus, digastricus (pars anterior) und mylohyoideus, die alle von der Innenseite des Unterkiefers zum Zungenbein ziehen.
Die motorische Innervation der Kiefermuskulatur geschieht durch den mandibulären Ast des N. trigeminus (N. V3), der im motorischen Trigeminuskern (Ncl. Vmot) in der Brückenformation des Hirnstamms seinen Ausgang hat. Eine Ausnahme bildet der an der Kieferabsenkung beteiligte M. digastricus, der vom Fazialisnerv mitversorgt wird ( ▶ Tab. 2.4 ).
Tab. 2.4
Innervation der Kiefermuskulatur
▶ [312]
.
Muskeln
Motorische Innervation*
Funktion beim Sprechen
M. digastricus
M. mylohyoideus
M. pterygoideus lateralis
M. geniohyoideus
N. facialis (Ncl. VII)
N. mandibularis (Ncl. Vmot)
N. mandibularis (Ncl. Vmot)
N. hypoglossus (C1, C2)
Kieferabsenkung
M. temporalis
M. masseter
M. pterygoideus medius
N. mandibularis (Ncl. Vmot)
Kieferanhebung
Stabilisierung des Unterkiefers
* Ncl. Vmot: Nucleus motorius nervi trigemini; Ncl. VII: Nucleus nervi facialis;
C1, C2: Vorderhornzellen des Zervikalmarks, Segmente 1, 2
Für die Artikulation sind ausschließlich die Öffnungs- und Verschlussbewegungen und die tonische Stabilisierung des Unterkiefers von Bedeutung. Bei normalem Artikulieren werden nur sehr eingeschränkte, aber fein abgestufte Kieferbewegungen unter geringem Kraftaufwand ausgeführt. Der größte Öffnungswinkel ist für die Bildung des Vokals /a/ erforderlich, etwas geringere Winkel für die weniger offenen Vokale (z.B. /i/ und /e/) und der geringste Winkel bei der Artikulation der Konsonanten, insbesondere der alveolaren und post-alveolaren Plosive und Frikative. Die großen Kieferhebermuskeln, Mm. temporalis und masseter, kommen dabei nicht zum Einsatz – sie dienen vermutlich eher der Stabilisierung der Unterkieferkonfiguration als „Widerlager“ für die phasischen ▶ Artikulationsbewegungen. Die Unterkieferanhebung bei der Artikulation wird nahezu ausschließlich durch den M. pterygoideus medialis, die Öffnungsbewegung durch den M. digastricus bewirkt. Darin unterscheidet sich die Unterkiefermotorik der Artikulation deutlich von der des Kauens ▶ [635]. In Kap. ▶ 12.4.2 wird davon die Rede sein, wie die Halte- und Widerlagerfunktion des Unterkiefers therapeutisch beeinflusst werden kann.
2.1.4.2 Zunge
Die Zunge wird als das wichtigste Artikulationsorgan angesehen, da sie an der Bildung aller Vokale und der meisten Konsonanten beteiligt ist. Im Unterschied zur Unterkiefer- und Kehlkopfmuskulatur bewirkt die Zungenmuskulatur keine Gelenkbewegungen. Kontraktionen der Zungenmuskeln führen vielmehr zu Verformungen des Zungenkörpers selbst und zu Verlagerungen seiner Masse innerhalb des Mundraumes. Man nennt solche Muskeln auch muskuläre Hydrostaten.
Die primäre vitalmotorische Funktion der Zunge besteht in der Manipulation und im Transport der Nahrung beim Kauen und Schlucken. Zungenbewegungen sind aber auch bei der Atmung, beim Husten oder Gähnen und bei anderen oral-motorischen Aktivitäten wie der Reinigung des Mundraums und der Lippen von Fremdkörpern oder Speiseresten zu beobachten ▶ [592]. Die Zunge ist ferner auch unser Geschmacksorgan.
Die Zunge wird grob anatomisch unterteilt in die Zungenspitze, das Zungenblatt, den Zungenrücken und die Zungenwurzel. Sie besteht zum größten Teil aus Muskelgewebe. Die Zungenmuskeln zeichnen sich durch eine hohe Kontraktionsgeschwindigkeit und eine geringe Ermüdbarkeit aus ▶ [585].
Man unterscheidet intrinsische und extrinsische Zungenmuskeln ( ▶ Tab. 2.5 ). Die intrinsischen Muskeln haben ihren Ausgang und ihre Endigung im Muskelgewebe der Zunge selbst. Durch Kontraktion dieser Muskeln lässt sich der Zungenkörper auf vielfältige Weise verformen.
Tab. 2.5
Innervation der Zunge
▶ [462]
,
▶ [585]
.
Muskeln
Motorische Innervation
Funktion beim Sprechen
Intrinsische Zungenmuskeln
M. longitudinalis superior
M. longitudinalis inferior
M. transversus
M. verticalis
N. hypoglossus (Ncl. XII)
Anhebung/Absenkung der Zungenspitze, Anhebung oder Absenkung der Zungenränder, Verkürzung oder Abflachung der Vorderzunge
Extrinsische Zungenmuskeln
M. genioglossus
M. hyoglossus
M. styloglossus
N. hypoglossus (Ncl. XII)
Protrusion/Retraktion und Anhebung/Absenkung des Zungenkörpers
M. palatoglossus
N. glossopharyngeus (Ncl. X)
Anhebung der Hinterzunge,
Verengung des Pharynx (mit M. palatopharyngeus)
Zu den intrinsischen Muskeln zählen:
die vertikalen Fasern des M. verticalis linguae, die bei Kontraktion die Zunge flach und breit formen,
der M. longitudinalis inferior, der in der Tiefe des Zungengewebes das Zungenblatt mit dem Zungengrund verbindet und bei Kontraktion die Zungenspitze absenkt und der Zunge eine konvexe Form gibt,
der an der Oberfläche in Längsrichtung verlaufende M. longitudinalis superior, der bei Kontraktion die Zunge verkürzt und die Zungenspitze anhebt und
der M. transversus linguae, dessen Fasern senkrecht zur Mittellinie in Horizontalrichtung verlaufen und bei Kontraktion zu einer Anhebung der Zungenränder und zu einer Verengung und Verlängerung der Zunge führen.
Die extrinsischen Zungenmuskeln verbinden die Zunge mit dem Unterkiefer (M. genioglossus), dem Schläfenbein (M. styloglossus), dem harten Gaumen (M. palatoglossus) und dem Zungenbein (M. hyoglossus). Ihre Kontraktion führt zu einer Verlagerung der Zunge nach vorne oder hinten, oben oder unten, oder in seitlicher Richtung:
Der M. genioglossus strahlt fächerförmig vom Kieferknochen in die Zunge ein und hat einen großen Anteil an der Masse des Zungenkörpers. Kontraktion der vorderen Faseranteile des Genioglossus bewirkt eine Absenkung und Retraktion, die der hinteren Faseranteile eine Anhebung und Protrusion.
Der M. styloglossus, der seitlich in den Zungenkörper einstrahlt und die Zunge mit dem Schläfenbein verbindet, hebt bei Kontraktion die Zungenränder an und retrahiert den Zungenkörper.
Der M. hyoglossus, der am Zungenbein ansetzt und als Teil der Zungenwurzel in den hinteren Anteil der Zunge einstrahlt, retrahiert die Zunge und senkt die Zungenränder seitlich ab.
Der M. palatoglossus verbindet den hinteren Anteil der Zunge mit dem weichen Gaumen und bewirkt, antagonistisch zum M. hyoglossus, eine Anhebung des Zungenrückens.
Die motorische Innervation der intrinsischen und extrinsischen Zungenmuskeln erfolgt ausschließlich durch Äste des im Hypoglossuskern der Medulla oblongata entspringenden 12. Hirnnerven, des N. hypoglossus ( ▶ Tab. 2.5 ).
Die Beteiligung der verschiedenen Zungenmuskeln an der Artikulation ist ein komplexes Geschehen. Beispielsweise ist der M. genioglossus hauptsächlich an der Bildung der geschlossenen Vorderzungenvokale (/i/, /e/) beteiligt, während der M. hyoglossus den Zungenrücken für die Bildung der offenen Vokale (z.B. /a/) absenkt. Zur Bildung und anschließenden Lösung eines alveolaren Verschlusses durch die Vorderzunge (/d/, /t/, /n/) ist abwechselnd eine Konstriktion des oberen und des unteren Longitudinalmuskels erforderlich, während die Anhebung des Zungenrückens für /g/, /k/, /η/ durch eine vereinte Aktivität der Mm. styloglossus und palatoglossus erzielt wird, die nachfolgende Absenkung durch eine Kontraktion des M. hyoglossus. Eine noch komplexere und vor allem sehr präzise Muskelaktivität ist schließlich für Konsonanten wie den Frikativ /s/ erforderlich, bei dem das Zungenblatt an den harten Gaumen angehoben und dabei zu einer zentralen Furche verformt werden muss. Die Anhebung wird wiederum durch den M. genioglossus erreicht, die Verformung der Zunge durch den M. styloglossus und den unteren Longitudinalmuskel.
Merke
Die Feinabstimmung der Zungenkonfiguration bei der Artikulation lingualer Konsonanten kann schon durch geringfügige sprechmotorische Beeinträchtigungen empfindlich gestört sein.
Seitliche Zungenbewegungen nach links und rechts oder Bewegungen außerhalb der Mundhöhle („Zunge heraustrecken“), wie sie in manchen mundmotorischen Aufgabenstellungen oder therapeutischen Übungen gefordert werden, treten beim Sprechen nicht auf (vgl. ▶ Abb. 8.8; Kap. ▶ 12.4.4).
Eine ausführliche und anschauliche Darstellung der Anatomie und Physiologie der Zunge findet sich in den Werken von Sanders u. Mu ▶ [462], ▶ [585].
2.1.4.3 Periorale Muskulatur
Die Muskulatur der unteren Gesichtshälfte, also die den Mund umgebende (periorale) Muskulatur, hat ihre primäre Funktion ebenfalls in der Nahrungsaufnahme, daneben aber auch im mimischen Ausdruck, z.B. beim Lachen oder Weinen. Beim Sprechen trägt die periorale Muskulatur – zusammen mit der Kiefermuskulatur – zum Verschluss bzw. zum Öffnen des Mundes bei labialen Konsonanten bei, aber auch zur Verlängerung des Vokaltrakts durch Protrusion der Lippen. Der Hauptanteil der perioralen Muskulatur wird durch den Ringmuskel M. orbicularis oris gebildet, der bei Kontraktion eine Lippenrundung und -protrusion bewirkt, aber auch an der Lippenschlussbewegung beteiligt ist. Rundung und Protrusion werden z.B. für die Artikulation der gerundeten Vokale /y/, /ø/, /u/ und /o/ benötigt, Lippenschluss für die Verschlusslaute /m/, /b/ und /p/. Weitere für die labiale Artikulation wichtige Muskeln sind die seitlich in die Lippen einstrahlenden Mm. risorius und buccinator sowie der M. zygomaticus major. Diese Muskeln spreizen die Lippen, wobei Spreizbewegungen bei der Artikulation, z.B. bei der Bildung der Vokale /i/ und /e/ oder der Frikative /v/ und /f/, nur sehr gering ausgeprägt sind (für therapeutische Implikationen s. Kap. ▶ 12.4.3). Ober- und Unterlippe können auch vertikal durch den M. levator labii superior und den M. depressor labii inferior bewegt werden, z.B. bei der Verschlussbildung für die labialen Verschlusslaute. Allerdings wird der Hauptanteil dieser Bewegungen durch den M. orbicularis oris und die Anhebung bzw. Absenkung des Unterkiefers übernommen ( ▶ Tab. 2.6 ).
Tab. 2.6
Periorale Muskulatur [308].
Muskeln
Motorische Innervation
Funktion beim Sprechen
M. orbicularis oris
N. facialis (Ncl. VII)
Lippenrundung, -protrusion
M. zygomaticus
M. buccinator
M. depressor anguli oris
Lippenspreizung
M. levator labii superior
M. depressor labii inferior
Mundöffnung
M. levator anguli oris
M. mentalis
Lippenprotrusion
Die emotionalen mimischen Ausdrucksbewegungen, an denen noch weitere, hier nicht genannte periorale Muskeln beteiligt sind, sind in ihrer Amplitude und der damit verbundenen Muskelaktivität oft weit ausgeprägter und dabei auch stereotyper als die artikulatorischen Mundbewegungen. Auch mundmotorische Aufgabenstellungen wie „Öffnen Sie den Mund“ oder „Spreizen Sie die Lippen“, wie sie in der Dysarthriediagnostik vielfach verwendet werden, führen meistens zu Bewegungen, die die Mundbewegungen beim Sprechen in ihrem Ausmaß weit übersteigen (s. Kap. ▶ 8.2.1; Abb. 8.8).
Die gesamte Muskulatur der unteren Gesichtshälfte wird motorisch von den unteren Ästen des N. facialis innerviert, der seinen Ausgang im Fazialiskern in der Brückenregion des Hirnstamms hat ( ▶ Tab. 2.6 ).
Zusatzinfo
Artikulation und Dysarthrie
Artikulationsstörungen sind ein zentrales Symptom aller Dysarthriesyndrome. Motorische Beeinträchtigungen von Zungen-, Lippen- und Kieferbewegungen führen, je nach ▶ Dysarthriesyndrom, zu unterschiedlichen Störungen vor allem der Konsonanten-, aber auch der Vokalartikulation. Besonders vulnerabel sind Frikative und Konsonantenverbindungen, wo bereits geringe Bewegungsabweichungen zu deutlich hörbaren Veränderungen führen. Bei Patient*innen mit velopharyngealer Insuffizienz kann starke Hypernasalität mit nasalem Luftverlust das Störungsbild dominieren, oft mit negativen Auswirkungen auf Sprechatmung, Stimmqualität und die Konsonantenartikulation (s. Kap. ▶ 2.2.2 und ▶ Abb. 2.4).
Artikulationsstörungen und Störungen der nasalen Resonanz haben in erster Linie Einschränkungen der Verständlichkeit zur Folge, sie führen aber auch zum Eindruck einer unnatürlichen Sprechweise und zu erhöhter Anstrengung der Kommunikationspartner*innen in der Konversation ▶ [250], ▶ [387], ▶ [603]. Die therapeutischen Ansätze zur Behandlung dysarthrischer Störungen der Artikulation werden in Kap. ▶ 12.4 ausführlich besprochen.
2.2 Zusammenspiel der Muskeln und Funktionskreise
Die strenge Fragmentierung der am Sprechvorgang beteiligten Muskulatur nach Funktionskreisen stellt eine Vereinfachung dar, die den tatsächlichen Verhältnissen nicht gerecht wird. Keiner der Funktionskreise arbeitet autonom, vielmehr bestehen zwischen den Funktionskreisen zahlreiche anatomische und aerodynamische Verknüpfungen. Diese zu kennen ist wichtig, um den Sprechvorgang zu verstehen und die Symptomatik der Dysarthrien und viele der in Kap. ▶ 12 beschriebenen Behandlungsansätze einordnen und zielgerecht anwenden zu können.
2.2.1 Anatomische Kopplungen zwischen den Funktionskreisen
Da die Bewegungsorgane des Sprechens sowohl innerhalb der Funktionskreise als auch über die Funktionskreise hinweg anatomisch miteinander verbunden sind, beeinflussen sie sich gegenseitig auf rein mechanische Weise. In ▶ Abb. 12.1, ▶ Abb. 12.2 und ▶ Abb. 12.3 werden diese Zusammenhänge im Hinblick auf ihre therapeutische Relevanz anschaulich dargestellt.
Ein offensichtliches Beispiel ist die enge Kopplung der Bewegungen von Zunge und Lippen mit den Bewegungen des Unterkiefers. Da sich jede Kieferbewegung mechanisch auf die Zungenposition und die Position der Unterlippe überträgt, müssen die Aktivitäten der verschiedenen Muskeln der linguo- und labiomandibulären Funktionskreise entsprechend koordiniert werden: Bei geringer Kieferöffnung ist der Bewegungsspielraum von Zungen- und Lippenbewegungen eingeschränkt und nur geringfügige Bewegungen reichen aus, um beispielsweise einen vollständigen Verschluss oder eine Engebildung für die Frikativartikulation zu realisieren. Umgekehrt müssen bei großer Kieferöffnung die Artikulationsorgane weitere Wege gehen, um linguale oder labiale Konstriktionen zu bilden und die koartikulatorische Feinabstimmung zu realisieren. Wenn zu geringe oder zu große Kieferöffnungen als Symptome einer Dysarthrie auftreten, ergeben sich daraus wichtige Konsequenzen für therapeutische Interventionen (s. Kap. ▶ 12.4.2).
Auch zwischen den Funktionskreisen bestehen solche mechanisch bedingten Interaktionen, etwa zwischen Phonations- und Artikulationsfunktionen. Die Funktion der intrinsischen Kehlkopfmuskulatur bei der Phonation ist von einer stabilen Haltefunktion der äußeren Kehlkopfmuskeln abhängig; diese bilden ein Widerlager für die Ab- und Adduktionsmanöver und die Spannungsveränderungen der Stimmlippen bei der Phonation. Die extrinsischen Kehlkopfmuskeln sind wiederum über das Zungenbein mit der Zunge und über den M. mylohyoideus mit dem Unterkiefer verbunden ( ▶ Tab. 2.2 , ▶ Tab. 2.4 ), was dazu führt, dass sich Änderungen der Zungen- und Kieferposition auf die Lage des Kehlkopfs und damit auch auf den Spannungszustand der Stimmlippen übertragen. So ist es z.B. zu erklären, dass Vokale mit hoher Zungenlage meist mit einer etwas höheren Sprechstimme (Grundfrequenz) gesprochen werden als etwa der offene Vokal /a/, weil durch die Anhebung der Zunge der Kehlkopf etwas gekippt und die Stimmlippen gespannt werden („intrinsische Tonhöhe“). Aus diesem Zusammenhang ergibt sich auch therapeutisches Potenzial für die Behandlung von ▶ Stimmstörungen.
Die Phonationsfunktion des Kehlkopfs ist im Übrigen auch an thorakale Strukturen gekoppelt, vor allem über die Mm. sternothyroideus und sternohyoideus an das Brustbein ( ▶ Tab. 2.2





























