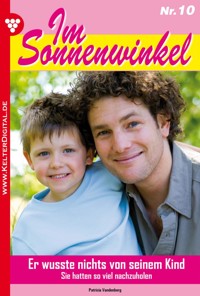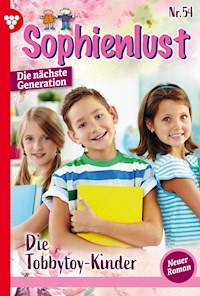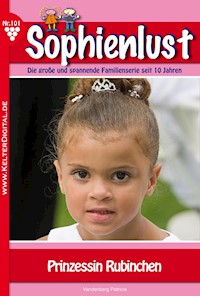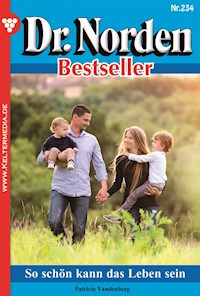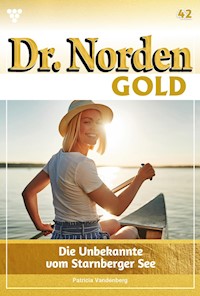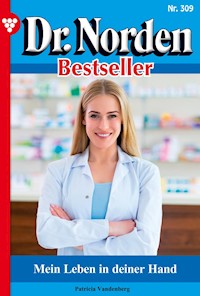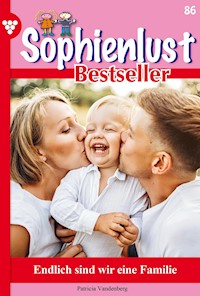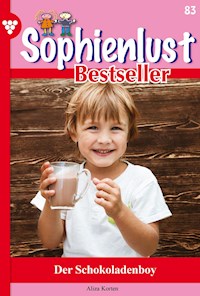30,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Dr. Norden Bestseller Staffel
- Sprache: Deutsch
Für Dr. Norden ist kein Mensch nur ein 'Fall', er sieht immer den ganzen Menschen in seinem Patienten. Er gibt nicht auf, wenn er auf schwierige Fälle stößt, bei denen kein sichtbarer Erfolg der Heilung zu erkennen ist. Immer an seiner Seite ist seine Frau Fee, selbst eine großartige Ärztin, die ihn mit feinem, häufig detektivischem Spürsinn unterstützt. Dr. Norden ist die erfolgreichste Arztromanserie Deutschlands, und das schon seit Jahrzehnten. Mehr als 1.000 Romane wurden bereits geschrieben. Die Serie von Patricia Vandenberg befindet sich inzwischen in der zweiten Autoren- und auch Arztgeneration. E-Book 141: Als geheilt entlassen E-Book 142: Die unbekannte Tochter E-Book 143: Dr. Norden hat Probleme E-Book 144: Ein guter Freund in schweren Stunden E-Book 145: Auch Dr. Norden schwieg E-Book 146: Dr. Norden und die Lügnerin E-Book 147: Ein Kind stand zwischen E-Book 148: Ein Traum zerrann E-Book 149: Sie bereute ihre Entscheidung E-Book 150: Sag nie adieu E-Book 1: Als geheilt entlassen E-Book 2: Die unbekannte Tochter E-Book 3: Dr. Norden hat Probleme E-Book 4: Ein guter Freund in schweren Stunden E-Book 5: Auch Dr. Norden schwieg E-Book 6: Dr. Norden und die Lügnerin E-Book 7: Ein Kind stand zwischen ihnen E-Book 8: Ein Traum zerrann E-Book 9: Sie bereute ihre Entscheidung E-Book 10: Sag nie adieu
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1474
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Leseprobe
Als geheilt entlassen
Die unbekannte Tochter
Dr. Norden hat Probleme
Ein guter Freund in schweren Stunden
Auch Dr. Norden schwieg
Dr. Norden und die Lügnerin
Ein Kind stand zwischen ihnen
Ein Traum zerrann
Sie bereute ihre Entscheidung
Sag nie adieu
Leseprobe: Das Geheimnis der schönen Antonia
Dr. Leon Laurin stand wie festgewachsen auf einer belebten Straße in der Münchener Innenstadt, während er seine Frau Antonia, die vor einem Café auf der anderen Straßenseite saß, nicht aus den Augen ließ. Seit mehr als siebzehn Jahren waren sie miteinander verheiratet, hatten vier Kinder, führten, jedenfalls seiner Ansicht nach, eine glückliche Ehe. Und nun sah er sie zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit mit ihrem Jugendfreund Ingo Ewert in sehr vertrautem und angeregtem Gespräch – und auch dieses Mal, daran zweifelte er nicht, würde sie die Begegnung zu Hause ihm gegenüber nicht erwähnen. Er war der Ansicht gewesen, die Eifersucht seiner frühen Jahre längst überwunden zu haben, nun musste er feststellen, dass er einem Irrtum erlegen war. Am liebsten hätte er Ingo Ewert – Dr. Ingo Ewert, Leiter der Kinderklinik Dr. Ewert – direkt zur Rede gestellt. Oder noch besser: ihn am Kragen gepackt und geschüttelt und Auskunft darüber verlangt, wie er dazu kam, am helllichten Tag mit seiner, Leons, Ehefrau in einem Café zu sitzen und sich allem Anschein nach gut zu unterhalten. Jetzt griff er sogar nach ihrer Hand und drückte sie! Leon hatte Mühe, an sich zu halten. Als er die beiden vor zwei Wochen das erste Mal zusammen gesehen hatte, war er noch überzeugt gewesen, Antonia werde ihn mit den Worten empfangen: »Rate mal, wen ich heute getroffen habe!« Aber nichts Dergleichen war geschehen, kein Wort hatte sie gesagt, sie hatte Ingo Ewert nicht einmal erwähnt. Dabei wusste er ja nur zu gut, dass Ingo früher einmal bis über beide Ohren in Antonia verliebt gewesen war. Allem Anschein nach war er es immer noch. Er musste sie zur Rede stellen, er brauchte Gewissheit. Aber vielleicht war alles ganz harmlos, und er sah Gespenster. Dann würde sie ihn auslachen, und er stünde da wie der letzte Depp. War es also doch besser, ruhig abzuwarten, bis Antonia von sich aus auf ihn zukam, um mit ihm über Ingo zu sprechen? Aber was würde sie ihm dann sagen?
Dr. Norden Bestseller – Staffel 15 –
E-Book 141-150
Patricia Vandenberg
Als geheilt entlassen
Roman von Vandenberg, Patricia
Voller Unruhe wartete Maria Wallberg auf ihre Tochter Monika. Sie war es gewohnt, dass das Mädchen immer pünktlich heimkam. Seit einem Jahr besuchte Monika die Meisterschule für Mode. Für diese Ausbildung hatte sie sich schon früh entschieden, und ein außergewöhnliches Talent versprach, dass sie es in diesem Beruf auch weit bringen würde.
Maria war stolz auf ihre Tochter, für die sie allein hatte sorgen müssen, seit Monika knapp acht Jahre alt war. Für ihr Kind hatte sie alle persönlichen Wünsche und Hoffnungen zurückgestellt, die bei einer so hübschen und vitalen Frau verständlich waren.
Nun läutete es dreimal. Maria atmete auf und eilte zur Tür, aber unwillkürlich fuhr sie zurück, als sie in Monikas verschwollenes Gesicht blickte.
»Kind, Liebes, was ist dir passiert?«, fragte sie bebend.
»Reg dich doch nicht gleich wieder auf, Mutsch«, sagte Monika. »Es sieht schlimmer aus, als es ist. Mein Auge ist plötzlich angeschwollen. Ich war auch schon beim Augenarzt, deswegen komme ich so spät. Er meint, es sei eine Infektion und hat mir erst mal Tabletten verordnet. Die habe ich auch gleich geholt. Verdammt teuer das Zeug.«
»Wenn sie helfen, macht das nichts«, sagte Maria. »Zeig mal her, was es für Tabletten sind.«
Sie konnte sich beherrschen. Sie zeigte nicht, wie beunruhigt sie war, aber als sie dann das Beiblatt gelesen hatte, das den Tabletten beigefügt war, schüttelte sie den Kopf.
»Da müssen wir erst mit Dr. Norden sprechen«, sagte sie. »Mit Penicillin muss man vorsichtig bei dir sein.«
»Und du weißt ja, wie ungern ich Tabletten schlucke.«
Maria Wallberg wusste es. Der Widerwillen, den Monika schon früh gezeigt hatte, hatte ihr einmal das Leben gerettet, sie zumindest vor sehr schlimmen Folgen bewahrt, denn als sie sehr spät die Masern bekam, hatte ihr ein Apotheker versehentlich viel stärkere Kapseln gegeben, als Dr. Norden verordnet hatte. Und der hatte den Irrtum dann sehr rasch festgestellt, als Maria ihn rief, weil das Kind Monika sich weigerte, die Kapseln zu schlucken.
Und diesmal wollten sie sich auch lieber auf Dr. Nordens Rat verlassen. Monika war damit sofort einverstanden.
»So einen Arzt gibt es so schnell nicht, Mutsch«, sagte sie. »Er nimmt sich Zeit, auch wenn es nicht sein Gebiet betrifft. Vielleicht kommt es auch bloß von den Kontaktlinsen.«
Die brauchte Monika, weil sie kurzsichtig war und gerade für den Beruf, den sie anstrebte, ganz genau sehen musste. Aber ein so bildhübsches Mädchen wollte ungern eine Brille tragen, obgleich Maria immer wieder gesagt hatte, dass es doch so hübsche Brillen gäbe.
Monika war auch sehr sportlich. Sie spielte Tennis und trieb Leichtathletik, und im Winter war sie jeden Tag eine Stunde auf der Eisbahn. Da störte eine Brille freilich.
Maria hatte schon zum Telefon gegriffen. Es war zwar schon sechs Uhr vorbei, aber sie wusste, dass Dr. Norden oft auch noch später in seiner Praxis war. Und auch diesmal war es so.
»Wir können gleich kommen«, sagte Maria zu ihrer Tochter.
»Musst du heute nicht noch mal zu Berneck?«, fragte Monika.
»Nein, er ist vier Tage auf Geschäftsreise.«
»Wenn ich erst verdiene, Mutsch, wirst du nicht mehr arbeiten«, sagte Monika, als sie schon auf dem Weg zu Dr. Norden waren.
»Was soll ich denn mit meiner Zeit anfangen, Moni?«, meinte Maria ruhig. »Es ist eine sehr angenehme Stellung, die uns doch auch große Vorteile bringt.«
»Bis Berneck mal auf den Gedanken kommt, dass du ihm unentbehrlich bist und er dir einen Heiratsantrag macht«, erwiderte Monika unwillig.
Maria schluckte es wortlos, denn Helmut Berneck hatte ihr schon vor Monaten einen Heiratsantrag gemacht und diesen immer wiederholt. Aber sie kannte Monikas Einstellung und hatte mit ihr darüber noch nicht gesprochen. Und jetzt, in dieser Stunde, stellte sie auch diesen Wunsch, ein gemeinsames Leben mit dem Mann, den sie lieben gelernt hatte, zu führen, zurück.
»Warum sagst du nichts, Mutsch?«, fragte Monika.
»Weil ich auf den Verkehr achten muss«, redete sich Maria heraus. »Heute sind wieder mal die Verrückten unterwegs.«
»Es ist Freitag, Mutsch«, sagte Monika.
Und für ihre Mutter schien es ein schwarzer Freitag zu sein, denn abgesehen von Monikas schlimmem Auge hatte sie ein Schreiben bekommen, dass sie ihre Wohnung bis zum 1. Januar räumen müsse, da das Mietshaus seinen Besitzer gewechselt hätte und dieser die Wohnung im Zuge der Sanierung in Eigentumswohnungen umwandeln wolle. Davon wollte sie Monika aber noch nichts erzählen.
*
Dr. Daniel Norden kannte Monika seit ihrem siebten Lebensjahr, nämlich schon so lange, wie er seine Praxis ausübte. Sie war eine der ersten Patientinnen gewesen, die er rein zufällig bekam, weil Maria Wallberg an jenem Tag, als Monika die Masern bekam, einfach den nächsten Arzt geholt hatte.
Elf Jahre verbanden sie nun schon, und Dr. Norden kannte auch so ziemlich alle Sorgen, die Maria Wallberg bewegten. Sie jammerte nie, sie war auch nie ernstlich krank, was ihn besonders freute.
Er wusste auch, dass Helmut Berneck Maria heiraten wollte, und er wusste auch, warum Maria nicht ihrem Herzen folgend ja dazu sagte.
Als er jetzt Monika betrachtete, mit den Augen des Arztes und auch mit der Sympathie, die er für dieses Mädchen empfand, das er so lange kannte, war er erschrocken.
»So plötzlich ist das gekommen, Moni?«, fragte er.
»Na ja, ein bisschen geschwollen war es schon mal«, erwiderte Monika.
»Da dachten wir, es wäre eine Bindehautentzündung«, warf Maria ein. »Moni machte gerade die Prüfung für die Meisterschule.«
»Da war auch etwas Nervosität dabei«, sagte Monika.
»Ich würde jedenfalls dazu raten, dass sie in der Augenklinik untersucht wird«, erklärte Dr. Norden. »Ich werde Ihnen eine Empfehlung an Professor Hillbrecht mitgeben und einen Termin für Montag ausmachen.«
»Und keine Tabletten?«, fragte Maria.
»Nein, keine Tabletten, das verantworte ich. Ich weiß, wie sie auf Penicillin reagiert. Wie ärgerlich, dass so was ausgerechnet am Freitag akut wird. Versäumen wollen wir ja nichts. Ich werde anrufen, ob Professor Hillbrecht morgen auch da ist.«
Der Anruf widersprach dieser Hoffnung, aber es wurde Dr. Norden gesagt, dass in einem dringenden Fall Professor Hillbrechts Assistent Dr. Seibert zur Verfügung stehe.
»Moni soll sich morgen um neun Uhr in der Augenklinik melden«, sagte Dr. Norden. »Zumindest wird man ihr ohne Penicillin Erleichterung verschaffen. Und vielleicht ist dann alles bald wieder in Ordnung«
Und Maria war in diesem Augenblick nur froh, dass sie die nächsten Tage ganz ihrer Tochter widmen konnte, dass sie nicht in den Konflikt zwischen Helmut Berneck und Monika gedrängt wurde.
Monika ging gleich zu Bett, als sie daheim waren, und sie schlief auch schnell ein. Sie hörte nicht, wie das Telefon läutete. Helmut Berneck rief aus Kopenhagen an.
»Wie geht es dir, mein Herzblatt?«, fragte er. Seine warme, tiefe Stimme rief wieder Sehnsucht in Maria wach.
»Mir geht es gut, aber Moni hat was am Auge. Morgen fahre ich mit ihr zur Augenklinik«, sagte sie. Da herrschte Stille.
»Bist du noch da, Helmut?«, fragte sie.
»Ja, ich überlege, wer der beste Arzt ist«, kam die zögernde Antwort.
»Auf Dr. Nordens Empfehlung können wir uns verlassen«, sagte Maria. »Er kennt Moni seit elf Jahren.«
»Ich wollte, ich würde euch schon so lange kennen«, vernahm sie. »Ich rufe morgen Abend wieder an. Du fehlst mir. Wenn wir doch endlich diese Klippen überwunden hätten. Ich möchte Monika so gern ein Vater sein, da ich meinen Sohn verloren habe.«
»Versuch doch wenigstens, ihn zurückzugewinnen, Helmut«, sagte Maria leise.
»Nein, er muss von selbst kommen. Belaste dich damit nicht auch noch, mein Liebes. Ich hoffe so sehr, dass du bald für immer zu mir kommst.«
Sie sah ihn vor sich, als sie den Hörer auflegte. Sein markantes Gesicht, das früh ergraute Haar, die klugen, wachsamen Augen.
Sie hatte ihn gemocht, als sie vor vier Jahren zu ihm kam, sozusagen als Mädchen für alles. Eine Hausdame hatte er per Annonce gesucht, die auch Schreibarbeiten erledigen könne. Eine Dame, die einem frauenlosen Haushalt vorstehen könne. Sie hatte sich bei ihm vorgestellt, aber sofort gesagt, dass sie ihre eigene Wohnung beibehalten müsse, da sie eine Tochter hätte.
Da hatte er einen Augenblick gezögert, dann ihr aber doch ein Gehalt geboten, dass ihr die Augen übergingen. Und seither bestimmte sie den Ton in seinem Haus. Sie hatte die schnippische, faule Lisa entlassen und dem treuen Hausmeisterehepaar Korbinian und Zenta Heitmanning Vertrauen eingeflößt.
Mit den beiden könne sie den Haushalt gut allein bewältigen, hatte sie dem Industriellen erklärt. Und er hatte keinen Grund zur Klage mehr gehabt.
Sie hatte ihm auch manche Briefe geschrieben, über die er volle Diskretion gewahrt wissen wollte. Sie hatte erfahren, dass er mit seinem einzigen Sohn Michael über Kreuz stand, dass die Verwandten seiner verstorbenen Frau ihn ständig anbettelten.
Nach dem zweiten Jahr ihrer Tätigkeit hatte sie auch den Menschen Helmut Berneck kennengelernt, einen einsamen Mann. An seinem fünfzigsten Geburtstag war es gewesen.
Da hatte er von seiner Ehe gesprochen, von seinem Sohn, der da gerade seinen Doktor gemacht hatte, sechsundzwanzig Jahre jung.
»Ich hatte mich in ein zauberhaftes Mädchen verliebt, Maria«, hatte er gesagt. »Und ich habe sie vier Monate später geheiratet. Da war ich vierundzwanzig und sie zwanzig, und ich fühlte mich ungeheuer glücklich, als sie mir einen Sohn schenkte. Zwei Jahre später verlangte sie die Scheidung, weil sie sich in einen anderen Mann verliebt hatte. Ich war so geschockt, dass ich einwilligte. Sie ließ mir meinen Sohn. Das genügte mir. Mir selbst gestand ich es ein, dass das zauberhafte Mädchen sich als vergnügungssüchtige Partylöwin herausgestellt hatte. Inzwischen ist sie zum vierten Mal verheiratet, und von jeder Ehe hat sie finanziell profitiert. Ich hatte genug von den Frauen. Ich hatte meinen Sohn. Ich sah meinen Erben in ihm, aber Michael wollte Medizin studieren. Als ich ihm zornig sagte, dass sich dann unsere Wege trennen würden, verließ er das Haus. Er hat keinen müden Euro von mir angenommen.«
Ob er nicht einen Weg gesucht hätte, mit seinem Sohn eine Verbindung herzustellen, hatte ihn Maria gefragt.
»Mehrmals habe ich das versucht, aber er ist stur. Er brauche mein Geld nicht, ließ er mich wissen. Er hätte keine Mutter gehabt, und er könne auch ohne Vater auskommen. Ich dachte, er würde eines Tages doch kommen, aber er kam nicht.«
Und das hätte er so einfach hingenommen, hatte Maria ihn gefragt.
»Was soll ich tun, Maria? Er muss seinen Weg gehen. Selbstverständlich wäre ich bereit, ihm zu helfen, wenn er Hilfe braucht, aber er ist genauso stur wie ich. Das ist mir ein kleiner Trost. Ich kann nur hoffen, dass er eine andere Frau findet, als es seine Mutter war, eine Frau, die ihn versteht, und ich weiß heute, dass man einen jungen Menschen nicht zwingen kann, ein Erbe zu übernehmen, das ihm nur eine Last sein würde. Man muss das tun, woran man Freude hat, nur dann kann man etwas leisten. Ich habe zu viele sogenannte Erben auf der Strecke bleiben sehen.«
Ganz genau erinnerte sich Maria an dieses Gespräch, das schließlich der Beginn ihrer gegenseitigen Zuneigung wurde, weil auch ihr Leben nicht frei von Konflikten gewesen war, weil ihre Ehe mit Monikas Vater ihr nicht die Erfüllung gebracht hatte, die sie einst erhoffte. Er, Alfred Wallberg, war ein Sprüchemacher gewesen, wie man in Bayern sagte. Er hatte tausend Pläne und verwirklichte nicht einen. Sie, die Tochter aus »gutem Hause«, hatte eine hübsche Mitgift bekommen. Als diese verbraucht war, musste sie Geld verdienen, weil er für den Unterhalt der kleinen Familie nicht sorgen konnte. Sie nahm eine Halbtagsstellung an, als Monika vier Jahre alt war. Das Kind verbrachte die Vormittage im Kindergarten. Alfred wechselte dauernd seine Stellungen. Manchmal verdiente er ganz gut, dann machte er wieder große Pläne. An Ideen fehlte es ihm nicht, aber der Höhenflug hielt nie lange an. Dann verlegte er sich auf den An- und Verkauf von Gebrauchtwagen, und es schien so, als würde er damit wirklich das große Geld machen. Aber mit einem dieser Wagen verunglückte er dann schwer und starb an seinen Verletzungen, und es blieben nur Schulden zurück. Für Maria blieb zuerst nichts als Bitterkeit, Resignation und Angst um Monikas Zukunft. Auch das hatte sie dann Helmut Berneck erzählt.
Und da hatte er ihr den ersten Heiratsantrag gemacht. Sie hatte nicht ja, aber auch nicht nein gesagt. Sie hatte Monika gefragt, was sie sagen würde, wenn sie wieder heiraten würde.
Abwehrend hatte Monika reagiert. »Bloß nicht, Mutsch, wir kommen besser allein zurecht. Ich hatte keinen richtigen Vater, ich will erst recht keinen Stiefvater haben.«
Und nun waren seither zwei Jahre vergangen, in denen Helmut Berneck und Maria Wallberg als Arbeitgeber und Angestellte nach außen hin ihre Zuneigung geheim zu halten wussten. Und insgeheim war Maria froh, dass sich diese Liebe, denn es war eine Liebe, sich so beweisen konnte. Nur wenige wussten davon, und dazu gehörte Dr. Daniel Norden.
*
Am Morgen, der nach einer für Maria fast schlaflosen Nacht folgte, schien die Schwellung an Monikas Auge zurückgegangen zu sein.
»Es tut gar nicht weh, Mutsch«, sagte sie. »Die Klinik kann ich mir wohl sparen.«
»Wir tun, was Dr. Norden gesagt hat. Es war immer richtig«, erklärte Maria.
»Na schön«, sagte Monika. »Aber wenn wir nichts erfahren, machen wir einen Stadtbummel.«
»Und kaufen dir ein hübsches Kostüm«, sagte Maria rasch.
»Sei nicht so großzügig, Mutsch. Die Preise sind gewaltig gestiegen.«
»Mein Gehalt auch«, erwiderte Maria leichthin.
»Er will dich ködern, Mutsch«, sagte Monika heftig.
»Berneck ist ein feiner Mensch«, erklärte Maria ruhig. »Wenn du dir die Mühe machen würdest, ihn kennenzulernen, würdest du es auch feststellen.«
»Er hat mehr von deiner Zeit als ich, das langt«, sagte Monika. »Und in gewisser Weise kann ich ihn sogar verstehen. So was wie dich findet er nicht wieder. Aber in erster Linie gehörst du mir«, fügte sie trotzig hinzu.
»Das weißt du, mein Kleines«, erwiderte Maria zärtlich.
»Dann ist es ja gut, Mutschilein«, sagte Monika, »ich will nicht, dass uns jemand auseinanderbringt.«
Dann sprachen sie nichts mehr miteinander, bis sie bei der Augenklinik waren. Dr. Seibert stand fast sofort zu ihrer Verfügung. Er war etwa vierzig und sah recht gut aus. Monika stellte wieder einmal fest, dass ihre Mutter auch auf ihn die Wirkung nicht verfehlte. Sie erstarrte sofort in Abwehr.
Die Untersuchung dauerte eine Stunde. Maria wartete ungeduldig auf das Ergebnis, zwischen Hangen und Bangen.
Ein junger Mann im beigen Anzug ging an ihr vorbei. Wenig später kam er im weißen Kittel aus einer Tür.
Er sah gut aus und weckte eine flüchtige Erinnerung in ihr, aber schon wieder waren ihre Gedanken bei Monika. Aber da erschien schon Dr. Seibert. Angstvoll blickte Maria ihn an, als er mit ernster Miene auf sie zukam.
»Was ist mit Moni?«, fragte sie flüsternd.
»In diesem Fall würde ich es für richtig halten, das Auge ganz ruhigzustellen, gnädige Frau«, erwiderte er höflich. »Ich möchte mit dem Chef sprechen, damit wir eventuell gleich am Montag operieren können.«
»Operieren?«, fragte Maria angstbebend. »Was gibt es zu operieren?«
»Eine Geschwulst am Tränensack«, erwiderte er. »Bitte, regen Sie sich nicht auf! Das Auge ist in Ordnung. Die Entscheidung möchte ich Professor Hillbrecht überlassen, aber äußeren Einwirkungen sollte Ihre Tochter jetzt nicht mehr ausgesetzt werden. Ich halte es für angebracht, wenn notwendige Untersuchungen sofort durchgeführt werden.«
Maria war wie betäubt. »Es ist doch Samstag«, sagte sie leise.
»Wir arbeiten rund um die Uhr, gnädige Frau«, erwiderte Dr. Seibert. »Es ist eine akute Geschichte.«
»Ich möchte es genau wissen«, sagte Maria tapfer.
»Genau können wir es erst sagen, wenn alle Untersuchungen abgeschlossen sind, aber Sie dürfen versichert sein, dass wir dabei nichts versäumen werden.«
Maria schien in einem luftleeren Raum zu schweben. Was sie hörte, hatte nicht Hand und Fuß.
»Ich darf doch mit meiner Tochter sprechen«, sagte sie.
»Aber sicher. Sie ist sehr ruhig. Ein Einzelzimmer hätten wir auch frei. Ihre Tochter sagte, dass Sie privat versichert sind.«
»Versichert oder nicht«, erwiderte Maria aggressiv, »der beste Arzt soll meine Tochter operieren, wenn es notwendig ist. Es ist mir völlig egal, was es kostet.«
»Sie können ganz beruhigt sein, gnädige Frau«, sagte Dr. Seibert.
Wie eine Traumwandlerin folgte ihm Maria. Was sie so alles dachte, hätte sie später nicht mehr zu sagen vermocht, aber dann sah sie Monika, und die sagte: »Ist bestimmt alles nicht so schlimm, Mutsch. Ich will es rasch hinter mich bringen. Ich brauche höchstens drei Tage hierzubleiben. Mir kann es doch nur recht sein, wenn die Voruntersuchungen schon am Wochenende stattfinden. Mir ist es wichtiger, wenn ich in der Schule nicht so viel versäume.«
»Ich rege mich ja nicht auf«, murmelte Maria. »Es kommt nur so plötzlich.«
»Mir doch auch, Mutsch. Jetzt wäre ich wirklich froh, wenn dein Tyrann dich in Atem halten würde.«
»Welcher Tyrann?«, fragte Maria verwirrt.
»Na, Berneck. Wie blöd, dass er gerade unterwegs ist.«
»Im Haus habe ich auch genug zu tun«, sagte Maria. »Und schließlich will ich auch bei dir sein.«
»Du musst mir ja auch Sachen bringen, wenn ich gleich bleiben soll«, sagte Monika. »Ich glaube fast, diesmal war Dr. Norden ein bisschen zu besorgt. Er hat hier mächtig Dampf gemacht!«
Dr. Norden?, dachte Maria. Dann scheint er etwas zu befürchten. Ihre Gedanken eilten schon weiter.
»Vorsicht ist besser als Nachsicht«, murmelte sie. »Was möchtest du alles haben, Moni?«
Ihr zerriss es das Herz, als sie in das verschwollene Gesicht blickte, aber das rechte Auge zwinkerte ein bisschen.
»Dein Bild, Mutsch, meinen Teddy, den Frotteemantel und was man sonst noch so braucht. Ich weiß es ja nicht. Ich war noch nie in einer Klinik.«
*
Mein Bild und ihren Teddy, dachte Maria, als sie hinauswankte, zum ersten Mal in ihrem Leben eine lähmende Angst verspürend. Angst um ihr einziges Kind. Sie war nicht fähig, sich sofort in ihren Wagen zu setzen, in den Wagen, den Helmut Berneck ihr zur Verfügung gestellt hatte, um heimzufahren und Monikas Sachen sofort zu holen.
Sie irrte blindlings, gedankenlos durch die Straßen der Innenstadt, fühlte sich unendlich allein unter all diesen vielen Menschen, die den ersten Samstag im Monat ausnutzten, um Einkäufe zu machen, weil die Geschäfte nicht schon mittags geschlossen wurden.
Dann wurde sie plötzlich von einem dicken Mann angerempelt, der anscheinend schon etwas über den Durst getrunken hatte. Sie kam zu sich, als er sie blöd anredete und fragte, ob sie ihm nicht Gesellschaft leisten wolle.
Da konnte sie wieder klar denken. Schnell drehte sie sich um und stand vor dem Schaufenster eines Modengeschäftes. Der dicke Mann hatte nichts mehr gesagt, aber Maria sah nun ein entzückendes Kostüm. So eines, wie sie es sich für Monika vorgestellt hatte. Sie überlegte nichts mehr. Sie betrat das Geschäft, schritt auf weichen Teppichen dahin, wusste auch sofort, dass es hier keine billige Konfektion gab.
Und dann stand eine ziemlich große, schlanke Frau vor ihr, schick gekleidet, ein höfliches Lächeln auf den Lippen. Kastanienbraunes modisch geschnittenes Haar schmiegte sich um ein blasses, ganz schmales Gesicht.
»Anna«, sagte Maria ungläubig.
»Maria«, flüsterte die andere, »das darf nicht wahr sein. Hier treffen wir uns wieder?«
»Was machst du hier?«, fragte Maria, die sich schneller gefasst hatte.
»Ich bin hier Verkäuferin. Irgendwie muss man sich ja über die Runden bringen. Und du?«
»Guter Gott, das kann man nicht in ein paar Minuten erklären. Ich habe ein Kostüm im Fenster gesehen, das meiner Tochter passen würde, wenn es Größe sechsunddreißig wäre, aber im Augenblick ist nicht mal das wichtig. Es ist fast zwanzig Jahre her, dass wir uns nicht mehr gesehen haben, Anna, und doch haben wir uns sofort erkannt.«
»Man hat uns ja auch die siamesischen Zwillinge genannt auf der Schule«, sagte Anna.
»Wieso bist du in München?«, fragte Maria.
»Das ist auch eine lange Geschichte. Können wir uns später treffen, nach siebzehn Uhr, wenn hier zugemacht wird?«
»Ja, komm zu mir. Aber das Kostüm möchte ich doch gern für Moni haben, wenn es ihre Größe ist und passt.«
»Es ist vierunddreißig, aber es fällt reichlich aus. Und du kriegst Prozente, die mir zustehen, wenn es niemand merkt, Maria. Man schaut schon auf mich. Mach es kurz.«
»Veilchenstraße zwölf. Ab sechs Uhr bin ich zu Hause.«
»Ich komme. Endlich ein Lichtblick in meinem Leben«, sagte Anna. Aber laut sagte sie: »Es tut mir leid, gnädige Frau, aber dieses Kleid führen wir nur in Größe zweiundvierzig und vierundvierzig.« Und da stand eine Wasserstoffblonde neben ihr und sagte: »Wollen Sie der Kundin nicht unsere neue Kollektion zeigen, Frau Haber? Sie wird sicher etwas finden.«
»Danke sehr«, sagte Maria geistesgegenwärtig, »ich war nur an einem bestimmten Kleid interessiert.«
Sie blinzelte Anna verständnisinnig zu und ging. Aber an der Tür blieb sie stehen und drehte sich noch einmal um. Sie sah, wie die Blondine auf Anna einredete.
Anna Haber, dachte sie. Früher hieß sie Anna von Steegen, und sie war das attraktivste Mädchen der Klasse gewesen, die sie gemeinsam besucht hatten.
Sie fuhr sich über die Augen. Guter Gott, sie musste doch ihrer Moni noch die gewünschten Sachen in die Klinik bringen. Wie hatte sie das vergessen können?
Nein, vergessen war es nicht, nur die Zeit war ihr davongelaufen. Jetzt war es schon zwei Uhr. Sie musste sich höllisch beeilen, wenn sie um sechs Uhr wieder zu Hause sein wollte.
Als sie ihre hübsch eingerichtete Wohnung betrat, wurde sie von dem Gedanken gefangen, dass sie diese zum Jahresende, oder wenn man es so nehmen wollte, zum Anfang des neuen Jahres räumen sollte. Um ihrem Kind ein gemütliches Heim zu schaffen, hatte sie alles getan, gespart, nur das gekauft, was auch Moni gefiel.
Reiß dich zusammen, Maria, mahnte sie sich, als die Uhr dreimal schlug. Sie ging schnell in Monis Zimmer, nahm ihren Koffer aus dem Schrank, den ganz modernen, leichten braunen Koffer, den sie Moni zum achtzehnten Geburtstag geschenkt hatte mit einem Geschenkgutschein für eine Reise. Aber Moni hatte keine Reise machen wollen. Sie wollte auf die Meisterschule.
»Wir verreisen zusammen, wenn ich meine Prüfungen geschafft habe, Mutsch«, hatte sie gesagt. »Allein mag ich nicht herumreisen.« Ihre Stimme, diese weiche Stimme, schien in Marias Ohren zu klingen. Und dann sah sie den Teddy, den sie Moni zum ersten Geburtstag geschenkt hatte. Tränen traten ihr in die Augen. Er sah schon recht mitgenommen aus, aber Moni hatte ihn ja auch immer im Arm gehalten und abgebusselt, bevor sie einschlief, als sie klein war, aber auch, als sie schon fast erwachsen war. Und an ihrem Bett stand die Fotografie, die Maria darstellte, als sie vor zwei Jahren den letzten gemeinsamen Urlaub verbracht hatten. Maria sah sich im blauweißen Dirndl vor der Bergkette, deren Gipfel schon mit Schnee bedeckt waren
Da hatte sie schon gewusst, dass sie die Stellung bei Helmut Berneck bekommen würde, aber sie hatte nicht geahnt, was ihr dieser Mann einmal bedeuten würde. Sie war nur Monis Mutter gewesen, glücklich, dass ihr Kind eine so gute Abschlussprüfung auf der Realschule gemacht hatte, dass Moni so sicher war, was sie werden wollte, dass sie so gesund und bildhübsch war, wie sich jede Mutter wohl eine Tochter wünschte.
Dicke Tränen rannen über Marias Wangen, als sie die Wäsche einpackte, den weißen Frotteemantel, den sie Moni selbst genäht hatte, aber auch ein Kleid, einen Rock, eine Bluse, alles Sachen, die Moni besonders gern mochte.
Es ist ja nicht schlimm, sagte sie vor sich hin, ich darf mir nichts einreden, ich brauche keine Angst zu haben.
Aber sie hatte doch Angst, höllische Angst, und sie dachte: Warum kann ich jetzt nicht mit dir darüber sprechen, Helmut. Ich bin so allein ohne dich.
Dann fuhr sie wieder zur Klinik. Der junge Arzt, mit dem sie sprechen konnte, war derselbe, den sie vorher schon gesehen hatte.
»Frau Wallberg ist gerade beim Röntgen, gnädige Frau«, sagte er. »Und dann sollen noch andere Untersuchungen gemacht werden. Vielleicht kommen Sie besser am späteren Abend wieder.«
Sie starrte ihn an. »Mit wem spreche ich?«, fragte sie geistesabwesend.
Er errötete leicht. »Verzeihen Sie bitte, dass ich mich noch nicht vorgestellt habe. Mein Name ist Berneck. Dr. Michael Berneck, um es genau zu sagen.«
Diese Ähnlichkeit, dachte Maria, während graue Schleier vor ihren Augen wallten. Dr. Michael Berneck – Berneck – Berneck.
»Ist Ihnen nicht wohl, gnädige Frau?«, hörte sie seine Stimme. »Sie brauchen sich doch nicht solche Sorgen zu machen. Wir müssen solche Vorsorgemaßnahmen treffen. Das ist üblich.«
»Ja, ich verstehe es«, sagte Maria tonlos. »Ich komme später wieder. Ich wollte meiner Tochter nur die Sachen bringen.«
Aber der Name Michael Berneck klang immer noch in ihren Ohren, und sie sah in sein Gesicht, in dieses noch so junge, unausgeprägte Gesicht, das aber die gleichen Augen hatte, die sie an Helmut Berneck so sehr liebte.
»Dr. Michael Berneck«, sagte sie mit klangloser Stimme.
»Ja, so heiße ich. Ich bin Assistenzarzt, erst seit vier Wochen an dieser Klinik. Aber Professor Hillbrecht wird sich persönlich um Ihre Tochter bemühen.«
Es ist verrückt, dachte Maria, das ist Helmuts Sohn, da gibt es keinen Zweifel. Er hat Helmuts Augen. Er ist hier, an dieser Klinik, und Moni ist auch hier.
»Sagen Sie mir doch endlich, was mit meiner Tochter geschehen wird«, stieß sie hervor.
»Ich weiß es doch nicht«, erwiderte er. »Ich werde nicht eingeweiht.«
»Aber Sie sind doch Arzt«, sagte Maria. »Sie können es erfahren. Mit wem kann ich sprechen, wenn ich wiederkomme?«
»Ich habe Nachtdienst«, erwiderte er.
»Wenn ich wiederkomme, möchte ich genau informiert werden«, sagte Maria. Dann ging sie. Sie dachte plötzlich an Anna. Alles war an diesem Tag so verwirrend.
Anna, die früher so Souveräne, so hilflos, dann Michael Berneck. Warum nicht eine Namensgleichheit, ging es Maria durch den Sinn. Aber diese Augen. Es waren doch Helmuts Augen. Wie kann ich denn überhaupt an andere denken, es geht doch um Monika, um meine Tochter, dachte sie dann.
Warum bist du nicht da, Helmut, dass ich mit dir sprechen kann. Und dann meinte sie wieder seine warme tiefe Stimme zu hören: »Ruf mich an, wenn du nicht zurechtkommst, Maria.«
Sie wusste, wo sie ihn erreichen konnte. Aber jetzt brachte sie es nicht fertig, diese Nummer zu wählen, und als sie dann in ihrer Wohnung war und doch den Hörer aufnahm, läutete es.
Anna van Steegen, nein, jetzt hieß sie ja Haber, stand vor der Tür, mit einem fast schüchternen Lächeln, sehr dezent und damenhaft wirkend in dem schlichten grauen Kostüm.
»Ich freue mich, Anna«, sagte Maria leise. »Dass wir uns ausgerechnet heute wiedersehen …«, gedankenverloren sah Maria die andere an. »Du hattest hoffentlich keinen Ärger meinetwegen.«
»Man gewöhnt sich an vieles, auch daran, dass manche sich produzieren müssen, wenn es an der nötigen Intelligenz fehlt. Du fragst dich natürlich, warum ich mir als Verkäuferin mein Geld verdienen muss. Das kommt davon, wenn man den falschen Mann heiratet«, meinte sie sarkastisch.
»Wir haben manches gemeinsam«, stellte Maria nachdenklich fest.
»Bist du auch geschieden?«, fragte Anna.
»Verwitwet seit elf Jahren.«
»Ich bin geschieden seit drei Jahren, aber ich wünschte, dass ich schon vor sechzehn Jahren den Mut dazu gehabt hätte.«
»Hast du Kinder?«, fragte Maria.
»Ich hatte eins. Es ist bald nach der Geburt gestorben. So nach und nach hat Bernhard Haber dann alles Geld verpulvert. Weißt du, er war so ein Genie, das dauernd Erfindungen machte, die aber keiner haben wollte. Jetzt hat er zwei Entziehungskuren hinter sich, und ich müsste ihn unterstützen, wenn ich mehr verdienen würde, aber ich habe lange genug draufgezahlt. Ich will nicht mehr. Reden wir von etwas anderem. Ich habe das Kostüm für deine Tochter mitgebracht. Wo ist sie?«
»In der Augenklinik. Ich weiß noch nicht genau, was festgestellt wurde, aber wahrscheinlich wird sie operiert.«
»Bei Hillbrecht?«, fragte Anna.
»Du kennst ihn?«
»Ich kannte ihn vor vielen Jahren, als wir noch jung und hübsch waren. Das heißt, du bist noch immer sehr hübsch, Maria. Ich komme mir alt und verbraucht vor.«
»Nun mach aber ’nen Punkt«, sagte Maria aufmunternd. »Es kommt auf die innere Einstellung an. Du darfst nicht so resigniert in die Zukunft schauen, Anna.«
»Für mich gibt es keine Zukunft. Es war ein Irrtum, dass ich glaubte, Bernhard durch die Scheidung loszuwerden. Er tut alles, damit ich ihn ja nicht vergesse. Siehst du, jetzt jammere ich dir auch noch etwas vor. Für dich wäre es besser gewesen, wenn wir uns nicht getroffen hätten.«
»Wir trinken ein Gläschen Sekt, dann geht es besser, Anna. Das ist ein seltsamer Tag. Erst die Nachricht, dass ich die Wohnung räumen muss …«
»Warum?«, fiel ihr Anna ins Wort.
»Wegen Sanierung, wie das heute so üblich ist. Das Haus hat einen neuen Besitzer, und der will natürlich mehr Geld herausholen. Manche Leute wissen ja gar nicht, wie und wo sie ihr vieles Geld anlegen sollen.«
Unwillkürlich musste sie dabei an Helmut Berneck denken, der ja auch über ein großes Vermögen verfügte, und feine Röte stieg in ihre Wangen.
»In diesem Fall muss man dir anderen Wohnraum zur Verfügung stellen«, sagte Anna. »Da weiß ich Bescheid. Du wohnst doch schon lange hier.«
»Achtzehn Jahre, nun, ich nehme es auch nicht so tragisch. Moni ist jetzt viel wichtiger.«
»Bei Hillbrecht ist sie in den besten Händen. Ich habe seinen Weg verfolgt. Er ist eine Kapazität. Ich wohne bei einer alten Dame, die er operiert hat. Sie hatte ein Glaukom. Er hat ihr das Auge gerettet, und er führt die kompliziertesten Operationen aus. Du wirst ihn ja kennenlernen.«
»Soll ich ihm einen Gruß von dir bestellen?«
»Um Himmels willen. Er wird sich an mich bestimmt nicht mehr erinnern. Ich wollte dir ja nur sagen, dass du Vertrauen zu ihm haben kannst. Er ist an sich ein sehr reservierter Typ. Aber nun erzähle mal ein bisschen von dir. Ist dein Lebensunterhalt gesichert?«
»Ich verdiene ihn mir«, erwiderte Maria mit einem flüchtigen Lächeln. »Allerdings habe ich eine angenehme, gutdotierte Stellung.«
»Und was machst du?«
»Ich bin Allroundkraft bei Herrn Berneck.«
»Ist mir kein Begriff.«
»Ein geschiedener Fabrikant.«
Sie war froh, dass Anna keine anzügliche Bemerkung machte, aber Anna war ja immer sehr taktvoll gewesen. Deshalb hatten sie sich auch so gut verstanden.
»Und du denkst nicht daran, wieder zu heiraten?«, fragte Maria später vorsichtig.
»Guter Gott, nein, ein Reinfall genügt mir.«
»Es gibt auch zuverlässige Männer, Anna, und dann könntest du dich von deinem Verflossenen befreien.«
»Um es mir später ständig vorhalten zu lassen, dass dies der Grund gewesen sei? Nein, danke.«
Wie verbittert sie war. Maria war tief bestürzt. »Es gibt doch auch echte Zuneigung, Gemeinsamkeiten, und auch Männer, die böse Erfahrungen gemacht haben.«
»Männer kommen darüber leichter hinweg. Ich versuche, mein Leben wechselvoll zu gestalten, obgleich es dadurch nicht froher wird. Ich wechsele jedes Jahr, und manchmal auch schneller, die Stellung. Immer gehe ich in eine andere Stadt. So lerne ich das liebe Vaterland kennen, und Herr Haber tut sich schwer, mir auf den Fersen zu bleiben.«
Immer auf der Flucht, dachte Maria erschüttert, und wieder sah sie die lebensfrohe Anna van Steegen vor sich.
Wie dankbar kann ich sein, ging es ihr durch den Sinn, ich habe meine Moni, und ich habe in Helmut einen ehrlichen, verständnisvollen, geduldigen Partner. Aber sie dachte auch, wie Anna wohl geholfen werden könnte.
»Wohnst du wenigstens einigermaßen angenehm?«, fragte sie.
»O ja, das kann man sagen. Frau Lauder war eine gute Bekannte meiner Mutter. Ich kann sie auch nebenher betreuen, und dafür werde ich auch honoriert. Es erfährt niemand.« Wieder flog ein bitteres Lächeln um ihren Mund. »So weit kann man kommen, Maria, aber dieses Scheidungsrecht hat seine Tücken. So großartig ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau auch wieder nicht, von der wir doch so viel erwartet haben. Weißt du noch, wie emanzipiert wir damals sein wollten?«
Und dann wurde die Vergangenheit lebendig, eine frohe, sorglose Jugend, da die Schrecken des Krieges schon fast vergessen waren, als sie das Gymnasium besuchten, gemeinsam auch die Tanzstunde, als sie mit netten jungen Männern Ausflüge machten.
»Was aus den anderen wohl geworden sein mag«, sagte Maria gedankenvoll. »Es wäre schon interessant zu wissen, was sie aus ihrem Leben gemacht haben.«
Anna schüttelte den Kopf. »Ich möchte mir wenigstens ein paar Illusionen erhalten. Jetzt schau dir mal das Kostümchen an.«
Es war wirklich reizend, und Maria war überzeugt, dass es Monika genau passen würde.
»Für dich kostet es zweihundert«, sagte Anna. »Rede nicht drüber. Du siehst, wie viel draufgeschlagen wird. Aber die Unternehmer stöhnen, die Geschäftsleute stöhnen, und ich erlebe täglich, wie locker das Geld bei den meisten Käufern sitzt. Bei uns war es früher ja auch so.« Nun lächelte sie doch etwas fröhlicher. »Weißt du noch, wie wir den Tick hatten, uns immer das Gleiche zu kaufen?«
»Ich muss mal die Bilder heraussuchen. Wenn du das nächste Mal kommst, schauen wir sie an.«
Sie erschrak über den traurigen, verlorenen Ausdruck in Annas Augen. »Du musst bald kommen, Anna. Ich kann doch mal mit Herrn Berneck sprechen. Vielleicht kann er dir eine gute Stellung verschaffen.«
»Und dann werde ich wieder abkassiert, damit Bernhard besser leben kann, um dann der nächsten Entziehungskur zuzusteuern. Ich hatte manchmal so einen Hass in mir, Maria, ich hätte ihn wirklich umbringen können.«
Eisige Schauer krochen durch Marias Körper. So weit konnte ein so toleranter, sanfter Mensch wie Anna gebracht werden. Spontan ergriff sie deren Hände. »Du kannst das nicht, Anna«, sagte sie bebend.
»Das ist es ja, und deshalb vegetiere ich dahin. Ich habe ihn damals geliebt, ich ahnte nicht, dass man einen Menschen, den man mal geliebt hat, so hassen kann. Und dann wird einem immer wieder gesagt, dass er doch ein kranker Mensch sei, dem man das Mitgefühl nicht versagen kann. Verzeih, dass ich so spreche, aber es war gut für mich, überhaupt mal mit einem Menschen sprechen zu können.«
Und für mich war es gut zu erkennen, dass andere viel größere Sorgen haben als ich, dachte Maria, als Anna dann gegangen war.
Und schon läutete das Telefon. »Ich muss dir doch gute Nacht sagen, mein Liebes«, klang Helmut Bernecks dunkle Stimme an ihr Ohr. »Ich muss ständig an dich denken. Freut sich Moni, dass sie dich ganz für sich hat?«
Sie sagte es ihm, dass Moni in der Augenklinik war, aber sie sagte nichts von Michael.
»Wenn du meinst, dass sie bei Hillbrecht gut aufgehoben ist, akzeptiere ich es. Wenn du aber den geringsten Zweifel hegst, bemühe ich mich noch, den besten Spezialisten zu finden.«
»Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit«, sagte Maria. »Manchmal sieht ja alles schlimmer aus. Ich war nur so erschrocken.«
»Ich werde so schnell wie möglich zurückkommen«, sagte er.
*
Dr. Michael Berneck hatte Nachtdienst, und selbstverständlich schaute er auch zu Monika ins Zimmer.
»Erfahre ich nun endlich, was es ist?«, fragte sie trotzig.
»Ich kann Ihnen leider keine Erklärung geben, Frau Wallberg. Ich bin noch ein Anfänger. Aber Professor Hillbrecht wird morgen in die Klinik kommen und sich informieren.«
»Mich soll man informieren«, sagte Monika. »Hätte ich doch nur die Tabletten geschluckt, vielleicht hätten sie schnell geholfen.«
»Es wird schon besser sein, dass Sie sie nicht geschluckt haben«, sagte er. »Man muss jedes Übel bei der Wurzel packen. Es nützt nichts, wenn man Experimente macht.«
Sie blinzelte mit dem gesunden Auge. »Wieso sind Sie eigentlich Augenarzt geworden?«, fragte sie.
Er war sichtlich irritiert. »Nun, es ist ein Bereich, der mich fasziniert hat«, erwiderte er. »Streben Sie einen bestimmten Beruf an, Frau Wallberg?«
»Ja, ich besuche die Meisterschule für Mode.«
»Und warum haben Sie sich dafür entschieden?«, drehte er den Spieß um.
»Weil ich nur dafür Talent zeigte«, erwiderte sie mit einem Spitzbubenlächeln. »Ich bin keine geistige Leuchte und in der Schule immer gerade so über die Runden gekommen, aber mich hat es schon früh gestört, wie geschmacklos sich manche Frauen kleiden.«
»Man sollte Äußerlichkeiten nicht überschätzen«, sagte er kühl.
»Aber Harmonie ist wichtig«, erklärte Monika sehr bestimmt.
»Weil man sagt, dass Kleider Leute machen?«, fragte er ironisch.
»Ich glaube nicht, dass man den Charakter eines Menschen durch Kleidung verändern kann, aber ich glaube, dass vor allem manche Frau viel mehr Selbstbewusstsein zeigen würde, wenn sie entsprechend gekleidet ist.«
Er lächelte flüchtig. »Ihnen mangelt es an Selbstbewusstsein nicht«, stellte er fest.
»Das wäre ja noch schöner. Meine Mutter hat mich so erzogen, dass ich mich allen Situationen gewachsen zeige, deshalb heule ich Ihnen jetzt auch nichts vor, obgleich es durchaus nicht angenehm ist, hier herumzuliegen, da ich ein wunderschönes Wochenende mit Mutsch allein hätte verbringen können. Meine Mutter ist nämlich berufstätig, und der Chef ist gerade verreist.«
»Es tut mir auch leid«, sagte er leise. »Aber ich hoffe, dass Sie gut schlafen können.«
Er ging zur Tür. »Darf ich fragen, wie Sie heißen?«, ertönte Monikas Stimme.
»Michael Berneck«, erwiderte er.
»Berneck? Wie komisch«, lachte sie auf, »der Chef von meiner Mutter heißt auch Berneck. Aber er ist nicht Arzt. Er ist so ein stinkreicher Fabrikant.«
Sie sah nicht, dass Michael das Blut aus dem Gesicht wich. »Und Sie mögen ihn nicht?«, fragte er heiser.
»Ich will nicht, dass er mir meine Mutsch wegnimmt«, stieß sie hervor. »Sie gehört mir. Entschuldigung, dass mir das herausgerutscht ist.«
»Ich verstehe Sie«, sagte er. »Tut mir leid, dass mein Name Aggressionen in Ihnen weckte.«
»Nein, so ist das nicht, er ist ja ein feiner Mann. Es wäre ungerecht, wenn ich ihm etwas nachsagen würde. Es hat mich nur verwirrt, dass Sie auch Berneck heißen.«
»Ich bin Augenarzt«, sagte Michael, und dann ging er rasch. Monika konnte nicht ahnen, was in ihm vor sich ging, denn Michael dachte jetzt weitaus weniger an sie als an ihre Mutter, die ihn so beeindruckt hatte. Er dachte auch daran, wie Maria Wallberg ihn angeschaut hatte, als er seinen Namen nannte.
Und dann dachte er auch an Marguerite Delfort, vor deren Zimmer er jetzt Halt machte.
Er hatte sich ein Lächeln nicht verkneifen können, als sie ihm vor ein paar Tagen sagte, dass eine große Wende in seinem Leben eintreten würde. Madame Delfort war eine berühmte Astrologin, die nur zur Augenoperation nach München gekommen war.
Unser Rauschgoldengel, nannte sie die Oberschwester, und so lag sie auch in ihrem Bett, das feine Gesicht von weißen Ringellöckchen umgeben. Michael Berneck wusste, dass sie alles nur noch schattenhaft sehen konnte, aber ihr Geist war hellwach, und sie erkannte jeden schon an dem Schritt, der ihr Zimmer betrat.
Er hielt den Atem an, als sie sagte: »Ich habe gewusst, dass Sie kommen, Dr. Berneck.«
»Und da bin ich«, erwiderte er, sich zu einem leichten, humorigen Ton zwingend.
»Setzen Sie sich. Ich kann sowieso nicht schlafen. Sie haben das Mädchen kennengelernt.«
»Welches Mädchen?«, fragte er beklommen.
»Ich weiß doch den Namen nicht, aber ich kann Ihnen in etwa sagen, wie sie ausschaut. Blond, ziemlich hohe Wangenknochen. Sie ist sehr eigenwillig und dürfte im Zeichen des Krebses geboren sein. Ich weiß, dass Sie über meine Neigungen lächeln, aber vielleicht wäre dies der erste Beweis für Sie, dass ich doch noch nicht ganz unglaubhaft bin. Sie haben ja die Daten der jungen Patientin schwarz auf weiß. Und nun rennen Sie nicht gleich wieder fort. Ich möchte Ihnen noch mehr sagen. Ganz eindringlich möchte ich es Ihnen sagen, was immer Sie jetzt auch bewegt oder verwirrt. Halten Sie dieses Mädchen fest, so viel Zweifel auch vorhanden sind. Es wird bestimmt Ihr Glück sein. Glauben Sie dieser alten müden Frau, die nicht mehr lange zu leben hat, so sehr sich die Ärzte auch darum bemühen.«
»Wie können Sie dessen so sicher sein, Madame Delfort?«, fragte Michael heiser.
»Weil ich etwas mehr fühle als Sie, als andere Menschen. Ich will nicht sagen, dass diese Gabe mich glücklicher machte als andere, aber sie hat mich selbst vor manchem bewahrt, aber das, was einem vom Schicksal bestimmt ist, muss man hinnehmen. Ich weiß, dass Sie nicht daran glauben, dass es eine hellseherische Gabe gibt, aber dennoch hören Sie mir zu. Ja, hören Sie nur, Michael Berneck. Es kann Ihnen nur helfen, Ihre inneren Konflikte zu besiegen. Sie können jetzt auch gehen, wenn es Ihnen lästig ist und als das Geschwätz einer alten Frau erscheint.«
»Nein, so ist es nicht«, sagte Michael rau. »Sie wissen doch, dass ich Sie gernhabe.«
»Und Sie haben auch Zeit?«
»Ja, jetzt habe ich Zeit«, erwiderte er. »Ich habe meinen Rundgang beendet. Besondere Ereignisse liegen nicht vor.«
»Dann kann ich sagen, was Sie sich merken sollten. Ihr Vater ist ein großer Mann, ein guter Mann, möchte ich sagen. Ihre Wege haben sich getrennt. Sie wollten es so.«
»Ich wollte Arzt werden«, sagte Michael leise.
»Sie mussten es werden, weil es Ihnen so bestimmt ist«, sagte Madame Delfort. »Warum können die Menschen, die meisten Menschen, nur nicht begreifen, dass ihnen ihr Leben schon in der Stunde der Geburt vorausbestimmt ist. Warum lachen sie sogar darüber, da ihnen doch auch schon die Stunde ihres Todes vorausbestimmt ist. Sie könnten ihre Zeit doch so viel bewusster nützen, wenn sie sich damit abfinden könnten, wie lang oder wie kurz ihr Erdendasein ist.«
»Wie lang wird meines sein, Madame?«, fragte Michael ruhig.
»Lang genug, um viel zu leisten«, erwiderte sie. »Aber vor allem sollten Sie jetzt mal alle Vorurteile beiseitelassen. Was zwischen Anfang und Ende liegt, können wir Menschen schon mitbestimmen. Sie wollen nicht sein wie Ihre Mutter, die jede Lebensphase genießt. Sie wollen nicht sein wie Ihr Vater, der von seinem Weg, den er sich selbst vorgezeichnet hat, oder der ihm eben auch bestimmt war, nicht abweichen will. Er hilft anderen Menschen auf seine Weise genauso, wie Sie helfen wollen.«
»Wie sollen Sie sagen, dass er hilft?«
»Er gibt anderen Menschen Arbeit und Brot, oder täusche ich mich?«
»Nun ja, das stimmt«, erwiderte Michael.
»Und er hat ein offenes Herz für Menschen, die sich mühsam durchs Leben bringen müssen. Eines Tages werden Sie es begreifen, begreifen müssen, Sie junger Mann, wobei auch gesagt werden soll, dass Sie den richtigen Weg eingeschlagen haben. Man kann nur das ganz tun, was man mit ganzem Herzen tut.«
»Und was ist mit dem Mädchen?«, fragte Michael heiser, ganz eingefangen von ihrer eindringlichen Stimme.
»Das Mädchen«, flüsterte sie, und ein Lächeln legte sich über das Gesicht, verschönte und verklärte es.
»Das Mädchen wird ihr Ziel verwirklichen«, fuhr sie dann mit leiser Stimme fort. »Ihr Name wird früher bekannt sein, als der ihres Mannes, aber es lohnt sich für den Mann, das zu akzeptieren, weil er von ihrer Willensstärke nur profitieren kann.« Sie verharrte ein paar Sekunden in Schweigen. »So viel sollte nicht über meine Lippen kommen«, flüsterte sie, »aber ich habe doch nur wenig Zeit. Und nie waren die Bilder so deutlich wie jetzt. Ich sehe zwei verschlungene M. Ja, der Vorname Ihrer Frau beginnt mit dem gleichen Buchstaben wie Ihrer.« Und dann herrschte Schweigen.
Ganz plötzlich war Madame Delfort eingeschlafen. Michael fühlte ihren Puls. Er war nur noch schwach vernehmbar.
Er sprang auf und eilte hinaus zum Telefon. Er rief Dr. Seibert herbei. Dr. Seibert kam, aber er konnte nur noch feststellen, dass Marguerite Delfort hinübergeschlummert war in die Ewigkeit.
»Immerhin war sie fast neunzig«, sagte er, Michael anblickend. »Die letzte Operation hätte sie sich ersparen können, aber sie wollte diese ja unbedingt.«
Vielleicht um mir zu sagen, was ich bisher nicht hören wollte, dachte Michael Berneck. Vielleicht gibt es so etwas wirklich.
Und dann ging er ins Ärztezimmer und nahm Monikas Krankenblatt mit. Er konnte sich überzeugen, dass sie im Zeichen des Krebses geboren war. Zwei verschlungene M, hatte Madame Delfort gesagt, aber sie hieß auch Marguerite, und Monikas Mutter hieß Maria. Es waren vier M, vier Vornamen, die mit diesem Buchstaben begannen.
Aber Michael Berneck dachte dann an eine Frau, deren Vorname mit dem Buchstaben B für Bianca begann, an eine bildschöne, faszinierende Frau, mit der er nach diesem Nachtdienst das Wochenende verbringen wollte.
Er hatte sie erst vor zwei Wochen kennengelernt, beim Tennis, dem einzigen Sport, für den er sich hin und wieder noch Zeit nahm. Es hatte ihn selbst gewundert, dass sie ihm, ausgerechnet ihm Beachtung schenkte, da doch wenigstens ein halbes Dutzend Männer sie umschwärmten.
Nie zuvor hatte er sich so für eine Frau interessiert, und da hatte ihm Madame Delfort einreden wollen, dass ein Mädchen, dessen Vorname mit einem M begann, die wichtigste Rolle in seinem Leben spielen solle?
Er hatte ihr fasziniert zugehört. Es schmerzte ihn, dass diese alte Dame nun nicht mehr lebte. Aber er wurde hin und her gerissen von seinen innersten Gefühlen.
Monika Wallberg, dieses Mädchen, konnte unmöglich eine Rolle in seinem Leben spielen. Ihr waren Kleider wichtig, Äußerlichkeiten. Und ihre Mutter? Seine Lippen pressten sich zu einem Strich aufeinander, weil er diese Frau nun mit seinem Vater in Verbindung bringen musste.
Ja, diese Frau, diese Maria Wallberg, hatte ihn tief beeindruckt. Sie war eine Frau, wie er sich seine Mutter gewünscht hätte. Aber er hatte seine Mutter erst vor ein paar Monaten getroffen, und sie war ganz anders, als er sie sich vorgestellt hatte.
Er hatte sie gesucht. Er hatte sie sehen wollen, mit ihr sprechen wollen, sie fragen wollen, warum sie seinen Vater verlassen hatte. Und was hatte sie gesagt?
»Sag nur ja niemandem, dass du mein Sohn bist, Michael. Meinetwegen können sie dich für meinen neuesten Flirt halten, aber mein Alter soll mir niemand nachrechnen. Ich bin jetzt zum dritten Mal geschieden, aber ich muss meinen Ehemännern zugutehalten, dass sie sich immer großzügig erwiesen haben. Ein so erwachsener Sohn, der sogar schon ein richtiger Doktor ist, verdirbt mein Image und alle Chancen. Ich will jung bleiben, Michael. Halt mir jetzt nur nicht vor, dass ich dich mal zur Welt gebracht habe. Betone nicht, wie viele Jahre das her ist. Du hattest doch einen fürsorglichen Vater. Warum streitest du dich mit ihm?«
»Ich streite mich doch nicht«, hatte er erwidert. »Er wollte nur nicht verstehen, dass ich nicht an seiner Fabrik interessiert bin.«
»Das verstehe ich allerdings auch nicht. Ärzte haben doch gar keine Zeit, ihr Leben richtig zu genießen. Von mir hast du bestimmt nichts geerbt.«
Nein, von ihr hatte er nichts, und endlich war er zu dieser Erkenntnis gekommen. Aber was hatte ihm denn sein Vater mitgegeben?
Achtundzwanzig Jahre war er alt, und seine Mutter war fast fünfzig. Und sie benahm sich wie ein Teenager. Sie hatte nur Vergnügen und Männer im Sinn, und er hatte gemeint, dass sie sich freuen würde, ihren Sohn wiederzusehen. Aber sie hatte ihn gar nicht schnell genug wieder loswerden können, als er sich weigerte, mit ihr zum Tanzen zu gehen. Genauso langweilig wie sein Vater sei er, hatte sie gesagt, und sie sei überhaupt nicht zur Mutter geboren. Es wäre wohl besser, wenn sie sich aus dem Wege gehen würden.
Aber Madame Delfort hatte über seine Mutter nicht viel gesprochen. Er wolle nicht so sein wie sie, die jede Lebensphase genieße, hatte sie gesagt.
Das stimmte. Wie kam diese Frau dazu, dies zu sagen, da sie seine Mutter doch gar nicht gekannt hatte. Und wie kam sie dazu, alles andere zu sagen, was er nicht mehr aus seinem Gedächtnis streichen konnte?
Es war eine seltsam ruhige Nacht in der Klinik. Er hätte ein paar Stunden schlafen können, aber er fand keinen Schlaf.
Die Minuten schlichen dahin, wurden zu Stunden, und schließlich kam der Morgen. Er machte wieder seine Runde, aber mit niedergeschlagenen Augen ging er an Madame Delforts Zimmer vorbei, das nun leer stand.
Und dann warf er auch nur einen kurzen Blick auf Monikas Bett. Sie schlief. Sie lag zusammengerollt wie ein Igel und hatte, wie ein Kind, einen Teddy im Arm.
Das ist doch noch ein Kind, dachte Michael Berneck. Sie kann Madame Delfort nicht gemeint haben. Und dann dachte er daran, dass er Bianca um zehn Uhr abholen sollte.
*
Es war Sonntag und ein strahlendschöner Tag. Maria hatte sich entschlossen, zu Fuß zur Klinik zu gehen. Sie hatte sich ausgerechnet, dass es ein Marsch von einer Stunde sein würde, aber dann konnte sie auch die Stadt mal so sehen, wie sie sie vorher noch nicht gesehen hatte, wenn sie mit dem Auto durch die Straßen fuhr. Sie lebte nun schon so lange in dieser Stadt und kannte sie doch nicht. Und schon um fünf Uhr war sie aufgewacht und hatte dann keinen Schlaf mehr gefunden.
Kaum einem Menschen begegnete sie, und die, die ihr entgegenkamen, schienen gerade erst auf dem Heimweg zu sein.
Wir denken zu wenig über unsere Mitmenschen nach, ging es ihr durch den Sinn, über das, was sich nachts in so einer Großstadt abspielt. Aber der Weg zur Klinik war viel weiter, als sie ausgerechnet hatte, ihre Füße waren müde geworden, als sie dann endlich durch die Pforte trat, und die Uhr zeigte siebzehn Minuten vor zehn.
Ein schlanker, grauhaariger, hochgewachsener Mann stürmte an ihr vorbei. »Guten Morgen, Herr Professor«, sagte eine junge Krankenschwester.
»Professor Hillbrecht?«, kam es wie von selbst, doch laut vernehmbar über Marias Lippen.
Der Mann blieb stehen, drehte sich um, starrte sie an. Sie sah in zwingende dunkle Augen.
»Sie haben mich gerufen?«, fragte er.
»Es war nur eine Frage«, erwiderte Maria verlegen. »Mein Name ist Maria Wallberg.«
Sein Gesichtsausdruck veränderte sich nicht. »Sie sind die Mutter von dem Mädchen mit dem Tumor?«
In diesem Augenblick begann sich alles um Maria zu drehen in einem tollen Wirbel, von dem sie mitgerissen wurde, aber doch war sie irgendwie noch gegenwärtig.
»Ich weiß nichts von einem Tumor«, stieß sie hervor und suchte gleichzeitig nach einem Halt. Doch da war er schon bei ihr. »Ich bitte um Entschuldigung«, klang seine Stimme nun gedämpfter an ihr Ohr. »Es muss ja nichts Bösartiges sein, gnädige Frau. Man soll bei solchen Dingen nur nicht zu lange warten.«
Maria spürte seine Hand, die sich um ihr Handgelenk gelegt hatte, als wolle sie den Puls fühlen. Sie wagte nicht, die Augen zu öffnen und ihn anzuschauen.
»Das darf auch nicht sein«, flüsterte sie, »nein, das darf nicht sein. Anna hat doch gesagt, dass ich Ihnen vertrauen darf.« Sie wusste gar nicht, was sie in diesem Augenblick sagte.
»Anna?«, fragte Professor Hillbrecht.
»Anna van Steegen, meine Freundin.«
»Anna«, wiederholte er und seine Hand schloss sich noch fester um ihren Arm. »Mein Gott, ich wollte Sie doch nicht erschrecken. Es trifft so viel zusammen. Ich werde es Ihnen später erklären. Sie sind eine Freundin von Anna«, sagte er nochmals.
»Aber es geht um mein Kind, um meine Moni. Sie ist doch noch so jung, und wenn ich etwas von einem Tumor höre …«
»Sie brauchen nicht die Nerven zu verlieren«, unterbrach er sie. »Es war eine dumme Reaktion. Immerhin bin ich dafür, die Wahrheit zu sagen. Ich werde es Ihnen genau erklären, wenn Sie es wünschen. Natürlich wollen wir die junge Dame nicht erschrecken. Wie ich von Dr. Seibert hörte, ist sie sehr vernünftig.«
Nun bat er sie in sein Zimmer und ließ Kaffee bringen. Maria war nun schon etwas gefasster. Sie sah ihn voll an, sein asketisches Gesicht, die klugen Augen, die von einem durchsichtigen Grau waren und doch nicht kalt wirkten, der schmale gut geschnittene Mund, die gebogene Nase, alles in allem wohl ein Gesicht, das eine ausgeprägte Persönlichkeit verriet, aber auch einen Menschen, der mehr nach innen lebte.
Man musste sich wohl einige Mühe geben und in Geduld fassen, um mit ihm vertraut zu werden. Und doch wurde Maria ruhiger, als sein Blick auf ihr ruhte.
»Wir können von Glück sagen, dass diese Geschwulst, es ist eine längliche in sehr fester Form, sehr günstig liegt. Nach einiger Zeit wird auch die Narbe kaum sichtbar sein«, erklärte er. »Sie brauchen nicht zu erschrecken, wenn es in den ersten Tagen ziemlich böse aussieht. Ich kann Ihnen sagen, dass es bedeutend schlimmere Dinge gibt. Ich werde jetzt zu Ihrer Tochter gehen. Sie warten bitte hier.«
»Bitte, sagen Sie es ihr nicht so direkt«, bat Maria.
»Ich habe mich vorhin sehr tölpelhaft benommen«, sagte er entschuldigend. »Ich war mit meinem Gedanken bei einem weitaus schlimmeren Fall.«
»Und ich muss Ihnen dankbar sein, dass Sie sich sogar am Sonntag herbemühen«, sagte Maria leise.
»Für mich sind alle Tage gleich. Ich bin kein Freizeitmensch«, erwiderte er mit einem flüchtigen Lächeln, das etwas von der Strenge seiner Gesichtszüge nahm. »Wir sprechen uns dann noch.« Und schon eilte er hinaus.
Maria saß mit gefalteten Händen da. Ihr Herz klopfte schmerzhaft. Es muss gut werden, dachte sie unentwegt, unfähig, überhaupt an etwas anderes zu denken.
Indessen hatte sich Professor Hillbrecht an Monikas Bett gesetzt, und seltsamerweise wirkte er auf sie ganz anders als auf ihre Mutter. Er imponierte ihr. Sie war völlig unbefangen.
»So was Blödes muss mir passieren«, sagte sie. »Hoffentlich bleibt da nichts zurück. Ich bin doch sowieso schon kurzsichtig.«
Über dem schlimmen Auge lag ein Verband, und das, was von ihrem Gesicht zu sehen war, war von mädchenhaftem Liebreiz. Professor Hillbrecht sah auch den Teddy, der jetzt an der Wandseite saß.
»Mein Talisman«, sagte Monika als sie seinen Blick und das leichte Erstaunen in seinen Augen gesehen hatte. »Er ist genauso alt wie ich.«
So was gibt es heutzutage auch noch, dachte er, und nun legte sich ein warmes Lächeln um seinen schmalen Mund.
»Und das ist meine Mutter«, sagte sie auf die Fotografie deutend. »Sie regt sich mehr auf als ich.«
»Das haben gute Mütter so an sich«, erwiderte er. Irgendwie verwunderte es ihn selbst, dass er sofort so vertraut mit diesem jungen Mädchen sprechen konnte.
»Dr. Norden hat gesagt, dass ich bei Ihnen in besten Händen bin. Der kennt mich ganz genau, und so meine ich, dass es wohl schlimmer ist, als ich angenommen habe.«
»Nun ja, es ist keine ganz einfache Sache, aber wir werden das schon so hinbringen, dass es der Schönheit nicht schadet.«
»Lieber Himmel, das ist doch nicht so wichtig. Ich muss richtig sehen können. Ich will Modezeichnerin und Schneiderin werden. Ich habe da ganz bestimmte Vorstellungen. Aber damit will ich Sie nicht aufhalten.«
»Das tun Sie nicht. Ich würde gern wissen, wann sich die Kurzsichtigkeit bei Ihnen bemerkbar machte und wie.«
»Das ist noch gar nicht so lange her. Zuerst hatte ich immer so ein Flimmern vor den Augen, und dann entzündeten sich die Lidränder. Wir müssen ja stets bei künstlichem Licht arbeiten. Aber dann bekam ich die Kontaktlinsen, und es wurde besser.«
»Und wenn Sie einen Druck verspürten, schoben Sie es auf die Linsen«, sagte er.
Monika nickte. »Man soll sie ja nicht zu lange drinnen lassen. Eine Infektion ist es wohl nicht?«, fragte sie. »Der Arzt, bei dem ich war, meinte das.«
»Ja, ich bin informiert. Es ist keine Infektion, sondern ein Fremdkörper, den wir herausoperieren müssen.«
»Ein Fremdkörper? Aber mir ist nichts ins Auge geflogen«, sagte sie.
»Der Fremdkörper war auch schon drinnen, aber durch unerfindliche Umstände ist er plötzlich gewachsen. Wir bezeichnen es als Zyste.« Das Wort Tumor, mit dem er Maria einen solchen Schrecken eingejagt hatte, wollte er lieber nicht verwenden.
»Das kann man auch im Auge kriegen?«, staunte Monika, keineswegs ein Erschrecken zeigend.
»Am Auge«, berichtigte er sie, »in Ihrem Fall in der Tränendrüse.«
»Liebe Güte, habe ich vielleicht zu wenig geweint?«, fragte sie.
Nun lachte er sogar leise auf. »Sie haben wohl nicht viel Grund dazu?«
»Nein. Ich habe eine wundervolle Mutter. Wir verstehen uns prima, und da wir nicht viel Geld haben, sind wir auch nicht so verbiestert wie reiche Leute, die immer nur Angst haben, etwas zu verlieren.«
Sie war herzerfrischend, ohne zu ahnen, wie sehr sie damit die Zuneigung dieses sonst so reservierten Mannes gewann.
»Ja, dann werde ich Ihnen mal erklären, was wir morgen mit Ihnen machen«, sagte er.
*
Maria war aufgestanden und ging hinaus auf den Gang. Wo bleibt er nur so lange, dachte sie angstvoll. Nimmt es Moni so schwer? Wagt er nicht, mir alles zu sagen?
Unwillkürlich lenkte sie ganz in Gedanken ihre Schritte zu der Tür, hinter der Moni zu finden war. Und leise öffnete sie diese, so leise, dass man es drinnen nicht hörte.
Aber sie hörte, wie Moni lachte. »Na, dann laufe ich eben ein paar Tage mit einem blauen Auge herum. Das werde ich schon verkraften, wenn ich das Zeug nachher los bin. Und so eine kleine Narbe kann doch ganz interessant sein. Sie haben doch da auch eine an der Stirn. Woher kommt die?«
»Das erzähle ich Ihnen später mal, Moni«, erwiderte Professor Hillbrecht mit so weicher Stimme, dass Maria den Atem anhielt.
Aber dann drehte er sich plötzlich um und bemerkte sie. »Treten Sie nur ein, Frau Wallberg«, sagte er. »Zu der Tochter kann man Sie nur beglückwünschen. Wir verstehen uns prächtig.«
Ganz anders wirkte er als vorher. Und Moni sagte: »Dr. Norden weiß genau, welcher Typ mir gefällt, Mutsch. Verstehen Sie das bitte nicht falsch, Herr Professor«, fügte sie aber schnell und recht verlegen hinzu.
»Ich verstehe es ganz richtig, Moni. Bis morgen.«
Er verneigte sich leicht vor Maria. »Wir sehen uns dann auch morgen, vielleicht so gegen zwölf Uhr, gnädige Frau. Es ist nichts einzuwenden, wenn Sie mittags einen kleinen Spaziergang machen. Es ist ein herrlicher Tag.«
*
Ja, es war ein herrlicher Tag, und doch war Michael Berneck dann mit gemischten Gefühlen zu Bianca Ravens Wohnung gefahren.
Sie öffnete ihm erst nach mehrmaligem Läuten mit verschlafenen Augen die Tür.
»Was willst du denn schon?«, fragte sie mürrisch.
»Wir waren um zehn Uhr verabredet«, erwiderte er.
»Hatte ich vergessen.«
»Dann kann ich ja eigentlich wieder gehen«, sagte er, und schon eilte er hinaus.
»Mick«, rief sie hinterher. »Sei doch nicht gleich beleidigt. Komm später noch mal.«
War er nicht gestern noch Feuer und Flamme für sie gewesen? Und nun konnte er gar nicht schnell genug wegkommen. Allerdings hatte sie auch gar nicht verführerisch ausgesehen. Er war ernüchtert, aber nicht allein das. Etwas anderes beschäftigte ihn viel mehr. Sein Vater, Maria Wallberg und ihre Tochter Monika spukten in seinen Gedanken herum, und eigentlich war er erleichtert, dass Bianca ihn nicht mit offenen Armen empfangen hatte.
Was sollte er überhaupt mit ihr reden? Doch nicht darüber, was ihn jetzt so bewegte, von seinen zwiespältigen Empfindungen. Konnte man mit ihr ein tiefsinniges Gespräch führen? Am Morgen wirkte sie so ganz anders als in Partylaune, als Mittelpunkt einer heiteren und angeheiterten Gesellschaft.
Und dann musste er daran denken, was Madame Delfort zu ihm gesagt hatte. Es war ihm, als höre er ihre leise, müde Stimme, und er erinnerte sich an jedes Wort, das sie gesagt hatte.