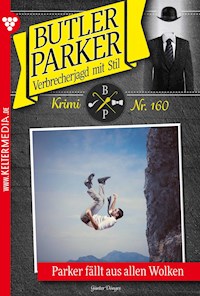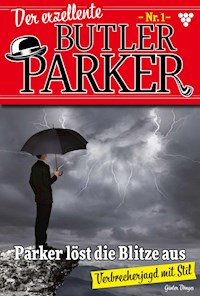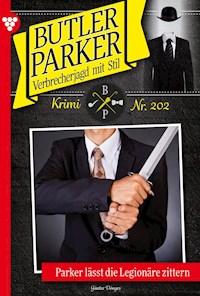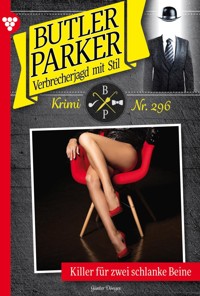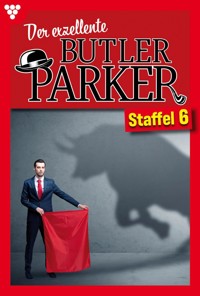
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Exzellent – das ist er im wahrsten Sinne des Wortes: einzigartig, schlagfertig und natürlich auch unangenehm schlagfähig. Wer ihn unterschätzt, hat schon verloren. Sein Regenschirm ist nicht nur sein Markenzeichen, sondern auch die beste Waffe der Welt. Seinem Charisma, Witz und Charme kann keiner widerstehen. Der exzellente Butler Parker ist seinen Gegnern, den übelsten Ganoven, auch geistig meilenweit überlegen. In seiner auffallend unscheinbaren Tarnung löst er jeden Fall. Bravourös, brillant, effektiv – spannendere und zugleich humorvollere Krimis gibt es nicht! E-Book 1: Parker duscht den "Kasino-Schreck" E-Book 2: Parker legt die "Sanitäter" flach E-Book 3: Parker spielt den Biedermann E-Book 4: Parker spielt den Biedermann
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Parker duscht den "Kasino-Schreck"
Parker legt die "Sanitäter" flach
Parker spielt den Biedermann
Parker spielt den Biedermann
Der exzellente Butler Parker – 6 –E-Book 51-60
Günter Dönges
Parker duscht den "Kasino-Schreck"
Roman von Dönges, Günter
Erholsame Stunden lagen hinter Lady Simpson. Auf der Strandterrasse eines mondänen Hotels im südenglischen Seebad Bornemouth hatte sie mit bemerkenswerter Ausdauer kulinarischen Genüssen gefrönt. Jetzt stand ihr der Sinn nach einem Spiel im örtlichen Kasino.
Daß Fortuna jedem ihrer Winke ebenso zuvorkommend folgen würde wie Josuah Parker, ihr Butler mit den erlesenen Manieren, stand für Agatha Simpson außer Frage.
»Stoppen Sie diese Verkehrsrowdys, die mich so dreist überholt haben, Mister Parker!«
»Wie Mylady zu wünschen geruhen«, erwiderte der Butler, der die passionierte Detektivin in seinem hochbeinigen Monstrum zur Spielbank chauffierte. »Unter Umständen ist jedoch der Hinweis gestattet, daß es sich um ein Fahrzeug der Polizei handelt.«
»Dann erst recht, Mister Parker!« entschied die resolute Dame und rieb sich in diebischer Vorfreude die Hände.
Mit unbeteiligt wirkender Miene ließ der Butler das Zusatztriebwerk aufröhren, um Anschluß an die schwarze Limousine zu finden, die sein altertümlich wirkendes Gefährt in raschem Tempo überholt hatte.
»Falls man nicht sehr irrt, dürften die Herren demselben Ziel zustreben wie Mylady«, meldete Parker, als der Polizeiwagen in die Straße einbog, an der das Kasino lag.
»Unglaublich, wie die Polizei sich heutzutage benimmt, Mister Parker«, schüttelte Lady Agatha entrüstet den Kopf. »Und dann auch noch im Dienstwagen zum Roulett fahren!«
»Fraglos dürften Mylady in Erwägung ziehen, daß es auch dienstliche Gründe sein könnten, die die Herren ins Kasino rufen«, gab der Butler in seiner höflichen Art zu bedenken.
»Darauf wollte ich Sie auch gerade aufmerksam machen, Mister Parker«, versicherte Mylady umgehend. »Ich ahne schon, daß noch Arbeit auf mich zukommt.«
An der Einfahrt zum Spielkasino hatte Parker das Polizeifahrzeug eingeholt.
»Wo fahren Sie denn hin, Mister Parker?« fragte Agatha Simpson irritiert, als der Butler auf den Besucherparkplatz einbiegen wollte. »Schließlich bin ich doch auch im Dienst.«
»Mylady sind stets im Dienst, falls man in diesem Zusammenhang eine von Myladys Äußerungen zitieren darf«, antwortete Parker und folgte dem Polizeiwagen, der in einen für Autos gesperrten Weg abbog.
Gleich danach stoppten beide Fahrzeuge vor einer Freitreppe am Hintereingang des Gebäudes.
»Mein Instinkt sagt mir, daß hier ein Verbrechen großen Stils begangen wurde, Mister Parker«, verkündete Mylady bedeutungsvoll.
»Nichts liegt meiner Wenigkeit ferner, als Mylady zu widersprechen«, versicherte der Butler, während er seiner Herrin diskret beim Aussteigen half.
Die jungen Beamten, die dem Polizeiwagen entstiegen, stutzten zwar, als sie das skurrile Paar erblickten. Sie hatten es aber ausgesprochen eilig und nahmen die Stufen zur Glastür im Dauerlauf, ohne die Lady und den wie üblich schwarz gewandeten Butler weiter zu beachten.
Agatha Simpson, die die Sechzig überschritten hatte, war eine ausgesprochen majestätische Erscheinung. Daran änderte auch das etwas aus der Mode geratene Abendkleid nichts, das ihre wogende Fülle nur mühsam bändigte.
Das eigenwillige Erzeugnis der Putzmacherkunst, das ihr ergrautes Haupt krönte, bestach durch seine absolute Zeitlosigkeit. Die Hutnadeln des Filzgebildes hatten das Format mittlerer Grillspieße.
Ein perlenbestickter Handbeutel, der sogenannte Pompadour, vervollständigte den Aufzug der älteren Dame. Das Behältnis mit den ledernen Trageriemen barg Lady Agathas sogenannten Glücksbringer. Dabei handelte es sich um ein Hufeisen, das von einem stämmigen Brauereigaul stammte.
Diesen Glücksbringer wußte die resolute Dame ebenso überraschend wie treffsicher einzusetzen. Glück hatte er den Empfängern aber noch nie gebracht. Immerhin hatte Mylady das schmiedeeiserne Souvenir aus humanitären Gründen in eine dünne Lage Schaumstoff gewickelt.
Josuah Parker, ein Mann von durchschnittlicher Statur und schwer bestimmbarem Alter, stand seit Jahren in Diensten der Agatha Simpson. Er war von Kopf bis Fuß und Zoll für Zoll das Ebenbild eines hochherrschaftlichen Butlers aus längst vergangenen Zeiten.
Dezent gestreifte Beinkleider, ein schwarzer Zweireiher mit weißem Eckkragen, darüber ein konservativ geschnittener Covercoat, unterstrichen sein würdevolles Auftreten, das häufig so steif wirkte, als hätte er einen Ladestock verschluckt. Die Melone und ein altväterlich gebundener Regenschirm am angewinkelten Unterarm rundeten das Bild ab.
Als Parker Mylady in das verschwenderisch ausgestattete Foyer eintreten ließ, befanden sich die uniformierten Ordnungshüter schon im Gespräch mit einem fünfzigjährigen Mann, der gleichermaßen Eleganz und Seriosität ausstrahlte.
»Der Betrüger ist aufgefallen, als ihm beim ›Black Jack‹ eine Karte aus dem Ärmel rutschte«, setzte der Elegante die Polizisten ins Bild und putzte nervös mit einem Seidentuch an den Gläsern seiner goldgeränderten Brille. »Zum Glück wurde allzu großes Aufsehen vermieden.«
»Und wo ist der Mann jetzt, Mister Rutherford?« erkundigte sich einer der Beamten. Er hatte einen Streifen mehr auf der Schulterklappe als seine Kollegen.
»Die beiden Croupiers, die an dem Tisch tätig waren, haben ihn in einen separaten Raum geführt«, teilte Marty Rutherford mit. »Die Personalien haben wir auch schon festgehalten. Es handelt sich um einen gewissen Bob Multon.«
»Am besten nehmen wir den Burschen mit und quetschen ihn in aller Ruhe auf der Wache aus, Mister Rutherford«, schlug der Wortführer des Quartetts vor.
»Darum wollte ich Sie sowieso bitten, meine Herren«, erwiderte Rutherford. »Nicht, daß ich etwas gegen Sie persönlich hätte. Aber die Polizei im Haus zu haben, macht immer einen schlechten Eindruck.«
»Verstehe, Mister Rutherford«, nickte sein Gesprächspartner und setzte ein vertrauliches Grinsen auf. »Wo steckt der Kerl denn?«
»Bitte, hier entlang, meine Herren«, bat der Elegante und ging voran.
Agatha Simpson schloß sich an, als hätte die Aufforderung auch ihr gegolten. Josuah Parker wich nicht von ihrer Seite, mochten die Polizisten auch noch so mißtrauisch herübersehen.
Schon nach wenigen Schritten machte Rutherford vor einer Tür Halt. Daß sie verschlossen war, schien ihn zu überraschen.
»Mister Fender! Mister Fulham!« rief er und pochte ungeduldig an die Tür. »Machen Sie auf! Die Beamten sind da!«
Fender und Fulham antworteten nicht. Nur ein schwaches Stöhnen war hinter der Tür zu vernehmen.
*
Am liebsten hätten die Polizisten in einer filmreifen Aktion die Tür eingerannt. Ähnliches schien auch Agatha Simpson zu erwägen. Kasinochef Rutherford zeigte jedoch wenig Sympathie für derartige Vorschläge.
Mit seinem handlichen Universalbesteck hätte Josuah Parker mühelos aushelfen können. Die Anwesenheit der Ordnungshüter bewog ihn jedoch, den vielfach bewährten »Sesam-öffne-dich« in der Tasche zu lassen.
Doch Rutherford schaffte es, innerhalb von drei Minuten einen Hausmeister aufzutreiben, der mit einem riesigen Schlüsselbund anrückte und weitere drei Minuten benötigte, um den richtigen Schlüssel herauszufinden.
Schon bevor die Tür sich öffnete, hatte Parker den betäubenden Geruch von Chloroform wahrgenommen, der durch alle Ritzen drang. Auf der Schwelle begannen auch die anderen argwöhnisch zu schnuppern.
Terence Fender und Lee Fulham, die beiden Croupiers, die Rutherford zur Bewachung des ertappten Betrügers abgestellt hatte, hingen schlaff wie Gliederpuppen in den Ecken eines imposanten Ledersofas. Sie hoben nur mühsam die Augenlider und murmelten Unverständliches, als ihr Chef mit den Uniformierten eintrat.
Die passionierte Detektivin hatte vergeblich versucht, sich vor den Polizisten durch die Tür zu drängeln. Als das Vorhaben mißlang, wollte sie zunächst aufbrausen, besann sich dann aber doch eines anderen und machte auf dem Absatz kehrt.
»Eigentlich hätten die Flegel es verdient, daß ich ihnen Manieren beibringe«, grollte die ältere Dame auf dem Weg zurück ins Foyer.
»Was man keinesfalls bezweifeln möchte, Mylady«, ließ der Butler sich vernehmen. »Allerdings dürfte in einem solchen Fall mit ausgesprochen undankbaren Reaktionen zu rechnen sein, falls der Hinweis erlaubt ist.«
Aus Erfahrung wußte Parker, wie beherzt Agatha Simpson vorzugehen pflegte, wenn sie jemand auf ihre handfeste Art Manieren beibrachte.
»Nicht, daß ich Angst hätte, mich mit Polizisten anzulegen, Mister Parker«, stellte Mylady vorsichtshalber klar. »Aber etwas Spiel und Unterhaltung ist mir einfach wichtiger zur Zeit.«
»Eine Einstellung, die meine Wenigkeit keineswegs zu kritisieren erwägt, Mylady«, merkte der Butler an. »Darf man im übrigen Myladys Äußerung so verstehen, daß Mylady sich entschieden haben, in diesem Fall keine Ermittlungen aufzunehmen?«
»Ich bitte Sie, Mister Parker«, reagierte Agatha pikiert. »Das wäre doch wirklich unter meinem Niveau, als Detektivin einem kleinen Kartenbetrüger nachzulaufen. Das kann meinetwegen die Polizei erledigen.«
»Wie Mylady zu wünschen belieben«, erwiderte Parker und geleitete seine Herrin in den weitläufigen Roulettsaal.
Das Kasino war gut besucht. Alle sechs Tische waren geöffnet. Regelrechtes Gedränge herrschte aber nur an einem.
»Dort scheint es am interessantesten zu sein, Mister Parker«, befand die ältere Dame und steuerte forsch auf die Menschen zu. Daß Spieler und Neugierige in mehreren Reihen den Tisch umlagerten, stellte für die resolute Lady kein ernstzunehmendes Hindernis dar. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis Agatha Simpson zum Rand des Spielfeldes vorgedrungen war und sogar einen Sitzplatz gefunden hatte.
Sie setzte unbekümmert ihre Ellbogen ein und schreckte auch vor Tritten gegen störende Schienbeine nicht zurück. Jaultöne und bissige Proteste nahm die selbstbewußte Dame dabei nicht zur Kenntnis.
Der Mann, der der Detektivin gegenübersaß, war nach Parkers Schätzung kaum älter als dreißig. Das gebräunte Gesicht unter den akkurat frisierten schwarzen Haaren wirkte verschlossen und hart. Noch härter aber war der Blick seiner stahlblauen Augen, die unablässig die elfenbeinerne Kugel fixierten, als wäre sie dadurch in das gewünschte Feld zu zwingen.
Das Auffälligste an dem Unbekannten, der einen von der Stange stammenden Smoking trug, war jedoch der eindrucksvolle Berg von Jetons, den er vor sich aufgehäuft hatte.
»Der junge Mann hat fast den ganzen Abend auf die Vierunddreißig gesetzt«, erfuhr Mylady von ihrer Sitznachbarin, einem ältlichen, hageren Fräulein, das unter der Last üppiger Brillanten fast zusammenzubrechen schien.
»Unglaublich, so eine Glückssträhne«, kommentierte die Hagere in andächtigem Flüsterton.
»Da müssen Sie mich erst mal erleben«, warf Lady Agatha sich in die ohnehin füllige Brust. »Wenn man das richtige System hat, ist es ein Kinderspiel, jede Bank in den Ruin zu treiben.«
Mylady wollte mit einem Zehn-Pfund-Jeton den Beweis antreten, doch sie zögerte zu lange.
»Rien ne va plus«, schnarrte der Croupier und ließ sich auch durch Agatha Simpsons ärgerliche Miene nicht beeindrucken. Das Rad rotierte. Wie ein verirrter Pingpongball hüpfte die weiße Kugel über schwarze und rote Felder.
Der Unbekannte mit den schwarzen Haaren und den stahlblauen Augen hatte tausend Pfund gesetzt – wieder auf die 34.
Wie gebannt starrten Dutzende von Menschen auf den Roulettkessel. Die Drehungen des Rades waren deutlich langsamer geworden. Die Kugel holperte nur noch müde über Rippen und Felder.
»Vierunddreißig!« rief jemand gleich darauf.
»Vierunddreißig«, gab der Croupier offiziell bekannt.
Ehrfürchtiges Raunen ging durch die Runde, während der Croupier und sein Assistent in Aktion traten und routiniert die Jetons hin und her schoben.
Als sie ihr Werk beendet hatten, war der Berg an Spielmarken vor Myladys Gegenüber um weitere 35000 Pfund gewachsen.
Teilnahmslos nahm der Spieler seinen Gewinn zur Kenntnis und angelte nach dem schwarzen Aktenkoffer, der zwischen seinen Füßen stand. Mit lässigen Bewegungen schaufelte der Mann den Verdienst des Abends hinein, stand grußlos auf und schritt zur Kasse, wo man ihm die Spielmarken in gebündelte Hundert-Pfund-Noten eintauschte.
*
Als hätte die Glücksgöttin Fortuna sich gleichzeitig zurückgezogen, verteilte sich die Menge innerhalb kurzer Zeit auf die übrigen Tische. Nur Lady Agatha harrte aus.
Beim nächsten Spiel war sie dabei – mit zehn Pfund auf die 34.
»Es kann ja nicht immer klappen«, bemerkte die ältere Dame unbeirrt, als die Kugel in der 18 liegenblieb. »Dafür ist es eben ein Glücksspiel.«
»Eine Feststellung, der man sich nur anschließen kann, Mylady«, bemerkte Parker, der hinter seiner Herrin aufmerksam das Spiel verfolgte.
Auch der zweite Einsatz ging verloren. Aber beim dritten Mal stimmte Myladys Beharrlichkeit die launische Fortuna doch gnädig.
Vor Freude klatschte Agatha Simpson in die Hände, als die weiße Elfenbeinkugel sich für die 34 entschied und aus den zehn Pfund plötzlich 360 geworden waren.
»Ich werde den Gewinn stehenlassen und der Bank Paroli bieten, bis sie zahlungsunfähig ist, Mister Parker«, setzte die mutige Dame den Butler ins Bild.
»Mylady lieben das Risiko«, sagte Parker mit der unbewegten Miene eines professionellen Pokerspielers.
»Natürlich, Mister Parker«, erwiderte die Detektivin gut gelaunt. »Was wäre das Leben ohne Risiko!«
»Eine Feststellung, der meine Wenigkeit durchaus nicht widersprechen möchte, Mylady«, pflichtete der Butler seiner Herrin bei und war schon wieder mit den Augen beim Spiel.
»Wieviel gewinne ich, wenn jetzt wieder die Vierunddreißig kommt, Mister Parker?« wollte sie wissen.
»Im genannten Fall dürften Mylady zusätzlich zu den eingesetzten dreihundertundsechzig Pfund weitere zwölftausendundsechshundert Pfund als Gewinn erhalten«, rechnete der Butler rasch vor.
»Und wenn ich das wieder stehen lasse und gewinne, Mister Parker?«
Die ältere Dame war eindeutig vom Spielfieber befallen. Schwärmerischer Glanz stand in ihren Augen.
»Dann dürfte Myladys Guthaben sich nahezu auf eine halbe Million Pfund belaufen, falls man sich nicht gründlich irrt«, antwortete Parker wie aus der Pistole geschossen, als handelte es sich um eine Aufgabe aus dem kleinen Einmaleins.
Doch soweit kam es nicht.
Als die Kugel beim nächsten Spiel auf dem grünen Feld mit der Null landete und die Groupiers sämtliche Einsätze einstrichen, waren auch Lady Agathas 360 Pfund verloren.
»Unverschämtheit!« räsonierte Mylady enttäuscht. Ihre Laune war schlagartig verflogen.
»Die sind ja nur darauf aus, anderen Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen«, behauptete sie wütend und erhob sich.
»Mylady haben Sinn und Zweck von Spielkasinos in einer Weise charakterisiert, die man nur als prägnant und zutreffend bezeichnen kann«, gab Parker seiner Herrin recht.
»So was mit einer alleinstehenden Dame zu machen, die jeden Penny dreimal umdrehen muß, grenzt schon an kriminellen Diebstahl, Mister Parker«, ereiferte sich die passionierte Detektivin. »Vielleicht geht es beim Roulett einfach nicht mit rechten Dingen zu.«
»Eine Möglichkeit, die man keinesfalls grundsätzlich ausschließen sollte, Mylady«, ließ der Butler sich vernehmen, während man durch die kleineren Räume schritt, in denen Karten gespielt und gewürfelt wurde.
»Deshalb werde ich jetzt würfeln, Mister Parker«, zeigte Mylady neu erwachten Tatendrang. »Da ist wenigstens kein Betrug möglich. Eine Sechs bleibt eine Sechs.«
»Eine Behauptung, die nur schwer zu widerlegen sein dürfte«, äußerte Parker mit einer angedeuteten Verbeugung. »Andererseits dürften Mylady in Betracht ziehen, daß gelegentlich auch offizielle Kasinos von professionellen Falschspielern heimgesucht werden.«
»Wem sagen Sie das, Mister Parker? Schließlich bin ich Kriminalistin«, mokierte sich Agatha Simpson. »Einen Betrüger würde ich schon nach der ersten Spielrunde entlarven.«
»Wie Mylady meinen«, erwiderte der Butler höflich. Er war keineswegs sicher, daß Agatha Simpson raffinierte Tricks durchschauen würde.
Es dauerte kaum eine halbe Stunde, bis sich herausstellte, daß die ältere Dame eindeutig den Mund zu voll genommen hatte.
*
Von Runde zu Runde fand sie mehr Gefallen am Spiel. Zwar ließen sich die Einsätze nicht so explosionsartig vermehren wie bei einem Zahlentreffer im Roulett. Auch mußte Mylady hin und wieder Verluste einstecken, was ihr sichtlich schwerfiel. Aber insgesamt war nicht zu übersehen, daß ihr bescheidenes Häufchen Jetons sich nach und nach zu einem ansehnlichen Berg mauserte.
Der Erfolg erregte Appetit auf mehr. Lady Simpson stachelte ihre Mitspieler zu immer höheren Einsätzen an. Ein Konkurrent nach dem anderen schied aus dem Spiel aus.
Nur der breitschultrige Glatzenträger schräg gegenüber, der über einen ähnlich guten Draht zu Fortuna zu verfügen schien, hielt unverdrossen mit.
»Einmal muß die Entscheidung fallen«, meinte Agatha Simpson ungeduldig, nachdem das Glück eine Weile mit ihr, mal dem Fünfzigjährigen gelacht hatte.
Mit lässiger Handbewegung schob die sonst so sparsame Dame ihren gesamten Jeton-Bestand in die Mitte des grün gedeckten Tisches. Dabei handelte es sich immerhin um den Gegenwert von 10000 Pfund, wie der aufsichtführende Croupier in Sekundenschnelle feststellte.
»Sie trauen sich wohl nicht, junger Mann?« versuchte Agatha Simpson ihren Gegenüber aus der Reserve zu locken.
Der Mann schien zu zögern. Doch dann nickte er, lächelte seiner couragierten Spielpartnerin zu und schob ebenfalls seine Jetons in die Mitte. Da sein Bestand nicht ganz ausreichte, legte er noch 1000 Pfund in Banknoten dazu.
Parkers Herrin war zuerst an der Reihe. Siegesgewiß griff sie nach dem Würfelbecher. Die Gelegenheit, ihr Budget um einen ansehnlichen Betrag aufzubessern, schien greifbar nahe.
Energisch ließ die ältere Dame die Würfel klappern und stülpte den Becher mit einem Knall auf den Tisch.
»Donnerwetter!« staunte ihr Gegenüber. »Sie haben wirklich ’ne Glückssträhne heute abend, Lady.«
Zwei Fünfen lagen nebeneinander auf dem grünen Filztuch.
»Mit Glück hat das nichts zu tun, junger Mann«, mußte der Glatzköpfige sich belehren lassen. »Gegen überlegene Technik kommen Sie nicht an.«
»Das wird sich zeigen, Lady«, erwiderte der Mitspieler, der mit amerikanischem Akzent sprach. Dabei lächelte er und ließ seine goldenen Eckzähne blitzen.
»Was wollen Sie überhaupt noch mit den Würfeln, junger Mann?« fragte Lady Agatha überrascht, als der Spieler nach dem ledernen Becher griff. »Daß ich gewonnen habe, steht doch sowieso fest. Oder glauben Sie im Ernst, Sie würden eine doppelte Sechs würfeln?«
»Unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen, Lady«, gab der breitschultrige Amerikaner zurück.
»Ich will ja keine Spielverderberin sein, Mister Parker«, tat Mylady in herablassendem Ton kund und wandte sich zu ihrem Butler um, der hinter ihr stand. »Soll der junge Mann seine Chance haben.«
»Meine Wenigkeit ist beeindruckt von Myladys Fairneß und Sportsgeist«, versicherte Parker mit einer angedeuteten Verbeugung.
Weil er dabei den Glatzköpfigen ebenso unauffällig wie konzentriert im Auge behielt, entging dem Butler nicht, daß es bei Lady Simpsons Gegenspieler mit Fairneß und Sportsgeist nicht allzu weit her war.
Als der stämmige Amerikaner gleich darauf den Würfelbecher auf den Tisch stülpte, hielt Parker den Augenblick zum Eingreifen für gekommen und benutzte seinen schwarzen Universal-Regenschirm, um das unlautere Spiel zu beenden.
Der Mann jaulte wie ein getretener Hund, als die bleigefüllte Schirmspitze mit der Zartheit einer Dampfwalze auf sein Handgelenk tippte. Reflexartig zog er die Hand zurück, als hätte er sich verbrannt.
»Verdammt, was soll der Blödsinn?« knurrte der Glatzköpfige wütend. »Sind Sie übergeschnappt?«
»Keineswegs und mitnichten«, erwiderte der Butler mit unbewegter Miene.
»Das geht aber nicht«, schaltete sich prompt der Croupier ein. »Störungen des Spiels kann ich nicht zulassen.«
»Was ist in Sie gefahren, Mister Parker?« wollte Lady Agatha wissen.
Der umgestülpte Becher mit den zwei Würfeln war auf dem grünen Tisch stehengeblieben.
»Der Herr darf den Wurf wiederholen, wenn er es wünscht«, entschied der Croupier.
»Ich verzichte auf eine Wiederholung«, fauchte der Amerikaner und massierte sein anschwellendes Handgelenk.
»Dann heben Sie bitte ab, Sir«, forderte der Croupier ihn auf.
Aller Augen waren auf den ledernen Würfelbecher gerichtet, den der Amerikaner geradezu entnervend langsam abhob.
»Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu«, räsonierte die ältere Dame und erhob sich entrüstet.
Zwei Sechsen lagen auf dem grünen Filz!
»Ich muß Sie dringend bitten, sich zu mäßigen, Mylady«, unternahm der Croupier den Versuch einer Beschwichtigung. »Das Glück läßt sich nicht berechnen.«
»Aber manipulieren, falls diese Anmerkung gestattet ist«, sagte Josuah Parker und ... griff blitzschnell nach den beiden Würfeln.
Als er sie unter den entgeisterten Blicken der Tischrunde zwischen Daumen und Zeigefinger der schwarz behandschuhten Rechten drehte, wurde sein Verdacht zur Gewißheit.
Die Flächen beider Würfel zeigten ausnahmslos die Augenzahlen vier, fünf, sechs, wobei gleiche Werte einander gegenüberlagen.
*
Urplötzlich kam Bewegung in den behäbig wirkenden Betrüger.
Der Stuhl flog zur Seite, als der Glatzköpfige aufsprang. Der Croupier, der sich ihm in den Weg stellen wollte, sackte stöhnend unter einem Fausthieb zusammen. Doch an Parker kam der flüchtende Ganove nicht vorbei.
Mit ruckartiger Bewegung hatte der Butler den schwarzen Universalschirm vom angewinkelten Unterarm senkrecht in die Höhe schnellen lassen und hielt die bleigefüllte Spitze in der Hand. Sekundenbruchteile darauf huschte der gebogene Bambusgriff dicht über den luxuriösen Teppichboden und hakte sich an den Fußgelenken des Falschspielers fest.
Wie eine Fußangel riß das unverhoffte Hindernis dem Fliehenden die Beine unter dem Leib weg.
Spontan entschloß sich der Mann zu einem Gleitflug, wobei er jedoch die Wirkung der Schwerkraft erheblich unterschätzte. Kreischend absolvierte er eine etwas holprige Bauchlandung.
Dieser Mißerfolg entmutigte den Glatzköpfigen jedoch keineswegs. Behend, was man ihm nicht im entferntesten zugetraut hätte, war der Falschspieler wieder auf den Beinen und setzte seine Flucht in Richtung Ausgang fort.
»Tun Sie doch endlich was, Mister Parker«, verlangte die passionierte Detektivin. »Wollen Sie den Schurken denn entwischen lassen?«
»Keineswegs und mitnichten, Mylady«, erwiderte der Butler, griff nach seinem Bowler, faßte die schwarze Kopfbedeckung an der Krempe und schickte sie dem Flüchtenden nach.
Wie eine Frisbeescheibe segelte die Melone durch den Raum, legte sich sanft in die Kurve und steuerte unfehlbar ihr Ziel an.
Der stämmige Betrüger produzierte einen Jaulton, als die Stahlkrempe seinen Nacken erreichte und die letzten Borsten von der blanken Kopfhaut schabte.
Anschließend geriet der Mann ins Trudeln, schleppte sich auf unsicheren Beinen noch ein paar Schritte weiter und blieb dann abrupt stehen – unmittelbar vor dem weißen Marmorrand eines flachen Wasserbeckens, in dem ein farbig angestrahlter Springbrunnen plätscherte.
Sekundenlang stand der Ganove schwankend vor dem dekorativen Wasserspiel. Das plätschernde Naß schien eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf ihn auszuüben.
Schließlich knickte er leicht in den Knien ein, begann heftig mit den Armen zu rudern und ließ sich dann in gestreckter Haltung nach vorn fallen. Dabei sorgte er für eine Wasserfontäne, gegen die der elektrisch betriebene Springbrunnen nur ein müdes Rinnsal war.
Allerdings wurde das Becken durch diese Wasserspiele schlagartig bis auf einen geringen Rest geleert. Dafür hatte sich der Teppichboden in zehn Metern Umkreis in einen Sumpf verwandelt. Einige Gäste weiblichen Geschlechts taten durch hysterische Schreie kund, daß sie in den Genuß einer unfreiwilligen Dusche gekommen waren.
Immerhin hatte die Wasserfläche den Sturz des Ganoven gemildert, so daß er ohne ernsthafte Blessuren davonkam. Seine Fluchtgedanken hatte der Mann jedoch fürs erste vergessen.
Er stöhnte verhalten, als Parker ihn am Kragen aus dem Becken zog, und hatte eindeutig Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Widerspruchslos ließ er es geschehen, daß der Butler ihn mit Handschellen aus speziell gehärtetem Stahl wirksam in seiner Bewegungsfreiheit einschränkte.
Kurz darauf war auch Kasinochef Marty Rutherford zur Stelle, um sich über die Ursache des Tumults zu informieren.
»Ich werde sofort die Polizei anrufen«, entschied der Mann mit der goldgefaßten Brille, nachdem der wieder vernehmungsfähige Croupier ihn knapp unterrichtet hatte.
»Das werden Sie nicht tun, junger Mann«, schaltete Agatha Simpson sich unüberhörbar ein. »Diesen Fehler haben Sie heute schon mal gemacht.«
»Ich? Wieso?« Rutherford maß die füllige Lady mit irritiertem Blick.
»Ich meine den Betrüger, den Sie beim Big Mac erwischt haben, junger Mann«, wurde die Detektivin deutlich.
»Sie meinen Black Jack?« vergewisserte sich der Kasinochef«
»Nichts anderes habe ich gesagt. Sie sollten besser zuhören, wenn eine Dame mit Ihnen spricht, Mister Motherlord«, reagierte Mylady mürrisch.
»Verzeihung, Mylady«, korrigierte ihr Gegenüber und putzte sich schon wieder nervös die blanken Brillengläser. »Mein Name ist Rutherford, Marty Rutherford.«
»Ich weiß«, nickte die ältere Dame. »Mein Namensgedächtnis ist unbestechlich, wie auch Mister Parker Ihnen bestätigen wird.«
»Mylady sind immer bestens informiert«, versicherte der Butler und verneigte sich höflich.
»Und warum war es ein Fehler, daß ich die Polizei alarmiert habe?« wollte Rutherford wissen.
»Wenn Sie mir die Ermittlungen übertragen hätten, wäre die Panne nicht passiert, Mister Motherlord«, antwortete Mylady.
»Ihnen?« Rutherfords Mund blieb offenstehen. Er vergaß sogar, weiter an seiner Brille zu putzen.
»Mylady genießt einen außergewöhnlichen Ruf als Privatdetektivin«, setzte Parker ihn ins Bild.
Rutherford schluckte.
»Wie dem auch sei«, meinte er. »Wir sollten jetzt erstmal in mein Büro gehen. Solche Diskussion sollte man nicht in aller Öffentlichkeit führen.«
»Das wollte ich auch gerade vorschlagen, Mister Motherlord«, erwiderte Lady Agatha. »Diskretion ist eine meiner hervorstechendsten Qualitäten.«
»Sie halten sich bitte bereit«, wies der Kasinochef den Croupier an. »Ich lasse Sie rufen, falls ich Sie brauche.«
Anschließend steuerte man das Foyer an. Links ging Rutherford, daneben Parker und Agatha Simpson. Den apathisch dahintrottenden Würfelbetrüger hatte das skurrile Paar in die Mitte genommen.
»Wenn wir den Mann mit in mein Büro nehmen, wird er wohl nicht entwischen wie dieser Multon«, meinte Rutherford.
»Eine Feststellung, der man sich vorbehaltlos anschließen möchte, Mister Rutherford«, pflichtete der Butler ihm bei. »Andererseits ist unter Umständen der Hinweis genehm, daß die Anwesenheit dieses Herrn die Gesprächsatmosphäre ungünstig beeinflussen oder gar nachhaltig stören könnte.«
»Darauf wollte ich Sie schon aufmerksam machen, junger Mann«, ließ Mylady sich mit ihrem sonoren Organ vernehmen. »Mister Parker wird den Schurken sicher unterbringen.«
Das tat der Butler denn auch.
In würdevoller Haltung geleitete er den ertappten Betrüger nach draußen zum hochbeinigen Monstrum und bugsierte ihn auf den Beifahrersitz. Anschließend zog Parker ein Sprühfläschchen aus der linken Außentasche seines schwarzen Covercoats.
Zwei, drei Sekunden ließ er den Verdutzt blickenden Ganoven an dem feinen Nebel schnuppern, der auf Knopfdruck der Düse entströmte.
Postwendend verdrehte der Mann die Augen, setzte ein geistesabwesendes Lächeln auf und ließ sich seufzend in die weichen Polster sinken. Das Betäubungsmittel pflanzlicher Herkunft, das der glatzköpfige Amerikaner eingeatmet hatte, wirkte ebenso rasch wie zuverlässig.
Mit unbewegter Miene ließ der Butler die Autotür ins Schloß fallen, nachdem der Ganove sanft entschlummert war.
Bevor Josuah Parker in das Foyer der Spielbank zurückkehrte, wo Agatha Simpson und Marty Rutherford ihn erwarteten, betätigte er mit der Schirmspitze einen kleinen, kaum sichtbaren Kontaktknopf auf dem Trittbrett seines altertümlich wirkenden Vehikels.
Dadurch waren alle Türgriffe des schwarzen Kastens unter Strom gesetzt. Falls der Glatzköpfige über Verbündete verfügte, die ihn befreien wollten, würden sie eine ausgesprochen unangenehme Überraschung erleben.
*
Mylady hatte die Abwesenheit des Butlers benutzt, um vor Rutherford ein buntes Kaleidoskop ihrer kriminalistischen Großtaten aufzublättern. Daß sie dabei mit der Wahrheit allzu kleinlich umgegangen wäre, konnte man nicht behaupten.
»Sie sind also die bekannte Privatdetektivin Agatha Simpson?« vergewisserte sich der Kasinochef gerade, als Parker hinzutrat. »Von Ihnen habe ich schon viel gehört.«
»Das wundert mich nicht im geringsten, junger Mann«, erwiderte die ältere Dame mit stolzgeschwellter Brust. »Sie dürfen sich glücklich schätzen, daß ich trotz meiner vielen Verpflichtungen bereit bin, Ihnen zu helfen.«
»Und Sie meinen wirklich, ich sollte die Polizei aus dem Spiel lassen, Mylady?« fragte Rutherford, während man sein repräsentativ ausgestattetes Büro betrat.
»Waren Sie schon mal während der Rush-hour in London, Mister Motherlord?« antwortete die Detektivin mit einer Gegenfrage.
»Schon öfter. Weshalb?« wollte der Kasinochef wissen.
»Dann ist Ihnen bestimmt aufgefallen, wie die Polizei schon mit der Regelung des Verkehrs überfordert ist«, meinte Lady Simpson.
»Natürlich«, nickte Rutherford.
»Und den Uniformierten trauen Sie die Aufklärung einer ganzen Serie von brutalen Verbrechen zu, junger Mann?« zeigte sich Agatha Simpson verwundert.
»Heute abend sind zwei Betrüger aufgefallen, Mylady«, erwiderte ihr Gesprächspartner. »Da ist es doch wohl übertrieben, von einer Serie brutaler Verbrechen zu reden.«
»Ich übertreibe grundsätzlich nie, Mister Motherlord«, stellte die Detektivin pikiert klar. »Was sich bisher gezeigt hat, ist doch nur die Spitze des Eisbergs.«
»Sind Sie sicher, Mylady?« Rutherfords Mienenspiel drückte Skepsis aus.
»Absolut, junger Mann«, behauptete Agatha Simpson in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete. »Ich übe auf kriminelle Elemente eine fast magische Anziehungskraft aus. Wo ich auftauche, umschwirren sie mich – wie Motten das Licht.«
»Eine Feststellung, die man aus langjähriger Erfahrung nur vorbehaltslos bestätigen kann, Mister Rutherford«, ließ Parker sich vernehmen. »Darf man im übrigen die Frage anschließen, ob es häufiger vorkommt, daß Ihre Spielbank von Falschspielern heimgesucht wird?«
»Ab und zu schon, Mister Parker«, räumte der Kasinochef ein. »Betrüger zu überführen, gelingt uns aber nur selten.«
»Das wundert mich nicht, Mister Motherlord«, warf Lady Simpson ein.
»Manche Besucher scheinen das Glück in einer Weise gepachtet zu haben, die uns natürlich stutzig macht«, fuhr der Mann mit der goldgefaßten Brille fort. »Trotzdem überlegt man es sich dreimal, ehe man eingreift. Das ist nämlich immer eine zweischneidige Sache.«
»Darf man möglicherweise erfahren, wie Sie diese Äußerung verstanden wissen möchten, Mister Rutherford?« hakte der Butler sofort nach.
»Nun«, zögerte Rutherford, »erstens ist es für den Ruf eines Kasinos immer nachteilig, wenn die Polizei in Aktion tritt. Außerdem ...«
Eine kurze Pause trat ein.
»Was ist außerdem, junger Mann?« bohrte Agatha Simpson.
»Besucher, die ungewöhnlich hohe Gewinne einstreichen, sind einfach ein Werbefaktor, den man nicht unterschätzen sollte, Mylady«, gab Rutherford mit verlegenem Lächeln Auskunft. »So etwas spricht sich herum. Es zieht zusätzliche Gäste an und motiviert sie zu höheren Einsätzen, so daß der Umsatz der Bank insgesamt steigt.«
»Kann und muß man Ihrer Äußerung entnehmen, daß Sie Betrüger bewußt gewähren lassen, um den übrigen Besuchern höhere Gewinnchancen vorzugaukeln, Mister Rutherford?« vergewisserte sich der Butler.
»So kraß darf man es nicht ausdrücken, Mister Parker«, erwiderte sein Gesprächspartner. »Aber wenn die Leute nach ein, zwei Abenden wieder verschwinden, machen wir kein Aufhebens davon. Manchmal sind solche Glückssträhnen ja auch wirklich echt.«
»Was man keinesfalls bezweifeln möchte, Mister Rutherford«, entgegnete Parker. »Dennoch dürften der Bank durch betrügerische Manipulationen auch beträchtliche Nachteile erwachsen, falls man sich nicht gründlich irrt.«
»Das hält sich in aller Regel im Rahmen und wird durch die erhöhten Einsätze der übrigen Gäste mehr als ausgeglichen, Mister Parker«, teilte der Kasinochef mit. »Die Bilanz der letzten Tage sieht allerdings nicht gut aus.«
»Eine Tatsache, die Sie auf das Wirken von Falschspielern zurückführen, Mister Rutherford?« wollte der Butler wissen.
»Anders kann ich es mir nicht erklären, Mister Parker«, gestand Rutherford.
»Sehen Sie, junger Mann?« schaltete Lady Agatha sich unüberhörbar ein. »Ich habe nicht ohne Grund von der Spitze eines Eisbergs gesprochen.«
»Mag sein, Mylady«, räumte der Kasinochef nachdenklich ein. »Sie glauben also, daß eine ganze Bande momentan ihr Unwesen treibt?«
»Genau, Mister Motherlord«, nickte die Detektivin.
»Dann sollte ich vielleicht doch die Polizei einschalten«, dachte Rutherford laut.
»Unsinn, junger Mann!« fuhr Mylady erregt dazwischen.
»Immerhin muß ich mich vor dem Aufsichtsrat der Betreibergesellschaft verantworten«, erläuterte ihr Gegenüber. »Man wird mir vorwerfen, daß ich nicht alles getan habe, um das Kasino vor Verlusten zu schützen.«
»Sie können nichts besseres tun, als auf meinen kriminalistischen Instinkt und meine Erfahrung zu vertrauen, Mister Motherlord«, entgegnete Mylady unbeirrt. »Morgen früh sitzt die ganze Bande hinter Schloß und Riegel.«
»Morgen früh?« wiederholte Rutherford ungläubig. »Wie wollen Sie das denn schaffen?«
»Das lassen Sie nur meine Sorge sein, junger Mann«, verriet die passionierte Detektivin ihr ausgesprochen gesundes Selbstbewußtsein. »Wenn ich mein Versprechen nicht halte, können Sie immer noch die Polizei rufen.«
»Abgemacht«, willigte Rutherford ein. »Natürlich haben Sie meine volle Unterstützung, Mylady.«
»Die brauche ich nicht«, gab die resolute Dame stolz zurück. »Aber vielleicht würde mir ein Schluck Cognac guttun, bevor ich in Aktion trete.«
»Aber selbstverständlich, Mylady«, erwiderte der Kasinochef und sprang auf. »Verzeihen Sie, ich bin ein schlechter Gastgeber.«
»Normalerweise rühre ich ja keinen Tropfen an«, behauptete die Lady ungeniert. »Aber mein außerordentlich sensibler Kreislauf braucht ab und zu eine Stärkung.«
Die bauchige Flasche mit dem vergilbten Etikett, die Rutherford aus der Bar in einem Wandschrank holte, erweckte so eindeutig das Wohlgefallen der Dame, daß es bei dem einen Schluck nicht blieb.
Als Parker seine Herrin hinausgeleitete, war Agatha Simpson heiter und gelöst, nur ihre Zunge etwas schwer. Dem Kasinochef fiel das allerdings nicht auf. Er hatte leichtfertigerweise versucht mitzuhalten und schnarchte friedlich in seinem Schreibtischsessel.
*
Josuah Parker rechnete damit, daß der ertappte Falschspieler inzwischen aus den Träumen erwacht war, die der feine Nebel aus dem Sprühfläschchen ihm beschert hatte. Entkommen konnte der Mann trotzdem nicht. Die Handschellen, die elektronische Zentralverriegelung und die elektrisch geladenen Türgriffe boten Sicherheit genug.
Der glatzköpfige Amerikaner war auch tatsächlich noch da. Er saß genauso auf dem Beifahrersitz, wie der Butler ihn verlassen hatte. Der Ganove rührte sich nicht mal, als Lady Simpson keuchend und mit Parkers diskreter Hilfe den Fond des hochbeinigen Monstrums enterte.
Da die gepanzerte Trennscheibe zwischen Fahrer- und Beifahrerplatz nicht geschlossen war, ließ Parker äußerste Vorsicht walten, als er seine Tür öffnete. Aber der stiernackige Betrüger stellte sich immer noch schlafend.
Mit der Spitze seines Universalschirmes tippte der Butler auf einen Kontaktknopf im Fußraum und ließ lautlos die Scheibe in die Höhe gleiten, ehe er sich in den Fahrersitz schwang.
Auf diesen Augenblick schien der unfreiwillige Beifahrer nur gewartet zu haben.
Er stieß einen Schrei aus, schnellte aus dem Sitz und sank jaulend wieder zurück. Das unsichtbare Hindernis hatte seiner Nase ein völlig neues Design verpaßt, das aber keineswegs vorteilhaft wirkte.
»Sie sollten lieber ein umfassendes Geständnis ablegen, junger Mann«, dröhnte Lady Agathas baritonal gefärbtes Organ aus der Sprechanlage, die den schußsicher verglasten Fond mit den vorderen Plätzen verband. »Jede Gegenwehr ist zwecklos.«
»Was soll der Quatsch?« knurrte der Mann mit dem eigenwillig verformten Riechorgan. »Ich habe nichts zu gestehen. Und überhaupt ist das Freiheitsberaubung, was ihr hier macht.«
»Natürlich ist das Freiheitsberaubung«, räumte die Detektivin bereitwillig ein. »Aber nichts anderes haben Sie verdient.«
»Das ist ja wohl der Gipfel«, brauste der Betrüger auf. »Wenn ihr nicht...«
»Sie haben versucht, eine alleinstehende Dame hinterhältig um ihre mühsam ersparten Groschen zu bringen«, fuhr Mylady barsch dazwischen.
»Was regen Sie sich denn auf, Madam«, reagierte der Ganove trotzig. »Schließlich bin ich jetzt blank, und Sie haben alles kassiert.«
»Das ist auch nicht mehr als recht und billig, junger Mann«, mußte er sich postwendend belehren lassen. »Außerdem hat dieser dreiste Lümmel von Croupier geradezu horrende Gebühren abgezogen.«
»Ein Verhalten, das eindeutig den geltenden Bestimmungen entsprach, falls die Anmerkung erlaubt ist, Mylady«, meldete Parker sich zu Wort.
»Trotzdem ist es pure Halsabschneiderei, Mister Parker«, beharrte die resolute Dame. »Die tun ja so, als müßte nach einmal Würfeln ein neuer Tisch gekauft werden.«
»Mylady dürften in Rechnung stellen, daß der Spielbank beträchtliche Unkosten verschiedener Art entstehen die auf die Kunden umgelegt werden«, wandte der Butler höflich ein.
»Das sollen sie mit Leuten machen, die in weniger bescheidenen Verhältnissen leben als ich, Mister Parker«, entschied Mylady. »Am besten würde ich in meinem Haus ein paar Spieltische aufstellen. Dann fließen die Gebühren mir zu.«
»Möglicherweise ist der Hinweis gestattet, daß ein solches Vorhaben als illegal gelten müßte, Mylady«, trug Parker seine Bedenken vor.
»Wie auch immer«, wich die ältere Dame aus. »Ich werde diesen Gedanken später näher prüfen, Mister Parker. Zunächst steht die Vernehmung dieses kriminellen Subjekts auf meinem Plan.«
»Darf man fragen, ob Mylady spezielle Wünsche zu äußern belieben, was den Ort der Vernehmung angeht?« erkundigte sich der Butler.
»Lassen Sie mich nachdenken, Mister Parker«, erwiderte Mylady gut gelaunt. »Wie wäre es mit einer romantischen Kulisse? Hoch oben auf einer steilen Klippe, am Himmel der Mond und tief unten die Brandung ...«
»Meine Wenigkeit eilt, Myladys Wünschen nachzukommen«, versicherte Parker und startete seinen Privatwagen, während der Glatzköpfige auf dem Beifahrersitz mißmutig brummte. »Allerdings dürfte eine Autofahrt von schätzungsweise fünfzehn Minuten erforderlich sein, sofern es genehm ist.«
»Ich werde die Zeit nutzen, um mein taktisches Konzept zu verfeinern«, antwortete die Detektivin. »Jedenfalls sitzt spätestens morgen früh die Bande hinter italienischen Vorhängen.«
»Darf man vermuten, daß Mylady ›schwedische Gardinen‹ zu meinen belieben?« fragte der Butler mit unbewegter Miene.
»Was heißt hier Bande?« schaltete sich der Amerikaner ein.
»Sie halten gefälligst den Mund und reden nur, wenn Sie gefragt werden, junger Mann!« herrschte Agatha Simpson ihn an. »Ich will jetzt nicht mehr gestört werden.«
*
Die Fahrt verlief tatsächlich ohne Störung, so daß die ältere Dame sanft entschlummert war, als Parker eine Viertelstunde später sein hochbeiniges Monstrum auf einem Kiesweg am Rand eines schmalen Wiesenstreifens ausrollen ließ.
Es war alles so, wie Mylady es sich gewünscht hatte: Zehn Schritte führten bis an den Rand eines schroff abfallenden Kreidefelsens, der gespenstisch im Mondlicht leuchtete. Tief unten dehnte sich das nachtschwarze Meer. Undeutlich war das Rauschen der Brandung zu hören, die unablässig gegen den Fuß der Klippe klatschte.
Auf die Gesprächsbereitschaft des stiernackigen Falschspielers konnte sich diese Umgebung nur günstig auswirken.
Zunächst aber schien die romantische Kulisse einen unbändigen Freiheitsdrang in dem Mann zu wecken.
Sobald Parker die Tür öffnete, um seinen Beifahrer aussteigen zu lassen, setzte der Glatzköpfige zum Sprung an und wollte sich vom Trittbrett herab auf den Butler stürzen. Dabei übersah er allerdings im schwachen Mondlicht die bleigefüllte Spitze von Parkers schwarzem Regendach, die ihm entgegenragte.
Das Hindernis wurde dem ungestümen Angreifer erst bewußt, als es sich durch einen äußerst unangenehmen Druck in der Magengegend bemerkbar machte. Neugierig tastete die Schirmspitze das sensible Verdauungsorgan ab und brachte dessen Besitzer in beträchtliche Atemnot.
Röchelnd knickte er in der Hüfte ein und absolvierte einen Salto vorwärts, der relativ glimpflich auf der Grasnarbe endete. Ermutigt durch den Erfolg dieser turnerischen Darbietung schloß der Mann gleich noch eine Rolle vorwärts an, die aber die einwandfreie Haltung vermissen ließ.
Entnervt streckte sich der untrainierte Sportler auf dem Rasen aus und schloß mit erlöstem Seufzer die Augen. Daß sein Schlummerplatz nur einen Schritt vom Abgrund entfernt lag, störte ihn nicht im geringsten.
Während der Ganove friedlich den Mond anschnarchte, öffnete Parker in würdevoller Haltung den hinteren Wagenschlag, um seiner Herrin mitzuteilen, daß die Vernehmung beginnen könne. Er mußte sich allerdings etliche Male räuspern, bis die ältere Dame mit einem Ruck hochfuhr und ihn wie geistesabwesend anstarrte.
»Man bittet in aller Form um Nachsicht, Mylady«, sagte der Butler und verneigte sich höflich.
»Schon gut, Mister Parker«, winkte Agatha Simpson ab. »Ich habe natürlich nicht geschlafen. Ich habe nur intensiv meditiert, daß ich Sie erst gar nicht gehört habe.«
Ächzend ließ Mylady sich von Parker aus dem Wagen helfen und sah sich um.
»Recht hübsch, Mister Parker«, fand sie ausnahmsweise zu einem Lob. »Genauso hatte ich es mir vorgestellt. Wo steckt denn das Subjekt?«
»Der Herr hat sich dort am Rand der Klippe niedergelassen und erwartet Myladys Fragen«, teilte der Butler mit und deutete auf den Glatzköpfigen.
»Hoffentlich fällt er nicht vor Schreck hinunter, wenn er zu sich kommt«, bemerkte Agatha Simpson, während sie auf den Schlummernden zuschritt.
»Meine Wenigkeit wird sich eingehend bemühen, ein derartiges Geschehen zu verhindern, Mylady«, versprach Parker und zog gleichzeitig ein Apothekerfläschchen mit Glasstöpsel aus einer der unergründlichen Taschen seines Covercoats.
»Es wäre wirklich ärgerlich, Mister Parker«, befand die passionierte Detektivin. »Wahrscheinlich könnte der Lümmel nicht mal mehr meine Fragen beantworten.«
»Was eindeutig zu befürchten steht, Mylady.«
Das Fläschchen enthielt ein altbewährtes Hausmittel, sogenanntes Riechsalz, an dem der Butler den Betrüger nun schnuppern ließ. Schon nach wenigen Sekunden zeigten die stechenden Dämpfe, die aus dem Flaschenhals stiegen ihre Wirkung.
Parker richtete sich auf und trat drei Schritte zurück, wobei er das Riechsalzfläschchen wieder in die rechte Außentasche seines Covercoats gleiten ließ. Den langsam erwachenden Ganoven behielt er konzentriert im Auge, um jederzeit rettend eingreifen zu können, falls der Mann dem Abgrund zu nahe kam.
*
»Aus gewichtigen Gründen darf man Sie dringlich ersuchen, keine unvorsichtigen Bewegungen zu machen«, sprach der Butler den Glatzköpfigen an, als der die Augen aufschlug und stöhnend den Kopf hob.
Nach ungestümer Betätigung schien dem Mann ohnehin nicht der Sinn zu stehen. Er brauchte fast eine Minute, um eine sitzende Haltung einzunehmen, woran die Handschellen nicht ganz unschuldig waren. Erst dann blickte er mit weit aufgerissenen Augen langsam in die Gegend.
Daß der Stiernackige unschlüssig war, ob er die gespenstische Szene im Mondschein für Traum oder Wirklichkeit halten sollte, ließ sich nicht übersehen. Aber noch hatte er sich nicht umgedreht. Nur das schwache Rauschen der Brandung hinter seinem Rücken schien ihn plötzlich stutzig zu machen.
»Man darf Sie noch mal eindringlich ersuchen, sich unkontrollierter Bewegung zu enthalten«, warnte Parker erneut. »Andernfalls würden Sie sich äußerst unerfreulichen Konsequenzen aussetzen, falls der wohlmeinende Hinweis erlaubt ist.«
Verständnislos glotzte der Ganove den Butler an und drehte langsam den Kopf über die Schulter.
Der Anblick des Meeres, das unten gegen die senkrecht abfallenden Klippen brandete, durchzuckte den Mann wie ein Stromstoß. Anschließend erstarrte er zur Salzsäule und schnappte hörbar nach Luft, bis es ihm endlich gelang, einen gellenden Schrei auszustoßen.
Danach robbte er in panischer Hast aus der Gefahrenzone.
»Name?« raunzte Lady Agatha den heftig atmenden Mann wie in dienstlichem Ton an.
»Ray Bunker«, kam die Antwort mit schwacher Stimme.
»Auftraggeber?« fuhr die resolute Dame fort.
»Was heißt das: Auftraggeber?« reagierte der Falschspieler postwendend. »Ich arbeite grundsätzlich allein.«
»Der Schurke erdreistet sich, mir ins Gesicht zu lügen, Mister Parker«, entrüstete sich Mylady. »Ich werde meine Vernehmungsmethoden verschärfen müssen.«
»Was bedeutet das?« fragte Bunker argwöhnisch.
»Das werden Sie gleich sehen, junger Mann«, kündigte Agatha Simpson gefährlich freundlich an und zog gelassen die martialischen Hutnadeln aus ihrer Kopfbedeckung.
Schritt für Schritt rückte sie dem Betrüger zuleibe. Schließlich fuchtelte sie mit den Spitzen derart nahe vor Bunkers lädierter Nase herum, daß ihr Gesprächspartner reflexartig ein Stück zurückwich.
»Wird’s bald, junger Mann?« drängte die passionierte Detektivin. »Meine Zeit ist kostbar.« Dabei trieb sie den unübersehbar schwitzenden Falschspieler, der ängstlich auf die Nadelspitzen starrte, Zoll für Zoll Richtung Abgrund.
»Was wollten Sie nochmals wissen?« versuchte der Mann Zeit zu gewinnen und warf einen sorgenvollen Blick über die Schulter.
»Ich will jetzt endlich wissen«, raunzte Agatha Simpson ihn an, »wer... was ... wo ...« Sie unterbrach sich und zog angestrengt die Stirn in Falten, doch gleich darauf ging ein erleichtertes Lächeln über ihr Gesicht.
»Mister Parker, Sie dürfen die Fragen stellen«, sagte Lady Agatha. »Sie wissen ja, worauf es mir ankommt.«
»Mylady begehrt zu wissen, in wessen Auftrag Sie Ihrem kriminellen Geschäft nachgehen, Mister Bunker«, übernahm Parker den Ball.
»Ich bin selbständig«, beteuerte der Ganove. »Ehrlich.«
»Darf man vermuten, daß Sie erst kürzlich von den Vereinigten Staaten nach Großbritannien übersiedelten?« fragte der Butler weiter.
»Stimmt«, nickte der Glatzköpfige. »Aber mein Ticket hab’ ich allein bezahlt. Ob Sie’s glauben oder nicht.«
»Darf Mylady möglicherweise davon ausgehen, daß Ihnen ein gewisser Bob Multon bekannt ist, Mister Bunker?« setzte der Butler den Bohrer an einer anderen Stelle an.
Bunkers Mundwinkel zuckten geringfügig. Aber es gelang ihm doch recht überzeugend, den Ahnungslosen zu spielen.
»Multon?« wiederholte er gedehnt und gab seinem breiten Gesicht einen nachdenklichen Ausdruck. »Nie gehört, den Namen. Wer soll das sein?«
»Weiterhin wäre Mylady Ihnen sehr verbunden, wenn Sie die Anschrift nennen würden, unter der Sie zur Zeit in Bournemouth Wohnung genommen haben, Mister Bunker«, blieb Parker hartnäckig am Ball.
Ray Bunker zögerte. Aber nur solange, bis Mylady herantrat und erneut die Gefährlichkeit ihrer Hutnadeln demonstrierte.
»Crown-Hotel«, stieß er hastig hervor. »Zimmer dreidreidrei.«
»Schon wieder eine Lüge, Mister Parker!« empörte sich die ältere Dame. »Ich werde diesen Schurken über die Klippen stürzen, wie er es verdient hat.«
»Wie Mylady wünschen«, erwiderte Parker mit der unbewegten Miene eines professionellen Pokerspielers. Ray Bunker schien mit dem Entschluß der Detektivin allerdings weniger einverstanden zu sein.
»Nein!« schrie er entsetzt. »Die Adresse stimmt.«
»Das wird sich zeigen, junger Mann«, entgegnete Agatha Simpson grimmig. »Natürlich werde ich Ihre Angaben sofort überprüfen. Sie kommen mit! Und gnade Ihnen Gott, wenn die Zimmernummer nicht stimmt.«
»Sie werden schon sehen, daß das die richtige Adresse ist, Madam«, beteuerte Bunker. Parker hatte den Eindruck, als huschte ein hämisches Grinsen über das breite Gesicht des Amerikaners.
»Auf zum Town-Hotel, Mister Parker!« Mylady stapfte zum hochbeinigen Monstrum.
»Crown-Hotel, Madam«, korrigierte Bunker.
»Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden, junger Mann«, wies die Detektivin ihn barsch zurecht. »Wenn Sie sich nicht endlich daran halten, werde ich ausgesprochen ungemütlich.«
*
»Dreidreidrei«, verlangte Bunker an der Rezeption des gepflegten Crown-Hotels seinen Zimmerschlüssel.
Der blonde Jüngling in der weinroten Livree stutzte zwar verhalten, als der Gast mit dem amerikanischen Akzent plötzlich einen hochherrschaftlich wirkenden Butler mitbrachte. Er sagte aber nichts, als Parker mit der schwarz behandschuhten Rechten nach dem Schlüssel griff und ihn an sich nahm.
Der Livrierte stutzte allerdings ein zweites Mal, als ihm aufging, daß die majestätisch sich gebende ältere Dame dazugehörte.
»Möglicherweise darf man vorschlagen, das Treppenhaus zu benutzen, Mylady«, bemerkte Parker, als seine Herrin den schmal wirkenden Lift ansteuerte.
»Nichts gegen Leistungssport, Mister Parker«, entgegnete Lady Agatha. »Aber alles zu seiner Zeit. Was Sie angeht, so erlaube ich Ihnen gern, zusammen mit Mister Bunker Treppen zu steigen. Aber passen Sie auf, daß Ihnen der Lümmel nicht entwischt.«
»Am notwendigen Bemühen wird meine Wenigkeit es jedenfalls nicht fehlen lassen, Mylady«, versprach der Butler, deutete eine Verbeugung an und machte sich an Bunkers Seite auf den Weg. Dabei registrierte er aufmerksam, mit welchem Geschick der Ganove die Handschellen vor den Blicken der Hotelgäste zu verbergen wußte.
Der Liftboy machte ein ausgesprochen bedenkliches Gesicht und durchlebte bange Augenblicke, als Agatha Simpson ihre beeindruckende Körperfülle in den engen Fahrkorb zwängte.
»Trinkgeld gebe ich grundsätzlich keines«, stellte sie von vornherein klar. Doch darauf schien der schmächtige Bursche gar nicht aus zu sein. Er war vermutlich froh, wenn die Fahrt in den dritten Stock ohne ernsthafte Zwischenfälle verlief.
Wider Erwarten kam der ängstliche junge Mann wohlbehalten am Ziel an, die Detektivin ebenfalls.
Am Treppenaufgang traf sie mit Parker und dem verbissen dreinschauenden Falschspieler zusammen.
»Hat der Lümmel womöglich einen Ausbruchsversuch gewagt, Mister Parker?« erkundigte sich Agatha Simpson und ließ kokett den wohlgefüllten Pompadour wippen.
»Keineswegs und mitnichten, Mylady«, teilte der Butler mit.
»Schade«, meinte die passionierte Detektivin. »Ich hätte ihm zu gern eine kleine Belehrung erteilt.«
Wenig später stand das Trio vor Zimmer 333.
Der Butler legte das Ohr an die Tür und spähte durchs Schlüsselloch, ehe er den Schlüssel ins Schloß schob und langsam drehte.
Von innen war kein Geräusch zu hören. Auch sonst deutete nichts auf die Anwesenheit eines Bewohners hin. Deshalb drückte Parker die Tür vollends auf und knipste das Licht an.
Daß das gediegene Appartement mit Bad und Balkon tatsächlich von Bunker benutzt wurde, war schon auf den ersten Blick zu erkennen. Überall lagen die verschiedensten Arten gezinkter Würfel und sonstige Falschspiel-Utensilien herum.
Das Arsenal, das der Amerikaner mit sich führte, hätte vermutlich gereicht, ein kleines Museum auszustatten – wenn es nicht später in die Asservatenkammern von Scotland Yard gewandert wäre.
»Schön und gut«, meinte Agatha Simpson unzufrieden, während der Butler auf seine Funde aufmerksam machte. »Irgendwo müssen doch auch Hinweise auf Komplicen und Auftraggeber zu finden sein. Kämmen Sie alles gründlich durch, Mister Parker. Ich halte solange den Schurken in Schach.«
»Wie Mylady zu wünschen belieben«, erwiderte Parker und schickte sich an, Schubladen und sonstige Behältnisse zu durchforsten, obwohl er kaum mit brauchbaren Hinweisen rechnete.
Immerhin hatte der Besuch im Hotelzimmer eindeutige Hinweise darauf ergeben, daß Ray Bunker den Würfelbetrug in großem Stil und mit professioneller Perfektion betrieb. Falls er wirklich einer Organisation angehörte, würden deren Mitglieder sich schon bald um ihn kümmern.
Wie schnell das erfolgen würde, ahnte der Butler in diesem Moment selbst noch nicht.
Es begann damit, daß Lady Agatha Bunkers recht ordentlich bestückten Kühlschrank entdeckte und kurzfristig die selbstgewählte Aufgabe vergaß, den Ganoven im Blick zu behalten.
Der Glatzköpfige nutzte die Gelegenheit zu einem kräftigen Fußtritt, mit dem er einen Eichenstuhl auf rasante Fahrt über das Parkett schickte.
Er hatte gut gezielt. Der in den Eisschrank gebeugten Lady wäre eine ausgesprochen unerfreuliche Erfahrung beschieden gewesen, hätte Parker nicht in letzter Sekunde den Bambusgriff seines altväterlich gebundenen Regendachs dazu benutzt, das reiselustige Möbel aus der Bahn zu bringen. Er konnte freilich nicht mehr verhindern, daß der Stuhl mit Getöse gegen die Wand zum Nachbarzimmer krachte und ein repräsentatives Ölgemälde zum Absturz brachte.
»Unverschämtheit!« Mylady grollte und setzte umgehend ihren perlenbestickten Pompadour zur Strafaktion in Marsch.
Ray Bunker jaulte wie ein getretener Hund, als der sogenannte Glücksbringer ihn an der Schulter erwischte und dem Schlüsselbein ein vernehmliches Knirschen entlockte.
Um sein Fehlverhalten wieder gutzumachen und die resolute Dame heiter zu stimmen, versuchte der Glatzköpfige durch eine tänzerische Einlage Freude zu bereiten. Die Mischung aus klassischer Pirouette und Kosakentanz fand jedoch wenig Beifall und erwies sich als ungemein anstrengend.
Dem Tänzer rann schon nach Sekunden der Schweiß in Strömen von der Stirn. Erste Anzeichen von Erschöpfung machten sich als Taumeln bemerkbar, das sich rasch verstärkte und in zielloses Torkeln mündete.
Mit schlenkernden Armbewegungen fegte Ray Bunker zwei Tischlampen und drei Porzellanvasen von ihrem gewohnten Standort, ehe er entnervt dem Butler in die Arme sank.
Sein ehrgeiziges künstlerisches Bemühen war zwar gescheitert, dafür war aber der Lärm, den der Ganove mit dem Tritt gegen den Stuhl produziert hatte, gehört und als Hilferuf verstanden worden.
*
Parker hatte den seiner Standfestigkeit beraubten Würfelartisten in einen Ledersessel gleiten lassen, als ein Geräusch ihn aufhorchen ließ. Gelassen wandte der Butler sich um und ... blickte in die Mündungen zweier Revolver, die sich durch den Türspalt schoben.
Dahinter tauchten zwei grobschlächtige Gesichter auf. Mißtrauische Blicke glitten von links nach rechts. Erst dann wurde die Tür auf geschoben, und die Unbekannten traten ein.
Hinter Parkers glatter Stirn arbeitete es fieberhaft, aber im Moment gab es nicht die geringste Chance, den Eindringlingen mit den superschallgedämpften Bleispritzen das Gesetz des Handelns zu entreißen. Das spürte sogar Lady Agatha, die sonst im Angesicht entsicherter Schußwaffen eine beneidenswerte Unbefangenheit entwickelte.
Bei den Breitschultrigen in den grauen Flanellanzügen schien es sich um ausgekochte Profis zu handeln. Ihre Wachsamkeit ließ keinen Augenblick nach. Die eiskalte Entschlossenheit, die sich in den Mienen der Killer spiegelte, ließ äußerste Vorsicht ratsam erscheinen, zumal ein dritter Mann das Zimmer betrat. Er war eleganter gekleidet und schlanker als die stämmigen Bodyguards.
Das gebräunte Gesicht unter dem akkurat gescheitelten, schwarzen Haar und die stahlblauen Augen hatte der Butler erst vor wenigen Stunden gesehen.
Es handelte sich um den überaus erfolgreichen Roulettspieler, der kurz nach Myladys Eintreffen im Spielkasino nicht unbeträchtliche Gewinne weggetragen hatte.
»Höchste Zeit, daß ihr kommt, Jungs«, stöhnte Bunker und verzog das Gesicht zu schmerzlichem Grinsen. »Diese Verrückten hätten mich total fertiggemacht.«
»Was ist denn passiert, Ray?« wollte der Schwarzhaarige wissen. »Und wer hat dir diese geschmacklosen Armketten verpaßt?«
»Der Lümmel besaß die Dreistigkeit ...« fuhr Agatha Simpson mit ihrer baritonal gefärbten Stimme dazwischen, doch der elegante Roulettspezialist ließ sie nicht zu Wort kommen.
»Halt’s Maul, alte Vogelscheuche!« raunzte er. »Du redest nur, wenn du gefragt wirst.«
»Solche Unverschämtheiten muß eine Dame sich nicht bieten lassen!« entrüstete sich Mylady. Der Anblick der entsicherten Revolver dämpfte ihre Wut jedoch wenigstens soweit, daß sie auf einen spontanen Einsatz ihres Glücksbringers verzichtete.
»Nicht mal im Traum würde es meiner Wenigkeit einfallen, Myladys Feststellung zu widersprechen«, pflichtete der Butler seiner Herrin bei und deutete eine Verbeugung an. »Allerdings dürften die Herren momentan über die Argumente mit der größeren Durchschlagskraft verfügen, falls der Hinweis erlaubt ist.«
»Wer zuletzt lacht, lacht am besten«, resignierte die Detektivin und bedachte ihr Gegenüber mit Blicken, die töten sollten, ihre Wirkung aber verfehlten.
»Euch wird das Lachen sowieso bald für alle Zeiten vergehen«, erwiderte der elegante Gangster und setzte ein hämisches Grinsen auf. Anschließend wandte er sich Ray Bunker zu, während die Bodyguards mit schallgedämpften Revolvern weiterhin das Paar aus Shepherd’s Market in Schach hielten.
Begleitet von Agatha Simpsons Unmutsäußerungen erstattete der Würfelspieler seinem Komplicen einen knappen Bericht, ohne allzu kraß von der Wahrheit abzuweichen.
»Dann hat der Opa im Gehrock also den Schlüssel zu den Handschellen?« vergewisserte sich der Roulettprofi, und Bunker nickte.
»Wird’s bald, Opa?« knurrte der Schwarzhaarige, als Parker keine Anstalten machte, den Schlüssel freiwillig abzuliefern.
»Wenn wir jetzt nicht standhaft bleiben, können wir uns einen neuen Beruf suchen, Mister Parker«, gab Lady Agatha zu bedenken.
»Eine Entwicklung, die es mit Verlaub zu verhindern gilt«, antwortete der Butler. »Deshalb wird man sich eingehend befleißigen, streng nach Myladys Weisung zu handeln.«
»Eigentlich könnten wir euch ja gleich umnieten. Dann hätten wir den Schlüssel sowieso«, schaltete Ray Bunker sich ein.
»Du weißt doch, daß ich den Gestank von Pulverdampf nicht ausstehen kann«, entgegnete der Elegante und rümpfte angewidert die Nase. »Aber keine Sorge. Die alte Schachtel wird ihren Butler gleich anflehen, daß er den Schlüssel rausrückt.«
Kichernd griff der Roulettspieler unters Jackett und zog ein Rasiermesser heraus, das er entnervend langsam aufklappte. Prüfend ließ er den Daumen über die Schneide gleiten und grinste in einer Weise, die das Prädikat »teuflisch« verdiente.
»Was haltet ihr davon, wenn wir der alten Fregatte eine kosmetische Operation verpassen, Jungs?« erkundigte er sich und nahm den spontanen Beifall mit selbstgefälligem Nicken zur Kenntnis.
»Das werden Sie nicht wagen, junger Mann«, grollte die resolute Dame. Ihre eindrucksvolle Gestalt vibrierte förmlich vor unterdrückter Wut.
»Warum nicht?« gab der Schwarzhaarige lässig zurück. »So eine Operation kann schon mal mißlingen. Aber an Ihrem Gesicht kann nicht mal ein Anfänger was verderben.«
Langsam schritt der Roulettspezialist mit gezücktem Rasiermesser auf Agatha Simpson zu, die wie versteinert mit dem Rücken zur Wand stand und Laute produzierte, die an das bedrohliche Rollen eines Erdbebens erinnerten.
Parker hielt mit allen Sinnen nach einer Möglichkeit Ausschau, um in das Geschehen eingreifen zu können, doch die Gangster präsentierten sich als eingespieltes Team und gaben sich nicht die geringste Blöße.
»Könnte es zutreffen, daß Mylady meiner Wenigkeit gewisse Weisungen erteilen möchte?« erkundigte sich der Butler.
»Ich wüßte gern, welche«, gab die passionierte Detektivin zurück.
»Mylady könnten aus rein taktischen Erwägungen den Herren einstweilen den gewünschten Schlüssel überlassen«, erwiderte Parker.
»Das wollte ich in der Tat gerade anordnen«, nickte Agatha Simpson umgehend. »Man muß eben flexibel sein. Um so vernichtender werde ich zuschlagen, wenn meine Stunde gekommen ist.«
»Myladys taktische Flexibilität sucht ihresgleichen«, ließ der Butler sich vernehmen und griff mit der schwarz behandschuhten Rechten in die Außentasche seines Covercoats.
Unter den argwöhnischen Blicken der Bewaffneten förderte er den kleinen Schlüssel zutage und warf ihn dem Roulettspieler zu, der ihn sicher auffing.
Sekunden später verfügte Ray Bunker wieder über seine gewohnte Bewegungsfreiheit.
»Das Bad hat kein Fenster«, meinte der Würfelartist und massierte hingebungsvoll die Handgelenke. »Da können wir die beiden fürs erste einlochen.«
»Okay«, stimmte der Schwarzhaarige zu und gab seinen Begleitern ein entsprechendes Zeichen.
Josuah Parker und Agatha Simpson hatten keine andere Wahl. Schritt für Schritt mußten sie sich in das verschwenderisch mit Marmor ausgestattete Badezimmer zurückziehen. Gleich darauf fiel mit dumpfem Knall die Tür ins Schloß. Knirschend drehte sich der Schlüssel.
*
»Sie werden doch hoffentlich keine Schwierigkeiten haben, diese Tür zu öffnen, Mister Parker?« erkundigte sich die Detektivin ungeduldig. »Taktische Flexibilität – schön und gut. Aber alles hat seine Grenzen.«
»Was man keinesfalls bezweifeln möchte«, erwiderte der Butler mit gedämpfter Stimme. »Dennoch dürften Mylady es vorziehen, einstweilen von einer Befreiungsaktion abzusehen.«
»Aber nur aus taktischen Gründen, Mister Parker.«
»Mylady treffen – wie es im Volksmund heißt – den Nagel auf den Kopf.«
»Und welche Gründe meine ich konkret?«
»Mylady dürften den unfreiwilligen Aufenthalt in Mister Bunkers Badezimmer dazu nutzen, weiterführende Informationen zu sammeln, falls man nicht sehr irrt.«
»Natürlich, Mister Parker. Informationen sind das ABC jeder Ermittlung.«
»Man bittet um Nachsicht, Mylady. Darf man möglicherweise vermuten, daß Mylady Informationen als das A und O jeder Ermittlung zu bezeichnen beabsichtigten?«
»Wie auch immer«, reagierte Lady Agatha unwirsch. »Kleinliche Unterscheidungen interessieren mich nicht. Wichtig ist nur, wie ich an die entsprechenden Informationen herankomme.«
»Mylady dürften sich mit der Absicht tragen, die Unterhaltung zwischen Mister Bunker und seinen Komplicen zu belauschen, falls diese Vermutung erlaubt ist.«
»Dann hören Sie endlich zu, was die Schurken zu besprechen haben, Mister Parker.«
»Das tut meine bescheidene Wenigkeit bereits seit geraumer Zeit, Mylady«, antwortete der Butler mit angedeuteter Verbeugung.
Die Stimmen des Würfelbetrügers und des Roulettspielers waren in der Tat durch die dünne Badezimmertür deutlich zu verstehen, zumal in das Türblatt Lüftungsschlitze eingelassen waren.
»Am besten brechen wir unsere Europatournee sofort ab«, meinte der Roulettspezialist in diesem Moment. »Es gibt ja kaum noch ein Kasino, das wir nicht geschröpft haben.«
»Stimmt, Hank«, pflichtete Bunker ihm bei. »Bob und ich, wir können uns hier in Brighton sowieso nicht mehr am Spieltisch sehen lassen. Aber warum machst du nicht weiter? Es lief doch so gut.«
»Mir ist die Sache zu heiß geworden«, bekannte Hank. »Ich werde noch heute nacht mit Fulham und Fender den Magneten aus dem Roulettkessel ausbauen.«
»Du hast doch nicht etwa Bammel wegen der komischen Figuren, Hank?« wollte Bunker wissen.
»Ich hab’ das Gefühl, die machen bloß auf blöd und haben’s faustdick hinter den Ohren«, erwiderte der Roulettbetrüger.
»Quatsch«, fuhr ihm der Würfelartist ins Wort. »Profis sind das mit Sicherheit nicht. Die beiden hatten unverschämtes Glück. Sonst hätte ich sie fertiggemacht.«
»Glück?« war Hanks zweifelnde Stimme zu hören.
»Naja ... und ein paar unkonventionelle Tricks«, räumte Bunker mürrisch ein. »Wer rechnet schon damit, daß...«
»Ich geh’ jedenfalls kein Risiko ein, Ray«, unterbrach ihn sein Komplice. »Heute nacht wird abgebaut, und dann gönnen wir uns noch ein paar Tage Urlaub, bis Bertone zum Kassieren kommt.«
»Hätte ich fast vergessen«, bekannte der Würfler. »Wann wollte Arturo hier sein?«
»Übermorgen«, gab Hank Auskunft.
»Dann lohnt es sich nicht mehr«, lenkte Bunker ein. »Aber was machen wir mit dieser ausgeflippten Lady und ihrem stocksteifen Butler, Hank? Wir können die Gestalten doch nicht hier behalten, bis Bertone kommt.«
»Der würde sich auch bedanken«, wußte Hank. »Der kommt doch nur zum Abkassieren und will von Problemen nichts hören.«
»Es wäre ja nicht das erste Mal, daß wir so was in eigener Regie bereinigt haben«, meinte der Würfelbetrüger. »Am besten karren wir die zwei noch heute nacht in einen Wald und pusten sie mit Blei voll.«
»Das wird das beste sein«, stimmte der Roulettspieler ihm zu. »Aber warum sollen ausgerechnet wir das erledigen? Wir haben sie schon festgesetzt. Den Rest könnte eigentlich Bob mit seinen Leuten besorgen.«
»Gute Idee, Hank«, meinte Bunker. »Seit Bob im Kasino aufgefallen ist und das Hotel gewechselt hat, hält er sich aus allem raus.«
»Ich hab’ die Nummer im Kopf«, sagte Hank. »Ich ruf den alten Knaben gleich mal an, damit er uns nicht ganz vergißt.«
Josuah Parker wußte genug. Bob Multon, Ray Bunker und Hank Temple hatten gemeinsam eine ganze Reihe europäischer Spielkasinos heimgesucht, und Temple hatte das Roulettspiel mit einem Elektromagneten manipuliert, wobei die Croupiers Terence Fender und Lee Fulham offenbar als Helfershelfer fungierten. Das erklärte auch, warum Bob Multon nach seiner Festnahme entkommen konnte.
Schließlich hatte der Butler erfahren, daß zwei Tage später ein Mann namens Arturo Bertone eintreffen würde, um Kasse zu machen. Daß der vermutliche Italiener aus den Staaten einfliegen würde und der dortigen Mafia-Organisation angehörte, schien naheliegend.
Zielsicher fischte Parker ein Plastikröhrchen aus der linken Außentasche seines schwarzen Covercoats. Was auf den ersten Blick wie ein Kunststofftrinkhalm aussah, war in Wirklichkeit eine miniaturisierte Blitzlichtbombe, die der Butler in freien Stunden in seiner Bastelwerkstatt im heimischen Shepherd’s Market entwickelt hatte.