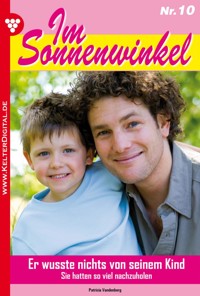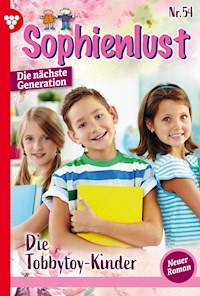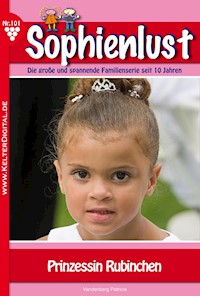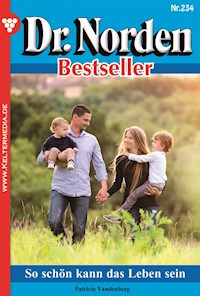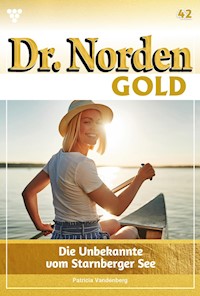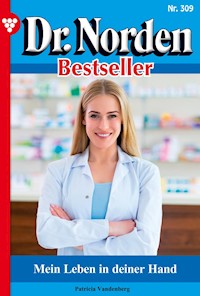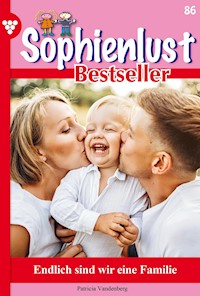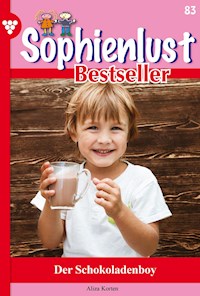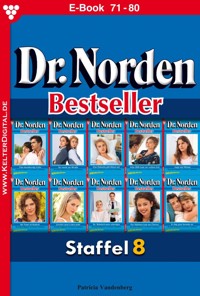
30,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Dr. Norden Bestseller Staffel
- Sprache: Deutsch
Für Dr. Norden ist kein Mensch nur ein 'Fall', er sieht immer den ganzen Menschen in seinem Patienten. Er gibt nicht auf, wenn er auf schwierige Fälle stößt, bei denen kein sichtbarer Erfolg der Heilung zu erkennen ist. Immer an seiner Seite ist seine Frau Fee, selbst eine großartige Ärztin, die ihn mit feinem, häufig detektivischem Spürsinn unterstützt. Dr. Norden ist die erfolgreichste Arztromanserie Deutschlands, und das schon seit Jahrzehnten. Mehr als 1.000 Romane wurden bereits geschrieben. Die Serie von Patricia Vandenberg befindet sich inzwischen in der zweiten Autoren- und auch Arztgeneration. E-Book 71: Eine barmherzige Lüge E-Book 72: Sie wurde zur Rivalin E-Book 73: Eine Patientin gibt Rätsel auf E-Book 74: Seine Hilfe kam zur rechten Zeit E-Book 75: Angst um Miriam E-Book 76: Ihr Name ist Katrin E-Book 77: Zerstört mein Leben nicht E-Book 78: Dr. Behnisch muß schweigen E-Book 79: Ein Mädchen kam aus Übersee E-Book 80: Es fing ganz harmlos an E-Book 1: Eine barmherzige Lüge E-Book 2: Sie wurde zur Rivalin E-Book 3: Eine Patientin gibt Rätsel auf E-Book 4: Seine Hilfe kam zur rechten Zeit E-Book 5: Angst um Miriam E-Book 6: Ihr Name ist Katrin E-Book 7: Zerstört mein Leben nicht E-Book 8: Dr. Behnisch muß schweigen E-Book 9: Ein Mädchen kam aus Übersee E-Book 10: Es fing ganz harmlos an
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1467
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Eine barmherzige Lüge
Sie wurde zur Rivalin
Eine Patientin gibt Rätsel auf
Seine Hilfe kam zur rechten Zeit
Angst um Miriam
Ihr Name ist Katrin
Zerstört mein Leben nicht
Dr. Behnisch muß schweigen
Ein Mädchen kam aus Übersee
Es fing ganz harmlos an
Dr. Norden Bestseller – Staffel 8 –E-Book: 71-80
Patricia Vandenberg
Eine barmherzige Lüge
Roman von Patricia Vandenberg
»Wird es auch nicht zu spät, Daniel?« fragte Fee Norden, als ihr Mann bald nach dem Essen aufbrach. »Vergiß nicht, daß wir Karten für Davids Konzert haben.«
»Ich vergesse es nicht, mein Schatz, und ich lasse es mir auch nicht entgehen. Ich muß nur zwei Besuche machen, und dann habe ich noch eine Verabredung mit Professor Weissenberger.«
»Warum?« fragte Fee erstaunt.
»Ich bin mir einer Diagnose nicht sicher.«
Fee runzelte leicht die Stirn. »Du bist sicher«, sagte sie nachdenklich. »Du willst sie dir nur bestätigen lassen.«
»Okay, ich will mir meine Diagnose bestätigen lassen, Feelein. Aber schließlich kann ich mich doch auch mal täuschen.«
Er wünschte das, und Fee Norden ahnte es. Doch sie wußte auch, daß sich ihr Mann nur ganz selten täuschte. Den Verlauf einer schweren Krankheit konnte er nicht vorausberechnen. Wer konnte das schon, aber an seinen Diagnosen hatte es noch nie einen Zweifel gegeben.
Er hatte einfach das Gespür, wenn die Symptome auch unklar waren. Sie ahnte jetzt auch, um welche Krankheit es sich handelte, denn Professor Weissenberger war bekannt dafür, daß er sich sehr intensiv mit der Erforschung der Blutkrankheiten befaßte, seit seine Frau und sein einziges Kind an perniziöser Anämie gestorben waren, ohne daß er ihnen hätte helfen können.
Noch geringer waren allerdings die Chancen, wenn es sich um Leukämie handelte, und da Daniel gar nichts gesagt hatte, nahm Fee an, daß ihn ein solcher Fall beschäftigte.
Wenn er sich machtlos fühlte, mußte er es erst selbst verkraften. Fee Norden kannte ihren Mann.
Dr. Daniel Norden hatte schon verschiedentlich mit Professor Walter Weissenberger zusammengearbeitet, und er hatte große Achtung vor diesem Mann, der so leidenschaftlich bemüht war, ein Heilmittel zu finden, das diese schlimmen Krankheiten zum Stillstand bringen konnte.
Von manchen Kollegen, die kein Verständnis für diese Bemühungen hatten, wurde Professor Walter Weissenberger sarkastisch ›Professor Wehweh‹ genannt, abgeleitet von seinen Anfangsbuchstaben, doch ironisch verlängert. Er machte sich nichts daraus. Er führte ein ganz zurückgezogenes Leben und pflegte seit dem Tode seiner Frau keine persönlichen Kontakte mehr.
Um so mehr wunderte sich Dr. Norden an diesem Tag, als der Professor ihm seine junge, sehr aparte Mitarbeiterin Stefanie Linden durchaus nicht formell, sondern mit herzlichem Ton vorstellte. Seit acht Wochen war sie als Medizinalassistentin seine sehr geschätzte Mitarbeiterin, wie er betonte.
Professor Weissenberger schien etwas betroffen, als Daniel erklärte, daß er ihn gern unter vier Augen gesprochen hätte. Stefanie zog sich daraufhin sofort taktvoll zurück.
»Ich habe keine Geheimnisse vor ihr«, sagte der Professor. »Ich kann sie gar nicht haben, denn sie nimmt an jeder Arbeit, an jeder Untersuchung teil. Oder handelt es sich um eine ganz private Angelegenheit?«
»Das nicht, aber um einen Patienten, der sich nicht im geringsten darüber klar ist, in welcher Gefahr er schwebt. Es ist ein junger Mann, und man könnte nicht ausschließen, daß dieser Name bekannt ist. Da ich Sie aber bitten möchte, ihn zu untersuchen, werden Sie ihn kennenlernen, falls Sie meine Bitte nicht zurückweisen.«
Der Professor runzelte die Stirn. »Mein lieber Norden, wie ich Sie kenne, haben Sie die Diagnose doch schon gestellt.«
»Und diesmal hoffe ich sehr, daß sie sich als falsch erweist.«
»Aber wenn sie sich nicht als falsch erweist, haben Sie auch keine Hoffnung, daß ich möglicherweise helfen könnte«, stellte der Professor sachlich fest.
»So ist es.«
»Also lautet die Diagnose Leukämie«, sagte Professor Weissenberger mit schwerer Stimme. »Wieder einmal.«
Daniel nickte zustimmend. Der Professor wandte sich ab und blickte zum Fenster hinaus.
»Kann ich die Anamnese nachlesen?« fragte er rauh.
»Selbstverständlich.«
*
Stefanie Linden saß im Nebenzimmer. Sie konnte jedes Wort verstehen, denn das Diktiergerät war eingeschaltet und Professor Weissenberger hatte nicht daran gedacht, es abzuschalten.
Stefanie wollte nicht lauschen und hatte schon den Finger auf dem Knopf, um es von sich aus auszuschalten, aber da fiel der Name Peter Reinhold, und sie hielt elektrisiert den Atem an.
»Peter Reinhold, achtundzwanzig«, sagte Professor Weissenberger. »Ledig?«
»Ja«, erwiderte Dr. Norden, »glücklicherweise. Er ist seit einem Jahr mein Patient. War ein sehr sportlicher junger Mann, der es nicht begreifen konnte, daß er so schnell ermüdete. Er und sein Bruder Ralph sind die Reinhold-Erben.«
Hatte Stefanie noch gehofft, daß es sich um eine Namensgleichheit handeln könne, wußte sie nun, daß dies nicht der Fall war.
Was die Anamnese besagte, über die Professor Weissenberger und Dr. Norden nun sprachen, konnte sie genau deuten.
Sie hatte großes Interesse an den Forschungsarbeiten ihres Chefs und sich schon bestens in diese Materie hineingearbeitet. Es handelte sich um eine lymphatische Leukämie.
»Nach Ihren Untersuchungsergebnissen spricht leider alles dafür«, bestätigte der Professor. »Nun, ich kann ihn ja noch mal untersuchen, aber nach dem rapiden Anstieg der weißen Blutkörper sehe ich kaum noch eine Chance.«
Stefanie schaltete nun doch das Diktiergerät ab. Ihre Hände zitterten, alles Blut war aus ihrem Gesicht gewichen.
Sie kannte die Brüder Reinhold seit einem Jahr. Sie hatten sich beim Skifahren in Südtirol angefreundet, als sie feststellten, daß sie in München zu Hause waren. Es war eine etwas differenzierte Freundschaft geworden, da beide Brüder sich um sie bemühten, aber Stefanie hatte es sehr diplomatisch verstanden, keine einschneidenden Konflikte aufkommen zu lassen, die eine Trennung herbeigeführt hätten, obgleich sie persönlich dem älteren Ralph den Vorzug gegeben hätte. Aber sie war im Grunde ein nüchtern denkendes Mädchen. Die Reinhold-Brüder waren reiche Erben, sie war ein Mädchen, das sich von früher Jugend an auf eigene Füße hatte stellen müssen. Sie war ehrgeizig, sie wollte sich auch nicht abhängig machen von einem Mann. Das wohl hatte ihr auch den Respekt von Professor Weissenberger eingebracht, mit dem sie nie über ihr Privatleben sprach. Sie war überaus zuverlässig und bestrebt, sich eine Position zu schaffen, die ihren Ansprüchen Rechnung trug, und diese Ansprüche waren nicht gring. Nur wollte Stefanie aus eigener Kraft das Ziel erreichen, das sie sich gesetzt hatte.
Die Freundschaft mit den Brüdern Reinhold bedeutete ihr viel, weil sie auch von ihnen respektiert wurde. Sie hatte Grenzen gesteckt, und die waren akzeptiert und noch von keinem überschritten worden.
Für Stefanie war es eine angenehme Abwechslung, wenn sie einen oder auch mal zwei Abende in der Woche mit den Brüdern verbringen konnte. Was sie sonst taten, interessierte sie nicht, zumindest zeigte sie kein Interesse daran. Sie wiegte sich nicht in dem Glauben, daß sie die einzige Frau war, für die sie Interesse zeigten. Sie ahnte auch nichts von den internen Kämpfen, die die beiden doch untereinander ausfochten, wenn auch in einer sehr dezenten Art, wenn es um sie ging.
So auch jetzt, während sie sich Sorgen um Peter machte. Ralph hatte die nicht leiseste Ahnung, daß Peter krank war. Er hielt ihn einfach für desinteressiert an der Firma, wenn er Müdigkeit zeigte oder über Kopfschmerzen klagte, denn über andere Beschwerden klagte Peter nicht, da er diese von sich weisen, nicht wahrhaben wollte. Er lehnte sich mit aller verbleibenden Energie dagegen auf, tatsächlich krank zu sein. Er zweifelte an Dr. Nordens Können, obgleich er immer Vertrauen zu ihm gehabt hatte.
An diesem Abend waren sie wieder mit Stefanie verabredet, und er wollte ihr gegenüber schon gar keine Schwäche zeigen. Aber erstmals hatte Ralph eine solche wahrgenommen, ohne etwas anderes dahinter zu suchen.
»Du solltest tatsächlich mal gründlich untersucht werden«, sagte er. »Vielleicht hast du Magengeschwüre. Darunter hat Vater auch gelitten. Geh nach Hause, leg dich hin und rufe Dr. Norden an.«
»Das könnte dir so passen«, sagte Peter. »Du willst ja nur allein mit Stefanie ausgehen. Meinst du, ich merke es nicht, daß du mich ausbooten willst?«
»Dazu hat Stefanie ja auch noch etwas zu sagen. Sie bevorzugt keinen von uns, Peter.«
Er war immer der ruhigere, der vernünftigere gewesen, auch der klügere der Brüder. Er war der leitende Kopf der Firma, obgleich man Peter nicht nachsagen konnte, daß er sich nicht bemüht hätte, mit ihm Schritt zu halten. Aber es war ihm schon in der Schule nicht gelungen und im praktischen Leben erst recht nicht. Sein Studium hatte er schon nach vier Semestern aufgesteckt, während Ralph Jura und Betriebswirtschaft studiert hatte.
Er betrachtete seinen Bruder nachdenklich.
»Fahr nach Hause und leg dich wenigstens hin«, sagte er. »Ich werde Stefanie anrufen und ihr vorschlagen, daß wir den Abend bei uns verbringen.«
Peter hob müde den Kopf. »Ja, das wäre doch eigentlich mal nett. Vielen Dank für dein Verständnis, Ralph.«
»Du fährst nicht allein«, bestimmte der Bruder. »Ich sage Henry Bescheid. Er bringt dich nach Hause, und wenn du dich immer noch so schlecht fühlst, rufst du Dr. Norden an.«
Da er nicht wußte, daß Peter in letzter Zeit Dr. Norden immer häufiger in der Praxis aufsuchte, wunderte es ihn, als Peter sagte: »Der weiß auch nicht mehr als andere Ärzte.«
»Er ist einer der besten Ärzte, die ich kenne«, sagte Ralph. »Hast du vergessen, wie genau er Papas Krankheit geholfen hat?«
»Schon gut, schon gut, ich bin aber nicht krank. Mich macht der Föhn müde.«
»Wir haben schon seit Wochen keinen mehr gehabt«, sagte Ralph. »Aber vielleicht ist es der dauernde Regen, der dich trübsinnig stimmt, da wir eigentlich Schnee haben sollten. In vierzehn Tagen starten wir nach Vevier.«
»Ohne Stefanie«, sagte Peter leise. »Sie kriegt doch jetzt nicht gleich Urlaub, da sie erst ein paar Wochen bei diesem Professor ist.«
»Es wird auch andere nette weibliche Unterhaltung geben«, sagte Ralph, um ihn von Stefanie abzulenken.
»Für mich nicht. Wir sollten uns einigen, Ralph. Ich möchte Stefanie heiraten. Vielleicht macht es mich krank, weil ich Angst habe, daß du sie mir wegschnappen könntest.«
»Die Entscheidung muß man schon ihr überlassen«, sagte Ralph. »Sei nicht kindisch, Peter. Vielleicht entscheidet sie sich für einen ganz anderen Mann.«
Er sagte es gegen seine innere Einstellung. Er konnte sich nicht vorstellen, Stefanie zu verlieren. Er gönnte sie keinem anderen Mann, auch nicht Peter. Der war früher immer viel leichtlebiger und flirtfreudiger gewesen als er. Er hatte gehofft, daß ihm eines Tages ein lebenslustigeres Mädchen über den Weg laufen würde, als es Stefanie war.
Nun wurde ihm ganz eigenartig, da Peter vom Heiraten sprach.
Er hatte sich immer für Peter verantwortlich gefühlt. Diese Verantwortung war ihm von seinem Vater aufgebürdet worden, der wohl erkannt hatte, daß Peter nicht zusammenhalten konnte, was er geschaffen hatte.
Ihre Mutter hatte an Peter mehr gehangen als an ihm. Sie war ein Jahr nach dem Vater gestorben, da sie den Halt ihres Lebens verloren hatte. Sie war immer eine schwache, zarte Frau gewesen, die ständig kränkelte, schon seit Peters Geburt, und jeden, der sie kannte, hatte es erstaunt, daß sie überhaupt noch so lange gelebt hatte.
Peter war keineswegs ein zartes Kind gewesen. Er war ein richtiger kleiner Brocken, viel lebhafter als Ralph, im Sport, welcher Art auch immer, bedeutend besser als dieser. Er hatte einen ungeheuren Ehrgeiz, immer zu siegen. Aber als der Vater starb und die Mutter nur noch dahinsiechte, änderte sich das schlagartig.
Beim Tennisspielen ermüdetete Peter rasch, beim Skifahren riskierte er nichts mehr. Rallyes fuhr er überhaupt nicht mehr, und das Schwimmen, in dem er mehrere Meisterschaften errungen hatte, genoß er nur noch vergnüglich. Erst seit sie Stefanie kennengelernt hatten, wollte er wieder fit sein, aber das blieb ein vergebliches Bemühen, und Ralph glaubte, daß es ihn kränkte, sich nicht wenigstens auf sportlichem Gebiet produzieren zu können.
Ja, Ralph dachte über seinen Bruder nach, als der Chauffeur Henry, ein netter junger Franzose, ihn heimgefahren hatte. Ihm war heute auch erstmals so richtig aufgefallen, daß Peter überschlank geworden war.
Er selbst war von kräftiger Statur, sehr groß, breitschultrig, vielleicht sogar ein bißchen zu gewichtig für sein Alter.
Er hatte ein breites, flächiges Gesicht, rostbraunes Haar, hellgraue Augen, einen breiten, aber schmallippigen Mund, eine gerade, ziemlich lange Nase und ein
energisches Kinn.
Peter hatte dunkles Haar, braune Augen, eine romantische Nase, einen hübschen, weichen Mund. Er glich seiner Mutter, Ralph seinem Vater. Die ungleichen Brüder wurden sie auch in ihrem Bekanntenkreis genannt. Peter war sehr beliebt, Ralph bezeugte man Respekt. Aber wehe, wenn jemand etwas gegen Ralph sagte, dann konnte Peter fuchsteufelswild werden, und Ralph hätte es niemals geduldet, daß man Peter einen Schwächling oder gar Nichtstuer nannte.
Der einzige Mensch, der jemals zwischen ihnen stand, war Stefanie, doch keiner sagte es dem andern, wenn solche Gedanken in ihnen aufkamen.
Ralph konnte sich an diesem Nachmittag überhaupt nicht auf seine Arbeit konzentrieren. Den Kopf in die Hände gestützt, saß er an seinem Schreibtisch und rang mir sich.
Peter ist schwächer als ich, dachte er. Er würde es nicht verkraften, wenn Stefanie mir den Vorzug geben würde. Aber kann ich es verkraften? Kann ich zuschauen? Er befand sich wirklich im größten Zwiespalt seines Lebens.
So erging es auch Stefanie. Und als Dr. Norden gegangen war, saß auch sie da und starrte vor sich hin.
Professor Weissenberger kam zu ihr ins Zimmer. »Na, was ist denn, Stefanie?« fragte er verwundert.
Sie schrak zusammen, stand auf und blickte in seine gütigen Augen.
Sie schluckte dreimal, dann sagte sie: »Es tut mir leid, Herr Professor, das Diktiergerät war nicht abgestellt. Ich habe manches gehört«, sagte sie leise.
»Das macht doch nichts. Ich hätte doch mit Ihnen gesprochen. Dr. Norden wollte wirklich nur Diskretion wahren.«
»Ich kenne Peter Reinhold«, sagte sie gepreßt.
Seine schweren Lider senkten sich. »Dann war es ein Schock für Sie, Stefanie.«
»Ja, es war ein schwerer Schock«, sagte sie leise.
»Sie dürfen nichts verlauten lassen, daß Sie es wissen. Dr. Norden ist äußerst korrekt. Ein vorzüglicher Arzt, wie es nur wenige gibt.«
»Ich werde schweigen«, flüsterte sie. »Das ist selbstverständlich. Aber ich würde gern alles erfahren über seinen Zustand. Ich schwöre Ihnen, daß ich kein Wort sagen werde.«
»Ich werde diesen jungen Mann untersuchen, Stefanie. Weiß er, daß Sie bei mir beschäftigt sind?«
Sie nickte zustimmend. »Ich bin mit den Brüdern Reinhold seit einem Jahr befreundet.«
»Es ist gut, daß ich das weiß. Wir wollen diesen jungen Mann nicht verwirren. Wie ist sein Bruder?«
»Groß, stark, mächtig, klug.«
»Und hat er Gefühl?«
»Ja, aber er zeigt es nicht. Er hat früh eine große Verantwortung übernehmen müssen.«
»Würden Sie mir erzählen, wie Sie diese Brüder kennengelernt haben?«
»Ja, gern. Ich werde Ihnen alles sagen. Ich möchte so sehr hoffen, daß Peter geholfen werden kann.«
»Haben Sie heute abend Zeit?«
Bevor Stefanie antworten konnte, läutete das Telefon. Sie nahm den Hörer auf.
»Entschuldige, Stefanie, daß ich dich anrufe«, tönte Ralphs Stimme an ihr Ohr, »aber ich wollte dich fragen, ob es dir recht wäre, wenn wir den Abend bei uns verbringen. Peter scheint es nicht gutzugehen.«
»Okay, ich komme«, erwiderte sie etwas zu hastig. »Bis dann, Ralph.«
Sie legte langsam den Hörer auf und blickte Professor Weissenberger an.
»Das war Ralph Reinhold. Er hat mich noch nie hier angerufen. Wir waren für heute abend verabredet. Peter geht es nicht gut, hat er gesagt, aber ich bin überzeugt, daß er nicht die geringste Ahnung hat, was ihm fehlt. Was kann ich denn nur für Peter tun, Herr Professor?« fragte sie bedrückt.
»Seien Sie nett zu ihm, Stefanie, so nett, wie es Ihnen möglich ist. Mehr kann ich nicht sagen.«
»Darf ich mich auch mit der Anamnese befassen?« fragte sie.
»Erst erzählen Sie mir von Ihren beiden Freunden, wenn das nicht zu indiskret ist.«
»Indiskret überhaupt nicht. Eigentlich war ich ganz froh, daß es zwei waren, weil ich mich nicht entscheiden und schon gar nicht binden wollte. Es sind zwei sehr ungleiche Brüder. Es war sehr interessant für mich, denn man kann da seine Studien machen. Ich gehöre nicht zu den Frauen, die sich Hals über Kopf verlieben und blindlings in ihr Unglück tappen.«
»Es könnte auch das Glück sein«, sagte Professor Weissenberger.
»Vielleicht bin ich dazu nicht geschaffen. Meine Kindheit war nicht gerade sonnig. Meine Eltern ließen sich scheiden. Ich pendelte zwischen Vater und Mutter hin und her, und bei keinem fühlte ich mich wohl. Mein Vater beklagte sich über meine Mutter, meine Mutter über meinen Vater. Wer nun eigentlich recht hatte, wußte ich nie. Wahrscheinlich wollten sie beide mir noch vormachen, daß jeder das Beste für mich wollte. Dann heirateten sie beide wieder. Sie haben mein Studium bezahlt. Ich war froh, als ich ihre finanzielle Hilfe nicht mehr in Anspruch nehmen mußte, denn andere bekam ich ohnehin nicht. Da faßte ich den Entschluß, niemals ein Kind in die Welt zu setzen. Man hat es verflixt schwer, seinen Weg zu finden in solch einem Fall.
Mit der Zeit konnte ich mir auch einiges leisten. Ich bin gern in den Bergen, im Sommer und auch im Winter. Sie setzen einem Grenzen, machen einem bewußt, daß man über manche Hindernisse nur mit äußerster Ausdauer hinwegkommen kann.
Gesellschaft habe ich eigentlich nie gesucht. Aber dann lernte ich Ralph und Peter kennen. Wir stellten fest, daß wir alle in München daheim sind, daß wir unsere Stadt lieben und auch gemeinsame Interessen haben. Sie waren richtig urig und kehrten ihr Geld nicht heraus. Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich herausbekam, daß sie so reich sind. Sie brauchen nicht zu denken, daß mir das imponierte. Ich fand es nett, daß sie sich nicht so aufspielten.«
»Darin sind sie sich also gleich«, warf Professor Weissenberger ein.
»Ja, darin sind sie sich sehr ähnlich. In letzter Zeit habe ich jedoch feststellen müssen, daß Peter sehr großzügig mit dem Geld umgeht.«
»Ein psychologischer Affekt dieser Krankheit«, sagte Professor Weissenberger. »Wie reagiert der Bruder?«
»Überhaupt nicht. Er ist sehr nachsichtig mit seinem Bruder. Der ist halt der Kleine.«
»Erzählen Sie weiter, Stefanie«, bat Professor Weissenberger, als sie in Schweigen versank. »Das ist höchst interessant für mich. Es ist ja auch nicht ganz einfach für ein sehr attraktives Mädchen, zwei Männer gleichzeitig im Zaum zu halten.«
Stefanie stieg das Blut in die Wangen. »Es ist verflixt schwierig«, gestand sie ein, »aber diese Freundschaft bedeutet mir viel.«
»Aber Sie würden sich doch für den Stärkeren entscheiden, für Ralph Reinhold«, sagte der Professor sinnend.
»Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Man muß Peter helfen, er ist krank. Er ist ein lieber Junge. Er könnte nie gemein sein.«
»Ralph eher?« fragte er.
»Dazu ist er zu stolz. Er würde sich zurückziehen. Er hat ja auch seine Arbeit.«
»Immerhin kommen Sie da in eine verzwickte Situation, Stefanie«, sagte er nachdenklich. »Es ist nicht so leicht, einen kranken Menschen zu täuschen. Vielleicht sollte man zu einem gewissen Zeitpunkt den Bruder aufklären.«
»Ralph hängt sehr an Peter«, sagte Stefanie deprimiert. »Entschuldigen Sie bitte, aber mir geht das sehr nahe.«
Er spürte, daß sie jetzt allein sein wollte. »Wir werden uns noch mit der Anamnese beschäftigen, wenn ich Herrn Reinhold untersucht habe«, sagte er. »Jetzt versuchen Sie abzuschalten, Stefanie.«
Das aber konnte sie nicht, und er wußte es. Stefanie war kein oberflächliches Mädchen, und sie wußte über diese Krankheit zu gut Bescheid, um sich nicht einzureden, daß es gar so schlimm nicht sein müsse.
Stefanie fuhr nach Hause, Professor Weissenberger beschäftigte sich mit Dr. Nordens Untersuchungsergebnissen. Erst seit einem Jahr war Peter Reinhold bei Dr. Norden in Behandlung. Immerhin konnte man daraus schließen, daß es sich bei ihm um die schleichend verlaufende chronische Form der Krankheit handelte. Aber wann hatte sie begonnen? Wie lange konnte die Lebensdauer noch sein? Drei, vier Jahre oder gar zehn? Aber war das ein Leben, das möglicherweise durch Bestrahlungen zu verlängern war? Dann konnte man ihn nicht mehr täuschen, dann mußte er mit dieser Krankheit leben und leiden, und die, die ihm nahestanden, würden mitleiden.
Er wußte, wie schwer das war, er hatte es selbst durchlebt. Es war für ihn entsetzlich gewesen, seiner Frau und seinem Kind nicht helfen zu können, da man in manchen Fällen der perniziösen Anämie doch mit Leberextrakten helfen konnte. In diesen beiden Fällen hatten sie versagt. Er rätselte heute noch darüber nach, warum das Knochenmark jegliche blutbildende Tätigkeit versagt hatte. Er hatte sein Leben den Kranken geweiht, der Forschung, da er Glück nicht mehr empfinden konnte. Es schmerzte ihn, daß nun auch die junge lebensfrohe Stefanie so direkt mit diesem Leid konfrontiert wurde.
*
Daniel Norden kam pünktlich nach Hause, aber verständlicherweise nicht gerade frohgestimmt. Fee hatte dafür Verständnis. Sie hoffte, daß ihn das Konzert auf andere Gedanken bringen würde. Sie waren schon lange in keinem Sinfoniekonzert mehr gewesen. Schandbar wäre das, hatte Katja gesagt, da sie doch einen berühmten Pianisten, der sich auch als Dirigent bereits Lorbeeren verdient hatte, zur Familie zählten.
Katja und David Delorme waren nun auch schon drei Jahre verheiratet, und mancher Befürchtung zum Trotz, war ihre Ehe überaus glücklich, obgleich David sehr umschwärmt wurde. Katja, zuerst sehr eifersüchtig, hatte sich daran gewöhnt. Sie wußte jetzt, wie sehr David sich nach der häuslichen Ruhe sehnte, wenn er wieder mal eine Tournee oder auch nur ein Konzert hinter sich gebracht hatte.
Für die, die es nicht anders wußten, galten Fee und Katja als echte Schwestern. Sie waren es erst geworden, als Anne, Katjas Mutter, Dr. Cornelius geheiratet hatte, aber das Wort Stiefschwester war für beide aus dem Wortschatz total gestrichen. Eine tiefe Zuneigung
verband sie, in der keinerlei Eifersucht aufkommen konnte.
David, der gebürtige Engländer, hatte hier eine neue Heimat gefunden, eine Familie, der er sich ganz zugehörig fühlen konnte und die ihn für seine armselige, lieblose Kindheit entschädigte.
Er hatte Mäzene gefunden, die sein großes Talent gefördert hatten, seine Karriere vollzog sich in einem komentenhaften Aufstieg. Aber er wurde nicht eitel und überheblich wie so mancher. Er arbeitete ständig an sich. Er jagte dem Ruhm auch nicht nach. Er war nur bemüht, ihm gerecht zu werden, und seit er die Professur in München bekommen hatte, war er sehr wählerisch, bevor er ein Engagement annahm, denn die Familie sollte nicht zu kurz kommen.
Aber wen von dieser Familie und von seinen vielen Bewunderern hätte es nicht gefreut, daß auch dieses Konzert wieder zu einem großartigen Erfolg wurde. Noch jung an Jahren, zeigte David in seinem Spiel eine Reife, die andächtig stimmte. Auch Daniel vergaß alles um sich her. Er ließ sich mitreißen und emportragen. Er vergaß alles, was ihn beschwert hatte.
Stefanie konnte das nicht. Für sie sollte dieser Abend einen dramatischen Verlauf nehmen. Sie war nicht zum ersten Mal in diesem schönen Haus, das die Reinholds schon in der dritten Generation bewohnten. Es war zwar den modernen Ansprüchen angepaßt worden, aber doch so dezent und mit künstlerischem Sinn, daß die Atmo-sphäre nicht verlorengegangen war.
Ralph kam ihr entgegen und begrüßte sie herzlich. »Peter hat sich hingelegt, weil er sich anscheinend nicht ganz wohl fühlte«, erklärte er. »Er schläft noch immer. Ich wollte ihn nicht wecken.«
Stefanie nahm sich zusammen, aber es fiel ihr doch schwer, ihrer Stimme einen ruhigen Klang zu geben, als sie sagte: »Es kursiert wieder mal eine Grippe. Hoffentlich hat es Peter nicht zu arg erwischt.«
»Er ist manchmal einfach schlapp«, sagte Ralph. »Vielleicht hat er Vitaminmangel oder so was.«
Sollte sie es ihm verübeln, daß er so leicht dahinredete? Er war völlig arglos. Er strotzte vor Gesundheit, und ihm mochte es unbegreiflich sein, daß Peter Schwäche zeigte. Wie würde er reagieren, wenn sie ihm jetzt sagte, welchen Grund das hatte? Sie konnte es nicht. Sie hätte es nicht über die Lippen gebracht. Sie hatte ihr Wort gegeben.
Und dann stand Peter plötzlich in der Tür, blaß, erregt und so aggressiv, wie Stefanie ihn noch nie erlebt hatte.
»Warum hast du mich nicht geweckt, Ralph?« stieß er hervor. »Du wolltest wohl den Abend mit Stefanie allein verbringen? Ist das die feine Tour, mich auszubooten?«
»Peter«, sagte Ralph beschwichtigend. »Ich dachte, du könntest krank sein.«
»Ich bin nicht krank«, ereiferte sich Peter. »Ich bin eingeschlafen. Das blöde Wetter ist dran schuld, oder gar diese Tabletten, die mir Dr. Norden verschrieben hat.«
»Du warst bei Dr. Norden?« fragte Ralph.
»Ja, ich war bei ihm«, brauste Peter auf. »Aber er kann auch nur Rezepte ausstellen.« Er machte eine Pause, und die anderen sagten auch nichts. »Ich habe Hunger«, erklärte er dann. »Gehen wir zum Weinbauern.«
»Ich habe alles herrichten lassen. Wir wollten doch den Abend hier verbringen«, sagte Ralph betont ruhig, aber Stefanie nahm den grollenden Unterton wahr.
»Ich habe nicht viel Hunger«, sagte sie leise. »Es war ein ziemlich anstrengender Tag.«
»Fühlst du dich auch nicht wohl, Stefanie?« fragte Peter, und das klang sogar hoffnungsvoll.
»Nein, so ganz wohl fühle ich mich auch nicht«, erwiderte sie ablenkend. Es entsprach allerdings nur ihrer seelischen Verfassung.
»Du solltest dich schonen, Stefanie«, sagte Peter sogleich besorgt. »Du scheinst ziemlich ausgenützt zu werden in dieser neuen Stellung.«
»O nein, nicht im geringsten. Es ist interessant, mit Professor Weissenberger zu arbeiten.«
»Womit beschäftigt er sich?« fragte Peter, erstmalig solches Interesse zeigend.
»Überwiegend mit der Erforschung unbekannter Krankheitssymptome«, erwiderte Stefanie vorsichtig.
»Was gibt es denn da für welche?« erkundigte sich Peter beiläufig.
»Ziemlich viele, deren Ursache man erst finden muß, um helfen zu können.«
Peter trank einen Schluck Wasser. »Dann soll er mal meine Müdigkeit erforschen«, sagte er mit einem Seufzer, der allerdings von einem Lächeln begleitet war, wenn auch von einem etwas gequälten. »Wieviel verstehst du davon?«
»Vielleicht brauchst du nur eine Luftveränderung«, sagte sie.
»Wir fahren ja in vierzehn Tagen«, warf Ralph ein.
»Wenn Stefanie nicht mitkommen kann, macht es mir keinen Spaß«, sagte Peter mürrisch. »Du kannst allein fahren, Ralph.«
Der wartete auf Stefanies Widerspruch, doch solcher blieb aus, und seine Miene verdüsterte sich. Dafür glomm in Peters Augen ein triumphierendes Leuchten auf. Er geriet plötzlich in eine fast euphorische Stimmung, aber es verging keine Viertelstunde, dann stand er auf und ging mit einer gemurmelten Entschuldigung hinaus.
»Merkst du nicht, daß er es darauf anlegt, dein Mitgefühl zu erregen, Stefanie?« fragte Ralph ungehalten.
»Er hat vielleicht nur ein Stimmungstief«, sagte sie ausweichend.
»Ich möchte dich einmal allein sprechen, Stefanie«, sagte Ralph nun drängend.
»Ich möchte nicht, daß unsere Freundschaft irgendwie gestört wird«, erwiderte sie rasch.
»Aber wenn Peter hierbleibt, dann wirst du ihm keinen Korb geben, wenn er mit dir zusammensein will.«
Bevor sie etwas sagen konnte, war Peter schon wieder zurück. »Entschuldigung«, sagte er, »mir wurde plötzlich so heiß.«
»Du hast Fieber«, stellte Stefanie fest. »Es ist besser, wenn wir unser Beisammensein nicht ausdehnen. Ich fühle mich auch nicht wohl. Ruf doch lieber Dr. Norden an, Ralph.«
»Nein, ich brauche ihn nicht«, widersprach Peter. »Es tut mir leid, daß ich heute ein richtiger Störenfried bin, aber man ist nicht immer in Form.«
Hoffentlich sagt Ralph jetzt nicht etwas Unpassendes, dachte Stefanie, aber Ralph schwieg.
»Ich wünsche dir gute Besserung, Peter«, sagte sie. »Wir werden uns ja noch sehen, bevor ihr in Urlaub fahrt.«
»Aber das steht doch fest«, sagte Peter stockend. »Es tut mir so leid, daß ich so mies beieinander bin.«
»Ich möchte nicht, daß du allein heimfährst, wenn du dich auch nicht wohl fühlst, Stefanie«, sagte Ralph.
»So schlimm ist es bei mir nicht. Hoffentlich erwischt dich die Grippe nicht auch noch, Ralph.«
Ihm gelang es nicht, ein paar Worte mit ihr allein zu wechseln, denn Peter blieb bei ihnen, bis Stefanie gegangen war. Und dann brauste er auf.
»Du wirst sie mir nicht wegnehmen, Ralph. Entweder ich bekomme sie oder keiner von uns beiden«, sagte er drohend. Zum Glück hörte das Stefanie nicht mehr.
Ralph blieb ruhig. »Du hast Fieber, Peter. Geh wieder zu Bett.«
»Du machst mich krank«, zischte der Bruder. »Du willst unbedingt, daß ich mit dir fahre, aber ich fahre nicht mit. Und du wirst es nicht verhindern können, wenn ich Stefanie treffe.«
»Es ist ihre Entscheidung«, sagte Ralph ruhig. »Ich finde dein Benehmen, bei allem Wohlwollen, reichlich albern.«
Er schnippte mit den Fingern. »Gute Besserung, Peter.« Dann zog er sich in sein Zimmer zurück.
Es hätte ihn wohl doch erschreckt, hätte er gesehen, wie mühsam sich Peter nun in sein Zimmer schleppte, so, als wäre er betrunken, aber er hatte ja keinen Schluck Alkohol zu sich genommen.
Ralph wartete eine halbe Stunde, dann wählte er Stefanies Nummer, doch es kam das Besetztzeichen. Peter konnte nicht mit ihr telefonieren. Mit wem sprach sie dann? Eifersucht brannte in ihm, denn jetzt wurde es ihm erst recht bewußt, wie eigenartig ihr Benehmen gewesen war, ganz anders als sonst. Gab es schon einen anderen Mann in ihrem Leben? War es gar der Professor, mit dem sie arbeitete?
*
Mit dem telefonierte Stefanie allerdings, aber nicht er hatte sie, sondern sie hatte ihn angerufen, um ihm zu berichten, was ihr an Peter aufgefallen war. Sie mußte einfach mit jemandem darüber sprechen, wenn es auch schon spät war. Daran hatte sie zuerst gar nicht gedacht, aber Professor Weissenberger nahm es ihr nicht übel. Wann konnte er denn schon mal früh einschlafen? Bis tief in die Nacht hinein grübelte er immer über die mageren Erkenntnisse nach, die er in all den Jahren gesammelt hatte. Er jedenfalls betrachtete sie als mager, obgleich sie für andere schon wegweisend waren. Er behielt sein Wissen nicht für sich. Er war nicht darauf erpicht, Ehren einzuheimsen, wenn er einen Schritt weitergekommen war. Ihm bedeutete es viel, wenn es ein paar Kollegen gab, die sich für sein Bemühen interessierten.
Er notierte sich alles, was Stefanie ihm sagte. Einen Kommentar gab er nicht dazu, denn erst wollte er Peter selbst kennenlernen.
Stefanie hatte kaum den Hörer aufgelegt, als das Telefon wieder läutete. Sie dachte, es wäre Peter, aber es war Ralphs Stimme, die an ihr Ohr tönte.
»Sei nicht böse, Steffi, daß ich so spät noch anrufe, aber deine Leitung war besetzt«, sagte er.
»Ja, ich habe telefoniert«, erwiderte sie.
Es wäre unpassend gewesen, sie zu fragen, mit wem sie telefoniert hatte. Sie hätte es ihm auch nicht gesagt.
»Ich muß unbedingt mit dir allein sprechen, Stefanie«, sagte Ralph bittend. »Peters Benehmen ist mehr als eigenartig, findest du nicht?«
Ob er sich auch ernsthaft Gedanken macht, fragte sich Stefanie. Aber am Telefon wollte sie dies nicht erörtern.
»Gut, morgen in der Mittagspause«, schlug sie vor, »wenn es dir paßt. Bei uns in der Nähe ist ein kleines Lokal. Klosterstüberl heißt es. Da esse ich.«
»Wann?« fragte er.
»Zwölf Uhr, aber mehr als eine Stunde habe ich nicht Zeit.«
»Ich bin pünktlich«, erwiderte er. »Danke, Stefanie, und jetzt wünsche ich dir eine gute Nacht.«
Ein frommer Wunsch war das. Sie konnte keine Ruhe finden. Sie wanderte in ihrer hübschen kleinen Wohnung hin und her, und endlich griff sie zu einer Beruhigungstablette. Es war die letzte von jenen, die ihr verschrieben worden waren, als sie vor drei Monaten Ärger mit ihrem früheren Chef bekommen hatte. Es waren ganz persönliche Differenzen gewesen. Er wollte sich ihretwegen scheiden lassen, obgleich sie ihm niemals Hoffnungen gemacht hatte. Er drohte, sich umzubringen, wenn sie ihn nicht erhören würde. Und dann hatte seine Frau einen Selbstmordversuch unternommen. Es war eine schlimme Zeit für sie gewesen, aber sie hatte mit niemandem darüber gesprochen, auch nicht mit Ralph und Peter. Sie hatte gekündigt, dann aber sehr schnell die Stellung bei Professor Weissenberger gefunden.
An diesem Abend kam Stefanie zu der Überzeugung, daß Männer ihr nur Unglück brächten.
*
Ausnahmsweise waren die Nordens und die Delormes an diesem Abend nicht gleich heimgefahren, wie es eigentlich vorgesehen war. Sie hatten sich im Foyer getroffen, aber dort wurden sie schon von einem jungen Paar erwartet.
David bemerkte es erst, als sein Name gerufen wurde. Die Überraschung war perfekt. Er erkannte in dem Mann einen Studienfreund, den ebenfalls sehr begabten Geiger Christopher Bentham. Die Frau an seiner Seite war eine auffallende Schönheit, aber von so mädchenhaftem Liebreiz, daß sie sofort Sympathie gewinnen mußte.
David und Christopher hatten sich herzlich begrüßt. Man machte sich bekannt. Christophers junge Frau Va-nessa blickte Daniel forschend an, als David erklärte, daß sein Schwager Arzt sei. Ihr zartes Gesicht belebte sich.
»Oh, Christopher, vielleicht kann Dr. Norden uns behilflich sein, einen Spezialisten zu finden«, sagte sie leise.
»Was für einen Spezialisten?« fragte David.
»Mit ein paar Worten ist das nicht zu erklären«, sagte Christopher. »Und fast habe ich die Hoffnung auch schon aufgegeben. Aber…«
Seine Frau unterbrach ihn. »Aber vielleicht dürfen wir Sie zu einem Drink einladen. Wir würden uns sehr freuen.«
»Ein Glas Wein könnte nicht schaden, aber vorher eine große Flasche Wasser«, sagte David. »Ich habe höllischen Durst. Die Luft war so trocken im Saal. Mir kam es auch so vor, als hätten die Töne nicht richtig angesprochen.«
»Du hast wundervoll gespielt, David«, sagte Christopher. »Dir ist das Glück treu geblieben.«
Eigentlich gaben diese Worte den Ausschlag, daß auch Daniel und Fee sich zu dem Umtrunk bereit fanden, und Daniel wie auch Fee war es inzwischen aufgefallen, daß Christopher Bentham seinen linken Arm nur mühsam bewegte.
Sie gingen zu einem Weinlokal. David Delorme war immerhin so bekannt, daß man sich schnellstens bemühte, in einem kleinen Nebenraum einen Tisch für die drei Paare zu decken, und hier sollten sie auch ganz ungestört bleiben.
David hatte seinen Studienfreund nicht so genau beobachtet wie Daniel Norden.
»Wo bist du eigentlich abgeblieben, Christopher?« fragte er. »Warum hört man nichts von dir?«
»Ich kann nicht mehr spielen«, erwiderte der andere leise. »Schon seit einem Jahr nicht mehr.«
»Christopher hatte einen Unfall«, warf Vanessa ein. »Aber irgendwo muß es doch einen Arzt geben, der ihm helfen kann.«
Ein paar Sekunden herrschte betretenes Schweigen.
»Was war das für ein Unfall?« fragte Fee dann. Bloß nicht schon wieder eine von diesen unheilbaren Krankheiten, hatte Daniel unwillkürlich gedacht, denn für diesen Abend wünschte er sich wirklich einen erfreulicheren Abschluß. Aber ihm schien es tatsächlich bestimmt zu sein, immer und überall mit Krankheiten konfrontiert zu werden.
Krank sah Christopher allerdings nicht aus, er wirkte nur ein bißchen sehr melancholisch, und seine kleine Frau schien sehr bemüht zu sein, ihm darüber hinwegzuhelfen.
»Es war ein ganz dummer Unfall«, sagte Christopher sarkastisch. »So was kann auch nur mir passieren.«
»Das kann jedem passieren«, warf Vanessa nachsichtig ein. »Wir verbrachten den Urlaub bei meinen Eltern in Florida, und ausgerechnet am letzten Tag glitt Christopher aus, als er aus dem Swimming-pool stieg, und fiel auf den Arm.«
»Ich wollte mich noch abstützen und habe das sehr ungeschickt angefangen«, bemerkte er. »Der Ellenbogen und der rechte Daumen wurden gestaucht.«
Florida, Swimming-pool, dachte Daniel unwillkürlich, sie scheint aus gutem Hause zu kommen. Nun, man sah es ihr an, ihrem feinen Gesicht, ihrem dezenten Benehmen, der damenhaften Eleganz.
»Leider hat sich Christopher nach der Behandlung nicht geschont«, sagte Vanessa sanft und ohne vorwurfsvollen Ton.
»Du weißt genau, warum, Liebling«, sagte er rasch.
»Und was ist nun mit dem Arm?« fragte Daniel, der seine Verlegenheit bemerkte.
»Jede Bewegung schmerzt«, sagte Christopher. »Ich kann ihn kaum noch heben. Ich werde mir einen anderen Beruf suchen müssen, wenn nicht bald etwas geschieht.« Er sah David an. »Du hast mir mal von der Insel der Hoffnung erzählt, Dave, und das ist der eigentliche Grund unseres Hierseins.«
David zwang sich zu einem Lächeln. »Bitte, Daniel ist der Mitbesitzer des Sanatoriums. Du kannst direkt mit ihm sprechen.«
»Sagtest du nicht, daß dein Schwiegervater das Sanatorium leitet?« fragte Christopher überrascht.
»So ist es, aber über unsere etwas verzwickten Familienverhältnisse reden wir nicht gern so nebenbei.«
»Was aber nicht besagt, daß die verzwickten Verhältnisse konfliktreich wären«, warf Fee lächelnd ein. »Dr. Cornelius ist mein Vater, seine Frau Anne ist Katjas Mutter. Außerdem war mein Vater der beste Freund von Daniels Vater. Ich bin im bereits fortgeschrittenen Alter zu einer reizenden Schwester gekommen und zu einem berühmten Schwager.«
»Und wir können uns glücklich schätzen, die besten Ärzte in der Familie zu haben«, gab Daniel seinen Kommentar dazu. Der Ton hatte sich gelockert. Man lächelte nicht mehr so gezwungen.
»Ich würde vorschlagen, daß Dieter den Arm erst einmal röntgt«, sagte Daniel. »Dr. Behnisch ist ein guter Freund von mir, der sehr viel von der Behandlung von Unfallfolgen versteht. Er ist Chrirurg.«
Christophers Gesicht verdüsterte sich wieder. »Eine Operation kommt nicht in Frage«, sagte er störrisch. »Da wird es nur noch schlimmer. Kannst du dich noch an Levell erinnern, Dave?«
»Aber gewiß.«
»Er hatte einen anscheinend einfachen Beinbruch. Jetzt hat er ein künstliches Hüftgelenk bekommen und ist fast steif. Er kann nicht mehr dirigieren.«
David war bestürzt. »Ich habe nur gehört, daß er sich ins Privatleben zurückgezogen hätte.«
»Was blieb ihm übrig? Zum Glück ist er ja vermögend, aber ich möchte nicht auf Kosten meiner gutsituierten Schwiegereltern leben.«
»Du sollst nicht so denken, Christopher«, sagte Vanessa. »Sie wollen dir gern helfen.«
»Aber du kennst meine Einstellung«, sagte er heftig.
Also auch eine psychische Belastung, dachte Daniel. Er wollte jetzt keine Fragen nach den persönlichen Verhältnissen stellen. Da würde David wohl doch manches wissen. Er wollte Christopher die Angst vor einer Operation nehmen. »Röntgen bedeutet nicht operieren«, meinte er. »Aber die Insel der Hoffnung ist ein Sanatorium, kein Krankenhaus. Eine Röntgenabteilung gibt es dort nicht. Wir können uns darüber noch eingehend unterhalten, wenn Sie sich entschließen, meinem Rat zu folgen.«
»Das werden wir tun«, sagte Vanessa rasch. »Wir werden nichts unversucht lassen.«
Sie verabschiedeten sich für den nächsten Nachmittag. Daniel und Fee, David und Katja fuhren gemeinsam heim, und auf der Fahrt erzählte David von Christopher, der ähnlich wie er aus bescheidenen Verhältnissen stammte.
Sie hatten sich auf dem Konservatorium kennengelernt, und da beide vom gleichen Ehrgeiz beflügelt waren, schnell voranzukommen, hatten sie sich auch bestens verstanden.
»Vanessas Vater besitzt eine Maschinenfabrik, und er hätte es wohl lieber gesehen, wenn sie einen Mann geheiratet hätte, der seine Nachfolge übernehmen könnte, da sie das einzige Kind ist. Aber sie hat ihren Willen durchgesetzt. Gerade deshalb will sich wohl Christopher nicht von den Schwiegereltern abhängig machen. Ich kann das gut verstehen.«
»Es muß schrecklich für ihn sein, daß er dieses Handicap hat«, meinte Katja.
»Eine schwere seelische Belastung, die Verkrampfungen hervorruft«, stellte Daniel fest. »Wie oft erleben wir es, daß ein seelisches Tief den Heilungsprozeß verzögert. Wollen wir doch mal sehen, ob dem guten Christopher nicht zu helfen ist.«
Für ihn war dies jedenfalls kein aussichtsloser Fall wie Peter Reinhold, und das stimmte ihn zuversichtlich.
*
Stefanie war in dieser Nacht von schweren Träumen geplagt worden. Aber pünktlich wie immer war sie auch am Morgen des neuen Tages im Institut.
Professor Weissenberger hielt Vorlesungen, und sie beschäftigte sich mit Peters Anamnese. Was Dr. Norden bisher festgestellt hatte, war allerdings besorgniserregend. Der Wert der weißen Blutkörperchen war erschreckend angestiegen und sie wußte sehr gut, daß es kein Mittel gab, diese Entwicklung zu bremsen. Demzufolge wucherten auch die Gewebe, die diese weißen Blutkörperchen erzeugten, die Milz und die Lymphknoten. Blässe, Appetitlosigkeit, häufig auftretendes Fieber waren die Begleiterscheinungen.
Auch Professor Weissenberger würde nichts anderes feststellen können. Ein Frösteln kroch durch ihren Körper bei dem Gedanken, daß es keine Hilfe für Peter gab und man ihm nur noch damit helfen konnte, daß man ihm seine verbleibende Lebensdauer so angenehm wie nur möglich machte.
Sie nahm sich vor, mit Ralph zu sprechen. Er mußte mehr Verständnis für seinen Bruder aufbringen. Sie war dazu fest entschlossen, als sie sich im Klosterstüberl mit ihm traf. Sie kamen fast zur gleichen Zeit.
»Wie geht es Peter heute?« erkundigte sie sich.
»Nicht besonders. Ich habe Dr. Norden angerufen. Er wird jetzt wohl bei ihm sein. Ich weiß nicht, was Peter plötzlich gegen ihn hat. Aber ich möchte jetzt mit dir
über uns sprechen, Stefanie.«
Sie zuckte zusammen. Sie ahnte, was kommen würde, aber es geschah etwas anderes. Ein paar neue Gäste kamen, unter ihnen eine sehr elegante, auffällig gekleidete junge Dame, die sich umblickte und dann auf Ralph zugeeilt kam.
»Ralph, mein Schatz!« rief sie ungeniert aus. »Wie schön, dich zu sehen. Ich bin erst seit gestern zurück. Wir haben uns viel zu erzählen.«
Ein herablassender Blick traf Stefanie. »Ach, du bist in Begleitung«, fuhr sie fort, »aber das macht ja eigentlich nichts.«
Sie hatte eine maßlos arrogante Art, sich aufzuspielen. Stefanie nahm Ralphs unwillige Meine nicht zur Kenntnis. Im Augenblick war sie sogar froh über diesen Zwischenfall.
»Darf ich bekannt machen«, sagte Ralph rauh, »Gitta Bartosch, Stefanie Linden.«
»Sollte ich sie kennen?« fragte Gitta ironisch.
»Kaum«, erwiderte Stefanie. »Ich muß ohnehin aufbrechen.«
»Wir hatten einiges zu besprechen, Stefanie«, sagte er heiser.
»Das ist jetzt wohl kaum möglich«, erwiderte sie kühl, und fast hätte sie hinzugefügt, daß er Gitta so schnell doch nicht loswerden würde. Sie unterdrückte jedoch diese Bemerkung.
»Die ist aber schnell eingeschnappt«, stellte Gitta fest, als sich Stefanie rasch entfernte, wobei sie aber Ralph am Arm festhielt, als er Stefanie folgen wollte. Ihre Augen verengten sich. »Doch nicht was Ernstes?« fragte sie anzüglich.
»O doch«, entgegnete er jetzt zornig. »Mußt du dich immer so aufführen, Gitta? Schließlich bist du verheiratet.«
»War ich, mein Bester. Ich bin seit acht Tagen geschieden und wieder zu haben. Ich habe meine Erfahrungen gesammelt, Ralphiboy und…«
»Ich bitte dich wirklich sehr darum, mich nicht mit diesem albernen Namen anzureden«, fiel er ihr hart ins Wort. »Verschwende deine Zeit nicht an mich, Gitta, um es ganz deutlich zu sagen. Mein Herz ist nicht mehr frei.«
Ein häßlicher Zug verzerrte ihr Gesicht. »Wenn es sich um dieses Mädchen handelt, scheinen deine Gefühle nicht erwidert zu werden«, sagte sie gehässig. »Du tust mir leid, Ralph.«
»Dann lassen wir es dabei. Ich muß jetzt auch gehen, und du bist ohnehin in Gesellschaft gekommen.«
Er hatte eine Mordswut auf sie. Endlich hatte sich ihm eine Gelegenheit geboten, einmal mit Stefanie allein zu sein, und nun hatte er diese Chance nicht nutzen können. Es war alles so unklar wie zuvor.
Peters gestriger Gefühlsausbruch hatte ihm klargemacht, daß sie harte Konkurrenten um Stefanies Gunst geworden waren, und er hatte heute nicht in Erfahrung bringen können, wer die größeren Chancen bei Stefanie hatte. Allerdings war es ihm nun ganz bewußt geworden, wie schwer es ihn treffen würde, wenn Peter der Sieger werden würde. Zum ersten Mal in seinem Leben liebte er wahrhaft. Stefanie bedeutete ihm viel mehr, als er sich bisher eingestanden hatte. Sie bedeutete ihm alles.
*
Peter setzte eine abweisende Miene auf, als Dr. Norden kam. Er fühlte sich elend, aber das versetzte ihn in einen noch aggressiveren Zustand. Die Haushälterin Katinka hatte es schon zu spüren bekommen, aber sie war nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Sie kannte die Brüder Reinhold schon als Buben, und sie empfand für beide wie eine Mutter, die sich auch mit unterschiedlichen Charakteren und auch Launen abfand.
Dr. Norden nahm Peter nichts übel. Auch nicht, daß er sagte: »Nun tun Sie doch endlich mal etwas, damit dieser Zustand nicht anhält.«
»Ich würde vorschlagen, daß Sie sich klinisch untersuchen lassen, Herr Reinhold«, sagte er jetzt freundlich. »Ich bin nicht allwissend, aber selbstverständlich daran interessiert, daß die eigentliche Ursache gefunden wird.«
»Es tut mir leid, wenn ich unhöflich war«, sagte Peter leise, »aber so lange haben diese Fieberanfälle noch nie angehalten.«
»Ich verstehe Sie sehr gut, und ich würde vorschlagen, daß wir doch einige Spezialisten zu Rate ziehen. Bitte, haben Sie dafür Verständnis, daß in der Praxis eines Allgemeinmediziners die Möglichkeiten doch beschränkt sind und bei Ihren kurzen Besuchen eine so genaue Diagnose nicht zu erstellen ist.«
»Wie lange soll ich in der Klinik bleiben?« fragte Peter müde.
»Zwei bis drei Tage zur Beobachtung.«
Peter wandte sein Gesicht zur Wand. »Ich will nicht, daß Stefanie es erfährt«, flüsterte er.
»Es braucht niemand etwas zu erfahren«, erwiderte Dr. Norden, der bei dem Namen Stefanie stutzte. Aber das war kein seltener Name, und er wollte sich darüber jetzt keine Gedanken machen.
Die machte er sich erst dann, als er am Nachmittag eine Unterredung mit Professor Weissenberger hatte.
Jetzt sagte er: »Sie könnten eine Reise vorschützen, Herr Reinhold.«
»Ja, das ist ein guter Gedanke«, erklärte Peter nun lebhafter. »Ich will dieses Unbehagen loswerden. Ich beginne schon, mir manches einzureden. Bitte, haben Sie Verständnis. Ich möchte heiraten.«
Dr. Norden stockte das Blut in den Adern, aber er war es gewohnt, seinen Patienten immer eine zuversichtliche Miene zu zeigen.
»Ich werde mit Dr. Behnisch sprechen. Es wird sicher noch diese Woche möglich sein, daß die Untersuchung stattfinden kann.«
»So schnell wie möglich«, sagte Peter. »Sie gestehen wenigstens ein, wenn Sie nicht mehr weiter wissen.«
Aber was soll man ihm sagen, wie soll man es ihm erklären, daß es nicht mehr besser, sondern immer schlimmer wird, dachte Dr. Norden verzagt. Er konnte jetzt nichts anderes tun, als ihm eine Injektion zu geben, die ihn beruhigte und ihm über die Depressionen hinweghalf. Er konnte nur darauf hoffen, daß diesem so labilen Stadium dann wieder ein optimistischeres folgen würde.
Er rief seinen Freund Dieter Behnisch von zu Hause aus an. In zwei Fällen brauchte er nun seine Hilfe, aber Dieter versagte sie nie, wenn es ihm nur einigermaßen möglich war.
Was Christopher Bentham betraf, war er sofort bereit, ihn schon am Nachmittag zu röntgen. Peter Reinhold sollte dann am Donnerstag in die Klinik kommen, da wurde ein Einzelzimmer frei, das man zwischenzeitlich für zwei Tage belegen konnte. Da Daniel sagte, daß er über diesen Fall noch persönlich mit ihm sprechen müsse, ahnte Dieter Behnisch schon, daß es sich mal wieder um einen sehr schwierigen handelte. Doch darauf mußten sie immer gefaßt sein. Viele hatten sie in freundschaftlicher Zusammenarbeit schon durchgestanden! Oft genug hatten sie auch helfen können, weil sie miteinander und nicht gegeneinander arbeiteten.
Daniel rief Christopher im Hotel an. Der und Vanessa hatten schon mit brennender Ungeduld auf diese Nachricht gewartet.
Fee sah sich um eine ruhige Mittagstunde mit ihrem Mann gebracht, da er nun noch zu Professor Weissenberger fahren wollte. Die Kinder, Danny, Felix und Anneka, waren damit auch nicht einverstanden. Sie schmollten. Sie hatten während der letzten Tage ihren heißgeliebten Papi zu selten zu Gesicht bekommen.
*
Als Professor Weissenberger von der Universität ins Institut zurückgekehrt war, wunderte er sich, daß Stefanie bereits an ihrem Platz saß.
»Was ist mit der Mittagspause?« fragte er erstaunt.
»Ich habe keinen Hunger«, erwiderte sie.
»Reinhold beschäftigt Sie, Stefanie«, stellte er nachdenklich fest.
»Beide Reinholds«, gab sie zu. »Meinen Sie nicht, daß Ralph über Peters Zustand informiert werden müßte?«
Er atmete schwer. »Da steckt man immer in einer Zwickmühe, Stefanie«, sagte er gedankenvoll. »Würden Sie diese Aufgabe denn übernehmen wollen?«
»Ungern.« Sie wollte nicht daran denken, daß sie noch vor einer Stunde dazu entschlossen gewesen war. Gittas Auftritt hatte sie so schockiert, daß sie in einen tiefen Konflikt gestürzt worden war.
»Dr. Norden wird heute zu mir kommen. Sind Sie einverstanden, wenn ich ihm sage, daß Sie die Brüder Reinhold kennen?«
»Ja, gewiß«, erwiderte Stefanie, ohne zu überlegen. »Ich würde sehr gern mit ihm sprechen.«
»Dann ist alles in Ordnung, Stefanie. Ich schätze keine Unklarheiten.« Mit väterlicher Zuneigung ergriff er ihre Hand. »Es ist eine sehr schwierige Situation für Sie.«
»Aber es ist gut, wenn ich die Wahrheit kenne«, erwiderte sie leise. »Ich weiß jetzt, wie ich mich verhalten muß. Ralph kann mehr aushalten als Peter.«
Es war seltsam, wie nahe sie sich durch dieses Geschehen gekommen waren. Die große Achtung, die Stefanie vor Professor Weissenberger hatte, war nun auch in vertrauensvolle Zuneigung umgeschlagen.
»Sie dürfen aber nicht zuviel von Ihrer seelischen Substanz investieren, Stefanie«, sagte er gedankenverloren. »Sie sind jung. Sie sind gesund. Für Sie geht das Leben weiter. Sehen Sie, damals, als wir unser Kind verloren, versuchte ich, meiner Frau zu helfen. Es konnte mir nicht gelingen, weil sie selbst kaum Widerstandkraft aufbrachte. Sie dachte eine Zeit, alles wäre nun auch für mich zu Ende, aber so war es nicht. Ich mußte leben und mit dem fertig werden, was mich aus dem Geleise geworfen hatte. Sich selbst darf man nicht aufgeben. Mir liegt jetzt Ihr Wohl am Herzen. Sie könnten meine Tochter sein, und ich möchte Ihnen sagen, wie sehr ich mir eine solche Tochter wünschte. Wenn Sie sich jetzt nicht umwerfen lassen, können wir gemeinsam vielleicht noch manches für die Menschheit tun.«
»Ich lasse mich nicht umwerfen«, sagte Stefanie, »aber ich weiß jetzt, daß ich Peter über diese schweren Tage hinweghelfen muß. Es ist doch wohl nicht verwerflich, einen Menschen zu belügen, wenn man ihm helfen will?«
»Nein, das ist nicht verwerflich. Sie glauben an Gott?«
»Ja.«
»Sie glauben, daß er Wunder vollbringen kann?«
»In diesem Fall nicht. Alles spricht dagegen. Aber geschehen nicht immer wieder Wunder?« Ganz leise war ihre Stimme.
»Und wenn ein Wunder geschähe, würden Sie bei ihm bleiben, obgleich Sie ihn nicht lieben?«
Stefanies Blick schweifte zum Fenster hinaus und zum Himmel empor. »Wenn dieses Wunder geschähe, würde ich auch daran glauben, daß man einen Menschen liebenlernen kann«, sagte sie.
Professor Weissenberger straffte sich. »Ich habe ein solches Wunder noch nicht erlebt, Stefanie. Sie werden sehr viel Kraft brauchen, wenn Sie Peter Reinhold zur Seite stehen wollen. Vielleicht über Jahre hinaus. Dar-über müssen Sie sich klar werden. Diese Kraft wird an Ihnen zehren.«
»Daran denke ich jetzt nicht«, sagte sie. »Wann kommt Dr. Norden?«
»Er wird wohl in einer halben Stunde hier sein.«
»Dann werde ich jetzt Teewasser aufsetzen.«
Als sie an ihm vorbeigehen wollte, hielt er sie am Arm fest. »Sie werden nicht vergessen, daß ich immer für Sie da bin, wenn Sie nicht mehr weiterwissen, Stefanie?« fragte er.
»Ja, das weiß ich. Ich danke Ihnen.«
*
Nur mit ein paar Minuten Verspätung war Daniel gekommen. Ohne lange Vorrede hatte ihm Professor Weissenberger erklärt, in welchen Konflikt er gebracht worden sei.
»Stefanie Linden kennt die Brüder Reinhold schon längere Zeit«, begann er ohne Umschweife. »Peter Reinhold weiß, daß sie meine Assitentin ist, also könnte er stutzig werden, wenn er meinen Namen hört, und den wird er ja hören, wenn ich ihn untersuche.«
»Man könnte Sie schlicht und einfach als Professor Berger vorstellen«, sagte Daniel nach kurzem Überlegen. »Persönlich kennen Sie sich doch nicht?«
»Nein. Stefanie hat Kenntnis erlangt über diesen Fall, weil ich vergessen hatte, das Diktiergerät abzustellen. Es ist verständlich, daß es ihr nahegeht. Sie möchte auch gern selbst mit Ihnen sprechen. Selbstverständlich wird die ärztliche Schweigepflicht gewahrt werden, obgleich Stefanie der Meinung ist, daß Ralph Reinhold vorbereitet werden sollte.«
»Ich halte das für verfrüht«, sagte Daniel. »Sie wissen, wie sehr das Mitleiden zehrt. Wir zwei brauchen uns da keiner Täuschung hinzugeben. Wie nervenstark ist Stefanie Linden?«
Professor Weissenberger zuckte die Schultern. »Sie macht sich stark. Bilden Sie sich selbst ein Urteil. Ich lasse Sie mit ihr allein.«
Wie charaktervoll Stefanie war, konnte Daniel Norden bald herausfinden. Sie schlug nicht den leisesten wehleidigen Ton an. Als er ihr dann aber sagte, daß Peter ihm gegenüber geäußert hatte, er wollte heiraten, glomm sofort ein Schimmer von Furcht in ihren schönen Augen auf.
»Er hat auch den Namen Stefanie genannt«, sagte Daniel. »Er will nicht, daß Sie erfahren, wie elend er sich fühlt.«
»Er soll es nicht erfahren«, sagte sie. »Er ist ein lieber Junge. Ich werde mich nicht verraten.«
»Sie würden ihn auch heiraten? Auch auf die Gefahr hin, daß man Ihnen später zum Vorwurf machen könnte, Sie hätten dies aus materiellen Erwägungen getan?«
Maßlose Verwunderung zeichnete sich auf ihren Gesichtszügen ab. »Auf solchen Gedanken wäre ich nie gekommen, und Ralph würde dies auch nicht vermuten.«
»Sind Sie dessen so sicher?« fragte Daniel skeptisch.
Sie legte ihren Kopf in den Nacken. »Wenn Ralph so etwas glauben würde, wären unsere Beziehungen abgebrochen«, sagte sie. »Selbstverständlich würde ich auf ein etwaiges Erbe verzichten. Sie denken zu weit, Herr Dr. Norden.«
»Ich habe schon manches erlebt, was ich für unwahrscheinlich hielt«, sagte er. »Sie nehmen jetzt hoffentlich nicht an, daß ich solche Motive bei Ihnen voraussetze. Aber in diesem Fall wollen wir doch offen miteinander sein. Ich möchte es nicht versäumen, Sie auf alle Probleme, die aus dem Verlauf einer solchen Erkrankung entstehen können, aufmerksam zu machen.«
»Ich werde mich eingehend mit diesen Problemen beschäftigen«, erwiderte Stefanie.
*
Als Dr. Norden in seine Praxis zurückkehrte, in der andere Patienten mit ihren Problemen auf ihn warteten, beschäftigte sich Dr. Dieter Behnisch schon mit Christopher Bentham.
Die Kraftlosigkeit seines Armes war tatsächlich besorgniserregend. Man gewahrte sie erst, wenn dieser nackt und von der verdeckten Kleidung entblößt sichtbar wurde. Aber die Kraftlosigkeit ging nicht vom Unterarm aus, nicht vom Ellenbogen, der bei einem Sturz verletzt worden war, sondern vom Schultergelenk, wie die Röntgenaufnahmen bewiesen. Dieses war total versteift, und ob das noch zu korrigieren sein würde, mußte eine gezielte Behandlung beweisen.
»Ich werde Ihnen jetzt eine Spritze geben«, sagte er zu Christopher. »Sie kann ziemlich schmerzhaft sein, und wir müssen diese noch zweimal wiederholen.«
»Was könnte mich noch erschüttern«, sagte Christopher. »Und was kommt danach?«
»Die Kur auf der Insel der Hoffnung, die einige Wochen strikt durchgeführt werden müßte, bis der Arm gekräftigt ist.«
»Kann ich dann auch wieder spielen?« fragte Christopher.
»Das kann ich nicht voraussagen. Aber denken Sie mal an Katja Delorme. Sie war an den Rollstuhl gefesselt und ist heute eine gesunde Frau. Sie wollte gesund werden! Sie dürfen nicht resignieren. Sie müssen mithelfen, Mr. Bentham.«
»Daran soll es nicht liegen. Ich will nur nicht vertröstet werden.«
»Und wenn nach vier Wochen noch keine Besserung ersichtlich ist, würden Sie aufstecken, obwohl schon ein paar Tage später alles anders aussehen könnte?«
»Ich würde nicht aufgeben«, sagte Christopher. »Meine Frau erwartet ein Baby. Ich muß für eine Familie sorgen. Ich will nicht, daß es nur das Enkelkind meiner Schwiegereltern wird. Sie warten jetzt schon auf einen männlichen Erben. Der Gedanke macht mich verrückt.«
»Machen Sie sich frei von diesem Gedanken, wenn Sie Ihre Frau lieben«, sagte Dr. Behnisch ruhig.
»Es wird doch niemand daran zweifeln, daß ich Vanessa liebe!« rief Christopher aus.
»Wenn man Sie reden hört, könnte man doch daran zweifeln«, sagte Dr. Behnisch. »Es ist doch eine ganz natürliche Folge, daß Ihr Kind auch das Enkelkind Ihrer Schwiegereltern sein wird. Ist es nicht wundervoll, wenn Kinder auch Großeltern haben? Unser Kind hat leider keine. Ihre Frau hätte sich doch längst von Ihnen trennen können, wenn sie Sie nicht lieben würde. Haben Sie daran nicht auch schon einmal gedacht? Ich will doch nicht wegleugnen, daß Sie mit großen Schmerzen und seelischen Belastungen zu kämpfen haben, aber Sie machen nichts besser, wenn Sie sich einreden, daß es keine Besserung gäbe. Kann ich Ihnen jetzt die Injektion geben?«
»Worauf warten Sie denn noch?« sagte Christopher.
Und Dr. Behnisch konnte staunen. Er zuckte nicht mal zusammen, als die Injektionsnadel in die Armkugel stieß. Der erfahrene Arzt wußte, daß dies ein höllischer Schmerz war.
Langsam, Christopher schien es gar nicht zu bemerken, zog er die Nadel wieder heraus.
»Und nun bewegen Sie mal Ihren Arm«, sagte er, wissend, daß Christopher dies unter der Wirkung der Betäubung konnte. Aber auch dies war ein psychologischer Effekt.
»Es geht ja«, sagte Christopher verwundert.
»Na also, nur nicht nachgeben, junger Mann«, meinte Dr. Behnisch.
Christopher blinzelte. »Soviel älter als ich sind Sie auch nicht«, sagte er.
»Aber was meinen Sie, wie viele schlimmere Fälle als Sie mir schon unter die Augen gekommen sind«, sagte Dr. Behnisch.
*
Daß Peter Reinhold ein aussichtsloser Fall war, wußte er ein paar Tage später. Da hatte Christopher schon seine dritte Injektion bekommen und sich bedeutend optimistischer gezeigt. Anfang der nächsten Woche, das war schon beschlossen, wollte er mit Vanessa zur Insel der Hoffnung fahren.
Als Peter seinem Bruder erklärt hatte, daß er ein paar Tage verreisen wolle, war Ralph deprimiert. Er hatte ein paarmal versucht, Stefanie zu erreichen, aber sie hatte sich im Institut verleugnen lassen und zu Hause hatte sie den Hörer ausgehängt.
Sie wollte jetzt auch nicht mit Peter sprechen, aber er hatte es auch gar nicht erst versucht.
Er hatte sich im Spiegel betrachtet und erschrocken feststellen müssen, wie fahl und eingefallen sein Gesicht war. So sollte ihn Stefanie nicht sehen.
»Wohin fährst du?« fragte Ralph, als er am Donnerstagmorgen das Haus verließ.
»Irgendwohin, nur ein paar Tage Luftveränderung«, erwiderte Peter. »Die Grippe hat mich arg geschlaucht.«
Ralph glaubte an die Grippe, aber er hegte doch die Vermutung, daß Peter mit Stefanie fahren würde. Er rief wieder im Institut an, und diesmal war sie selbst am Apparat.
»Endlich kann ich mit dir sprechen, Stefanie«, sagte er erleichtert. »Es gibt da etwas zu erklären.«
»Was denn?« fragte sie.
»Diese Sache mit Gitta. Du hast das doch nicht etwa ernst genommen? Sie übertreibt immer. Können wir uns heute oder morgen sehen?«
»Tut mir leid, Ralph, ich habe keine Zeit. Wir haben viel zu tun.«
»Aber abends könnte doch eine Stunde herausspringen«, meinte er.
»Ein Abend zu dritt?« fragte sie nach kurzem Überlegen.
»Peter verreist ein paar Tage«, erwiderte er.
Sie wußte es besser. »Warten wir, bis er zurück ist. Entschuldige, aber ich habe eine Besprechung.«
Auch das war freilich eine Ausrede, aber sie wollte sich nicht in ein längeres Gespräch mit ihm einlassen. Professor Weissenberger machte sich schon bereit, in die Behnisch-Klinik zu fahren. Stefanie wußte, daß er dort als Professor Berger in Erscheinung treten würde, um jedes Mißtrauen bei Peter auszuschließen.
»Wir wissen beide, daß bei dieser Untersuchung nicht viel herauskommen wird, Stefanie«, sagte er, als er sich von ihr verabschiedete.
Sie nickte nur, und als er gegangen war, sagte sie in der Telefonzentrale Bescheid, daß sie für niemanden zu sprechen sei.
Sie mußte drei Stunden warten, bis der Professor zurückkam. »Wollen wir uns nicht in einer freundlicheren Atmosphäre unterhalten, Stefanie?« fragte er.
»Darf ich vorschlagen, daß wir zu mir fahren?« fragte sie zurück.
»Einverstanden.«
Stefanie konnte nicht ahnen, daß Ralph vor ihrem Haus auf sie warten würde. Er hatte sich dazu entschlossen, weil er unbedingt mit ihr sprechen wollte.
Als er ihren Wagen halten sah, wollte er schon auf sie zugehen, aber dann sah er den Mann, der diesem Wagen ebenfalls entstieg. Ein schlanker, hochgewachsener Mann war es, ohne Kopfbedeckung, doch in der Dämmerung war es nicht zu unterscheiden, ob sein Haar grau oder blond war.
Für den von Eifersucht geplagten Ralph stand es in diesem Augenblick fest, daß es in Stefanies Leben doch einen anderen Mann gab, aber es konnte ihn nicht beruhigen, daß es nicht Peter war. Ihn brachte es aus dem Gleichgewicht, als dieser Mann mit Stefanie das Haus betrat. Im Schatten eines Baumes auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehend, beobachtete er, wie hinter ihren Fenstern das Licht aufflammte, wie sie dann die Jalousien herabließ. Er wartete mehr als eine Stunde, daß ihr Begleiter wieder aus der Türe treten würde, aber er wartete umsonst.
Stefanie und Professor Weissenberger hatten sich eine ganze Stunde unterhalten, bis sie die Frage stellte, wie lange er Peter noch an Lebensdauer geben würde. Ihre Stimme zitterte dabei, sosehr sie sich auch zusammennahm.
»Ein paar Monate«, erwiderte er. »Genau kann es niemand sagen. Was immer wir auch unternehmen, es werden nur Versuche sein, Stefanie. Ich will Sie nicht täuschen. Er muß diese Krankheit schon längere Zeit in sich tragen. Es kann eine langsame Entwicklung gewesen sein, doch jetzt wird sie rapide fortschreiten. Dr. Norden hat dies sehr genau erkannt.«
»Ich habe nicht mit einer besseren Nachricht gerechnet. Ich fürchte mich nur davor, wie er reagieren wird, wenn sich keine Besserung einstellt.«
»Wir haben uns zu einer medikamentösen Behandlung entschlossen, die ihm Besserung vortäuschen wird«, erklärte Professor Weissenberger zögernd.
Stefanie wußte, was er meinte. Opiate! Ja, diese Behandlung würde ihm wohl die Ängste nehmen, aber er würde sie immer häufiger in Anspruch nehmen müssen. Und er würde immer mehr verfallen. Er würde sich im Spiegel sehen und diesen Verfall feststellen. Der Hochstimmung würde das Tief folgen und eines Tages das Ende.
Sie würde ihn nicht im Stich lassen, so schwer diese Wochen auch sein würden. Sie dachte an den lustigen, lebensfrohen Peter, mit dem sie so übermütig hatte lachen können, daß Ralph manchmal nur nachsichtig den Kopf geschüttelt hatte. Das Lachen würde ihr in Zukunft schwerfallen.
*
Peter machte sich keine Gedanken. Er fühlte sich so wohl wie schon lange nicht mehr und war froh, daß er in die Klinik gegangen war.
Er war felsenfest davon überzeugt, daß dies der erste Schritt zu seiner Genesung war.
Die Ärzte hingegen zerbrachen sich den Kopf, wie die Behandlung durchgeführt werden könnte, ohne daß er dahinterkam, welche Medikamente ihm verabreicht wurden.
Dr. Norden hatte dann die Idee, ihm die Kapseln in einer neutralen Dose zu geben. Er brachte ihm auch vorsichtig bei, daß hin und wieder eine Infusion nötig sein würde.
»Hauptsache, es hilft«, meinte Peter, der sich jetzt in einem euphorischen Zustand befand.
»Sie dürfen keinesfalls mehrere Tabletten am Tag nehmen«, erklärte Dr. Norden. »Das wiederum könnte eher schaden als nützen.«
»Jetzt möchte ich aber wissen, um was für eine Krankheit es sich handelt«, sagte Peter.