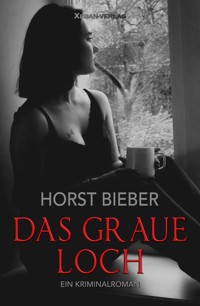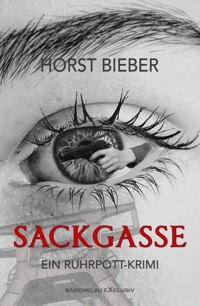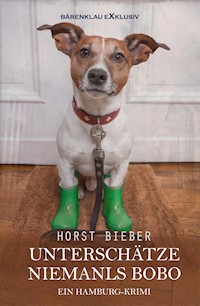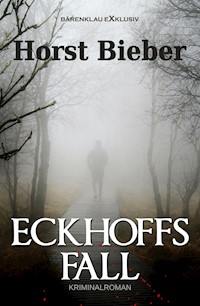
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Plötzlich fror er, dass seine Zähne klapperten. Genau so würde es ablaufen. Erst verschwand die Frau, dann wurde die Freundin umgebracht, »eigenartiger Zufall, nicht wahr …«
Wer würde ihm glauben, dass hinterher ein fremder Mann mit Henkelohren aus dem Haus gekommen war? »Ach nein, Sie haben ihn sogar verfolgt … ohne Grund? Nur so?«
In diesem Moment sah er Grembowski direkt vor sich und hörte dessen Hohn. »Natürlich, der große Unbekannte …«
Nein. Keiner würde ihm glauben. Niemand.
Ein Mann unter Mordverdacht – Ingenieur Peter Eckhoff gerät in Panik und taucht unter. Mit Gelegenheitsjobs schlägt er sich durch, immer auf der Hut, nicht mit der Polizei in Berührung zu kommen. Dann findet seine Flucht ein überraschendes Ende …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Horst Bieber
Eckhoffs Fall
Kriminalroman
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Bärenklau Exklusiv, 2023
Korrektorat: Christian Dörge
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Eckhoffs Fall
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
16. Kapitel
Horst Bieber – sein Leben und Wirken
Das Buch
Plötzlich fror er, dass seine Zähne klapperten. Genau so würde es ablaufen. Erst verschwand die Frau, dann wurde die Freundin umgebracht, »eigenartiger Zufall, nicht wahr …«
Wer würde ihm glauben, dass hinterher ein fremder Mann mit Henkelohren aus dem Haus gekommen war? »Ach nein, Sie haben ihn sogar verfolgt … ohne Grund? Nur so?«
In diesem Moment sah er Grembowski direkt vor sich und hörte dessen Hohn. »Natürlich, der große Unbekannte …«
Nein. Keiner würde ihm glauben. Niemand.
Ein Mann unter Mordverdacht – Ingenieur Peter Eckhoff gerät in Panik und taucht unter. Mit Gelegenheitsjobs schlägt er sich durch, immer auf der Hut, nicht mit der Polizei in Berührung zu kommen. Dann findet seine Flucht ein überraschendes Ende …
***
Eckhoffs Fall
Kriminalroman von Horst Bieber
1. Kapitel
Im Präsidium wartete er fast eine Stunde. Die Holzbank auf dem Flur war hart und unbequem, vom Treppenhaus zog es wie Hechtsuppe. Auf dem Flur herrschte reger Betrieb, die meisten Polizisten warfen ihm prüfend-misstrauische Blicke zu, denen er auswich. Das abgetretene Linoleum wies Risse und Sprünge auf. Bis zu halber Höhe waren die Wände in einem schmutzigen Olivgrün gestrichen, die Farbe platzte bereits ab und auf der helleren Decke studierte er braune Schlieren. Ein ungemütlicher Ort, der ihn einschüchterte. In dem Treppenhaus hallten die Schritte und Stimmen, alle beeilten sich, ins Wochenende zu kommen.
»Herr Eckhoff?«
Erschrocken fuhr er zusammen und stand rasch auf.
»Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat.«
Mit Hauptkommissar Grembowski hatte er bisher nur einmal gesprochen und die ganze Zeit über das Gefühl gehabt, dass der massige Mann ihm kein Wort glaubte. Gesagt hatte er zwar nichts, ihn aber unentwegt angestarrt, als müsse er Maß nehmen. Zwei Meter groß, weit über hundert Kilo, Schultern und Arme wie ein Preisringer, dazu ein wuchtiger Schädel mit tief liegenden Augen – auf dem Heimweg hatte er sich eingestanden, dass er diesen Hauptkommissar fürchtete, obwohl Grembowski höflich geblieben war.
»Setzen Sie sich doch!«
»Danke.«
Das Zimmer war klein, höher als breit, ein enger Schlauch. In der Mitte stand ein Schreibtisch, dahinter ein Stuhl, der mit der Lehne schon an die Wand stieß; und sie hatte die Tapete zerfetzt und tiefe Kerben in den Putz gerissen. Das Oberfenster war geklappt. Trotzdem stank es nach einem fürchterlichen Tabak.
»Tja, Herr Eckhoff, ich hab den Fall noch immer auf dem Tisch.« Mit den Fingerknöcheln pochte der Beamte auf eine dünne Akte. Fäuste wie ein Dampfhammer, dachte Eckhoff unwillkürlich. »Haben Sie inzwischen etwas von Ihrer Frau gehört?«
»Nichts, kein Anruf, kein Brief, keine Karte, nichts.«
Der Hauptkommissar grunzte: »Wie lange ist sie jetzt verschwunden?«
»Am Sonntag sind es sechs Wochen.«
»Hm. Sechs Wochen. Ich hab gestern und heute noch einmal mit der Bank und den Kreditkartenfritzen telefoniert. Auch nichts.«
»Und das Auto …?«
»Keine Spur.« Grembowski grollte. »Herr Eckhoff, das gefällt mir gar nicht. Nein, langsam werd ich unruhig. Deshalb hab ich Sie hergebeten.« Das winzige Zögern sagte alles. Herbestellt, meinte er in Wahrheit. »Sie haben uns den Streit geschildert, den Sie mir Ihrer Frau hatten. Da ging es doch um die Scheidung.«
»Nein«, berichtigte Eckhoff höflich, doch bestimmt. »Julia wurde erst richtig laut und hysterisch, als ich ihr vorschlug, wir sollten uns trennen. Aber davor hatten wir uns schon fast eine Stunde gezankt.«
»Na gut. Aber das Wort Scheidung ist gefallen?«
»Ja.«
»Fein. Um sich scheiden zu lassen, müssen die Partner ein Jahr getrennt leben.«
»Ja, ich weiß.«
»Kann es nicht sein, dass Ihre Frau weggezogen, weggegangen ist, um die zwölf Monate abzuwarten?« Er gab sich gar keine Mühe, den lauernden Blick zu verschleiern, und Eckhoff holte tief Luft: »Wollen Sie damit andeuten, dass meine Frau gar nicht verschwunden ist, sondern mich informiert hat, dass sie wegzieht? Damit wir die Scheidung einleiten können?«
»Wäre doch denkbar – oder?«
»Und ich hätte sie als vermisst gemeldet, obwohl ich wusste, dass sie freiwillig irgendwo untergekrochen ist?«
»Alles schon da gewesen«, röhrte Grembowski, nicht im Mindesten verlegen. »Böswilliges Verlassen kann nämlich teuer werden, später, bei der Regelung des Versorgungsausgleichs.«
»Und Sie denken …« Vor Empörung verschlug es ihm die Sprache, was den Kommissar nicht beeindruckte.
»Was meinen Sie, welche Tricks und Kniffs wir hier erleben.«
»Dann kann ich Sie beruhigen: Nein, meine Frau hat nicht angekündigt, dass sie für zwölf Monate wegzieht, damit wir uns scheiden lassen können. Ich habe sie als vermisst gemeldet, weil sie verschwunden ist.« Eckhoff beugte sich vor. »Wenn sie ausgezogen wäre, hätte sie doch Kleider, Wäsche, persönliche Dinge mitgenommen.«
»Anzunehmen. Na schön, also keine einvernehmliche Trennung. Aber Sie denken an Scheidung?«
»Unsere Ehe existiert nur noch auf dem Papier.«
»Und in zahlreichen Krächen und Streitereien.«
»Richtig.«
»Dann müssen wir mal ein anderes Thema anschneiden.« Grembowski stülpte die Lippen vor und musterte Eckhoff scharf. »Nämlich Geld.«
»Wie meinen Sie das?«
»Sie sind kein armer Mann.«
»Nein.« Eckhoff zuckte die Achseln.
»Sie verdienen gut, Sie besitzen einige Patente, für die Sie ordentliche Lizenzgebühren beziehen, Ihr Haus ist schuldenfrei und von Ihren Eltern haben Sie Aktien, Wertpapiere, zwei Firmenanteile und ein halbes Mietshaus in Nürnberg geerbt.«
»Woher wissen Sie das alles?«, fragte er unwillkürlich. Grembowski schnaubte unfroh: »Ich habe mich natürlich erkundigt. Und was hat Ihre Frau mit in die Ehe gebracht?«
»Was soll das heißen?«
»Ja, was besaß Ihre Frau, als sie heirateten?«
»Ich verstehe Ihre Frage immer noch nicht.«
»Was ist daran so schwer zu verstehen? Sie waren ein reicher Mann, als Sie eine Frau heirateten, die nichts besaß. Die zu der Zeit jobbte, um genau zu sein, als Teilzeit-Aushilfe in dem Geschäft einer Freundin.«
»Ja.« Später hatte Julia ihm gestanden, dass ihr Freund sie Knall auf Fall vor die Tür gesetzt hatte, angeblich wegen einer anderen, und noch viel später fand er durch Zufall heraus, dass der Freund sie loswerden wollte und sich mit einer Abstandssumme freigekauft hatte; doch da waren sie schon drei Jahre verheiratet und er ahnte bereits, warum der Freund so gehandelt hatte.
»Im Klartext: Reicher Mann heiratet arme Frau und lebt mit ihr in Zugewinngemeinschaft.«
»Ja, und?«
»Herr Eckhoff, so weltfremd sind Sie nicht: Bei einer Scheidung müssen Sie gewaltig löhnen, das ist Ihnen doch klar.«
»Natürlich.«
»Und das für eine Frau, an deren ehelicher Treue Sie zu Recht zweifeln. Seit langer Zeit schon.«
»Halt, nicht so schnell! Ich zweifele, ja, aber ich habe keine Beweise für Seitensprünge meiner Frau.«
»Die könnte ich Ihnen in der Akte zeigen«, erwiderte Grembowski geringschätzig. »Und offen gesagt, Herr Eckhoff – das glaube ich Ihnen nicht. Ein Mann wie Sie gibt sich nicht mit Zweifeln zufrieden, der sucht nach Beweisen.«
»Nein.«
»Ich denke mir, Sie wissen recht genau, wann und mit wem Ihre Frau Sie betrogen hat. Und der Gedanke, Sie sollten für diese Untreue bei einer Scheidung auch noch zahlen, hat Sie immer heftiger umgetrieben.«
»Wollen Sie damit etwa unterstellen …« Die Angst schnürte ihm die Kehle zu.
Grembowski verzog den Mund zu einem freudlosen Grienen. »Ich wälze so meine Gedanken, Herr Eckhoff.«
»Aber ich habe – wie kommen Sie darauf …?«
»Einer dieser hässlichen Gedanken lässt mich einfach nicht los. Was, wenn der Ehemann die Geduld verloren hat? Sich nicht länger zum Hampelmann machen lassen will? Überhaupt nicht mehr bereit ist, seiner Frau auch nur einen Pfennig zu zahlen?«
»Das kann – nein, das ist doch Unsinn …«
Grembowski beachtete sein Gestammel nicht. »Aber ein alter Bulle wie ich denkt nicht mehr gern kompliziert, der hat's lieber klar und gerade, der braucht für alles einen Grund, einen Anlass, ein Motiv. Was hat dazu geführt, dass der geduldige Ehemann plötzlich ungeduldig geworden ist? Hat ihm die Frau gestanden, dass da ein neuer Freund aufgetaucht ist, mit dem sie zusammenziehen will? Für den sie sich gern scheiden lassen will, was ihr nicht schwer fällt, im Gegenteil, sie rechnet gut und weiß deshalb, dass sie bei einer Scheidung nur gewinnen kann. Oder wie war das, Herr Eckhoff?«
»Quatsch, Blödsinn, nichts davon …«
Grembowski winkte lässig ab. »Es kann auch ganz anders gelaufen sein. Der Mann hat eine Freundin und überlegt immer häufiger, seine Frau loszuwerden. Ohne große Kosten. Haben Sie eine Freundin?«
»Nein«, antwortete er automatisch. In seinen Ohren sauste und brauste es. Dieser grobe Klotz konnte ihn doch nicht ernsthaft verdächtigen, er habe Julia beseitigt?
»Also keine Freundin?«, wiederholte Grembowski drohend.
Wie betäubt schüttelte Eckhoff nur den Kopf und spürte, dass ihm der Schweiß auf die Stirn getreten war. Das Atmen fiel ihm schwer, als habe er einen engen Ring um die Brust.
Nach einer bedrohlich langen Pause fuhr Grembowski fast gemütlich fort: »Okay, dann also nicht. Ich will Ihnen auch sagen, warum ich so deutlich mit Ihnen rede. Ihre Frau kennt das Wort Diskretion gar nicht. Gut, sie hat Ihnen die Seitensprünge nicht gerade auf die Nase gebunden, sich aber sonst nicht die geringste Mühe gegeben, sie vor anderen Menschen zu verbergen. Vielleicht wollten Sie auch nichts hören, sehen, sagen, kann sein. Aber weil es uns nicht die geringste Mühe gemacht hat, die früheren Liebhaber zu finden, irritiert mich, dass wir niemanden aufgestöbert haben, mit dem sie im Februar freiwillig weggelaufen sein könnte. Verstehen Sie das? Gäbe es da einen, würde ich vermuten, okay, sie ist ein Luder, ein Biest, gewissenlos und egoistisch, sie haut einfach ab und schert sich einen Dreck um den Ehemann. Der sie als vermisst anzeigt, weil sie tatsächlich ohne Piep und Kommentar verduftet ist. Aber diesen anderen finden wir einfach nicht, es gibt ihn nicht.«
»Mit anderen Worten – Sie glauben, ich habe meine Frau umgebracht und sie hinterher als vermisst gemeldet?« Eckhoff wunderte sich selbst, dass er diesen Satz klar und verständlich herausbrachte, obwohl seine Stimme versagen wollte.
Grembowski betrachtete ihn kühl: »In diesen unheiligen Hallen kommt es nicht auf Glauben an, Herr Eckhoff, hier zählen Wissen und Beweise. Guten Abend.«
Nach dem ersten Schock blieb er so ruhig, dass es ihn selbst erstaunte. Es war nur logisch, dass die Polizei den Ehemann ins Visier nahm. Von Anfang an hatte er zugegeben, dass es in ihrer Ehe gewaltig kriselte, und wenn ihn Julias spurloses Verschwinden auch beunruhigte – es bedrückte ihn nicht, er vermisste sie nicht. An die finanziellen Folgen einer Scheidung hatte er nie einen Gedanken verschwendet, am liebsten hätte er dem Grobian gestanden, dass er gern blechen würde, nur um endlich seine Ruhe zu haben und Julia loszuwerden. Aber Grembowski hätte ihm ohnehin nicht geglaubt. Und verrückterweise hatte er ihm mit seinen letzten Sätzen sogar das Gleichgewicht wiedergegeben: Beweise dafür, dass er Julia etwas angetan hatte, würde die Kripo nicht finden, weil es sie nicht gab.
Trotzdem rief er Bodo an: »Ich müsste dich mal sprechen.«
»Du hörst dich ziemlich besorgt an.«
»Bin ich auch. Etwas wenigstens. Heute Nachmittag war ich bei der Kripo und dieser Hauptkommissar Grembowski hat mir mehr oder minder offen an den Kopf geknallt, dass er mich für Julias Mörder hält.«
»Ach ja?« Bodo lachte, nicht im Geringsten erstaunt. »Das ist typisch Grem. Wie lange ist Julia – sechs Wochen? – und damit ist er erst heute rausgerückt? – Peter, mach dir nichts draus, Grem vermutet immer das Schlimmste.«
»Es ist nicht so schön …«
»Nein. Grem ist zwar ein Mistvieh, aber korrekt. Weil er mit der Routine nicht weiterkommt, hat er's mal mit einer kleinen Einschüchterung versucht. Die hat nichts gebracht, also macht er wie üblich weiter. Da musst du durch.«
»Du hast gut reden, Bodo.«
»Klar, weiß ich. Morgen bin ich völlig ausgebucht – was hältst du von Sonntag, zehn Uhr, auf dem Golfplatz?«
»Einverstanden. Wenn das Wetter mitspielt.«
*
Fast den ganzen Samstag hockte Eckhoff in der Firma und zerbrach sich den Kopf, warum zum Teufel seine schönen Roboter nach Monaten, in denen sie einwandfrei funktioniert hatten, plötzlich den Gehorsam verweigerten. In sein großes, leeres Haus zog ihn nichts und nach der kalten Dusche, die ihm der Hauptkommissar verpasst hatte, verspürte er wenig Lust auf andere Menschen, die sich natürlich alle sofort nach Julia erkundigten. Bisher hatte keiner seiner Freunde und Bekannten erkennen lassen, dass er ihn so direkt verdächtigte wie Grembowski, aber wenn er die letzten Wochen Revue passieren ließ, erinnerte er sich doch an eine gewisse Zurückhaltung. Oder eine verkrampfte Herzlichkeit. Möglich, dass er überempfindlich geworden war. Julia hatte in der Tat aus ihrem Treiben nie ein Geheimnis gemacht, einige Freunde hatten sich über ihren Lebenswandel empört, andere hatten ihn bestürmt, warum er sich das gefallen lasse. Auch Schadenfreude hatte er herausgehört. Selbst unter den Kollegen. Naiv, wie er in vieler Beziehung wohl war, hatte er sich nie vorgestellt, jemand beneide ihn oder wünsche ihm Schlechtes. Die Einsicht, dass er sich damit geirrt hatte, schmerzte, aber sie half ihm, noch mehr zu schweigen als früher. Als er zum ersten Mal bemerkte, wie sehr sich seine Umgebung veränderte, hatte er noch gedacht Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot. Doch das erklärte es nur zur Hälfte. Normale Menschen verkehrten nicht gern mit Menschen, um die ein Unglück oder ein Schicksalsschlag eine gläserne Wand gebaut hatte. Ungewöhnliches schloss das Unverbindliche aus. Die Überlegung, die er immer häufiger anstellte, hier alles aufzugeben, wegzuziehen, einen neuen Job zu suchen, hatte an Schrecken verloren und an Reiz gewonnen.
*
»Dieser April wird die bruchlose Verlängerung des Winters«, stöhnte Bodo. Es war lausig kalt, die Sonne versteckte sich hinter einem dünnen Wolkenschleier und alle fünf Minuten strich eine schwache Bö über den Golfplatz, die sie trotz Pullover und Handschuhen frösteln ließ. Aber ausnahmsweise hatte es zwei Tage lang nicht geregnet.
»Dafür haben wir den Platz für uns«, tröstete Eckhoff.
»Und hinterher die Bar.« Bodo Menzel hatte ein beachtlich niedriges Handicap, weil er, wie Eckhoff ihn hänselte, seine Rechtsgeschäfte am liebsten auf dem Golfplatz erledigte. Heimlich geschmeichelt widersprach der Anwalt wortreich, was niemanden überzeugte. Er bewegte sich gern im Freien und klagte Mitleid erregend, die Luft in den Gerichtsgebäuden löse bei ihm Asthma aus. Eine alberne Schwindelei für einen Mann, der sich an Volksmarathonläufen beteiligte. Eckhoff hatte sich oft über Bodos phänomenales Gedächtnis gewundert, bis Menzel ihm unter dem dicksten Siegel der Verschwiegenheit anvertraute, er sei Eidetiker. Was fast alles erklärte – er brauchte keine Akten, er hatte sie im Kopf.
Bis zum achten Grün hatte Bodo Eckhoff beruhigt. Hauptkommissar Grembowski, allgemein nur Grem genannt, müsse seinen Ruf als Grobian verteidigen. »Aber sein Äußeres täuscht, Peter, er ist ein gerissener, erfahrener Fuchs.«
»Und ich bin die Gans, auf die er anschleicht.«
»Wenn schon, der Ganter. Ich rede mit ihm, einverstanden?«
»Du bist mein Anwalt, du musst wissen, was am besten ist.«
Von Eckhoffs Gedanken, die Brocken hinzuschmeißen, zeigte sich Bodo wenig begeistert. Bei allem Verständnis für Peters Schwierigkeiten mit seinen Freunden und seiner Umgebung oder auch in seiner Firma – das sei keine gute Idee. Zwölf Monate müsse er abwarten, wenn er sich nicht ganz unnötig verdächtig machen wollte. »Bis dahin ist auch Julia wieder aufgekreuzt.«
»Dann glaubst du also auch …«
Eckhoff hatte seinen Ball in einen Bunker geschlagen und Menzel hielt ihn zurück. Nein, er glaube gar nichts. Im Moment vertraue er auf die Wahrscheinlichkeit, und die sprach dafür, dass Julia ihren Mann verlassen hatte. Mit der festen Absicht, ihm so viel Ärger wie möglich zu bereiten. Denn umgekehrt wurde aus dem, was Grembowski ihm vorgehalten hatte, ein Schuh: Julia würde ihm nichts schenken, keine müde Mark, die ihr nach Recht und Gesetz zustand. Von ihren sonstigen Ansprüchen ganz zu schweigen. Sie würde den lieben Peter bluten lassen, und das funktionierte nur, wenn sie wieder auf der Bühne erschien und sich einen Anwalt nahm.
»Und wenn sie nicht wieder auftaucht?«
»Hast du sie umgebracht?«
»Nein!«, brüllte Eckhoff empört.
»Na also! Wenn sie tot ist – ermordet, verunglückt, ertrunken, was weiß ich – wird man die Leiche eines Tages finden und dann bist du so oder so aus dem Schneider.«
»Manchmal glaube ich, unter deinen Vorfahren gibt's einen Fleischerhund.«
»Das nicht, aber einen berüchtigten Pathologen.« Menzel gluckste und deutete auf den Ball. »Ich drehe mich um und zähle die Schläge nicht.«
Er packte seine Reisetasche, als es schellte, und holte tief Luft, nachdem er die Haustür geöffnet hatte.
»Komm rein!«, sagte er müde und trat zur Seite.
»Danke.« Sie warf ihm einen halb zornigen, halb misstrauischen Blick zu, der ihm nicht entging. Also stand ihm eine Auseinandersetzung bevor und damit wurde ein beschissenes Wochenende beschissen abgeschlossen.
»Möchtest du einen Kaffee? – Entschuldige, nein, du bist ja Teetrinkerin. Oder etwas anderes?«
»Nein, danke, Peter. Ich will nur mit dir reden.«
»Über Julia.« Leise seufzend setzte er sich und starrte sie an. Blut ist doch dicker als Wasser, schoss ihm durch den Kopf.
»Natürlich. Sie ist jetzt seit genau sechs Wochen verschwunden.« Er nickte nur und zog den Aschenbecher heran. »Du musst doch eine Ahnung haben, wo meine Schwester steckt. Oder was mit ihr passiert ist.«
»Nein. Ich kann mich nur wiederholen, Luz: Ich habe nicht den Hauch einer Vermutung, wohin sie gefahren ist. Oder warum. Geschweige denn, mit wem.«
Ihr Gesicht zeigte, dass sie ihm nicht glaubte. So wenig wie Hauptkommissar Grembowski. Zu Anfang hatte er die Beamten regelrecht drängen müssen, eine Vermisstenanzeige aufzunehmen; Julia sei volljährig, und wenn er schon zugebe, dass es in ihrer Ehe gewaltig krache und sie am Abend zuvor lange und erbittert gestritten hätten, liege es doch nahe, dass sie fortgelaufen sei, vielleicht zu einem Freund, einer Freundin, zu Verwandten. Sie werde schon wieder auftauchen. Was sie nicht getan hatte.
»Ich traue Julia viel zu, aber sechs Wochen ohne ein Lebenszeichen?«
»So ähnlich hat sich am Freitag die Kripo ausgedrückt.«
»Die war also bei dir?«
»Nein, ich war ins Präsidium bestellt. Jetzt scheinen sie den Fall ernst zu nehmen. Erst jetzt.« Er lachte bitter, weil er verschwieg, was Grembowski wirklich vermutete.
»Tu doch nicht so! Du bist doch froh, dass du Julia los bist!«
»Soll ich dir zuliebe heucheln?«
»Nein, aber endlich die Wahrheit sagen!«, stieß sie heraus.
»Worüber?«
»Was an dem Wochenende wirklich passiert ist.«
Das hatte er ihr mehr als einmal erzählt. Am Samstagnachmittag war er gegen sechs Uhr aus der Tennishalle gekommen und Julia hatte ihn sofort mit Vorwürfen überfallen. Er vernachlässige sie, er lasse sie allein im Hause hocken, sein blödes Tennis sei ihm wichtiger als seine Frau, er kümmere sich nicht um sie, er treibe sich herum, er sei nie zu Hause, er liebe sie nicht mehr, er denke nur noch daran, wie er sie abschieben könne, er sei ein Ekel, demütige und tyrannisiere sie; wenn man ihr zuhörte, war er der Abschaum der Menschheit, ein Widerling und Geizkragen, ein Versager und brutaler Macho, der ihr Leben, ihr Glück, ihre Zukunft zerstört hatte. Sie stritten nicht zum ersten Mal, aber solch einen hysterischen Ausbruch hatte er bei ihr noch nicht erlebt, und richtig zu kreischen und zu toben begann sie erst, als er ihr lautstark anbot, sich zu trennen und endlich die Scheidung einzuleiten.
Um ihr Geschrei zu ertragen, hatte er sich die Cognacflasche geholt. Was sich als Fehler herausstellte, Julia schaffte es, ihn auf neunundneunzig zu bringen, und er torkelte erst ins Bett, als die Flasche leer war. Am Sonntag wachte er kurz vor Mittag mit einem gewaltigen Brummschädel auf und da hatte sie das Haus bereits verlassen – in ihrem Auto. Und später suchte er vergeblich nach ihrem Pass und Personalausweis – wie nach den Schecks und Kreditkarten; doch bis zum vorigen Donnerstag hatte sie keinen Scheck eingelöst und keine ihrer Kreditkarten benutzt.
»Peter, das kann nicht die ganze Wahrheit sein …«
»Von meiner Seite aus – doch, Luz.«
Vor zehn Jahren hatte es zwischen ihm und Luzia geknistert, bevor er die jüngere, hübschere, lebhaftere, aber eben auch verwöhnte, anspruchsvolle und launische Schwester Julia geheiratet hatte. Den Fehler sah er rasch ein, aber Luz hielt ihn auf Distanz, hörte sich die Klagen von Schwester und Schwager schweigend an und bezog keine Stellung. Nie, mit keinem Wort, ließ sie erkennen, ob sie das Scheitern der Ehe begrüßte oder bedauerte. Sie war nur drei Jahre älter als Julia, aber hatte nach dem Tod der Mutter deren Rolle bei Julia übernommen, weil der Vater sich zur Erziehung oder gar zur Herzlichkeit als unfähig und unwillig erwies. Für den Schwager Peter brachte sie immer noch Sympathien auf, obwohl seine Entscheidung für Julia sie verletzt und gekränkt hatte. Geheiratet hatte sie nicht und der letzte Mann, mit dem sie zusammengelebt hatte, war vor zwei Jahren von seiner Firma nach Südamerika versetzt worden und hatte sie nicht gefragt, ob sie mitkommen wolle.
»Und wie soll es jetzt weitergehen?«
»Ich weiß es nicht. Irgendwann wird sich Julia melden.«
»Glaubst du denn, dass sie mit einem anderen Mann weggelaufen ist?«
»Kannst du dir vorstellen, dass sie wirklich ohne einen Dussel auskommt, der sie pausenlos bewundert, auf Händen trägt und alle ihre Wünsche erfüllt?«
Bei seinem scharfen Ton zuckte sie zusammen. Es war schon merkwürdig, wie unterschiedlich sich Schwestern entwickeln konnten, äußerlich und im Charakter. Julia war zum süßen, verführerischen Blondchen mit einem wunderschönen Busen, biegsamer Figur und sanftem Blick herangewachsen; sie erwartete, dass ihr alle Welt zu Füßen lag, und viel zu spät hatte Eckhoff erkannt, dass sie in einem Punkt gerissen war: Ihren grenzenlosen Egoismus verbarg sie perfekt hinter schmeichelnder Anschmiegsamkeit, die präzise in der Sekunde endete, in der ihr etwas verweigert wurde. Luzia stand auf eigenen Füßen und ließ sich nichts schenken. Sie schmeichelte und schmiegte sich nicht an, sie war aufrichtig und selbstständig, was Eckhoff an Julia immer schmerzhafter vermisst hatte.
»Wenn sie – wer sollte dieser Mann sein?«
»Du weißt doch, dass sie Weltmeisterin im Lügen und Verschweigen ist.«
Nach einer Weile stöhnte Luzia und holte Zigaretten aus ihrer Handtasche. Als er sich vorbeugte, um ihr Feuer zu geben, musterte sie ihn einen Moment unschlüssig. »Ich darf gar nicht an meine Telefonrechnung denken«, murmelte sie.
»Ich auch nicht«, stimmte er gelassen zu.
»Niemand hat etwas von ihr gehört.«
»Du hättest lieber fragen sollen, mit wem …«
»Auch das habe ich getan. Ohne Ergebnis.«
»Wie bei mir.«
»Und was willst du jetzt tun?«
»Nichts. Ich warte geduldig, bis sie wieder aufkreuzt.«
»Oder bis die Polizei sie findet.«
»Auch das.«
»Hast du mal daran gedacht, einen Privatdetektiv zu engagieren?«
»Nein, Luz. Wie du selbst ganz richtig geurteilt hast – ich bin heilfroh, dass sie weg ist. Und ich werde keine müde Mark dafür opfern, sie zu finden.«
Ihr Gesicht vereiste. Sie liebte ihre Schwester nicht, das musste sie vor ihm nicht eigens aussprechen, aber sie würde Julia nicht gleichmütig abschreiben wie einen wertlosen Gegenstand, den man irgendwo verloren hatte und der die Mühe nicht lohnte, sich im Fundbüro zu erkundigen. Wortlos stand sie auf und er begriff, dass auch sie ihn jetzt verdächtigte, Julia etwas angetan zu haben.
Führerschein, Wagenpapiere, Ausweise, Schlüssel, Brieftasche, Schecks, Portemonnaie – er klopfte seine Taschen ab, alles da. Reisetasche für eine Übernachtung; Aktenkoffer mit Diskette und Unterlagen. Vor der Haustür drehte er sich noch einmal um. Sollte Julia sich in den beiden nächsten Monaten nicht melden, würde er das Haus trotzdem verkaufen. Selbst wenn Bodo Menzel abriet.
Auf der Autobahn herrschte so wenig Verkehr, dass er flott vorankam. Als unvermutet die Sonne durchbrach, fiel ihm der Kinderspruch ein: April, April, der macht, was er will.
Der dicke Singer strahlte: »Mensch, Herr Eckhoff, das ging ja schnell.«
»Wunder werden prompt erledigt, Unmögliches dauert etwas länger.«
»Darauf einen Kaffee?«
Eckhoff grinste. Als er seinen Wagen auf dem Parkplatz der Firma Gebr. Wenger Galvanotechnik abstellte, hatte er mit sich selbst gewettet, dass Singer spätestens im vierten Satz einen Kaffee anbieten werde. Der Werksleiter schien in dem schwarzen Gebräu zu baden: Es waren Furcht erregende Mengen, die er in sich hineinschüttete. Bei ihrem ersten Gespräch, das ziemlich genau zwei Stunden dauerte, hatte Singer zwölf Tassen getrunken; seine Sekretärin seufzte nur ergeben und brachte ohne Aufforderung eine neue Thermoskanne ins Zimmer. Äußerlich schien es ihm nicht zu schaden; er schleppte wohl zehn Kilo zu viel mit sich herum, aber die beschwerten ihn nicht, jedenfalls litten weder seine Lebhaftigkeit noch seine Zähigkeit darunter. Sehr viel später fiel Eckhoff auf, dass Singer keinen Alkohol trank, und heute vermutete er, dass der Dicke, wie er im Betrieb allgemein genannt wurde, eine Entziehung hinter sich hatte. Der Sucht nach Alkohol widerstand er, aber der große Durst war geblieben.
»Also, was haben wir falsch gemacht?«
»Ich fürchte, Sie haben einen Oberschlauen in Ihren Reihen.« Eckhoff klappte den Aktenkoffer auf und holte die Computerausdrucke heraus. Singer zog den Kopf ein. »Wir haben aus gutem Grund im Steuerprogramm einige Schrittkombinationen ausgeschlossen. Ein Schlaumeier hat das entdeckt und die entsprechenden Befehle eliminiert.«
»Im Steuerprogramm?«
»Genau dort, Herr Singer. Nicht auf der Anwenderebene, sondern im Steuerprogramm.«
»Mir schwant Fürchterliches.«
»Das sollte es auch. Denn Ihr Cleverle hat übersehen, dass wir diese Befehle nicht aus Daffke eingearbeitet haben, sondern mit Rücksicht auf die mechanische Belastbarkeit der Arme.« Er schob den Ausdruck mit den gelb markierten Zeilen herüber, doch Singer schüttelte den Kopf. Mit der Mechanik der Roboter, die sie aufgestellt hatten, kannte er sich aus, als gelernter Ingenieur konnte er auch die Kräfte und Belastungen ausrechnen, aber bei der Steuerelektronik streikte er.
»Ich zeichne Ihnen mal auf, was passiert ist …«
Der Roboterarm nahm das direkt vor ihm liegende Werkstück auf, und zwar automatisch; Sensoren tasteten die Oberfläche ab und steuerte die beiden Backen der Greifzange so, dass sie mit größtmöglichem Öffnungswinkel das zu transportierende Stück an der Stelle seiner größten Ausdehnung einklemmten.
»Klar, damit der Anpressdruck möglichst gering gehalten werden kann.«
»Eben. Um das Werkstück nicht zu verformen.« Das Werkstück wurde automatisch gewogen, bevor die Greifer zulangten, und aus dem Gewicht errechnete die Steuerung einen maximalen Anpressdruck.
»Das Stück kann zwischen einem Kilo und einer Tonne wiegen.«
Singer nickte ungeduldig. Tausend Kilogramm zu heben, erforderte eine bestimmte Kraft respektive einen bestimmten Druck in den Hydraulikzylindern, deren Kolben den Arm nach oben drückten. Aber eben auch eine gewisse mechanische Steifigkeit des Arms und seiner Gelenke. Oder anders: eine gewisse Größe, um ein Tonnengewicht mit maximaler Streckung des tragenden Arms von fast sechs Metern anzuheben und auf einen halben Millimeter genau in die diversen Galvanisier-Becken zu befördern. Um diese Größe zu begrenzen, wurden die Greiferhebel von anderen Steuerarmen, die als diagonale Verstrebungen montiert waren, unterstützt und entlastet. Diese Hilfsarme wurden zwar auch hydraulisch verlängert oder verkürzt, aber darüber hinaus besaßen sie mechanische Verriegelungen.
»Das Verriegeln dauert eben.«
Jetzt grinste Singer betreten. Na klar, Junge, es dauerte, aber Zeit kostete Geld, und Eckhoff verdächtigte seit der ersten Alarmmeldung den Dicken, einen Mitarbeiter auf das Betriebsprogramm angesetzt zu haben. Da eine Sekunde abgeknapst, dort ein halbe eingespart, das läpperte sich bei zwölf Stunden Arbeitszeit.
»Erst wenn die Verriegelung gefasst hat, wird die Drehautomatik freigegeben.«
»Alles klar.«
»Sie haben diese Wenn-dann-Logik überlisten wollen und die Drehbewegung eingeleitet, bevor die Stützarme mechanisch arretiert waren.«
»Ich?« Ein Baby konnte nicht harmloser dreinschauen und Eckhoff winkte ab: »Sie sind der Chef und verantwortlich für Ihre Leute.«
»So, so.«
»Ich habe übers Wochenende nachgerechnet. Ihren Wunsch, den Roboter zu beschleunigen, verstehe ich ja, aber bei Gewichten über 325 Kilogramm müssen Sie beim alten
Schema bleiben: erst heben, dann verriegeln, danach drehen.«
»Und diese erfreuliche Verbesserung haben Sie programmiert?«
»So ist es.« Mit der Diskette wedelte er vor Singers Gesicht herum. »Und das machen wir schriftlich. 325 Kilo, keines darüber … Herr Singer, ich erkenne dieses Leuchten in Ihren Augen. Warum 325 und nicht 350? Da könnte man doch im Programm zwei Zeilen verändern …«
»Schon verstanden, Herr Eckhoff.«
Die Steuerungscomputer für die sechs Roboter standen in einem separaten Raum mit Klimaanlage. Sie mussten zehn Minuten warten, bis in der Produktion eine Pause eintrat und Singer die zweite Arbeitsstraße stilllegen konnte. Das Löschen des manipulierten Programms und das Einspielen der korrigierten Fassung dauerte eine Viertelstunde, in der Singer vor Ungeduld von einem Fuß auf den anderen trat. Aber Eckhoff kannte den Dicken lange genug, um nicht nervös zu werden. Hetzen ließ er sich nicht und Singer wusste selbst viel zu gut, was es bedeutete, wenn ihnen ein überlasteter Roboter in der Produktion zusammenbrach.
»Dann schauen wir mal …«
Die Gebrüder Wenger hatten vor achtzig Jahren als kleiner Galvanisierbetrieb angefangen. Aber beim Galvanisieren war es nicht geblieben, das machte heute nur den kleinsten Teil des Umsatzes aus. In den beiden lang gestreckten Hallen wurden alle möglichen Oberflächen mit allen möglichen Schutzschichten überzogen, in Tauchbädern, Brennöfen, Elektrolysebecken und seit neuestem auch in Vakuumkammern bedampft. Längst handelte es sich nicht mehr nur um Stahl oder Eisen, Holz wurde behandelt, Kunst- und Faserverbundstoffe oder keramische Teile. Einen Wenger gab es nicht mehr, nach äußerst komplizierten Erbgängen hieß der Chef heute Falkenstein, und Gero von Falkenstein war eines Tages bei Kortmann & Schräder erschienen: »Sie müssen mir helfen. Zuerst hab ich die Umweltschutzauflagen erfüllt und bin fast Pleite gegangen. Dann ist mir die Gewerbeaufsicht auf den Pelz gerückt, ich würde meine Leute vergiften. Jetzt soll ich winzige Stückzahlen betriebswirtschaftlich vernünftig bearbeiten. Menschen kann ich mir nicht mehr leisten, also brauche ich Roboter.«
Für Eckhoffs Firma kam Gero von Falkenstein gerade zur rechten Zeit. Kortmann & Schrader hatten japanische Industrieroboter importiert und aufgestellt, aber das Geschäft lief recht flau. Wenn ein Roboter immer wieder dieselbe Tätigkeit ausführen musste, zum Beispiel Punktschweißen oder Umsetzen von Werkstücken, übertraf er jede menschliche Leistung. Doch wenn Flexibilität gefordert war, die Maschine sich nach zwei Durchgängen automatisch auf einen anderen Arbeitsablauf einstellen musste, hakte es. Die populäre Bezeichnung »intelligente Roboter« führte in die Irre, gebraucht wurden zuverlässige, flexible Maschinen, und diese Roboter mussten weitgehend automatisch gesteuert werden, ihre Bewegungsabläufe nach dem heranrollenden Werkstück selbst errechnen und umsetzen. Ein Jahr hatten sie konstruiert und erprobt, acht Monate lang war Eckhoff zwei, manchmal fünf Tage pro Woche hier herumgeturnt, inzwischen funktionierten die Roboter so zuverlässig, dass Singer den nächsten Schritt wagte: Wie konnte man sie beschleunigen?
In der fast menschenleeren Halle roch es nur noch schwach säuerlich.
»Als nächstes müssen wir an die Vorbereitung ran«, murmelte Singer und wuselte in einem Tempo, das man ihm nicht zutraute, an den Maschinen vorbei in einen abgetrennten Teil. Hier bewegten sich noch Menschen, die anpacken mussten, Flaschenzüge klirrten, Kräne brummten, und vor den vier großen Holzkisten lachte Eckhoff laut auf: »Was ist denn das?«
»Eine milde Gabe der sächsischen Schlösserverwaltung. Die vier Elemente, Gips auf Flechtgerüst, die vergoldet werden sollen.«
Eine halbe Stunde sah Eckhoff schweigend zu, Singer hatte sich davongeschlichen. Zwei Arbeiter dirigierten eine Laufkatze über die Kiste heran und befestigten die Drahtseile am Sockel einer Figur, das gute Stück wurde vorsichtig aus der Kiste herausgehoben und in eine Art Wanne umgesetzt, die auf Rollen lief. Ein Mitarbeiter betätigte einen Schalter, die Wanne mit der Figur bewegte sich im Millimetertempo auf ihn zu, bis eine aus der Wanne hervorragende Nase vor seinem Stand stehen blieb, mit einem Millimeter Abstand zu einer spiegelbildlich geformten Platte. Im Hallenboden waren Kabel verlegt, mehrere Empfänger pro Wanne nahmen induktiv die Steuersignale auf, ein Computer berechnete den Weg zu der richtigen Bearbeitungsstraße in der benachbarten Haupthalle und sorgte dafür, dass die Wannen nicht kollidierten. Wenn Hochbetrieb herrschte, sah es schon putzig aus, wie sich die Wannen langsam quer zu den Öffnungen hin bewegten und Zusammenstöße vermieden. Der Mann hatte inzwischen die Daten zu der Figur eingetastet: Material, gewünschter Überzug, Behandlungsmethode. Eine Waage und mehrere über- und nebeneinander angeordnete Laser mit Empfangsoptiken in den Durchbrüchen zur Bearbeitungshalle maßen Größe und Gewicht, daraus errechnete ein Computer die Stabilität des Werkstücks während des Transports; alle Angaben wurden über die »Nase« und die Antennenplatte übertragen und im Kleincomputer der Wanne gespeichert. Ab jetzt war menschliches Eingreifen nicht mehr erforderlich; Eckhoff wartete, bis die Wanne im Messkanal verschwunden war, und schlenderte in die Haupthalle. Vor den diversen Behältern und Kesseln besaß er einen Heidenrespekt, von Chemie verstand er wenig und deswegen nahm er die Sicherheitsvorschriften sehr ernst, zog den Schutzanzug über, setzte Helm und Brille auf und vergewisserte sich, dass die Atemschutzmaske am Gürtel hing.
Vier schwere, zerbrechliche, sperrige Figuren; Singer stöhnte pausenlos, die Aufträge würden immer komplizierter und die Stückzahlen pro Auftrag immer kleiner. Wie sollten sie dabei noch auf ihre Kosten kommen? Die Wanne tauchte aus dem Messkanal auf und bewegte sich zielstrebig auf eine Art Gasse zu, an der rechts und links Roboter standen, stoppte. Zwei Roboter schwenkten ihre Arme; bei der Arbeitsvorbereitung hatte der Mann eingegeben, dass sie ausnahmsweise nicht an der Stelle des größten Umfangs zugreifen sollten, sondern sich den Sockel schnappen mussten, um die Figur nicht zu beschädigen. Was sie auch taten, Eckhoff schmunzelte, die Unterstützungsarme fuhren aus, er sah, wie die mechanische Verriegelung einrastete, und dann erst klappten die Arme mit der Figur hoch, wurden länger, die Roboter drehten sich gegensinnig, wobei sie die Arme hydraulisch ausfuhren, bis sie mit ihrer Last über einem Kessel angelangt waren, dessen Wand gut vier Meter von der Wanne entfernt war; die Arme knickten in den mittleren Gelenken ab, dann in den vorderen, die melancholisch lächelnde Erd-Göttin verschwand in der Tiefe und tauchte in das fettlösende Reinigungsbad.
Aus dem Messkanal bewegte sich die nächste Wanne heran. Eckhoff brummte zufrieden und verließ die Halle.
*
Bevor Singer ihn in die Kantine verschleppte, fragte Eckhoff, ob er einmal telefonieren dürfe.
»Na sicher doch, in meinem Büro, den Weg zu unserer Vergiftungsanstalt finden Sie wohl selber, wie?« Dabei schüttelte es den Dicken vor Vergnügen.
Er ließ es achtmal klingeln, aber Charly hob nicht ab. Vielleicht eine Konferenz, er würde es später noch einmal versuchen.
An ihrem Vierertisch hatte die Fachsimpelei begonnen. Vergolden und versilbern war ja gut und schön, aber lohnte es wirklich? Oder musste man nicht ehrlicherweise gestehen, dass man höchstens zum Selbstkostenpreis, wenn nicht darunter, eine Leistung anbot, um im Geschäft zu bleiben? Singer zuckte die Achseln, mit den beiden alerten jungen Typen aus der Kalkulation schien er sich nicht übermäßig gut zu verstehen, und Eckhoff schwieg. Im Grunde seines Herzens bezweifelte auch er, dass Falkenstein die richtige Politik verfolgte, durch intelligente, aber teure Investitionen alle Aufträge zu erfüllen. Aber Eckhoff wusste eben auch, dass Gebr. Wenger Galvanotechnik seiner Firma eine einmalige Gelegenheit geboten hatten, ihr Konzept der dezentralen Steuerung und flexiblen Roboter praktisch zu erproben. Wie Falkenstein das finanziell verkraftete, interessierte ihn nur am Rande. Am Wochenende hatte er im Büro gehockt, um herauszufinden, warum ihre Roboter plötzlich den Dienst verweigerten, und am Samstag war der alte Schrader gegen Mittag in sein Büro geschlurft: »Was führt Sie denn am heiligen Sonnabend in diese unheiligen Räume?«
Nachdem er geschildert hatte, was ein Schlaukopf bei Gebr. Wenger angerichtet hatte, war Schrader lange stumm geblieben. Daran musste man sich gewöhnen, der Grauhaarige redete nicht viel, verließ oft grußlos Sitzungen und verschickte Stunden später durch seine Sekretärin kleine Zettelchen mit Anweisungen oder Lösungen.
»Hoffentlich hält Falkenstein durch. Wir müssen ihm helfen, auch in unserem Interesse.«
»Ich bin Montag und Dienstag dort.«
Schrader hatte sich umgedreht und war ohne ein Wort gegangen.
Ihr ehemals gutes Verhältnis hatte sich abgekühlt. Die Kalkulation aus Eckhoffs Abteilung für den Wenger-Auftrag hatte Schrader freihändig nach unten korrigiert; nun gut, ihm gehörte der Laden zur Hälfte, sollte er; aber Eckhoff hätte schon gern gewusst, warum Schrader ihn seitdem ausgesprochen kühl behandelte: Ärgerte er sich über die Verluste aus dem Wenger-Auftrag oder wollte er den Mitwisser seines Fehlers vergraulen? Zu einer Stellungnahme war er nicht zu bewegen und deshalb hatte Eckhoff mehr als einmal überlegt zu kündigen. Von Alfred Kortmann, dem zweiten Eigentümer, war keine Einmischung zu erwarten. Mit 41 Jahren wurde es für Eckhoff höchste Zeit, an seine berufliche Zukunft zu denken.
*
Bis kurz vor fünf Uhr stand er mit Singer vor zwei Reißbrettern. Natürlich verstand der Dicke, seine CAD-CAM-Computer zu bedienen, aber wenn er knobelte, brauchte er Papier und Bleistift, dazu zwei Zeichenbretter, um die er herumlaufen konnte. Und Abstellmöglichkeiten für seinen Kaffeebecher. Seit er einen Becher so unglücklich umgestoßen hatte, dass der Kaffee in den Computer gelaufen und der mit einem genialischen Kurzschluss abgeraucht war, achtete er auf Abstand zu seinen elektronischen Helfern.
»Vakuumbeschichtung, Herr Eckhoff. Dünnschichten, Molekularstrahlepitaxie, Dampfphasenabscheidung. Das marschiert gerade mit Riesenschritten aus den Labors in die Produktion.«
»Davon verstehe ich nichts, Herr Singer.«
»Brauchen Sie auch nicht. Aber Sie könnten uns bei zwei Problemen vielleicht helfen. Erstens müssen wir die Werkstücke exakt positionieren. Was Zeit kostet.«
»Zeit ist Geld.«
»Sag ich doch immer. Und dann dieses verfluchte Vakuum.«
»Wieso verflucht …?«
»Kostet Zeit. Sie öffnen die Kammer, wuff, das Vakuum ist zum Teufel. Kammer geschlossen, Vakuumpumpe angestellt. Sie warten und warten. Und Energie schlucken diese Anlagen auch.«
Das leuchtete ein und Singer zeigte ihm mehrere Entwürfe für Dampfphasenabscheider-Kessel. Gab es eine Möglichkeit, die Werkstücke auf Zehntelmillimeter genau in Position zu bringen? Und zwar dalli, dalli!
»Trinken Sie keinen Kaffee, Herr Eckhoff?«
»Schon, aber ich will nicht ersaufen.«
»Alles Trainingssache. Können Sie sich eine Konstruktion vorstellen, in der beim Beladen das Vakuum erhalten bleibt?«
»Zwillingskessel. Sie öffnen den einen, indem Sie ihm die Luft aus dem anderen zuführen.«
»Was nach den unschönen Gesetzen der Physik dazu führt, dass nachher gleicher Druck in beiden herrscht und ich doch noch abpumpen muss.«
Als Singer die zweite Thermoskanne aufschraubte, gestand er, dass sie natürlich mit einem – hm – großen Elektrokonzern zusammenarbeiteten. Oberflächenätzung im Nanometer-Bereich; Eckhoff lächelte schräg. Von Elektronik verstand er genug, um Singers Andeutung sofort zu verstehen. Chips sollten immer kleiner und leistungsfähiger werden, doch der Dicke hob mahnend einen Finger: »Richtig, das ist aber nur die halbe Wahrheit. Herr Eckhoff, die Biester strahlen Wärme ab und ich zerbreche mir den Kopf, welches press- und gießbare Material die größte Wärmeleitfähigkeit besitzt.«
»Bei möglichst unendlich großem elektrischen Widerstand.«
»So ist es.«
Zwischendurch rief Eckhoff noch zweimal bei Charly an, aber sie ging nicht ans Telefon. Langsam beunruhigte es ihn.
Bis zum Dienstschluss berieten sie eine andere technische Verbesserung der Roboter. Um die diversen Kessel und Tanks und Behälter möglichst nahe an der Rollbahn der Wannen zu platzieren, mussten sie auf Ausgleichsarme mit Gewichten – wie bei Turmkränen – verzichten; das senkrechte Gestell hatte also die gesamte Belastung aus Last mal Lastarm aufzunehmen und die Biegemomente erforderten stabile, schwere Gestelle. Singer hatte sich in den Gedanken verrannt, man könne das Tragegestell nach hinten kippen, sobald durch die Drehung der Grundplatte Platz dafür geschaffen wurde, so dass das Metazentrum aus der Kraftsenkrechten herauswanderte, und Eckhoff rechnete ihm vor, dass dadurch wenig gewonnen wurde, aber viel an Mechanik investiert werden musste. Völlig überzeugen konnte er den Dicken nicht, der ihn bat, sich trotzdem darüber einmal Gedanken zu machen.
»Wird erledigt, Herr Singer.«
»Und wenn Sie mir versprechen, meine schönen Aufdampfungsreaktoren nicht in der Zeitung zu veröffentlichen, dürfen Sie einen Satz Kopien mitnehmen.«
Eckhoff dachte an Schraders Befehl – die Korrektur der Kalkulation war so gut wie ein Befehl gewesen – und nickte stumm.
»Was machen Sie heute Abend?«
»Ich weiß noch nicht, vielleicht fahre ich gleich zurück.«
»Oha!« Singer kollerte vergnügt. »Sie hatten sich also auf eine Übernachtung eingerichtet.«
»Ich ahnte nicht, dass Sie ein so schlechtes Gewissen hat- ten, dass Sie das geänderte Betriebsprogramm sofort akzeptieren würden.«
»Eins zu null für Sie. Bis dann also.«
*
Auf dem Parkplatz fröstelte Eckhoff. Zwar schien die Sonne immer noch, aber selbst für Anfang April war es verflixt kühl und am Himmel trieben eilig vereinzelte, dicke Regenwolken. Auch beim letzten Anruf hatte sich Charly nicht gemeldet. Er überlegte. Heimfahren? Was sollte er in seinem leeren Haus? Lieber in der Eichendorffstraße warten; irgendwann musste Charly ja nach Hause kommen, es waren keine Ferien und sie klagte regelmäßig über die vielen Konferenzen und Besprechungen in der Schule.
Die Eichendorffstraße hatte ihm schon beim ersten Besuch gefallen, eine ruhige Wohnstraße mit breiten Bürgersteigen, vielen Bäumen und gepflegten Gärten vor den dreistöckigen Mietshäusern und alten Villen, die liebevoll restauriert worden waren. Hier gab es keinen Durchgangsverkehr, und vom Lärm der Stadt war auf dem Hügelhang nichts zu hören. Charlotte Gerber wohnte im zweiten Stock eines Dreifamilienhauses und räumte ein, dass sie mit der Wohnung in jeder Hinsicht – Lage, Miete, Nachbarn – unverschämtes Glück gehabt hatte. Wenn, dann gab es nur einen Nachteil: Sie musste ihr Auto auf der Straße parken, und das bekam dem kleinen, roten Uraltmodell ausgesprochen schlecht. Es rostete fröhlich vor sich hin, beim nächsten Mal würde sie nicht durch den TÜV kommen. Missbilligend inspizierte Eckhoff die Löcher in der Tür.
Viertel nach fünf, er klingelte vergeblich und setzte sich in sein Auto. Auf eine Stunde kam es jetzt auch nicht mehr an.
Charlotte Gerber hatte er in einem Restaurant kennen gelernt. Seit zwei Tagen bauten sie die Roboter auf, Singer tanzte begeistert um die Monteure herum und sprudelte über vor guten Ideen, die er vor Monaten hätte äußern sollen, und Eckhoff musste sich zusammenreißen, um nicht grob zu werden. Abends platzte ihm der Kopf, er behauptete, eine Verabredung zu haben, und suchte sich ein Lokal, wo er ungestört essen wollte. Das Restaurant war gut besetzt, die Bedienung zeigte ihm schweren Herzens den letzten freien Vierertisch und zwanzig Minuten später fragte eine junge Frau in aggressivem Ton, ob an seinem Tisch noch ein Platz frei sei.