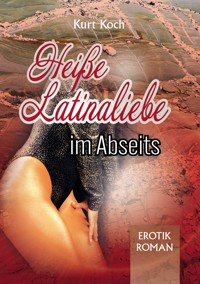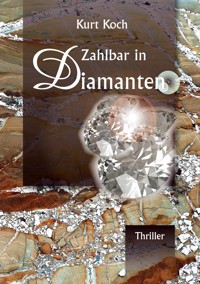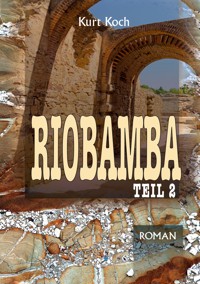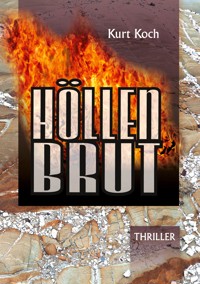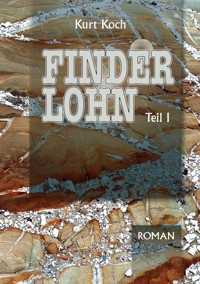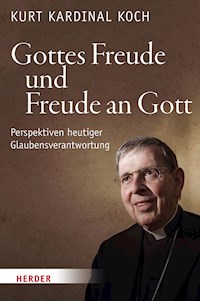Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Autobiographisch Koch in einer Bananenrepublik Von Weilerbach nach Quito/Ecuador. Kochs erste Station in 3000 m über NN auf dem Äquator, bei "meinen" Indios. Ihre täglichen Demütigungen durch die weißen "Eroberer", ihr Elend, Deutsche Pädagogen sind Plünderer Nummer eins der uralten Kulturgüter. Und vieles andere aus einer erwachenden Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ecuador im Jahr 1957
(Die nicht unterstrichenen Angaben Angaben sind der Zeit entsprechend „Ungefährwerte“)
Amtssprache Spanisch, für „interkulturelle Beziehungen“ die Sprache der Ureinwohner - Kichwa
Hauptstadt Quito
Staatsform Republik
Regierungssystem Präsidialsystem
Staatsoberhaupt, zugleich Regierungschef
Fläche 283.561 km2
Einwohnerzahl 6,5 Mil.
Bevölkerungsdichte 43,5 Einwohner pro km2
Währung Sucre
Unabhängigkeit 1821 (von Spanien)
Laut UNO-Statistik 1958
54% Indigene Bevölkerung
8% Weiße
38% Ethnische Mischungen
Inhalt
Das Schlüsselerlebnis
Das Angebot, das ich nicht abschlagen konnte
Die Reise - Mai 1957
Der Ankerplatz mitten im Fluss
In Quito - (m)eine Einführung
Einblicke in meine Arbeitswelt
Unser Hausberg
Kegelbruder und Kriegsverbrecher
Bauernopfer Minister
Von wegen: <Geld stinkt nicht>
Nochmals Beltrán
Unser Kundenbetreuer
Der Clou
Der Neubau und andere Fortschritte
Die Moderne kommt nach Ecuador
Die Helden der Nation
Quito und andere Städte
Ambato - ciudad de flores - die Blumenstadt
Reisen - in der Stadt, über Land
Der „Express“
Die Mutter so mancher Reise
1957 Seit Oktober in Ambato
Silvester 1957- auf in den Urwald
Der Inhalt - ein Geständnis
Ich gestehe und versichere jeder verehrten Leserin und jedem geehrten Leser, dass mich mein Textaufbau als auch meine Ausdrucksweise als echten Pfälzer ausweisen.
Der Autor Kurt Koch
Das Schlüsselerlebnis
Ich: In Weilerbach. Ganz jung und wissbegierig.
Es war ein Abenteuerbericht. Ein richtiges Buch.
Ich hatte es aus der neu eröffneten Pfarrbücherei ausgeliehen. Es war mein erstes Buch überhaupt, das ich ganz offiziell auslieh und somit der Vorgang ordentlich bürokratisch besiegelt wurde. Auch das war schon eine neue Erfahrung für mich. Bücher musste man nicht unbedingt besitzen - kaufen.
Es war kurz nach dem schrecklichen Krieg. Und ich kann mir heute denken - nein, ich bin mir sicher - dass eine solche Bücherei unter der Schirmherrschaft einer Religion im Dritten Reich nicht besonders beliebt und deshalb auch nicht geduldet wurde. Nun waren alle, die es wirklich wollten, wieder in der Lage über den geistigen Stacheldrahtverhau weit nach draußen zu blicken.
Das Buch erzählte aus einem fernen <wilden Westen>.
Dieser lag aber doch etwas weiter südlich als der gemeinhin als Indianerwesten bekannte, innere Teil der Nordamerikanischen Landmasse. Western waren mir, wie auch andere „richtige“ Bücher, noch unbekannt. Es vergingen noch Jahre, bis mir dann Karl May <seine/meine Einstellung dazu vermittelte>.
Bis dahin hatte ich die Märchen der Gebr. Grimm in mich aufgenommen, zunächst gehört und dann selbst gelesen. Ich kannte sie so gut wie alle auswendig.
Von daher war es nun auch das erste Buch, das ich bewusst und auch mit großer Begeisterung in mich aufgenommen hatte. Es ließ mich nicht mehr los. Ich verschlang es. Las manche Abschnitte mehrmals. Gewisse Teile konnte ich sogar so gut wie auswendig hersagen - nach nur einmaligem lesen. Bestimmte Textteile hatten sich regelrecht unauslöschlich in meinem Gedächtnis eingebrannt.
Ich träumte davon. Ich erdachte mir neue Abenteuer, mit denen ich Abschnitte des Buches ergänzte. Ich stellte mir immer wieder vor, wie dies oder jenes gewesen sein musste, in einem Land, das noch so gut wie <unentdeckt> war. Unbekanntes wartete, aber mit vielen Indianern - die ich im Laufe der Zeit in meiner Vorstellung gerne mehr und mehr mit jenen wilden federgeschmückten Helden viel weiter nördlich vermischte.
Die Tropen! Warm, Sonne, Palmen, aber auch gefährliche Tiere. Viele Gebiete unzugänglich, noch unerforscht. Bedeckt mit Urwald. Träumerei pur. Ohne laufende oder auch nur stehende Bilder. Urwald - Berge - Schluchten - Flüsse - Vulkane, es gab ja noch sooo viel zu tun, um sie zu sehen, zu erleben.
Wann immer ich zu Träumereien aufgelegt war oder die Gelegenheit hatte, dann war es da, Ecuador. Ein Land, das in meiner Fantasie immer mehr zu einem festen Begriff wurde. Ein Land, das die Tatkraft tüchtiger, europäischer Menschen benötigte. Menschen die bereit waren Strapazen auf sich zu nehmen und dafür miterleben durften, wie der Fortschritt einzog, das bescheidene Wohlergehen der Menschen dort sich verbesserte.
In „meinem jugendlichen Leichtsinn“ hatte ich einmal mit dem Gedanken gespielt Missionar zu werden. Ich verliebte mich in diesen Gedanken und stellte mir vor, dass ich als solcher dann in „vorderster Front“ bekehren und somit natürlich auch die allereinfachsten Menschen glücklich machen konnte. Meinen Teil würde ich so dazu beitragen, Ihnen den modernen Teil der Welt zugänglich zu machen.
Ich muss dazu natürlich auch bekennen, dass ich in „dieser Zeit“ gar keine andere Möglichkeit sah „in die Welt“ hinauszukommen. Und irgendwie zog es mich hinaus.
Wenn es denn sein sollte als Missionar. Als Missionar wurde man hinausgeschickt, da brauchte man nicht lange in anderer Form darauf hinzuarbeiten, darum zu bitten oder besondere Beziehungen zu haben - außer zu Gott natürlich.
Ich wurde kein Missionar.
Welch ein Glück, dass es nicht dazu kam. Ein Glück, dass Menschen nicht auf diesem Weg „glücklich“ gemacht wurden - von mir? Ausgerechnet von mir!
Ich suchte nach weiteren Informationen - und genau das machte die Angelegenheit <Ecuador> noch spannender. Ich fand nichts mehr. Keine weiteren Abenteuerberichte - so wie ich es gehofft hatte. Der Buchinhalt, meine Geschichte, die ich bereits verinnerlicht hatte, blieb einzigartig. Und hatte damit in meinem Gedächtnis und meinem Gefühlsleben einen konkurrenzlosen Platz. Ich konnte sie jederzeit abrufen, ohne dass sie mit anderen Fantasiegeschichten in Wettbewerb treten musste.
Ich besaß einen Globus - es war mehr ein Globüschen in der Größe eines Tennisballs - nun ja, da war auch das Land meiner Träume. Das aber, was da gezeigt wurde, war nicht geeignet meiner Fantasie mehr Grundlagen zu verschaffen oder sie mehr anzufeuern.
Es war ein Eckchen auf dem Südamerikanischen Kontinent, verächtlich als <Subkontinent> bezeichnet. Ein Splitter, eine recht kleine Kante, die auf der Landmasse leicht zu übersehen war. Aber dieser Splitter war größer als die damalige Bundesrepublik.
Entschuldigend merke ich dazu an: Ich hatte ja noch keine Ahnung oder Vorstellung, was in Südamerika, im Vergleich zu meiner Heimat, Entfernungen bedeuteten.
Zu einem späteren Zeitpunkt fand ich in der Schule auf einer Landkarte mehr Details und eigentlich das bestätigt, was mich so besonders faszinierte:
Da waren keine Straßen eingezeichnet. Es stimmt, das faszinierte mich. Da blieb also zweifelsfrei noch eine Menge zu tun.
Zugegeben, Straßen bauen war auch nicht mein hochgestecktes Ziel. Brücken bauen schon, das war mein erster Berufswunsch. Und der ging auch in Erfüllung, wenngleich in ganz anderer Weise, wie ich mir das als Ingenieur vorgestellt hatte. Ich durfte/konnte nämlich tatsächlich Brücken bauen/errichten - zwischen Menschen.
Aber auf der Karte waren eine Unmenge gewaltiger Berge eingezeichnet. Sehr hohe, für mich unvorstellbar hohe Berge. Man hätte die höchsten Gipfel der Alpen darin verstecken können. Und Vulkane. Ein Gebirgskonglomerat, das nur noch vom Himalaya übertroffen wurde. Von dem in jener Zeit in den Nachrichten allgemein, in der Zeitung, in der Wochenschau und im Radio viel zu lesen und zu hören war.
Von dort kamen die Nachrichten vom „Sturm auf den Nanga Parbat“, der „Everest“ sollte demnächst <fallen>. Auch unter <dem Karakorum> stellte ich mir wilde Gebirgslandschaften vor.
Doch seltsam. Ich verfolgte zwar mit der gebührenden allgemeinen Spannung den Wettlauf <unter den Nationen> da oder dort als Erstbesteiger auf diesen und jenen Gipfel zu gelangen. Als Erste auf diesem oder jenem Achttausender zu stehen. Aber ansonsten ließen mich diese dicken Brocken in Asien kalt. Die waren am verkehrten Platz.
Und nun die Anden - sie wurden sozusagen zu <meinen Anden>. Zu meinen Gebirgszügen. Und so mancher Gipfel war sicher auch noch nicht bezwungen.
Da und dort kam auch über die Anden mal die eine oder andere Nachricht. Ganz gleich wo, für mich standen <diese Anden> immer in Beziehung zu Ecuador. Ich transplantierte sie eben dorthin, auch wenn alle anderen Angaben dagegen sprachen. So viel Unterschied konnte es ja, weiß Gott, nicht geben.
So etwas Gewaltiges, dazu noch der allgegenwärtige Urwald und die Indianer. Man sprach zwar von Indios. Aber wo sollte da schon ein großer Unterschied sein? Das konnte höchstens an der Aussprache, an einem fremden Sprachgebrauch liegen. An einer anderen Schreibweise. Aber Indianer waren es trotzdem. Rothäute. Wilde. Für mich und meine Fantasie. Die Angaben zum Urwald, der bis in gewaltige Höhen reichen sollte, bezweifelte ich schon ein bisschen - wie gesagt: Nur <ein bisschen>.
Ich hatte aber nichts dagegen, es passte ja auch in meine Träumereien. Eventuell noch Burgen auf deren Gipfeln?
Aber keine Straßen. Trampelpfade, wie man sie bezeichnete, die bereits vor hunderten von Jahren von den Indios im Inca-Imperium genutzt wurden. So musste es sein.
Großzügig setzte ich die INCAS auf eine Stufe mit den Apachen, Mohikanern, Comanchen und anderen.
Das Schlüsselerlebnis in dem erwähnten Abenteuerbericht war und blieb in meinem Gedächtnis haften. Ich durchlebte es immer wieder in neuen Varianten.
Das Buch:
Da war beschrieben, wie das erste Automobil in die 3000 Meter hoch in den Bergen liegende Hauptstadt geschafft worden war. 3000 Meter!! Immer wieder hielt ich den Atem an. So hoch wie unser höchster Berg, die Zugspitze. Und dort oben nicht nur eine Stadt. Nein, sogar die Hauptstadt.
Es gab von einem Hafen am Meer noch keine Straße dorthin. Nur Pfade und Wege, die aber lange vor der Erfindung des Automobils gebaut worden waren. Völlig ungeeignet für einen motorisierten Transport oder wenigstens mechanisierte Fortbewegung von Menschen und Waren.
Der „Dampfer“, wie die Frachtschiffe damals noch korrekt hießen, ankerte mitten im Fluss vor der Hafenstadt Guayaquil. Das stand auch in „meinem“ Buch.
Danach wurde das Automobil - es war kein gewöhnliches <Auto> - nach dem Entladen vom Schiff, in Einzelteile derart zerlegt, dass diese jeweils auf einen Eselsrücken passten. Ein eigens aus Europa mitgereister (mitgekaufter) Mechaniker und Fahrer überwachte die Operation. Er sollte das Gefährt, nach einem wochenlangen Transport durch Urwälder und unwegsame Berge, in Quito wieder zusammenbauen. Fahrtüchtig machen. Für Straßen, die es auch in Quito, so nach unseren Begriffen, nicht geben sollte. Aber ein reicher Mann wollte eben ein Automobil haben. Das Erste in der Hauptstadt.
Und ich schmückte im Geiste diesen Esel-Transport mit meinen eigenen Ideenbeiträgen aus. Im Buch stand vom Durchqueren von reißenden Bächen, auf primitiven Hängebrücken ging es über Schluchten mit tosenden Wassern, durchnässt waren die Führer von den ewig tropfenden großblättrigen Urwaldpflanzen. Alles wurde nass. Man hatte Probleme die Einzelteile des Autos trocken zu halten oder wieder zu trocknen. Ein Kampf gegen die übermächtige Natur. Und immer höher in die Berge hinauf.
3000 Meter. Ich stellte mir wieder die Zugspitze vor. Gleiche Höhe. Aber vor der Stadt musste man dann noch mehr als 4000 Meter hohe Bergrücken überwinden. Die irgendwie wie ein Riegel den Zugang zu dem Hochtal versperrten. Allein schon diese Vorstellung einmal bis auf 4000 m zu gelangen - wie auch immer - war für meine Fantasie eine absolute Herausforderung und schließlich zu viel.
3000 Meter. Und dort oben war eine mit gewaltigen Schluchten durchzogene Hochebene, wo bereits die <alten Incas> eine wichtige Verwaltungs- und Königsstadt gebaut hatten. Dort, rings um die Stadt Quito, ging es erst so richtig in die Höhe. Sie war eingesäumt von 5000-ern.
Ungefähr von dort kamen <meine> Esel mit den Autoteilen herab. Es war noch alles dabei. Kein Esel ging verlustig. So kam Quito zu seinem ersten Automobil. Wann, in welchem Jahr das war? Fragen Sie mich etwas Leichteres.
Ich widmete noch Aufmerksamkeiten dem tapferen Mechaniker in Quito, immerhin im Laufe der Zeit etwas weniger intensiv. Aber Quito und sein erstes Automobil, die riesigen Berge, der Urwald und die Indianer, sie spielten immer noch eine Rolle. Eine sehr gewichtige Rolle. Und immer wieder.
Das Angebot, das ich nicht ausschlagen konnte.
Als Teil meiner intensiven und besonders exklusiven Ausbildung - direkt unter der Schirmherrschaft der drei Direktoren Heimann, Schläfer, Kieffer - sollte ich auch Erfahrungen <an der Front>, im Außendienst sammeln. Die Wahl - warum auch immer, weiß ich nicht mehr - fiel auf Bremen. Neun Monate waren vorgesehen.
Ich war zum ersten Mal von zu <Hause weg>. Ich musste mein Alleinsein organisieren. Zu Hause gab es kein Telefon, jedweder elektronischer Schnickschnack war noch Zukunftsmusik. Ich war also, zumindest eine erste Zeit, wirklich allein. Aber ich konnte mich an die neue Art von Freiheit gewöhnen. Sie begann mir sehr schnell zu gefallen. Mit kleinen Schönheitsfehlern. Nichts ist halt perfekt.
Ich wohnte bei Frau Meine, einer Kriegerwitwe in Bremen-Hemelingen. Ihr einziger Sohn wohnte auch in dem schönen Haus. Ich wurde von Frau Meine verwöhnt, sie wurde so etwas wie eine Ersatzmutter.
Nicht weit weg war die damals hoch angesehene Autofabrik BORGWARD. Irgendwie war dieses Werk kriegswichtig gewesen und man hatte in der Nähe Hochbunker gebaut. Diese dienten nun allgemein als Restaurants. In einem solchen hatte ich dann meine erste Unterweisung in Esskultur bekommen. Bis dahin waren die Tischsitten meiner Heimat, der Pfalz, meine in dieser Richtung einzige kulturelle Ausstattung. Ich muss das doch noch präzisieren. Es war nicht einfach als Pfälzer. Es war die Hinterpfalz und wir gehörten in Weilerbach (damals) schon beinahe zur „Alten Welt“ - dort, wo man, „den Mond in klaren Nächten mit langen Stangen über die Berge schob“.
Als Fisch kannten wir - eben in unserer Hinterpfalz - nur den in einem Fass in Salzlauge eingelegten Hering. Einen Fisch, über weite Strecken mit den damals zur Verfügung stehenden Transportmitteln zu verfrachten, verbot sich aus naheliegenden Gründen. Die Tiefkühltruhe, und die damit zusammenhängenden Transportmöglichkeiten, war noch nicht erfunden.
So wagte ich in Bremen schon ziemlich bald, an einem Sonntag, in einem Bunkerrestaurant Fisch zu bestellen. Der sah gut aus und roch auch gut. Mein erster Seefisch. Doch das war nicht das Entscheidende. Entscheidend war, dass ich nicht wie üblich <Messer und Gabel> erhielt. Die Bedienung hatte sie offensichtlich vergessen. Dafür hatte ich zwei Gabeln. Einfach lächerlich, sich so zu vertun.
Ich winkte sie freundlich herbei und machte auf den Irrtum aufmerksam. Sie schaute mich an, als wollte sie sagen: „Aus welchem Loch kommt denn so was Unkultiviertes hervorgekrochen?“
Dann klärte sie mich mit ziemlich herablassender und auch besonders lauter Stimmlage auf. Sie stellte sich an, als hätte sie nun wiederum die Kultur mit dem <Löffel gefressen>.
„Das wissen Sie nicht? Fisch wird nicht mit Messer und Gabel gegessen. Dafür nimmt man zwei Gabeln. Und die habe ich Ihnen ja gebracht. Guten Appetit - trotzdem!“
Ich hatte etwas gelernt und die <Dame> hatte ihren Auftritt. Sie schaute sich noch triumphierend um, versicherte sich, dass die Szene auch von den anderen Gästen im Spitzbunker miterlebt wurde.
Peng, das war´s mal fürs Erste.
Ich war in der großen weiten Welt angekommen. Fortan durfte ich in dieser Liga mitspielen.
Das war mein erster Seefisch und es dauerte lange - Jahre - bis mir Seefisch richtig schmecken wollte. Wenn ich als Besteck irgendwo und irgendwann die beiden Gabeln sah, kam mir meine kulturelle Niederlage immer wieder peinlich ins Gedächtnis.
Das mit den zwei Gabeln. Oder so.
Es war Anfang November, meine vorgesehene Zeit in Bremen lief in einem Monat ab. Ich bereitete mich auf den Abschied vor. Von einer Stadt, die mir inzwischen doch an´s Herz gewachsen war. Und auch von Freunden und einer Freundin, die meinetwegen eine siebenjährige Verlobung gelöst hatte. Was aber nicht auf meine Initiative hin geschah - das möchte ich ausdrücklich betonen.
Liebe Dora, wenn Du das hier einmal lesen solltest. Ich bestätige Dir, dass es mir schwer gefallen ist Dich zu verlassen. Vergessen habe ich Dich nie. Aber Bremen war ja für mich nur eine Zwischenetappe - auf meinem Weg in die Welt hinaus. Der zeichnete sich sehr realistisch ab. Ich hatte keinen anderen Gedanken mehr.
Und gerade Bremen, diese weltoffene Stadt, hat mich in meiner Stimmung und Absichten noch verstärkt. Ich kann sogar sagen, dass diese Stadt zu meiner Heimat wie ein erzieherisches Gegenstück darstellt. Wie oft habe ich die Schiffe - die Dampfer - im Hafen kommen und abfahren sehen - in die weite Welt hinaus, aus der weiten Welt kommend, von der ich so wenig wusste und die kennenzulernen mein Herz schlug.
Klar, dass Du es nicht verstehen konntest. Bestimmt zu Recht interessierten Dich Indios, Urwald und Fünftausender ziemlich wenig. Mich umso mehr und das hat Dir sicher mindestens einen Teil Deines Herzens gebrochen. Verzeih mir meinen „Egoismus“.
Aber, da kam eines Tages ein Brief der Exportabteilung <meines Mutter-Betriebes>, in dem von einer offenen Stelle in Ecuador - in ECUADOR!! - berichtet wurde und wenn ich Interesse daran hätte, möge ich mich doch alsbald melden. Man würde mir dann die nötigen Informationen zukommen lassen. Details würde man <im Hause> besprechen. Nun, wenn ich Lust hätte dieses Abenteuer einzugehen, dann ...
Nun lieber Leser bzw. Leserin, Sie können sich denken, was sich da zusammengebraut hatte. Von tausenden von anderen Möglichkeiten für meine Kumpels und mich, reichte mir das Schicksal punktgenau die Hand. Mein Leben begann definitiv eine neue, besonders aufregende Richtung einzuschlagen.
Für mich gab es keine weitere Sekunde zu zögern. Ich hatte die Chance nach Quito, meiner Traumstadt in Ecuador zu kommen. Das Geschäft für meine Firma in diesem Land aufbauen, so lautete die Aufgabe. Helfen das moderne Zeitalter in diese Region zu bringen. Sozusagen Entwicklungshilfe leisten. So etwas Ähnliches machen, was die Missionare auf einer anderen Ebene verwirklichten.(??? Verzeihen Sie mir bitte meine Anmaßung.)
Ich brauchte also kein Missionar zu werden, um meine Fähigkeiten zum Wohle der Menschen „dort“ einzusetzen. Aber so ein bisschen fühlte ich mich schon wie ein Missionar. Ich würde zu fremden Menschen gehen, um ihnen meine Hilfe anzubieten. Nun, so stellte ich mir das wenigstens vor. Mein Idealismus war grenzenlos. Ich trieb mich in diesem Sinne vorwärts - natürlich auch mit einer guten Portion Abenteuerlust. Gott konnte ich aber getrost außen vor lassen.
Dabei sollte ich auch noch die Überfahrten bezahlt bekommen und monatlich ein Salär. Für zwei Jahre ein Vertrag. Nun, das sah doch mal nach einem guten Anfang aus. Ich sah das als ein glückliches Omen an. Ich griff zu.
Ich hatte nicht damit gerechnet, dass das monatelange Warten dann doch so nervenaufreibend wurde. Nach einer mir endlos erscheinenden Wartezeit, in der allerlei bürokratischer <Kram> zu erledigen war, u.a. ein Visum, das wochenlang unterwegs war, wurde eine Überfahrt auf einem deutschen Schiff mit dem Namen Heidelberg gebucht.
Was ich nicht wusste, verdrängte oder auch nicht wissen wollte, war, dass die Postverbindung mit Ecuador noch ziemlich <vorsintflutig> funktionierte. So ähnlich wie die Flaschenpost - nun - doch etwas schneller.
Ein Brief war in der Regel sehr scnelle 10 - 12 Tage unterwegs, wenn man so aufmerksam war mit großer Schrift auf den Umschlag zu schreiben: VIA NEW YORK.
Dann wurde der Brief per Luftpost nach New York transportiert und von dort - weiß der Geier wie weiter - jedenfalls nicht ausschließlich per Luftpost.
Man kann sich ausrechnen, dass der Erhalt einer Antwort nicht unter drei Wochen zu schaffen war.
Telefonieren? Das geht noch nicht. Vielleicht in ein paar Jahren.
Telegramme - ja das ging. Aber auch diese Nachrichtenübermittlung konnte zwei Tage dauern, denn es ging wieder über New York. Dort wurde das Telegramm umgeschrieben und neu per Morsezeichen nach Quito weitergeleitet. Und wenn in New York gebummelt wurde - was aus Ecuador kam konnte ja nicht wichtig sein, oder schrieb zunächst einmal die CIA ab? - dann verzögerten sich die paar teuren Worte noch mehr.
Ich verbrachte noch den letzten Winter in Deutschland, vor dem großen Abenteuer.
In der zweiten Maihälfte sollte ich - wieder in Bremen, einschiffen.
In meiner Begleitung würden 56 Nähmaschinen, meist für den modernen Industrieeinsatz mitreisen. <Meine zukünftige Arbeit>. Ein großer Vertrauensvorschuss. Ein übergroßer optimistischer, wie sich zeigen sollte.
Dabei waren mir die technischen Besonderheiten der Maschinen und deren Leistungsdaten kein Geheimnis und in keiner Hinsicht problematisch.
PS.: Mit ihnen hätte ich, wenn alle Gedankenspiele der dabei Mitentscheidenden aufgegangen wären, eines der damals rückständigsten Länder der Welt, mit einem Schlag in die Moderne katapultiert. Wenigstens auf dem Bekleidungssektor.
Aber die Entscheidung fiel in Kaiserslautern. Betrieben von Menschen mit den besten Absichten aber - nur eben aus der Sicht von Menschen die wenig oder kaum aus „dem Wald“ rings um Kaiserslautern herausgekommen waren. Ich meine hier buchstäblich den „Pfälzer Wald“.
Ungeniert erwarteten sie offensichtlich Wunder. Und da hielten sie mich für den richtigen Mann - äh, richtigen jungen Mann.
Die Reise - Start 21. Mai 1957
Die HEIDELBERG war ein moderner Turbinendampfer mit Kriegs-Geschichte. Aber immer noch ein echter Dampfer. Kurz vor Kriegsende unter einem anderen Namen versenkt. Das Wrack wurde dann gehoben, runderneuert und mit dem modernsten damaligen Antriebssystem (Turbinen) ausgestattet. Es war ein Ausbildungsschiff von HAPAG. Der Kapitän war ein ehemaliger U-Boot-Kommandant, der allgewaltig und selbstherrlich die 40 Offizierskadetten drillen ließ. Doch zu diesem Abschnitt kommen wir noch im Detail.
Die HEIDELBERG fuhr als „Filler“ und konnte mehr als 6000 Tonnen Güter unterschiedlichster Art und Verpackung an Bord nehmen. Und bis zu 12 Fahrgäste. Darunter war ich.
Meine geräumige Kabine war für mich der reinste Luxus. Mein eigenes Bett mit einem Gitter, damit man bei Seegang nicht herausfallen konnte und ein eigenes Bad. Und was für eins! Ganz für mich allein. Ich hatte einen Schreibtisch, zwei gepolsterte Stühle und einen schönen Kleiderschrank.
(Apropos Bad: Ein klein wenig ausschweifend: Während meiner Außendienstausbildung in Bremen ging ich jeden Samstag im Zentrum der Stadt in ein öffentliches Bad. Das kostete ein paar Pfennige. Dafür durfte ich mir in aller Seelenruhe mit wirklich warmem Wasser den in der Woche angehäuften Dreck und Schweiß herunterschrubben. Seife und Handtuch war mitzubringen. Danach fühlte ich mich jedes Mal wieder wie neu. In meiner Bremer Mietwohnung gab es noch kein Badezimmer.)
Nach unserer Hafenausfahrt aus Bremen spielte am Ufer der Weser eine Kapelle: <Muss i denn, muss i denn - usw.> Ein paar mühselig unterdrückte Tränen. Dann kam auch bald die Nordsee. Die Tür zur Welt stand nun für mich wirklich offen. Ich durchschritt sie. Und die HEIDELBERG brachte mich immer weiter voran.
Das Meer. Ich war auf dem großen Wasser, das rund um die Erde verteilt war. Es war damals noch der einzig praktische Weg die Welt zu erkunden. Und ich war jetzt bereits mittendrin. Das gab mir eine ungewöhnlich emotionsgeladene, sensationelle, erwartungsvolle Stimmung.
Am nächsten Tag machten wir in Antwerpen fest, um Ladung und weitere Gäste zu übernehmen.
Charlotte, blond, mit toller Figur und im schönsten jugendlichen Alter, so wie auch ich, kam mit ihren Eltern an Bord.
Ein Spektakel für die vielen jungen Männer, Offizierskadetten, an Bord.
Die halbe Besatzung und so gut wie alle Offiziersanwärter standen an der Reling und leckten sich die Lefzen.
Doch sie sollte mir gehören, sie gehörte mir. Nicht aus Besitztumsdenken. Auch nicht, weil ich im <Aufreißen> von Mädchen Spitze gewesen wäre. Im Gegenteil. Und auch nicht, weil ich Mädchen <überzeugen> konnte. Ich hatte ja noch kaum Erfahrung und die Hinterpfalz hatte mir in Punkto Paar- und Sexualkunde nichts, aber auch rein gar nichts mitgegeben. Doch hat sie - aber nichts für das praktische Leben Verwertbares. Ich war weitgehend ein Ignorant - was Mädchen anging, ganz allgemein „das andere Geschlecht“.
Nein, es fand einfach eine normale Entwicklung zwischen zwei jungen Menschen statt. Wir hatten fünf Wochen Zeit uns näher kennen zu lernen. Fünf Wochen, in denen wir die neuen Eindrücke der Seefahrt und der neuen Welt teilen konnten, uns mitteilen und das sexuelle Treiben in unseren Körpern erleben konnten. Keiner konnte sich verdrücken oder ausreißen. Wir waren uns immer nahe.
Ihre Eltern sahen die <Verbindung> nicht ungern. War ich doch ein präsentabler <junger Mann, ganz offenkundig mit Zukunft>.
Herr Papa war ein angesehener Mitarbeiter der UNO und besaß im Privatleben in Kalifornien fünf Veterinärkliniken. Gut situiert. Mutti, attraktiv mit ausgeprägten berechnenden Umgangsformen - die ich erst noch zu lernen hätte. Meinte sie und provozierte bei <meiner> Charlotte Tränen. Ich versprach meine kulturellen und erzieherischen (Weilerbach)-Lücken schnellstens zu füllen.
Mutti hatte eine große Bitte an ihre Tochter: „Bitte keine Babys machen!“
Wie sie vermeiden - davon hatte weder Charlotte noch ich eine Idee. Nicht mal eine richtige Idee wie sie zu machen waren. Aber es war Liebe.
Die „Pille“ wurde erst Jahre später erfunden.
Charlotte war ein Adoptivkind, wie mir die Schwiegermutter in spe anvertraute. Aus Finnland - in Finnland geboren. Ihr Ein und Alles.
Charlotte hatte bis kurz vor der Schiffsreise ihre Lebens-und Erziehungszeitzeit in einem ausgesuchten, hochgelobten und teuren österreichischen Internat zugebracht. Wir freuten uns über unsere Freiheit und hatten wirklich keine Langeweile. Wenn der Seegang hoch ging, standen wir am Bug und duckten uns hinter das Schanzkleid vor den Brechern, die bis zur Brücke hochspritzten.
Wir erlebten, wie im wild bewegten Golf von Biscaya die Suppe in unseren Tellern mal beinahe über den linken, dann zurück, beinahe über den rechten Tellerrand schwappte.
Wir sahen erwartungsfroh und doch mit einem gewissen Bammel zu, wie Teile der Mannschaft in unserem „Salon“ die Stühle auf dem Boden festschraubten. Die Tische waren sowieso festgeschraubt. (Könnte ja einer auf die Idee kommen sie zu klauen.)
Wir freuten uns wie Kinder - die wir ja auch noch waren - wenn wir beim Seegang und stark schwankendem Schiff, die quer im Schiff verlaufenden Treppen stiegen. Je nach Schräglage liefen wir beinahe wie auf ebener Erde über die Stufen, nur um gleich danach vor einem schier unüberwindlichen Stufensteilhang zu stehen. Wenn wir dann warten mussten, bis sich das Schiff wieder auf die andere Seite neigte.
Dann die Berg- und Talfahrten. Tiefe Täler wechselten sich ab mit Wellenkämmen.
In die tiefen Täler von Dünungen mit gewaltigen Ausmaßen tauchte unser Schiff tief hinab, rauschte auf dem Grund der Dünung in die Flanke des nächsten Wellenkammes, bis dass sich der Bug quasi hineinbohrte.
Dann wieder hoch, es ging für uns regelrecht bergauf. <Oben> angekommen, hing für einen Moment der Vorderteil des Schiffes in der Luft, um dann gleich danach vornüber zu kippen und ab ging es wieder auf <Talfahrt>.
Später, weiter draußen auf dem Atlantik, wurde die Luft mit jedem Tag weicher. Es lag für mich buchstäblich etwas völlig Unbekanntes in der Luft. Diese Luft konnte den Körper regelrecht umschmeicheln, im Gegensatz zu dem, was mir als mitteleuropäischer Landratte wohlbekannt und oft genug gefürchtet war. Ganz zu schweigen von dem vielfach nasskalten Wetter in der Hafenstadt Bremen.
Dann die Schwärme von fliegenden Fischen, die sich wie auf Kommando seitlich unseres Schiffes aus dem Wasser lösten, einfach plötzlich da waren und viele Sekunden lang dicht über dem Wasser neben uns hersegelten. Dann wieder plötzlich, wie auf ein Kommando, spur- und lautlos verschwanden.
Schließlich die unvergesslichen Mondnächte in der Zaragossasee. Es leuchtete, sprühte grün glitzernde Funken. Die Bugwelle war ein einziges Aufschäumen dieser grünlich leuchtenden Funkenpracht. Dabei konnte man die Nacht an sich vergessen. Andererseits, was hatten wir schon zu verlieren? Jedenfalls hatten wir Zeit für die eine Ewigkeit dauernden Eindrücke und Erlebnisse.
Pfingstsonntag liefen wir in Curacao ein, einer Insel in der Karibik in holländischem Besitz. Es ging durch einen engen Kanal, mitten durch die Insel. Links und rechts <Holland>. Autos fuhren an uns vorbei. Reihenweise Häuschen mit gepflegten winzigen Vorgärtchen. Überall Gardinen an Fenstern und Fensterchen. Alles propper weiß gestrichen, rot gedeckt. Blau war auch irgendwie dekorativ dabei. (Heute alles Vergangenheit, ausgemustert und durch höhere und Hochbauten ersetzt.)
<In der Insel> war ein großes Becken mit Anlegestellen. An einer nahmen wir 3000 Tonnen Schweröl in unsere Bunker. Da wurde ständig, zum Antrieb der Turbinen ganz schön was verbrannt.
Beim ersten Pfingst-Morgen-Licht standen wir an Deck. Erlebten zum ersten Mal <Tropenluft> mit Sicht auf Land. Wir rochen und schmeckten sie mit einem großartigen Gefühl. Für einen Landgang war die Liegezeit zu kurz.
Dann ging es auf unserer Reise wieder ein bisschen zurück, denn wir sollten in LA GUAIRA, Venezuela, Ladung löschen. Wie das Schiff sich <fortbewegte> konnte ich anhand einer von einem Offizier speziell angefertigten Karte täglich miterleben. Der Steward gab sie mir jeden Morgen vom Vortage als Souvenir. Die Strecke war abgesteckt, die jeweils mittlere Geschwindigkeit dazu notiert, Längen- und Breitengrade vermerkt, die Tagesstrecke war akkurat eingezeichnet, dazu noch das <Wetter von gestern> sowie die Temperatur. (Wettervorhersagen gab es noch nicht.) Und die war in den letzten zehn Tagen ständig nach oben gegangen. Die Tropen begannen in meinem Leben eine wichtige Rolle zu übernehmen. Jetzt hatte ich es schwarz auf weiß.
Ja, dieser Steward. Alle Mann wussten natürlich, wie es um uns, die beiden Turteltauben stand. Ich denke, dass Charlotte und ich ständig Gesprächsthema vom Kapitän abwärts bis zum Mechaniker im Schiffsbauch waren.
So stand auch bereits das Frühstück im Zeichen wilder Spekulationen.
Willibald, der Steward, an den ich mich liebend gern erinnere, sorgte für mein leibliches Wohl. „So´n Junge braucht doch was Anständiges. Wir haben´s und so soll er´s auch kriegen.“
....“Wieviel Eier dürfen es heute sein?“
....“Bloß fünf? Gestern waren es doch noch sieben.“
....“Aber mit ein paar anständigen Scheiben Schinken!“
....“Wie wärs mit einem Teller Kaviar?“
....“Tu nicht so, ich weiß doch, dass er Dir schmeckt!“
Das war Schlaraffenland pur. In einer Zeit, als wir uns zuhause - und nicht nur wir - noch nicht alles, was das Herz begehrte, erlauben konnten.
Nun ja, der Kaviar gehörte wirklich zu meinen Lieblingsspeisen oder besser gesagt, zu meinen Vorzugsspeisen auf dieser Überfahrt. Dank dem <Drängen> des Freundes Willibald, seines Zeichens Steward. Er war Diener der Passagiere und des Kapitäns persönlich. Und der schwarze Kaviar kam immer im Suppenteller. Was lag näher, als ihn auch mit dem Suppenlöffel zu verzehren, wie einen Teller Suppe. So war´s.
Seit dieser Zeit habe ich praktisch keinen Kaviar mehr gegessen - oder essen wollen.
Nun ja, ich konnte (noch) nicht erkennen, was an diesem <Fraß> das ganz Besondere sein sollte. Alle Genussmenschen mögen mir verzeihen. Ich war halt in (Ess)Kultur minderbemittelt, zurückgeblieben. Meine Zunge, noch so kurz <nach dem Krieg>, wurde niemals derart geschult, dass ich das wirklich Außergewöhnliche in diesem <schwarzen Gekrümel> hätte erkennen können.
War´s denn wirklich etwas Besonderes, wenn man es auslöffelte, wie einen Teller steife Suppe?
Seither habe ich dieses Genussmittel nur noch selten und dann auch nur in Miniportiönchen auf Minibrotstückchen <geschmeckt>. Aber niemals wieder mit dem Suppenlöffel. Suppenlöffel - ich glaube es manchmal selbst nicht mehr so richtig.
Nun stand das Anlegen in der Hafenstadt Venezuelas <La Guaira> bevor. Anderthalb Tage sollten wir da festliegen. Zeit für Ausflüge und besonders zum Besuch der nahen Hauptstadt CARACAS.
Mein <Täubchen> und ich würden gemeinsam mit ihren Eltern dorthin fahren. Mit dem Taxi. Mutti und Papi wollten bezahlen. Das war schon was. Mir auf die Reise Taschengeld mitzugeben - das hatte man offenbar vergessen.
Bis zum literarischen Antritt dieser Reise will ich doch noch etwas aus dem täglichen Schiffsleben berichten, das gehörte nämlich zu dem, was wir alsbald schockiert erleben sollten.
Dass der Kapitän ein alter U-Boot-Kommandant war, was offensichtlich stimmte, habe ich bereits erwähnt. Er gab wenig aus dieser Zeit <zum Besten>. Aber eine Nachricht brachte ihn dann doch dazu nach dem Abendessen in unserer Passagierrunde sich in Rage zu reden und regelrecht ungemütlich zu poltern. Die Nachricht stand auch in der täglichen Nachrichtenzusammenfassung, einer Art Schiffs-Tageszeitung, zusammengestellt mit den wichtigsten Meldungen aus aller Welt.
Die Amis hatten ihm <auf den Schlips getreten>. Sie posaunten hinaus, dass ihnen die bislang längste Unterwasserfahrt eines U-Bootes gelungen sei. Drei Wochen oder so was.
<Was das wohl sei>? Langsam, aber stetig kam der Herr Kapitän verbal in <volle Fahrt voraus>. Und brachte dann Erstaunliches aus seinem Leben zum Vorschein.
Er habe eine wichtige Mission erfüllt. Hatte Geheimes nach Japan transportiert und einiges Geheimes von dort wieder nach Deutschland zurückzubringen. Er hatte den Weg um die Südspitze Südamerikas für seine Heimfahrt gewählt. Das Kriegsende war nicht mehr fern und die <Häscher> überall. So musste er bis nach Europa einmal über 5 Wochen ununterbrochen getaucht fahren - schnorcheln.
<Und fünf Wochen sind nun mal verdammt mehr als drei. „Jawoll!“ So wie ich es betont schreibe und auch noch unterstrichen, so schleuderte es der Käpt´n uns um und in die Ohren. Ein älteres, liebevolles, jüdisches Ehepaar löffelte mit gesenktem Kopf weiterhin die Suppe, sie zuckten nicht einmal. Sie taten als wären sie taub. Oder völlig desinteressiert.
Ich kann mich erinnern, dass er, einmal in Fahrt, auch Details aus dem <Sauleben> in der großartigen Röhre der deutschen U-Bootwaffe von sich gab.
Man habe eine Höhensonne dabeigehabt, unter der die Mannschaft regelmäßig <zu baden> hatte. <Die wäre ihm ja sonst von den Knochen gefallen.>
Dann in der Nähe von Kap Vincent in Portugal, kurz vor Europa, die Flieger der Tommys waren überall, griffen sie ihn an. Nur weil die den Schnorchel orten konnten und das auch noch nachts.
Eine gottverdammte Sauerei war das, nach der wochenlangen Schinderei unter Wasser, wollten sie ihm jetzt, kurz vor <der Haustür> an den Kragen.
Er/sie kamen davon, mit einem großen Schrecken.
Der damalige U-Boot-Kommandant und selbsternannter Rekordhalter im Langzeittauchen hatte auch jetzt das Befehlen noch nicht verlernt. Ich durfte das fast täglich, sehr peinlich berührt, miterleben.
Er hatte etwas, eine regelrechte Manie gegen alles, was sich im Maschinenraum die Finger ölig machte. Obenan, auf seiner Zielliste, stand der leitende Ingenieur als bevorzugter und privilegierter <Ansprech(!)partner>. („Anschreipartner wäre treffender“) Er war einfach der Blitzableiter des hochwohlgeborenen <Ex-U-Kommandanten>.
Ob er in solchen Aufführungen seine blechgewordenen Zeugen, seine Ordensbrimborien, die er für seine Heldentaten im Namen des Führers des Großdeutschen Reiches eingesammelt hatte, wohl vermisste?
Die Blitze, seine Blitze kamen vor meinem Kabinenfenster von links oben. Dort liefen die Stufen eines Aufgangs zu den oberen Regionen des Schiffsaufbaus aus. Er schimpfte lauthals, mit sich oft überschlagender, oder auch krähender, manchmal blechern tönender Stimme. Fast vor meinem Fenster stand der <Leitende> Leidende - oder umgekehrt. Von links oben kam es dann oftmals pausenlos knüppeldick, dann ging es von <Arschloch> über Blödmann, Idiot, Rindvieh, Scheißer - und das Geringste war noch der Begriff <Dummkopf>. Da spukte noch der Nazi- Herrenmensch in seinem Kopf. So outete er sich als unverbesserliches Scheusal, ein Überständer aus dem tausendjährigen „Großdeutschen Reich“. (Und so einen hatten die von HAPAG als Ausbilder von Offiziersanwärtern eingesetzt!? Das ist doch eine berechtigte Frage!
Ich hatte zwar kein Verständnis, aber was hätte es genutzt mich da einzumischen? Hatte ich überhaupt etwas zu sagen? Ich mochte den Leitenden, denn er ließ mich im Maschinenraum überall hin. Und überall war es wahnsinnig interessant. Bis ans Ende des Wellentunnels.
Der Steward erzählte mir - Im Vertrauen, da darf nichts durchsickern - was da bereits so alles gelaufen sei.
Die HEIDELBERG war ein <Filler>. Sie fuhr Routen, auf denen gerade mal ein anderes Schiff ausgefallen war. So war man letztes Jahr in Australien. Die Heimfahrt war <Richtung Weihnachten>. Geplante Ankunft am 31. Dezember. Es war die letzte Reise, dann verbrachte man bis jetzt - Mai - Monate in der Werft.
Das Schiff konnte eine Reisegeschwindigkeit von 17 Knoten dauerhaft halten. Beachtlich, gegenüber den normalen Dampfschiffen, die noch überwiegend mit Kolbendampfmaschinen fuhren. Wollte man aber bis Weihnachten in Hamburg sein, musste man 21 Knoten fahren, im Dauerbetrieb. Theoretisch war das, laut Betriebsanleitung, kurzfristig möglich.
Der Kapitän verlangte das nun als wochenlangen Dauerzustand, im Interesse der Mannschaft. Von Australien bis nach Hamburg.
„Das Schiff muss das abkönnen“!
„Weihnachten sind wir zu Hause.“
Der Ingenieur ließ sich überreden, besonders, da er praktisch die gesamte Mannschaft gegen seine Kenntnisse und besondere professionelle <Vorsicht> und Verantwortung hatte.
Eine komplette Woche wollte der Kapitän aufholen.
So sei man <durchgerauscht>. Mit einem Wahnsinnszacken. Und auf der Höhe von Belgien passierte es. Es zerriss Maschinen. So sagte er es mir.
Monate gingen verloren, bis die Reparaturen durchgeführt waren.
Nun war man also wieder unterwegs. Der Kapitän-Kommandant war bereits tagelang stocksauer, weil er augenblicklich einen Tag hinter seinem Fahrplan herhinkte. Die Zeit sollte aufgeholt werden. Über das Wie zankten sich die beiden Macker auf dem Kahn.
Der Leitende wollte nicht mehr nachgeben, keine halbe Meile mehr über der Reisegeschwindigkeit. Der Kapitän rechnete ihm vor, was das für einen Verlust für die Gesellschaft bedeutete.
„Ich bin hier der Chef!“
„Und ich bin der Verantwortliche für die Maschinen!“
Es waren wirklich unschöne, überlaute, wahrlich hässliche Szenen, die ich miterleben musste. Dabei waren das nur die morgendlichen Ausfälle. Was da alles so zwischendurch ablief, konnte und wollte ich lieber nicht wissen.
„Ja“, sagte Willibald, „der Alte kann schon ganz schön scheußlich sein.“
So passiere es ihm mit großer Regelmäßigkeit, dass er von ihm bei seinen täglichen Zusammentreffen, zusammengeschissen werde. Bringe er ihm seinen Tee oder Nachmittagskuchen empfange er ihn durchweg mit Zurechtweisungen. Gängig sei das Anschnauzen mit:
„Abstand, Etikette - wann lernt er das endlich?“
Das war unser Käptn. Beim Mittagessen ließ er sich meist entschuldigen. Abends kam er scheinbar nicht um seine sozialen Verpflichtungen herum. Er aß dann mit uns Passagieren, sprach außergewöhnlich wenig - schiss aber oft, wenngleich nur mit seinen Augen den <aufbackenden> Steward zusammen. Hinterher kam dann das verbale Donnerwetter. Schon allein deshalb tat es Willibald gut, mir suppentellerweise den Kaviar zu servieren. „Irgendwann ist er schneller als berechnet und erwartet zu Ende und für den Käptn ist von seiner Leibspeise nichts mehr da - ja, die Passagiere gehen eben vor. Auf diesen Tag freute sich Willibald.“
Das war der Stand der Dinge, als wir in den drückend heißen Hafen <La Guaira> einliefen und an einem langen Kai ganz hinten festmachten.
Die Stadt war praktisch der Hafen der Hauptstadt CARACAS. Diese lag, klimatisch etwas besser dran, auf durchschnittlich 900 Metern über dem Meer. Eine tolle, sechsspurige Autobahn führte <nach oben>. Venezuela war reich geworden, es hatte Ölquellen. Ihr Präsident war einmal wieder ein allmächtiger selbsternannter Herrscher.
Ein Diktator löste seinerzeit in diesem Land noch den nächsten ab. Jetzt war es - glaube ich - Pérez Jimenez. Er warf mit den Petrodollars um sich. Baute großkotzig. Auch diese Autobahn war für weit in die Zukunft projektiert. Zurzeit war da recht wenig Verkehr, als wir mit dem Taxi die Windungen lang in die Berge fuhren.
Das Leben und Treiben in meiner ersten Südamerikanischen Stadt schüttete kübelweise Eindrücke - nicht nur auf mich.
So ließ ich die Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen, um meinen Mangel an Kultur unter Beweis zu stellen.
Es war in, vor oder zwischen einem Aufzug - wie auch immer. Wir waren auf die Aussichtsplattformen der neuen hohen Zwillingstürme hochgefahren, als es passierte.
Ich konnte ja nicht wissen, dass füllige <Damen>, stramm in ein Korsett eingepasst, beim Verlassen eines Aufzugs das Vorrecht genossen, sich als Erste nach draußen drängeln durften. Woher sollte ich das wissen? Ich war noch niemals mit einem Aufzug gefahren. Überhaupt, wo hätte ich in der Kriegs- und Nachkriegszeit, dann noch in der Kleinstadt Kaiserslautern, meine kulturelle Erziehung diesbezüglich trainieren sollen? Weil ich in diesem gut gefüllten Aufzug an der Endstation eben vorne links stand, war ich auch flugs draußen - aus Höflichkeit natürlich, für die ich mir immerhin etwas zugutehielt. Aber, das sei nochmals betont, selbige war hausgemacht.
Mutti aber machte meiner lieben Charlotte eine Szene. Das produzierte Tränen bei meiner schönen Charlotte, als sie mir die ernsten Vorhaltungen beichtete.
Ich versprach Besserung, sagte zu, demnächst besonders viele Aufzüge benutzen zu wollen - sofern es denn welche in Quito gab - um mein Kultur- und Erziehungsdefizit auszugleichen. Das hatte ich gar nicht so gerne, dass sich meine Charlotte die Vorhaltungen der ungehaltenen Mutti so zu Herzen nahm.
Immerhin gab es Hoffnungen, dass sich dieser Schwie- germuttertyp Kurt Koch bessern würde. Er war ja noch jung. Und war lernfähig. Er hatte ja auch begriffen, dass man als männlicher Fahrstuhlbenutzer nicht als erster aus einer sich öffnenden Fahrstuhltür flüchten durfte. Zuerst die Damen. Von kleinen Kindern hörte ich nichts. Hätte ja sein können und ich rechnete mir aus, dass es irgendwie analog zum Verlassen eines sinkenden Schiffes zugehen würde - vielleicht. Von dort hatte ich die Weisheit, um den Standardspruch zu kennen: „Frauen und Kinder zuerst!“ Ja, soweit war ich schon.
Später am Nachmittag fuhren wir wieder zurück zum Hafen.
Als das Taxi auf den langen Kai einschwenkte, sahen wir zu unserer Bestürzung, dass auf dem Schiff die deutsche Fahne auf Halbmast gesetzt war.
Als Erstes vermuteten wir, dass Adenauer gestorben sein könnte/musste. Wieso würde sonst ein so symbolträchtiges Stück Stoff in der Mitte statt auf der Höhe eines Mastes baumeln - sie konnte nicht flattern, es gab ja keinen Wind.
Nein, Adenauer lebte noch. Sogar noch etliche Jährchen darüber hinaus.
Der Steward hatte praktisch auf mich gewartet. Er musste Neuigkeiten loswerden.
Der Leitende habe sich erhängt, Selbstmord. „Der hatte die Schnauze gestrichen voll. Sah keinen Ausweg mehr. Die noch vor Kurzem abgelaufenen Beleidigungen des Käptns waren jetzt kaum noch steigerungsfähig. Unfähiger Pfuscher, Versager, totale technische Null, Hohlkopf, er solle endlich zugeben, dass er für diesen Posten völlig ungeeignet sei“, usw. So habe er ihn noch, kurz bevor man den Ing. tot fand, beschimpft.
Es sei mehr und mehr unerträglich geworden, auch für die Mannschaft. „Aber, bitte halt Deinen Mund. Ich kann nur nicht ab, dass der jetzt von einem tragischen Unfall spricht. Ich muss mich aussprechen.
„Dazu hat er uns in der Mannschaft zum Schweigen vergattert. Das kann doch nicht sein“, schimpfte Willibald.
„Die Wahrheit muss doch ans Tageslicht kommen.“
Konsularbeamte seien bereits dagewesen. „Der Ing. wird in einen Zinksarg eingelötet und auf dem Schiff verstaut bis nach der Rückreise in den Heimathafen.“
„Und wer macht jetzt den Chief?“, wollte ich wissen.
„Der Zweite. Mit dem hat der Käptn dann leichteres Spiel.“
Beim Abendessen teilte uns der Kapitän mit finsterer Miene mit, dass es leider einen tragischen Unfall auf der HEIDELBERG gegeben habe. Der hätte dem sehr geehrten 1. Ingenieur das Leben gekostet. Tragisch. So was kann passieren!“ Aus, Schluss, basta. So wie ich ihn mit seinen Ausfällen kannte, hätte er ohne mit den Wimpern zu zucken ein „Scheiß drauf“ dazugeben können.
Dann aber doch noch eine Zugabe: Wir sollten uns nicht in unserer guten Laune beeinträchtigen lassen. Das Leben auf dem Schiff gehe weiter, wie bisher.
Das stimmte nicht ganz. Morgens wurde nicht mehr gebrüllt vor meinem Kajütenfenster. Da hatte sich doch allerhand geändert. Noch einmal war es ein verspäteter Sieg eines Herrenmenschen über einen „normalen Zivilisten“.
Als nächstes Ziel hatten wir COLON an der Einfahrt zum Panamakanal. Dass die schwüle Hitze noch steigerungsfähig war, konnte ich mir nicht vorstellen. Doch sie steigerte sich sogar noch beträchtlich.
In COLON hatten wir 3000 Tonnen Baustahl zu löschen - ordinär: auszuladen. Der wurde von unseren Bordkränen aus den Tiefen des Schiffes herausgehievt. Dazu brauchte man doch eine Reihe von Muskelmännern, die sich um die Handgriffe kümmerten. Das war schon schwer genug - in dieser Hitze.
Da arbeiteten sie mit verschmutzten kurzen Hosen und freiem schweißglänzenden, sehr dunklen Oberkörpern. Kein einzig hellfarbiger oder sogenannter <Weißer> war unter ihnen. Jeder hätte gut und gern der Figur nach einen Boxweltmeister abgeben können.
Um ihren Durst zu löschen, wurden Eimer mit Wasser beigebracht. Der Käptn wollte sie bei Laune halten, denn durch die <dumme Geschichte> in LA GUAIRA hatte man soundsoviele Stunden verloren. Was sich hier, an der Einfahrt zum Panama-Kanal auf einen weiteren geschlagenen Tag ausweiten konnte. Denn nur bis 17 Uhr Ortszeit durften Schiffe in den Kanal <einfahren>. Danach ruhte der Verkehr bis zum kommenden Tag. Und die später ankommenden Schiffe mussten in einer Kolonne Anker werfen.
Also versuchte auch der Käptn darauf hinzuwirken, dass wir es noch vor Toresschluss des Kanals schaffen sollten. Die Bedienung mit frischem Wasser in Eimern war ein Mittel die Laune bei den <Estibadores> zu erhalten.
Ich konnte nur staunend zuschauen. Die schütteten das Wasser tatsächlich in sich hinein und einen Teil daneben, über ihren Körper - aber nicht umgekehrt.
Ich hatte ganz einfache Turnschuhe mit sehr dünnen Gummisöhlchen an, als ich von einem <Balkon> aus dem Entladen - dem Löschen - zuschaute. Und begann alsbald einen Tanz, denn die Füße brannten auf den unbarmherzig von der gnadenlosen Sonne aufgeheizten stählernen Bodenplatten.
Wir schafften es aber ganz kurz vor <Toresschluss> in den Kanal einzufahren. Wir waren das letzte Schiff, das diesen Tag passieren würde.
Ein technisches Schauspiel, ein Erlebnis ohnegleichen wurde für mich das Ziehen des Schiffs in die und in den Schleusenkammern. Dreimal ging´s hoch.
Der Tag neigte sich dem Ende zu. Um die sechs Uhr würde es sehr schnell dunkel werden. Das hatte ich bereits gelernt.
Ausdrücklich wurden wir Passagiere vom 1. Offizier vor den Dieben gewarnt, die sich im Laufe der Kanaldurchfahrt, in der Dunkelheit und aufgrund der sehr geringen Geschwindigkeit, an Bord schmuggeln würden.
„Schraubt die Fenster zu. Schließt die Türen ab, lasst keinesfalls den jetzt üblichen Lüftungsspalt offen. Wenn Sie den Einheimischen was abkaufen wollen, dann versichere ich Ihnen im Voraus, dass Sie übers Ohr gehauen werden. In Panama gibt es mehr Spitzbuben als anständige Menschen. Jedenfalls aus der Sicht eines Schiffsführers.“
Gerade noch bei Tageslicht fuhren wir in eine Art See. Wir waren nicht weit vom rechten Ufer entfernt. In großen Mengen waren dort noch riesige rostige Maschinenteile zu erkennen, die noch vom Versuch eines französischen Ingenieurs zeugten, der Ende des 19. Jahrhunderts gerne den Kanal gegraben hätte. Im Hinterkopf hatte ich horrende Zahlen parat: 40 000 Tote durch Gelbfieber und Malaria. Dann gab man das Projekt auf. Die Amis kamen danach, versprühten tonnenweise DDT und verwirklichten dann nur einige Jahre später diesen Traum einer Verbindung zwischen Pazifik und Atlantik.
Die Schwüle steigerte sich noch einmal, als wir dann zwischen den Dschungelbergen mit kaum wahrnehmbaren und erlaubten fünf Knoten fuhren.
Dann kam die Nacht und zunächst, von unseren Lampen angezogen, die Schmetterlinge. Weder Charlotte noch ich hatten je solche Fantasiegebilde gesehen. Die meisten, die sich um die Lichter sammelten waren groß oder größer als Sperlinge. Mit Farben und Formen, von denen man nur träumen konnte.
Dann kamen schemenhaft die ersten <blinden Passagiere>. Sie bewegten sich wie Wiesel, geschwind und gespenstisch. In knielangen Hosen, oder wenigstens sahen diese Kleidungsstücke danach aus. Oberkörper frei. Wie die Piraten. Und sie verteilten sich rasch in Richtung der Wohnräume oder Kabinenaufbauten.
Verschwinden hieß die Parole. Alle quasselten unverständliches Zeugs. Verstehen, was die wollten, konnten wir nichts. In meiner Kabine konnte ich alsbald mitbekommen, dass der 1. Offizier richtig geraten hatte. Mein rundes Fenster hatte ich so verschraubt, dass noch ein wenig Luft herein- oder hinausgelangen konnte. Als Vorsichtsmaßnahme gegen Ersticken in schwüler Hitze. Schon machten sie sich von außen mit eisernen Haken daran zu schaffen.
In englischer Sprache kam es von der Tür her. „Mister, open. Good things to sell. Open Mister.“
Ich hatte ja alles, bloß so gut wie kein Geld, weshalb also öffnen?
Gegen elf Uhr waren wir auf der anderen Seite. Panama City beleuchtete ein wenig den Pazifik. Schon wieder ein Traumziel erreicht.
Der Käptn ließ auf dem offenen Meer - dem Pazifik, den ich leider noch nicht sehen konnte, es war ja Nacht - sofort Fahrt machen, wir sollten als nächstes den kolumbianischen Hafen BUENAVENTURA anlaufen. Dass die wörtliche deutsche Übersetzung dieses Stadtnamens - <Gutes Abenteuer> - überhaupt nichts mit der Realität zu tun hatte, ja regelrecht Hohn sprach, erfuhren wir noch am gleichen Tag.
Bei Tageslicht fuhren wir auf einem relativ schmalen Fluss aufwärts. Fast zum Greifen nahe die grüne Dschungelwand. Dann kam die <Hafenstadt> (!!) in Sicht. Durchweg krumme Bambushütten, unbefestigte, ausgewaschene Straßen-Pisten, freilaufende schwarzdreckige Schweine, giftig grünlich schillernde Pfützen oder Tümpel, menschliche Gestalten, die z.T. nicht minder dreckig, entweder einfach herumlungerten, an schuppenähnlichen Gebilden lehnten, Sichtblenden aus Bambus - mehr waren es auch nicht bei den offensichtlich bewohnten Hütten - das alles in greifbarer Nähe. Ein intensiver, strenger Geruchsmischmasch strömte bis zu uns herauf. Ein von mir nicht einzuordnendes Leben. Einer der Kadetten machte mir Mut und meinte mehr beiläufig, aber doch wichtigtuerisch und hinterhältig: „Guayaquil ist noch schlimmer!“
Dort, an der nächsten „Haltestelle“ sollte ich aussteigen.
Unser Schiff drehte und legte an einer überaus verdreckten Kaimauer an.
Von einem Landgang hatte man uns dringend abgeraten. Hier gibt´s nichts zu sehen - und was zu sehen ist kann man auch vom Schiff aus sehen.
Nutten sollte es en masse geben. Die entsprechenden Krankheiten, neben den Gefahren sowieso.
Einige Mann vom Schiff hatten da so ihre Erfahrungen, die sie sicherlich auffrischen wollten. Später kommentierten sie ihre Abenteuer absichtlich so laut, dass wir Passagiere es auch ja mitbekommen mussten: „Nee, mit der mach ich´s nich. Die muss es mir machen. Flötenspielen. Oder auch Handbetrieb. Ich bin aber doch nicht lebensmüde und besorg´s der. Da kannse dir ja sonstwas holen.“
Es war mir damals nicht alles klar, was diese Anspielungen bedeuten sollten. Und fragen wollte ich nun doch nicht.
Lieber würde ich mit meinem kulturellen „Defizit“ unerkannt weiterleben wollen.
Jedenfalls wurden Kisten und Holzkontainer auf den Platz hinter der Kaimauer gehievt. Total verlotterte, klapprige, stinkende LKWs schleppten sie weg.
Dann kam der große Moment, den mir bereits Willibald angekündigt hatte.
„Das musst Du gesehen haben. Die Arbeiter, die bei der Löschung der Ladung geholfen haben, werden jetzt von unserem Zahlmeister ausbezahlt. Dann beginnt das Schauspiel. So war es.
Der Zahlmeister stand auf der unteren kleinen Plattform des Fallreeps, der langen Treppe die von Deck bis auf die Kaimauer reichte. Er übergab Geld, während die Taue, die uns mit der Mauer verbanden, bereits gelöst waren. Dann machte er ein Zeichen nach oben, wo zwei Mann mit dem Bootsmann das Fallreep einholten - hochkurbelten, und zwar so rasch es eben ging.
Zwischen den zerlumpten Gestalten - Ca. 15 Mann, begann sofort ein lautstarker Streit. Messer kamen zum Vorschein. Sie gingen aufeinander los. Das Ergebnis wollte ich nicht sehen.
Laute Befehle hallten über das Schiff. Der Käptn war mal wieder in seinem Element.
Ich bekam mit, dass man es gewagt hatte ihm zu widersprechen. Die Ebbe sei zu weit fortgeschritten, der Wasserstand in der Flussmündung zu niedrig.
Er setzte sich durch und wir fuhren mit Caracho den Wasserlauf entlang. Ich spürte einige Male, dass es nicht nur Wasser war, das wir unter dem Kiel hatten.
Ganz schnell erfuhr ich von Willibald, dass man sich das <Logstaurohr> abgerissen hatte. Hatte irgendetwas mit der Geschwindigkeits- und/oder der Tiefenmessung zu tun. Das wiederum brachte den Käptn in noch schlechtere Laune. Darunter hatte sogar ich zu leiden.
Die Äquatortaufe stand bevor. Ein Ereignis, an dem ich natürlich gerne selbst teilnehmen wollte. Willibald warnte mich. Der Käptn hat was vor. Aber ich wollte nicht hören. Den Äquator überquert man nur einmal das erste Mal.
Auf dem Hinterdeck wurde ein großes Segeltuch so an vier Ecken aufgespannt, dass daraus ein Pool wurde. Ein Schwimmbecken - weshalb war man nicht vorher auf eine solche Idee gekommen?
Auf der Längsseite dazu wurde ein Belüftungssack, ca. 60 cm im Durchmesser gelegt. Mehr als 10 Meter lang. Für Neptun wurde ein Thron aufgebaut. Das alles, weil einige Kadetten, Offiziersanwärter ebenfalls getauft werden sollten. Ich gedachte mir die Rolle als Mitläufer zu. Wenn es diese jungen Männer machen, weshalb nicht auch ich.
Der Kapitän hatte wahrlich anderes im Sinn.
Er wollte mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Der alte Stratege. Wollte seinen Jungs einen Spaß erlauben, sozusagen als Entschädigung dafür, dass ich ihnen die Beute in der Person von Charlotte weggeschnappt hatte. Und er wollte natürlich auch seinen Spaß haben, wollte seinen Sadismus ausleben. Nicht nur für einen Kapitän ein krankhaftes Unterfangen.
Die Zeremonie begann gegen Mittag. Sie dauerte <ziemlich> lang. Vor meinem Auftritt waren bereits einige andere Jungs durch die Mangel gedreht worden. Sie mussten die Stiefel des Neptuns küssen, um die Taufe nachsuchen. Sie wurden dann im Becken getaucht indem zwei Mann sie festhielten und hatten durch den Belüftungssack kriechen müssen. Spätestens da hätte ich aufgeben sollen, denn manche, nicht alle, wurden ganz schön rangenommen.
Aber ich und aufgeben? Dann noch vor Charlotte?
Sie schmierten mich viel intensiver und hingebungsvoller mit schwarzer Schmiere ein als je einen davor. Ein extra Eimer voll mit diesem Zeugs wurde beigebracht.
Dann <abwaschen>, abspritzen in dem Belüftungsrohr, denn so kommt uns der Kerl nicht in das Becken mit dem schönen sauberen Meerwasser.
Ich musste durch. Es kostete mich alles, was ich an Überlebenswillen hatte. Man spritzte mit einem C-Rohr von vorn und von hinten.
Dann, völlig entkräftet schleppte man mich in das Becken und tauchte mich, bis ich dabei war das Bewusstsein zu verlieren.
Hatte der Kapitän noch nicht genug Tote auf diesem Schiff und dieser Reise? Er ging entschieden zu weit mit einem Gast.
Und dann malträtierte mich nochmals Neptun. Bis ich Stimmen hörte, dass Schluss sei.
Ich wurde zum Reinigen entlassen. Ich verzog mich in den Maschinenraum in eine Ecke unter eine heiße Dusche. Ich verbrauchte zwei Dosen Schmierseife und Unmengen heißes Wasser. Und kam nach ca. 90 Minuten wieder ans Tageslicht.
Nahe dem Abendessen kam einer aus dem Maschinenraum und reklamierte, dass ich seine ganze Schmierseife aufgebraucht hatte. Ich war nahe dabei ihm an die Kehle zu fahren, derart, dass der Kapitän eingreifen musste und sich notgedrungen - sogar als der Urheber und Pate des recht hintersinnigen Taufverfahrens - auf meine, des Fahrgastes Seite, schlug.
Die anderen Passagiere beklagten sein <passives> Verhalten - bei der <Zeremonie> und drängten ihn zu einer lauen Entschuldigung. Dabei war er der Initiator.
Willibald steckte es mir, dass er es von der Mannschaft wusste. Es war alles geplant. Und, wie bereits gesagt, als Sondervergütung für die Offizieranwärter gedacht. Willibald drängte mich dazu mich bei der Gesellschaft zu beklagen. Er würde als Zeuge dabei sein. Den wollten sie loswerden.
Doch die nächsten Tage hatte ich andere Gefühle zu bewältigen. Ich wollte es vergessen. Und vergaß meine anklagende Stimmung.
Früh am nächsten Morgen rasselten die Ankerketten.
Es war dunstig, wir lagen inmitten einer sehr breiten Flussmündung, ein paar grün bewachsene Inselchen waren sichtbar. Ansonsten Hügel mit Grün so weit das Auge in der diesigen Luft schauen konnte. Und gut, gut warm. Das schon so früh morgens.
Nach etwa einer Stunde kam ein Motorboot und damit scheinbar ein Lotse. Der Anker wurde eingeholt und wir begannen eine langsame Fahrt in eine Flussmündung hinein. Einige zig Kilometer weiter Flussaufwärts werde man Guayaquil erreichen. Die größte Hafenstadt in Ecuador. Wir schoben uns langsam den <Fluss Guayas> - Rio Gayas - hoch.
Rundum trübes und nicht gerade angenehm riechendes Wasser. Es schien zu stehen, keine Bewegung in irgendeine Richtung zu haben. Viel Unrat, Abfall, wie mir schien, schwamm herum, scheinbar richtungslos.
Dann kamen lange schmale Boote, beladen mit allerlei, aber hauptsächlich mit Bananen. Je zwei Mann lenkten, ruderten und trieben das Fahrzeug auf unser Schiff zu.
Irgendwie und schnell waren sie an Bord, hatten sich hochgehangelt. Einem Redeschwall, von dem ich natürlich nichts verstand, entnahm ich, dass sie alles günstig zum Kauf anboten. Natürlich Bananen und handgemachte Textilien, Ananas, Papayas - was immer das sein mochte, ich kannte ja diese Früchte noch nicht - und vieles andere mehr.
Sie bedrängten jeden, den sie an Bord sehen konnten. Aber die Geschäfte liefen schlecht. Ich ging, wie angeraten, meine Kabine abzusichern.
Noch ein paar Stunden bis zum Abschied von Charlotte. Fünf Wochen hatten wir Zeit zum Kennenlernen. Zum Bestaunen von neuen Gefühlen und Erlebnissen in und mit der Natur. Ja, das auch.
Charlottes Vater hatte einen UNO-Auftrag in Bolivien. Doch er versicherte, dass er ihn so schnell wie möglich abbrechen wolle, damit <die Kinder> zusammenfinden könnten.
Bis nach Bolivien, Zielhafen Arica, waren es für Charlotte noch einige Tage.
Der Ankerplatz mitten im Fluss
Die HEIDELBERG ankerte mitten auf dem großen, Fluss Guayas. Breite dunkle Streifen an den Uferseiten bestätigten, dass Ebbe und Flut bis hierher zugange waren. Es schien noch ablaufendes Wasser zu sein, weil die Heidelberg mit dem Hinterteil in die Richtung wies, aus der wir in langsamer Fahrt gekommen waren. Die Ankerketten waren vor dem Bug gespannt.
Das Schiff hing praktisch an den Bugankern, die sich sicherlich in das Flussbett eingegraben hatten.
Links war die Silhouette einer großen Stadt zu sehen. Ich atmete auf. Absolut kein Vergleich mit dem, was wir in Buenaventura zu sehen bekommen hatten. Hohe, moderne Gebäude bildeten eine recht imposante sky line, zumindest in einem überschaubaren Bereich. Weiter <unten> und weiter <oben> am Fluss, dort wo auch die Sicht-Durchlässigkeit der Luft, wohl aufgrund ihres hohen Feuchtigkeitsgehaltes, immer schlechter wurde, knickte die Silhouette deutlich ein. Scheinbar gab es dort nur noch eingeschoßige Gebäude. Sie bildeten eine Art Anhängsel zu den sichtbaren recht modernen Gebäudeansammlungen.
Sicherlich führte eine Straße in Ufernähe vorbei. Ich sah dort Autos fahren.
Es war noch lange nicht Mittag und die Atmung wurde zunehmend schwieriger. Das lag zum einen an der wassergeschwängerten Schwüle und zum anderen daran, dass ein kräftiger Mix von teils unbekannten Gerüchen auf die Geschmacksnerven einwirkten - regelrecht drückte. Mal dominierte eindeutig ein Fäulnisgestank, da vergammelten Abfälle, dann war es wieder Fisch - noch nicht vergammelt - dann schwerer Blütenduft oder was ich dafür hielt, auch Autoabgase und Teer waren mit von der Partie.
Von meinem Freund, dem Steward Willibald hatte ich Abschied genommen. Der Kapitän ließ sich nicht blicken. Warum auch?
Auf eine Art Kahn - ein großer flacher Kahn - wurden Kisten verladen. Die meisten kamen mir irgendwie bekannt vor. Ach ja, Industrienähmaschinen. Ich hatte sie eine längere Zeit verdrängt - oder vergessen. Die neue Wirklichkeit kam - unerbittlich oder drängend? - auf mich zu.
Kurz nach Mittag kam ein ziemlich kleines Boot mit zwei Mann an Bord. Einer davon, ein verschwitzter, leicht übergewichtiger Mann mit großem Schnauzer stellte sich mir vor - das glaubte ich wenigstens aus seinen Gebärden herauszusehen. Er nahm mich väterlich um die Schulter, geleitete mich das Fallreep hinunter. Der andere, ein heruntergekommener Begleiter, nahm sich meiner Koffer an. Es waren ja nur zwei. Mit meinem ganzen Hab und Gut für den Start in einen neuen, entscheidenden Lebensabschnitt. Dann tuckerten wir Richtung Ufer und Charlotte blieb auf dem Fluss zurück.
Bald würde ich den festen Boden im Land meiner Träume unter mir spüren. Irgendwann hatte Kolumbus auch einmal diesen ersten Schritt getan. Aber das war auf der Ostseite von Amerika. Ich war jetzt im Westen. Auf der „Pazifik-Seite“.
Irgendwo am Ufer zeichneten sich Anlegestellen als primitive Holzplattformen ab. Dreckig, überall Fischreste und Reste von Schalentieren - Krebse oder so was. Näher am festen Land, dort wo das Wasser bereits abgelaufen war, gab es feuchte, dunkelgraue bis schwarze, nass glänzende Pampe. Darin sah ich flüchtig einige Männer, manche bis zu den Oberschenkeln watend - sie suchten nach etwas. Ich glaubte bei einem einen großen Krebs gesehen zu haben.
Nahrung aus diesem Faulschlamm?
Der „intensive Geruch“ hatte sich noch verstärkt.
Hier und jetzt betrat ich zum ersten Mal das Land meiner <Träume>. Es schien nicht der <Wilde Westen> zu sein, aber Attribute wie „stinkend“ konnte ich fürs Erste festhalten.
Der Träger - an den Ausdruck würde ich mich schnellstens gewöhnen müssen - schwang mein Gepäck in das schlundähnliche Hinterteil eines riesigen Amischlittens. Das war alles. Kein erweitertes Empfangskomitee, keine Blasmusik, keine Einreiseformalitäten, kein Zoll, einfach so.
Bald glitten wir über aufgeheizten und recht pappigen Asphalt, tauchten in Schluchten von 5 bis 7-stöckigen Gebäuden ein. Die Hitze nahm noch einmal beträchtlich zu, wenngleich ich eine weitere Steigerung bis vor kurzem noch für unmöglich gehalten hatte.
Die Menschen ringsum: Keine Hetze. Alle schlenderten mehr wie beim gemütlichen Sonntagsspaziergang auf den breiten Bürgersteigen. Alle waren sehr leger gekleidet. Viele auch lässig oder besonders nachlässig. Bei näherem Hinsehen war es denn doch nicht Nachlässigkeit, sondern Ärmlichkeit. Das war ein neues Erlebnis: Arme Leute. Abgerissen. So sahen sie also aus.
Sicher, ich kannte sie aus Deutschlands Nachkriegszeit, konnte ein bisschen Maß an mir selbst nehmen. Das, was aber jetzt auf mich einstürmte, hatte so etwas wie Methode. Diese <neuen> Armen waren nicht nur ärmlich, sie waren auch schmutzig, die Kleidung nicht nur abgewetzt, sondern auch zerschlissen und zerrissen, teils verlumpt. Stark gebeugte Männer quälten sich mit schweren Lasten auf dem Buckel, festgehalten vor der Stirn mit einem Seil oder Riemen. Sie machten auf mich den Eindruck wie Lastentiere. So hatten die Kuhbauern ihre Rindviecher vor einen Wagen gespannt. Das Kummet drückte auf die Stirn.
Bald sollte ich feststellen, dass sie auch ziemlich streng rochen - ach, weshalb diese verdeckte Höflichkeit: Sie stanken, z.T. erbärmlich. Die Atemluft, sowieso schon schwer, konnte einem im Halse stecken bleiben.
An den Häuserfronten hingen an fast allen Fenstern große Kästen. Der Boden darunter schien nass. Ich würde Klimaanlagen kennenlernen.
Hupen schien ein Volkssport. Wegen jeder Nichtigkeit wurde auf die <Bocina> gedrückt. Jeder schien sich im Verkehr <durchzuschlängeln>, immer irgendwie, Regeln schien es nicht zu geben.
Mit wenigen und kaum verständlichen englischen Brocken versuchte mir mein Begleiter klarzumachen, dass er mich zunächst in ein Hotel bringen würde.
Dort erklärte man mir nach einigem Palaver am Empfang, dass mein Begleiter die Absicht habe, hier auf mich zu warten, bis ich mich frisch gemacht habe.
Vom Hotel schlenderten wir - wie bereits gesagt, niemand hatte es eilig - einige Straßen weiter und mit einladender Geste setzten wir uns an einen der auf dem Bürgersteig aufgestellten Tische. Ein dienstbarer Geist fragte offensichtlich nach unseren Bedürfnissen. Er brachte kaltes Wasser, irgendeinen Fruchtsaft, von dem ich in meinem