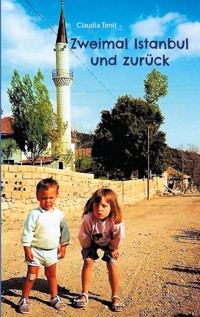Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frei sein und sonst nichts - dieser Vorsatz zieht sich durch die Geschichte eines jungen Paares in den Achtzigerjahren. Einer Geschichte, die mit der Reise nach Spanien - per Autostopp und (fast) ohne Geld - beginnt und in einem Leben jenseits aller gesellschaftlicher Normen endet. Der Kampf ums tägliche Dope bestimmt den Alltag - und trotzdem: Das Leben ist leicht. Da kommen Veränderungen, die den bisherigen Lebensentwurf auf eine harte Probe stellen....
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Claudia Tenit, geboren 1965 in Salzburg, beschreibt in ihrem zweiten Buch „Ein bisschen Dope und noch mehr Freiheit“ das unbekümmerte Leben eines jungen Paares in den Achtzigerjahren, das von der Sucht nach Freiheit bestimmt ist, einer Freiheit, die den gesellschaftlichen Normen so ganz und gar nicht entspricht …
Inhalt
Anstatt eines Vorworts
Einfach weg
Eine gemeinsame Wohnung
Amsterdam
Sonne, Strand und Abenteuer
Ausgesperrt
Dope um jeden Preis
Reisepläne
Urlaub mit Hindernissen
Freunde werden Feinde
Die neue Connection
Veränderungen
Zu Dritt
Zurück ins alte Leben?
In eine fremde Welt
Anstatt eines Vorworts
„Die Sonne scheint. Es ist ein wunderbarer Tag. Und ich bin weit weg von zu Hause. Das macht mich leicht und unbeschwert.“
Ich saß unter einem, an den Felsen neben mir gelehnten Fischerboot, das mir heute als Nachtlager gedient hatte und schrieb diese paar Zeilen in mein Tagebuch. Die Morgensonne glitzerte auf den Wellen, die sanft ans Ufer plätscherten. Laut kreischend umkreiste ein Schwarm Möwen den Felsen vor der Bucht.
Wir waren in Spanien. Und das ohne Geld, ohne Unterkunft und ohne einer Vorstellung davon, wie lange wir bleiben und wovon wir leben wollten. Wir – das waren Woifal und ich. Wir hatten uns auf einer Silvesterparty kennen gelernt. Woifal war arbeitslos, ich hatte kurz vor der Matura die Schule abgebrochen. Gemeinsam vertrieben wir uns die freie Zeit in verschiedenen Lokalen, bis ich eines Tages das Gefühl hatte, raus aus Salzburg, raus aus diesem eintönigen Leben zu müssen … Ich wollte frei sein. Frei sein, das zu tun, was mir gerade in den Sinn kam - und sonst nichts.
Einfach weg
Ich packte meinen kleinen Wanderrucksack, rollte meinen Schlafsack ein, befestigte ihn obenauf und schlüpfte in meine samtenen China-Schuhe. Obwohl sich die Sonne nur zaghaft zeigte, trug ich meinen geblümten Sommerrock und eine leichte Bluse dazu. Was kümmerte mich das Aprilwetter hier in Salzburg – ich wollte sowieso nach Spanien!
Aus einer Laune heraus hatte ich gestern Abend, als wir von einem Lokal in das nächste gezogen waren, zu Woifal gesagt: „Fahren wir doch fort von hier. Trampen wir nach Spanien!“
Und ohne lange nachzudenken, hatte Woifal geantwortet: „Ja, warum nicht. – Wann denn?“
„Morgen früh – so um neun?“, hatte ich vorgeschlagen und nicht im Geringsten damit gerechnet, dass Woifal diesen Vorschlag ernst nehmen würde.
Doch er hatte sofort eingewilligt: „Passt. Treffen wir uns morgen um neun beim Lokalbahnhof, dorthin ist es für uns beide gleich weit!“
Nun, da ich meine Sachen fertig gepackt hatte, überkamen mich Zweifel. Würde Woifal wirklich kommen? Oder war er gestern schon so betrunken gewesen, dass er heute gar nichts mehr davon wusste?
Als hätte sie meine Gedanken erraten, sagte meine Mutter plötzlich: „So eine Schnapsidee! Hals über Kopf nach Spanien fahren – glaubst du denn, dass dein Bekannter überhaupt kommen wird?!“
„Wenn nicht, dann kehr ich eben wieder um“, beschwichtigte ich sie, verabschiedete mich dann aber doch mit den Worten: „Sobald wir angekommen sind, ruf ich dich an!“
Danach machte ich mich auf den Weg durch die fast leeren Seitenstraßen und hatte in wenigen Minuten den Bahnhofsvorplatz erreicht. Das kleine Gebäude der Lokalbahnstation war menschenleer. Auch von Woifal war nichts zu sehen.
„Vielleicht ist er im Warteraum“, dachte ich, spürte aber zugleich, wie ein Gefühl der Enttäuschung in mir hochkam.
Beim Näherkommen warf ich einen kurzen Blick durch die Glasscheibe. Der Warteraum war leer.
Da sah ich plötzlich hinter dem Gebäude jemanden kommen – mit einem Rucksack auf der Schulter – es war Woifal.
Erleichtert sagte ich: „Du bist wirklich gekommen!“
„Was glaubst denn du! War ja ausgemacht! Von wo fahren wir weg?“
„Salzburg-Mitte“, schlug ich vor.
Wir nahmen den Bus und stiegen nach einer Fahrt quer durch die Stadt in der Nähe der Autobahnauffahrt aus. Inzwischen hatte sich der Himmel verfinstert. Dunkle Wolken bedeckten die Sonne, und ein kühler Wind blies mir die Haare ins Gesicht und zerrte an meinen Kleidern. Nachdem wir die Auffahrt entlang gegangen waren, stellten wir uns an den Pannenstreifen. Ein Auto nach dem anderen fuhr an uns vorbei. Missmutig sah ich den Autos hinterher. Während wir warteten, verschlechterte sich das Wetter zusehends. Der Himmel wurde schwarz und schwärzer. Es sah so aus, als würde es in kürzester Zeit zu regnen beginnen. Und plötzlich, mit einigen heftigen Windböen, wirbelten erste Schneeflocken vom Himmel.
„Das kann doch nicht wahr sein! Hoffentlich hat bald jemand Mitleid mit uns!“, dachte ich, während ich den heranfahrenden Autos entgegenblickte und abzuschätzen versuchte, ob uns eines davon mitnehmen würde.
Wieder näherte sich im mittlerweile dichten Schneegestöber ein Fahrzeug. Es schien seine Fahrt zu verlangsamen. Hoffnungsvoll hob ich den Daumen. Da erkannte ich, dass es sich um ein Polizeiauto handelte. Es hielt neben uns. Ein wichtigtuerischer Polizist, einer, der seine Arbeit ganz genau nahm, stieg aus und fragte, was wir hier täten.
„Autostoppen. Nach Spanien“, war unsere Antwort.
„Ihr steht auf der Autobahn. Das ist verboten!“, sagte er und fragte nach unseren Ausweisen.
Danach begann er zu schreiben, notierte Namen und Adressen und stellte zwei Strafzetteln aus, die er uns mit triumphierendem Gesichtsausdruck überreichte.
„Das macht für jeden von euch 250 Schillinge. Wegen unerlaubten Verweilens auf der Autobahn!“
Mir blieb kurz die Luft weg. 250 Schillinge – das war genau die Hälfte von meinem bisschen Geld, das ich für die Reise mitgenommen hatte. Zähneknirschend bezahlten wir die für uns riesengroßen Summen und verließen die Autobahn. Mutlos stellten wir uns an die Auffahrt. Mir war eisig kalt, die China-Schuhe waren durchnässt, und meine Stimmung war am Nullpunkt. Auch Woifal wirkte nicht gerade begeistert. Missmutig sah er zu, wie ein Auto nach dem anderen beschleunigte und an uns vorbei auf die Autobahn fuhr. Unsere Chancen, von hier wegzukommen, standen schlecht. An dieser Stelle anzuhalten, war fast unmöglich.
Da blieb, aller widrigen Umstände zum Trotz, plötzlich ein älterer, weißer VW-Passat stehen. Das Fenster wurde heruntergekurbelt.
„Wohin wollt ihr? Ich fahre nach Villach!“, fragte eine Frau mit zerzauster blonder Dauerwelle und sah uns fragend an.
„Wir wollen nach Italien und weiter bis Spanien“, antwortete Woifal erfreut. „Können wir mitfahren?“
„Steigt ein!“
Das ließen wir uns nicht zweimal sagen! Schnell stiegen wir ein, um keinen Stau zu verursachen. Endlich im Trockenen! Es war angenehm warm im Auto. Ich massierte meine Füße, die kalt wie Eis waren.
„Deine Freundin muss ja entsetzlich frieren! Nicht einmal Socken hat sie an! Bei diesem Wetter! Sie sollte welche anziehen. Das ist nicht gut für die Nieren. Sie wird krank, wenn sie so leichtsinnig ist!“, sagte unsere Fahrerin zu Woifal.
Verlegen gab ich zu, dass ich mit einem derartigen Wetterumschwung nicht im Entferntesten gerechnet hatte und gar nicht auf die Idee gekommen war, Socken einzupacken.
„Wenn wir Pause machen, gebe ich dir welche von mir. So kannst du nicht weiterfahren!“, sagte sie und erzählte dann, dass auch sie schon viel gereist wäre, manchmal per Autostopp, genau wie wir. Vor kurzem wäre sie in Afrika gewesen.
Langsam merkte ich, wie ich müde wurde. Das wohlig warme Auto, die vielen Gläser Wein gestern Abend, das frühe Aufstehen heute Morgen – ich schloss die Augen und döste vor mich hin. Irgendwann war ich eingeschlafen.
„Kommst du mit auf einen Kaffee, wir machen Pause!“, hörte ich plötzlich Woifals Stimme.
Verschlafen richtete ich mich auf. Wir waren an einer Raststätte stehen geblieben. Es schneite immer noch. Das nasskalte Wetter verlockte mich nicht im Geringsten, auch nur einen Fuß vor die Autotür zu setzen.
„Ich bleibe lieber hier und schlafe weiter“, gab ich zur Antwort.
Unsere Fahrerin kramte kurz im Kofferraum und reichte mir ein Paar weiße Tennissocken. Dankbar nahm ich sie entgegen und zog sie an. Gleich darauf spürte ich, wie meine eiskalten Füße ein wenig wärmer wurden. Ich rollte mich ein und schloss die Augen. Im Halbschlaf bekam ich mit, wie wir nach einiger Zeit unsere Fahrt wieder fortsetzten.
Als ich aufwachte, waren mehrere Stunden vergangen. Die Landschaft draußen war winterweiß geworden. Überall, wo man hinsah Schnee!
„Ich bringe euch noch nach Thörl-Maglern. Von dort könnt ihr mit dem Zug weiterfahren. Autostoppen hat bei diesem Wetter keinen Sinn!“, meinte unsere Fahrerin, während sie von der Autobahn abfuhr.
Kurze Zeit später ließ sie uns vorm Bahnhof aussteigen, wünschte uns noch alles Gute für unsere Reise und fuhr zurück nach Villach. Wir gingen durch den Schnee, der bereits knöchelhoch war.
„Wir müssen aber Autostoppen! Für ein Bahnticket reicht unser Geld nicht!“, sagte ich und war fest entschlossen, den Bahnhof so schnell wie möglich wieder zu verlassen.
„Bei diesem Wetter kommen wir nie von hier weg! Weit und breit ist kein Auto zu sehen! Versuchen wir es morgen früh und übernachten wir hier irgendwo“, überlegte Woifal.
„Hier am Bahnhof? Wo denn?“
Der Gedanke, die Nacht im Warteraum zu verbringen, gefiel mir ganz und gar nicht.
„Wir finden bestimmt einen abgestellten Waggon. Da ist es wenigstens trocken. Komm! Schauen wir uns mal um!“, versuchte Woifal mich zu überzeugen und ging voraus.
Und gleich darauf: „Da schau! Hier ist einer! Der ist für die Gleisarbeiter! In so einem Waggon hab ich schon einmal die Nacht verbracht! Damals bin ich mit ein paar Freunden in Südfrankreich gewesen. In Saint-Marie-de-la-Mer. Auf der Rückfahrt haben wir dann keinen Anschlusszug mehr gehabt. Deshalb haben wir die Nacht am Bahnhof verbringen müssen, zum Glück aber einen Waggon wie diesen gefunden.“
Wir überquerten einige Gleise, bis wir den alten Waggon, der abgekoppelt auf einem Nebengleis stand, erreicht hatten. Woifal drückte den Türgriff nach unten. Die Tür ließ sich öffnen. Wir stiegen ein. Der Waggon war, bis auf einige Ablageflächen und einem Tisch aus Metall, innen leer.
„Aber was ist, wenn das jemand merkt?“, fragte ich unschlüssig.
„Da kommt doch heute keiner mehr!“, meinte Woifal zuversichtlich.
Woifal hatte recht. Der kleine Bahnhof wirkte verlassen und leer. Weder Reisende, noch Bahnbedienstete waren zu sehen. Es würde für uns das Beste sein, diesen Waggon als Nachtlager zu benutzen. Wir stiegen ein, schlossen die Tür hinter uns und machten es uns einigermaßen bequem. Dann aßen wir unseren Proviant und rauchten einige Zigaretten. Die Kälte war ungemütlich.
„Ich rolle mich in meinen Schlafsack ein. Zum Wachbleiben ist es sowieso zu kalt“, sagte Woifal und suchte sich einen passenden Platz am Boden.
Ratlos sah ich mich um. Auf den schmutzigen Boden wollte ich mich nicht legen. Dann schon lieber auf den metallenen Tisch. Ich kletterte hinauf, breitete meinen Schlafsack aus und kroch hinein. Doch bald schon merkte ich, dass das kalte Metall auch keine ideale Unterlage war. Es fühlte sich an, als würde ich auf einem Eisblock liegen. Ich versuchte zwar, diese Tatsache zu ignorieren und trotzdem irgendwie einzuschlafen, doch unbarmherzig drang die Kälte durch meinen dünnen Schlafsack und weckte mich in regelmäßigen Abständen.
Irgendwann wurde es Morgen. Die schlimme Nacht war um. Wir stiegen aus. Der Schnee reichte nun bis über die halbe Wade. Ich war hundemüde und durchfroren.
Nachdem ich auf der Bahnhofstoilette mein Gesicht gewaschen und meine Zähne geputzt hatte, fühlte ich mich wieder besser. Paradoxerweise hatte das kalte Wasser im Gesicht bewirkt, dass mir einigermaßen warm wurde. Zumindest oben herum. Meine nassen, klammen Füße spürte ich ohnehin kaum mehr.
„Suchen wir mal ein Gasthaus. Was ich jetzt dringend brauche, ist ein heißer Kaffee!“, sagte Woifal.
Wir verließen den Bahnhof und fanden einige hundert Meter weiter ein Gasthaus an der Straße, die zur Grenze führte. In der Gaststube waren kaum Leute. Wir setzten uns an einen der freien Tische und bestellten ein kleines Frühstück. Der heiße Kaffee tat gut.
Nachdem wir uns ein wenig aufgewärmt hatten, schlug Woifal vor: „Fragen wir gleich hier, ob uns jemand mitnimmt! An die Straße brauchen wir uns nicht stellen. Bei diesem Wetter fahren sowieso keine Autos!“
Suchend ließ er seinen Blick durch die Gaststube schweifen. Die wenigen Einheimischen machten nicht den Eindruck, als würden sie irgendwohin fahren. Sie unterhielten sich lautstark bei Bier und Zigaretten und schienen sich so den trüben Tag zu vertreiben. Da entdeckte Woifal etwas weiter hinten ein Pärchen, das soeben bezahlt hatte und im Begriff war, aufzustehen.
„Fahrt ihr nach Italien?“, fragte Woifal auf gut Glück.
„Nur bis Tarvis“, war die Antwort.
„Nehmt ihr uns mit?“
Die beiden schienen nicht sonderlich erfreut. Wären wir an der Straße gestanden, wären sie bestimmt an uns vorbei gefahren. Nun aber war es ihnen unangenehm, nein zu sagen. So nahmen sie uns mit, ließen uns an der Autobahnauffahrt Richtung Venedig aussteigen und fuhren weiter.
Nachdem wir einige Zeit gewartet hatten, blieb ein Italiener stehen, der nach Triest musste. Erfreut stiegen wir ein. Die Fahrt ging durch das Kanaltal. Schroffe Hänge mit winzigen Dörfern säumten die Autobahn. Wir fuhren durch etliche Tunnel und ließen die Berge hinter uns. Inzwischen zeigte sich sich die Sonne, und dass der Italiener ein kurzärmeliges T-Shirt trug, ließ uns den gestrigen Wintereinbruch beinah vergessen. Langsam stellte sich Reiselust ein.
Mit dem nächsten Fahrzeug ging es nach Milano. Italienische Rockmusik klang aus dem Kassettenrekorder. Woifal wippte mit dem Kopf zur Musik, während er sich angeregt mit dem jungen Italiener unterhielt. Ich hingegen spürte die Nachwirkungen der letzten Nacht im kalten Waggon. Mein Kopf sank immer wieder zur Seite, bis ich schließlich meinen Rucksack als Kopfpolster benützte und einschlief.
Um vier Uhr nachmittags hatten wir Milano erreicht. Unser Fahrer setzte uns auf einer Durchzugsstraße ab. Wenn wir richtig verstanden hatten, mussten wir diese Straße entlang gehen, um zur Autobahnauffahrt Richtung Frankreich zu kommen. Laut donnerte der Verkehr an uns vorbei.
„Wer weiß, wie weit das ist … Stoppen wir hier schon …“
Ich hob meinen Daumen und versuchte immer wieder, unterm Gehen, ein Auto anzuhalten. Vergeblich. Der vorbeiwälzende Strom von Fahrzeugen ließ nicht zu, dass auch nur ein Einziges stehen bliebe.
Nachdem wir etliche Kilometer gegangen waren, hatten wir den Stadtrand erreicht. Endlich blieb ein LKW stehen, der nach Alessandria musste. Er nahm uns ein Stück mit und setzte uns dann an der Autobahnauffahrt Genua/ Savona ab.
„Nun müssen wir also Richtung Genua weiter“, überlegte ich. „Und dann geht’s nach Frankreich!“
Inzwischen dämmerte es. Der Abend brach herein, und damit begann es leicht zu regnen. Wir gingen am Pannenstreifen entlang. Die Geduld, stehen zu bleiben und zu warten, hatten wir nicht mehr. Woifal wirkte genervt. Unser Trip nach Spanien wurde anstrengend.
Nachdem unzählige Autos an uns vorbeigefahren waren, blieb endlich eines stehen. Schnell rannten wir hin, um enttäuscht festzustellen, dass es bis Savona fuhr.
Beim nächsten Fahrzeug wieder dasselbe.
Entmutigt gingen wir weiter. Einige verlassene Firmengebäude lagen an der Strecke und wirkten unheimlich. Irgendwo bellte ein Hund. Das Bellen kam näher, bedrohlich nahe. Niemand war in der Nähe, um den Hund zurückzurufen. Woifal ging weit vor mir. Ich versuchte, aufzuholen, ärgerte mich über Woifal, weil er mich einfach zurückließ und hatte Angst vor dem Hund. Zum Glück wurde das Bellen nach einiger Zeit leiser.
Nach circa einem Kilometer Fußmarsch hielt endlich ein als Campingbus umgebauter Lieferwagen.
Hoffnungsvoll fragten wir: „Genua?“
„No. Savona.“
„Wieso fährt denn niemand nach Genua! Verdammt!“, fluchte Woifal.
„Irgendwer muss doch nach Genua fahren! Wir können die ganze Strecke ja nicht zu Fuß gehen!“, sagte ich verzweifelt.
Es regnete, es war dunkel, wir waren müde. Ich suchte die Landkarte aus meinem Rucksack. Wo waren wir überhaupt?
„Schau mal! Das kann doch nicht wahr sein!“, rief ich aus. „Wir müssen gar nicht nach Genua. Genua liegt östlich von uns. Auf der Strecke nach Frankreich liegt Savona! Genau dort müssen wir hin!“
Woifal war verärgert.
„Scheiße! So eine Scheiße!“
Wütend ging er weiter und kümmerte sich nicht mehr um mich. Ich ging hinterher, genauso wütend, wütend auf Woifal, wütend auf mich selbst, wütend auf die Autos, die einfach an uns vorbeifuhren.
Irgendwann hielt ein LKW.
„Savona?“
„Si, Savona!“
Vom Cockpit des LKWs sah die Welt wieder anders aus. Weich glänzte der schwarze Asphalt im Regen. Die Rücklichter der Fahrzeuge vor uns bildeten rote Lichtsäulen auf der nassen Fahrbahn und verloren sich irgendwo in der Dämmerung. Ich war froh, meine müden Beine endlich ausstrecken zu können und lehnte mich in den Sitz zurück.
Gegen neun Uhr abends hatten wir Savona erreicht. Der LKW-Fahrer setzte uns vor der Ausfahrt ab. Und während wir uns fragten, wie lange wir hier wohl wieder stehen würden, nahm uns ein LKW mit, der nach Toulon musste. Bei Fréjus fuhr er von der Autobahn ab und ließ uns aussteigen. Nun ging es die Bundesstraße weiter. Lange Kolonnen von LKWs fuhren an uns vorbei, als wir wieder einmal einen Blick auf die Karte warfen, um uns zu orientieren.
Saint-Marie-de-la-Mer sollte unser nächstes Ziel sein. Einer der vielen LKWs nahm uns dorthin mit. Als wir ankamen, war es weit nach Mitternacht. Wir suchten uns etwas außerhalb einen Platz am Strand und verbrachten dort die Nacht. Als wir aufwachten, war es bereits spät am Vormittag. Wir rollten unsere Schlafsäcke ein und besuchten ein kleines Lokal an der Küste, wo wir Café au Lait tranken. Es roch nach Meer. Der Himmel war blau. Ich spürte ein unbestimmtes Gefühl von Freiheit.
„Hier weht immer ein starker Wind“, sagte Woifal. „Weißt du wie dieser Wind heißt?“
„Hm. Lass nachdenken. Das ist doch der Mistral?“
„Ja, richtig!“, Woifal lachte. „In Jugoslawien gibt es einen kalten Wind. Weißt du, wie der heißt?“
Ich schüttelte den Kopf.
„Das ist die Bora“, klärte mich Woifal auf.
„Ach ja! Habe ich schon mal gehört“, fiel mir ein.
„Und der heiße Wind aus Afrika?“, fragte Woifal weiter. „Wie heißt der?“
Ich dachte nach. „Das ist der Scirocco!“
„Wie nennt man ihn in Jugoslawien?“
„Keine Ahnung!“
„In Jugoslawien nennt man in Jugo!“
„Was? Das ist aber jetzt ein Scherz. Oder?“
Nachdem wir gefrühstückt hatten, spazierten wir die Promenade entlang. Riesige Wellenbrecher schützten den Ort vor der Brandung, die unaufhörlich gegen die Gesteinsbrocken schlug.
„Einmal im Jahr treffen sich die Zigeuner in Saint-Marie-de-la-Mer. Hast du das gewusst?“, erzählte Woifal. „Und das französische Wort für Zigeuner ist Gitanes. Wie die Zigarettenmarke.“
Wir näherten uns dem Ortskern. Eine bunte Vielfalt an Cafés, Bistros, Boutiquen und Souvenirshops schmückte die weißen Häuserfronten und verbreitete südfranzösisches Flair. Wir schlenderten durch die kleinen Gassen und ließen uns treiben.
„Bevor wir weiterfahren, sollten wir noch was essen“, schlug ich nach einiger Zeit vor.
„Hier ist es aber ziemlich teuer. Mal schaun, was es für wenig Geld gibt“, überlegte Woifal.
Während wir das Ortszentrum wieder verließen, studierten wir die Speisekarten der verschiedenen Restaurants. Angesichts der Preise wurde die Aussicht auf eine warme Mahlzeit immer unwahrscheinlicher. Endlich fanden wir ein kleines Bistro, das zu einem halbwegs günstigen Preis Chili con Carne anbot. Doch das, was uns wenig später in zwei kleinen Tonschüsselchen serviert wurde, war Bohneneintopf mit kaum Fleisch darin. Chili con Carne hatte ich mir immer anders vorgestellt. Ich war ein wenig enttäuscht, tröstete mich dann aber damit, dass wir wenigstens wieder einmal eine warme Mahlzeit hatten und mit dem Baguette dazu auch satt wurden.
Nachdem wir gegessen hatten, setzten wir unsere Reise fort und versuchten, am Ortsausgang von Saint-Marie eine Mitfahrgelegenheit zu finden. Doch meist waren die Autos voll. Es dauerte lange, bis endlich ein Pärchen hielt, das nach Aigues-Mortes musste, uns ein Stückchen mitnahm und an der Abzweigung zur Autobahn absetzte.
Da standen wir nun – an einer Straße, die so einsam und wenig befahren war, dass wir uns auf eine längere Wartezeit einstellten. Als wir aber das Gekritzel anderer Autostopper am Verkehrsschild lasen, machten wir uns auf das Schlimmste gefasst.
Da stand zum Beispiel: „What a hell is this here!“ Oder: „You never get out of here!“
Und die Botschaften schienen sich zu bewahrheiten. Meist dauerte es fünfzehn bis zwanzig Minuten, bis überhaupt ein Fahrzeug auftauchte - und dann fuhr es einfach vorbei. Nach einiger Zeit hatten auch wir das Gefühl, nie von hier wegzukommen.
Wieder näherte sich ein Auto. Es war ein Mittelklassewagen. Die Lenker solcher Fahrzeuge waren meist viel zu gesetzt, um Autostopper mitzunehmen. Fest rechnete ich damit, dass er an uns vorbeifahren würde.
Da rief Woifal plötzlich: „Er ist stehen geblieben!“
Der Fahrer öffnete die Tür und sagte irgendetwas von „autoroute“ und“ Montpellier“.
Das war unsere Richtung! Erleichtert stiegen wir ein. Doch schneller als gedacht war unsere Fahrt wieder zu Ende. Denn kaum war der Franzose auf die Autobahn aufgefahren, fuhr er die erste Raststätte an und gab uns zu verstehen, dass er in Montpellier abfahren müsse, hier aber viele Fahrzeuge am Weg nach Spanien noch einmal tanken würden und uns bestimmt eines davon mitnähme. Enttäuscht stiegen wir aus und hatten wieder Pech. Alle, die wir fragten, fuhren, genau wie er, nur bis Montpellier …
Woifal setzte sich auf den Boden. Ich war müde, und mir fröstelte. Mit dem hereinbrechenden Abend war es kühl geworden. Irgendwo hinlegen und ausruhen war im Moment mein einziger Wunsch – doch wo? Suchend sah ich mich um. Der Flipperautomat bot eine große Fläche zum Liegen – und als ich es mir darauf bequem gemacht hatte, stellte ich fest, dass er sogar ein wenig Wärme abgab. Der Inhaber der Raststätte beobachtete mich. Ich tat so, als würde ich nichts merken. Nach einiger Zeit kam eine Runde Burschenschafter herein, eigenartige Typen in komischen Uniformen, die uns demonstrativ anstarrten. Irgendwie fühlten wir uns nicht mehr wohl hier. Draußen hielt ein Auto. Woifal hatte es bemerkt und ging hinaus. Gleich darauf kam er zurück.
„Wir können mitfahren!“, sagte er sichtlich froh und führte mich zu einem Ford Taunus mit niederländischem Kennzeichen. Zwei Türken boten sich an, uns bis Spanien mitzunehmen. Wir sollten unsere Rucksäcke in den Kofferraum geben. Der Beifahrer stieg aus und nahm unser Gepäck entgegen, das aber nicht in ihrem Kofferraum, sondern in dem des dahinterstehenden Fahrzeuges verschwand. Dann öffnete er die Beifahrertür, ließ Woifal einsteigen und setzte sich zu mir auf die Rückbank. Das Auto mit unserem Gepäck fuhr hinter uns her. Ein unbehagliches Gefühl stieg in mir auf. Das war eine Situation, vor der man sich in Acht nehmen sollte, dämmerte es mir. Was hatten die Türken vor? Was würde mit unserem Gepäck geschehen?
Der Fahrer verwickelte Woifal in gebrochenem Englisch in ein Gespräch. Ich sah angestrengt hinaus. Wir fuhren schnell und überholten ein Fahrzeug nach dem anderen. Mir war kalt. Am Boden lag eine Decke. Einige Zeit war ich unschlüssig. Konnte ich diese Decke einfach nehmen und mich damit zudecken? Dann siegte der Wunsch nach Wärme und Behaglichkeit. Ich legte die Decke über meine Beine und zog sie über meinen Oberkörper. Gleich darauf wurde mir angenehm warm. Ich fragte mich, ob mein Verhalten nicht unhöflich wirkte und entschloss mich dummerweise, mit dem übrigen Teil der Decke den neben mir sitzenden Türken ebenfalls zuzudecken. Das musste dieser aber völlig falsch verstanden haben, denn er begann von nun an, mich ständig zu betatschen. Kaum hatte ich seine Hand weggestoßen, lag sie schon wieder auf meinem Oberschenkel. Ich zog die Decke von ihm weg, wickelte mich fest darin ein und gab ihm durch Fußtritte zu verstehen, dass ich absolut nichts von ihm wollte. Hilfesuchend sah ich zu Woifal hin. Er hatte von diesem Vorfall nichts mitbekommen und unterhielt sich immer noch mit dem Fahrer.
Einige Zeit und einige Fußtritte später ließ der Türke seine Annäherungsversuche endlich bleiben. Wir fuhren noch bis Perpignan auf der Autobahn, dann ging es die Bundesstraße weiter, die in unzähligen Kurven bergauf und bergab führte. An der Ortseinfahrt von Port Bou ließen uns die Türken aussteigen und gaben uns auch unsere Rucksäcke wieder. Danach wendeten sie ihre Fahrzeuge und fuhren zurück.
Ich atmete auf. Wir hatten Glück gehabt. Wider Erwarten war alles gut gegangen - mehr noch: Sie hatten uns sogar extra nach Spanien gebracht! Wir hatten es geschafft!
Nachdem wir am Strand übernachtet hatten, standen wir früh auf, um nicht von der spanischen Polizei überrascht zu werden, die den Ruf hatte, Rucksacktouristen mit Fußtritten zu wecken. Außerdem hatten wir vor, nach Barcelona zu trampen, da Woifal sich noch mit Dope versorgen wollte, bevor wir im kleinen Ort Tossa de Mar an der Costa Brava Badeurlaub machen würden.
So standen wir nach einem Café con Leche, dem spanischen Pendant zum Café au Lait, an der Straße und warteten auf ein Fahrzeug, das uns mitnehmen würde. Das war in Spanien nicht schwer. Immer wieder blieb jemand stehen, und schon wenige Stunden später befanden wir uns mitten im lebhaften Zentrum Barcelonas.
„Weißt du denn wo man hier was kaufen kann?“, fragte ich Woifal.
Wir standen in der Altstadt. Ein Gewirr von Gassen und Straßen, Häusern und Menschen breitete sich um uns aus.
„Ja“, sagte Woifal und sah sich suchend um, „am Placa Reial. Der muss hier irgendwo sein, in der Nähe des Gotischen Viertels.“
Ein paar junge Spanier kamen uns entgegen. Woifal fragte sie nach dem Weg. Wir folgten ihrer Beschreibung und entdeckten in einer kleinen Seitenstraße den Zugang zu diesem Platz. Ein Polizist patrouillierte davor. Nachdem wir an ihm vorbei durch das Portal gegangen waren, befanden wir uns in einem großen, von alten Gebäuden begrenzten Viereck mit einem steinernen Brunnen in der Mitte. Alles wirkte heruntergekommen. Es war unschwer zu erkennen, dass einige Dealer auf ihr Geschäft warteten. Woifal wurde gleich von einem von ihnen angesprochen. Nach einer kurzen Unterredung hatte Woifal ein kleines Stückchen Stanniolpapier in der Hand. Woifal prüfte es und bezahlte. Der Deal war gemacht. Nun stand einem gemütlichen Strandurlaub nichts mehr im Weg.
Wir trampten zurück nach Tossa. Die Straße führte über von Kiefern bewaldete Hügel und ging das letzte Stück Richtung Küste bergab. Wie hingewürfelt breitete sich der Ort mit seinen weißen Häusern und verwinkelten Gassen vor uns aus, der malerisch in einer Bucht lag und von einer mittelalterlichen Burganlage begrenzt wurde. Und als ob der Anblick nicht kitschig schön genug gewesen wäre, erstreckte sich ein tiefblaues Meer, tiefblauer, als ich es mir jemals hätte vorstellen können, bis zum Horizont und glitzerte in der warmen Nachmittagssonne.
„Ach, ist es schön hier!“, sagte ich überglücklich, als wir durch die Gassen gingen. „Gehen wir doch mal zur Burg hinauf!“
Wir spazierten durch die Vila Vela, dem mittelalterlichen Teil der Stadt unterhalb der Burganlage, der mit seinen kopfsteingepflasterten Gassen und alten Steinhäusern den ältesten Teil Tossas bildete. Oben angekommen, trafen wir auf eine Folkloreveranstaltung im Burghof. Einige Zeit sahen wir den Tänzen zu, dann gingen wir weiter zum Burgbrunnen auf einem kleinen Platz vor einem der Wehrtürme. Von dort hatten wir einen wunderschönen Ausblick auf die wild zerklüftete Küste. Ein Segelboot lag vor Anker in der Bucht.
„Es ist so wunderschön hier!“, schwärmte ich noch einmal und konnte mich gar nicht satt sehen am tiefblauen Meer, an den weißen Häusern und an den schäumenden Wellen, die wild gegen die Felsküste schlugen.
Nachdem wir einige Zeit auf der Burg verbracht hatten, beschlossen wir, als feierlichen Auftakt unseres Urlaubs, eine echte spanische Paella zu Abend zu essen. Das würde zwar zugleich das Ende meines winzig kleinen Reisebudgets bedeuten, doch darüber machte ich mir am heutigen Tag noch keine Sorgen. Wir suchten das schönste Restaurant im Ort, ließen uns einen Tisch zuweisen und warteten auf unser Essen. Nach einigem Warten wurden zwei große Platten Paella mit Langusten, Fisch und Meeresfrüchten an unsere Plätze gebracht. Mit großen Augen bestaunte Woifal das Essen vor sich – und bevor der Kellner wieder weg war, fragte er schnell: „Können Sie mir bitte zeigen, wie man das isst?“
Auch ich hatte keine Ahnung, wie man an das Fleisch der Langusten käme. Doch die Art und Weise, wie Woifal das sagte, klang so komisch, dass ich einen Lachkrampf bekam. Vor meinem geistigen Auge sah ich den Kellner Woifals Essen essen.
Zum Glück hatte der Kellner richtig verstanden. Er öffnete Woifals Langusten und zeigte vor, wie man das Fleisch herausschneiden müsse. Nachdem wir gegessen und einige Gläser spanischen Rotwein getrunken hatten, verließen wir das Restaurant. Beim Hinausgehen hatte ich plötzlich das Gefühl, dass mir so richtig übel wurde. Ich blieb stehen und atmete tief durch - einmal, zweimal – es wurde nicht besser.
Zwei deutsche Touristen kamen zum Eingang und lasen die Speisekarte. Ich wollte Platz machen und atmete noch einmal ganz tief durch. Und plötzlich, ohne dass ich es verhindern konnte, musste ich mich übergeben, direkt neben dem Eingang, neben den Touristen. Mit einem erschrockenen Blick auf mich eilten die zwei Deutschen schleunigst weiter. Woifal musste unwillkürlich lachen. Die Lust, hier essen zu gehen, hatte ich den beiden scheinbar gründlich verdorben!