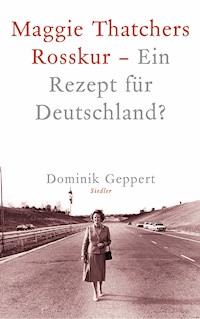Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Euro spaltet Europa: Die berkommenen Begründungen der europäischen Integration ? Abbau zwischenstaatlicher Konflikte, Einbindung Deutschlands, Bewahrung von Recht und Demokratie sowie Mehrung von Sicherheit und Wohlstand verkehren sich in der Schuldenkrise in ihr Gegenteil. Das Buch stellt die Alternativlosigkeit der Rettungspolitik infrage und skizziert eine tragfähigere Ordnung für das Europa der Zukunft. Geppert thematisiert insbesondere die Verschärfung des Nationalismus, die Rückkehr der deutschen Frage, die Gefährdung der sozialen Marktwirtschaft, die Entmachtung der Parlamente, die Aushebelung des Rechts und die Lehren, die wir aus der Geschichte ziehen sollten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. eBook-Ausgabe
© 2013 Europa Verlag GmbH & Co. KG, Berlin · MünchenUmschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, ZürichSatz: BuchHaus Robert Gigler, München
eBook-Herstellung und Auslieferung:Brockhaus Commission, Kornwestheim
www.brocom.de
ePub-ISBN 978-3-944305-19-6
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Meinen Kindern Anton, Charlotte und Paul, die im Europa der Zukunft leben werden
Inhalt
Vorwort
1.Die europäische Krise in historischer Perspektive
2.Europas geschichtliche Vielfalt
3.Die uneinigen Staaten
4.Die Fehlkonstruktion der Europäischen Währungsunion
5.Die Aushebelung von Rechtsstaat und Demokratie
6.Die Schwächung Europas in der Welt
7.Die Rückkehr der deutschen Frage
8.Frankreichs vergeblicher Führungsanspruch
9.Das Europa der Zukunft
Nachwort
Vorwort
Die politische Krise Europas ruft nach einer Deutung, die sich der historischen Perspektive nicht verschließt. Die sechs Jahrzehnte währende europäische Integration ist längst zu einem wichtigen Forschungsgegenstand geworden, den man nicht den Geschichtspolitikern allein überlassen darf. Die demokratische Legitimation der EU hängt nicht nur vom jeweiligen Institutionendesign ab, sondern auch davon, dass die Bürger verstehen, was vor sich geht und wie es entstanden ist.
Wer die Einigung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg begreifen und sich ein eigenes kritisches Urteil bilden will, kommt mit harmonieverliebten Weichzeichnern nicht aus. Die Euro-Währungsunion war ein mutiges Experiment, mit dem für die einen ein neuer starker wirtschaftlicher Sachzwang zur politischen Einheit des Kontinents gesetzt und für andere die wirtschaftliche Dominanz Deutschlands vermindert werden sollte. Aber es war und es ist ein Experiment mit ungewissem Ausgang; eines, das enorme Kräfte freisetzt, die nach dem Geist und den Buchstaben der Verträge auf die Anpassung nationaler Politik an die Stabilitätsbedingungen der Währungsunion drängen. Wenn diese Anpassung verweigert wird oder sich als sachlich unmöglich erweist, können die enormen Kräfte auch zerstörerisch wirken. Sie könnten die europäischen Verträge und die supranationalen Institutionen verformen. Die unbewältigte Krise könnte uns alle in eine ganz andere Wirklichkeit führen, die nicht notwendigerweise die erträumten starken Vereinigten Staaten von Europa sein werden. Es könnte auch eine politisch prekäre Transferunion entstehen, die mit bürokratischen Mitteln immer größere Teile der Wirtschaft reguliert anstatt – gestützt auf die Grundfreiheiten und die offene soziale Marktwirtschaft – einen verlässlichen Wettbewerbsrahmen zu setzen.
Vor diesem Hintergrund und ersichtlich getrieben von der Sorge um die Zukunft des europäischen Projekts sucht Dominik Geppert mit der Schrift »Ein Europa, das es nicht gibt« nach den tieferen Gründen der Krise. Mit dem nüchternen Blick des Historikers nimmt er politische Gipfelerklärungen nicht zum Nennwert ihrer diplomatischen Sprache, sondern fragt nach den höchst heterogenen nationalen Interessen und den unterschiedlichen Sichtweisen auf Europa, die heute offen ausbrechen, aber immer schon bestanden haben. Dabei folgt er nicht dem kontinentalen Komment, der die englische Sicht auf Europa für (nur) egoistisch hält und irgendwie als bizarr wahrnimmt. Keine mitgliedstaatliche Politik, auch nicht die deutsche, wird hier affirmativ oder mit Aversionen behandelt, sondern in der Vielfalt offen dargestellt. Geppert gelangt dabei zu dem harten Urteil, die europäische Währungsunion sei eine Fehlkonstruktion. Er gelangt zu einem solchen Urteil, indem er die nationalen Ziele der Väter der Währungsunion untersucht, aber auch ökonomisch wertet – immer im Blick auf historische Erfahrungen – und Zeitzeugen zu Wort kommen lässt, deren Mahnung viele zuerst in den Wind geschlagen und dann gezielt vergessen haben. Für Geppert ist die Währungsunion der untaugliche Versuch, die europäischen Volkswirtschaften zu fusionieren, um die Geister der Vergangenheit endgültig loszuwerden, während sie in Wirklichkeit genau dadurch wieder geweckt wurden.
Bevor hier mit der nicht seltenen Voreiligkeit der Stab über einen Europaskeptiker gebrochen wird, sollte sich der Leser auf die Argumente einlassen. Es hilft der Einheit Europas nicht, Probleme und Interessengegensätze zu leugnen. Das mochte noch in der Startphase der Integration notwendig sein, um Zustimmung zu erlangen. Ein Europa der verdeckten Konflikte und des permissiven Konsenses kann auf Dauer nicht alle zufriedenstellen, wohl aber alle unzufrieden machen. In Wirklichkeit gelingt Europa nicht durch Leugnung von Unterschieden und Interessengegensätzen, sondern durch die Zivilisierung der Gegensätze in einem teilweise verselbständigten Verhandlungssystem der EU-Organe und mit Hilfe einer rationalen Ordnung des Wettbewerbs.
Eine immer enger werdende Union, die mit immer neuen Mitgliedern, neuen Projekten und immer neuer Zentralisierung der Zuständigkeiten angeblich in steter Bewegung bleiben muss, stößt nach Ansicht Gepperts an Grenzen, weil das demokratische Legitimationssystem im Staatenverbund für diese Entwicklung nicht gerüstet sein kann. Seine resümierende Mahnung deckt sich mit Urteilsgründen der Lissabon-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2009. Im Europa der Zukunft werden die einzelnen Nationen als Träger von Demokratie, Recht und Sozialstaat weiter eine tragende Rolle spielen. Sie können das allerdings nur, und das sollten auch die Protagonisten einer Renationalisierung in Rechnung stellen, wenn sie sich in einer gemeinsamen EU konstruktiv verflechten, durch Handel, eine ausgewogene Wettbewerbsordnung des Binnenmarktes, die Definition gemeinsamer Interessen und gemeinsames Auftreten in der Welt. Dabei gilt es zu erkennen, dass solche Bindung der Staaten untereinander für das einzelne Land nicht die Buchung eines All-inclusive-Pakets ist, sondern gerade wegen der Bindung zusätzliche Anstrengungen verlangt sind, die eigenen Hausaufgaben zu machen, bevor man an die Hilfe anderer denkt. Vor Einheits-Illusionen, die derartige Zusammenhänge verdecken, warnt der Autor, weil die Mitgliedstaaten auch weiterhin ihre eigenen Interessen verfolgen, die mal miteinander harmonieren und mal divergent sind. Wenn wir – und damit meint Geppert heute wohl nicht nur die Deutschen – »einseitig die europäische Solidarität beschwören und nationale Traditionen, Denkweisen und Interessen verleugnen, sind wir auf ein Europa fixiert, das es nicht gibt«.
Bonn, im Juli 2013 Udo Di Fabio
1. Die europäische Krise in historischer Perspektive
Geschichte wiederholt sich nicht, hat der amerikanische Schriftsteller Mark Twain einmal gesagt, aber manchmal reimt sie sich. Das gilt auch für die tiefe politische und wirtschaftliche Krise, in der wir uns in Europa heute befinden. Wir stecken nicht in einer historischen Endlosschleife fest, die uns dazu verdammt, dieselben Fehler immer wieder zu begehen. Geschichtliche Wiederholungszwänge gibt es nicht. Aber ohne die Anklänge der Vergangenheit in der Gegenwart zu erkennen und ohne um die verschiedenen Vorgeschichten der aktuellen Schwierigkeiten zu wissen, können wir die gegenwärtige Malaise nicht verstehen.
Bislang wird die Auseinandersetzung über die Zukunft Europas vor allem ökonomisch geführt. Sie wird von den älteren Generationen geprägt. Und sie ist hierzulande oft allzu sehr auf Deutschland, auf die deutschen Krisendeutungen und Zukunftsvisionen beschränkt. Die folgenden Überlegungen sind zwar ebenfalls aus einer deutschen Perspektive geschrieben, aber sie wollen die gegenwärtige Krise in einen breiteren europäischen Kontext einordnen. Sie wollen ihr eine größere historische Tiefenschärfe geben und einen alternativen Lösungsansatz umreißen. Die Zukunftsentwürfe, die momentan zur Debatte stehen, stammen meist von Männern über 60, die oft ihre über Jahrzehnte gewachsenen Überzeugungen gegen eine widriger werdende Wirklichkeit zu verteidigen suchen. Die Jüngeren hingegen, die länger im neuen Europa leben werden und deren Kinder die Zukunft des Kontinents sind, hüllen sich in Schweigen.
Ich selbst bin Jahrgang 1970 und gehöre damit zu einer Altersgruppe, die in ihrem Leben selbst keinen Krieg mehr erlitten hat. Das ist unser Glück, nicht unser Verdienst. Aber es prägt, ob wir wollen oder nicht, unseren Blick auf die Gegenwart und unsere Erwartungen an die Zukunft. Existenzielle Erfahrungen lassen sich nicht einfach von einer Generation an die nächste weiterreichen wie ein Staffelstab. Man mag uns für naiv halten, weil nicht mehr die Kriegserfahrung unsere politischen Überlegungen dominiert. Doch es kann auch von Vorteil sein, wenn es schwieriger wird, mit Verweis auf den Krieg eine Politik zu rechtfertigen, die momentan Konflikte in Europa intensiviert, statt sie zu vermindern.
Die weltgeschichtlichen Umwälzungen, die meine Generation in ihrer Jugend und im jungen Erwachsenenalter während der 1980er und 1990er Jahre erlebt hat, waren von anderer Art. Wir sind zum einen vom Trend zu weltweiter Deregulierung und Ökonomisierung geprägt worden und haben zum anderen das Ende des Kalten Krieges, den Zusammenbruch des Sowjetimperiums, die Wiedervereinigung Deutschlands und Europas als historische Wendepunkte erlebt, die unser Leben bestimmt haben. Beide Entwicklungen standen in einem gewissen Widerspruch, zumindest in einem Spannungsverhältnis zueinander. Die Globalisierung wies den Einzelstaaten die Grenzen ihrer Handlungsmöglichkeiten auf. Die Implosion des Kommunismus hingegen zeigte, dass Nation und Nationalstaat nicht nur Zerstörungskraft entfalten, sondern auch befreiend wirken können.
Die Zunft der Historiker, zu der ich gehöre, hält sich – von Ausnahmen abgesehen – in den Diskussionen um die europäische Krise eher zurück. Wenn gegenwärtig überhaupt eine Debatte über die Zukunft Europas stattfindet, wird sie von Wirtschaftswissenschaftlern geführt. Dabei ist die europäische Währungsunion von ihrer Entstehungsgeschichte und ihrer Zielsetzung her von Anfang an ein politisches Projekt gewesen, das mit historischen Notwendigkeiten begründet wurde. Wirtschaftliche Überlegungen waren demgegenüber zweitrangig. Es ist daher wichtig, nicht nur die ökonomischen Konstruktionsmängel des Euro zu verstehen, sondern auch die politischen Fehlannahmen und die historischen Trugschlüsse, die ihm zugrunde liegen. Sonst begreift man nicht, wie sich die Staaten der Europäischen Union in die Sackgasse manövrieren konnten, in der sie sich heute befinden.
Gelegentlich werden wir Historiker ermuntert, bei der Gestaltung Europas mitzuhelfen, indem wir eine neue geschichtliche Großdeutung des Integrationsprozesses entwerfen. Daran ist oft die Forderung geknüpft, bessere historische Begründungen für die gegenwärtige Politik der europäischen Regierungen zu finden. Derartige Erwartungen kann eine seriöse Geschichtswissenschaft kaum erfüllen. Sie kann aber herausfinden helfen, ob die überkommenen historischen Legitimationen der europäischen Integration den aktuellen Entwicklungen noch standhalten. Sie kann Antworten auf die Frage geben, welche alternativen Lehren sich aus der Vergangenheit ziehen lassen und welche neuen Perspektiven sich eröffnen, wenn man den historischen Blickwinkel verändert.
Ein guter Ausgangspunkt zu testen, was geschieht, wenn man die überkommenen Sichtachsen verschiebt, ist die Juli-Krise des Jahres 1914, die sich bald zum hundertsten Male jährt. Auf den ersten Blick verbindet uns kaum noch etwas mit jener Welt der halbautokratischen Monarchien und Großmachtrivalitäten, die damals gleichsam schlafwandlerisch dem Ersten Weltkrieg entgegentaumelte. Die europäischen Staaten haben dem Wettlauf in der Flotten- und Heeresrüstung abgeschworen. In unseren Gesellschaften wird militärische Macht kaum noch unkritisch bewundert, eher misstrauisch beäugt. Der Glaube an den Krieg als ultimativen Test für die Standortbestimmung von Nationen in der internationalen Politik ist uns fremd geworden. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, so könnte man sagen, existierten die europäischen Staaten durch den Krieg und für den Krieg. In der zweiten Jahrhunderthälfte wurden sie durch und für den Frieden umgebildet.
Nach allem, was wir heute einschätzen können, droht auf absehbare Zeit kein weiterer großer Krieg in Europa. Die Erinnerung an die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts verblasst. Nur wer heute über 70 Jahre alt ist, hat den zweiten noch selbst erlebt. Der Frieden ist – auch dank der europäischen Integration – für fast alle Europäer glücklicherweise zum Normalzustand geworden. Für unseren Kontinent scheint sich Victor Hugos Prophezeiung von 1849 bewahrheitet zu haben, es werde der Tag kommen, »an dem es keine anderen Schlachtfelder geben wird als die Märkte, die sich dem Handel, und die Geister, die sich den Ideen öffnen«.1 Die Auseinandersetzungen, in denen wir uns gegenwärtig befinden, werden auf eben jenen »Schlachtfeldern« des Handels und der Ideen ausgetragen, nicht in den Schützengräben des Ersten oder den Panzerschlachten des Zweiten Weltkriegs.
Heute ist die Wirtschaft in mancher Hinsicht an die Stelle des Militärischen getreten. Während sich früher die Rangordnung der Nationen aus der Größe ihrer Armeen und aus der Bilanz ihrer Siege und Niederlagen im Krieg ergab, liefern heute eher die ökonomischen Parameter von Produktivität und Bruttosozialprodukt Hinweise auf den Stellenwert einzelner Staaten im globalen Machtgefüge. Man kann diese Verschiebung mit guten Gründen als zivilisatorischen Fortschritt betrachten. Den Anfang einer konfliktfreien Ära harmonischen Einvernehmens zwischen Staaten und Gesellschaften, wie es die Vorkämpfer der Freihandelsdoktrin um Richard Cobden und John Bright im 19. Jahrhundert erwartet hatten, markiert sie jedoch nicht.
Deswegen gibt es bei genauerem Hinsehen doch Parallelen zu jener großen europäischen Krise am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Damals wie heute laden sich Nationalismen, medial verstärkt, dramatisch auf. In einer Zeit intensiver globaler Verflechtung wächst das Misstrauen zwischen den europäischen Völkern. Vor allem Deutschland als größtes Land in der Mitte des Kontinents wird immer stärker als Bedrohung empfunden – ehemals wegen seiner militärischen, aktuell wegen seiner wirtschaftlichen Macht. Umgekehrt sieht sich Deutschland durch Koalitionen anderer Länder ausgegrenzt und eingekreist, früher militärisch, gegenwärtig im Rat der Europäischen Zentralbank und auf den Gipfeltreffen der europäischen Staats- und Regierungschefs. Der Eindruck verstärkt sich, man werde übervorteilt. Einige politische Schlagworte der Juli-Krise von 1914 – die »Einkreisung«, der »Blankoscheck«, die »Flucht nach vorn« oder der »Sprung ins Dunkle« – gewinnen im Jahr 2013 eine ungeahnte Aktualität.
Wie damals ist auch die aktuelle Krise an der südöstlichen Peripherie Europas ausgebrochen und droht von dorther den gesamten Kontinent zu erfassen. Heute wie vor 1914 spielen die Entscheidungsträger mit hohem Risiko. Sie befinden sich alle, ihrer eigenen Einschätzung nach, in der Defensive und haben ein gemeinsames Interesse daran, einen schlimmen Ausgang zu verhindern. Zugleich jedoch verfolgen sie Eigeninteressen, die einander ausschließen, und nutzen die verbreitete Angst vor einer großen Katastrophe, um ihre Vorstellungen gegen die Widerstände anderer Länder durchzusetzen.2 Vor 1914 gelang es mehrfach, europäische Krisen zu entschärfen und den großen Krieg zu vermeiden, so wie es derzeit die europäischen Regierungen bislang stets gerade noch geschafft haben, mit immer neuen Rettungspaketen die steigende Zahl der Krisenstaaten vor der Insolvenz und den Euro vor dem Zusammenbruch zu bewahren.3
Doch allerorten überlagert ein vages Unbehagen, dass es wie bisher nicht mehr lange weitergehen kann, das Gefühl der Sicherheit, das in Jahrzehnten von Frieden und Wohlstand gewachsen ist. Organisierte Interessen – seinerzeit vor allem Landwirtschaft und Schwerindustrie, gegenwärtig die Finanzbranche und die großen Exportunternehmen – üben machtvollen Einfluss auf die Politik aus. Die politischen Eliten fühlen sich in ihren Entscheidungen zunehmend gehetzt. Vor hundert Jahren ging der Zeitdruck von den Aufmarschplänen der Massenheere aus, heute wird er von den Öffnungszeiten der Börsen in London, New York und Tokio hervorgerufen. Regeln, die auf friedlich-schiedlichen Interessenausgleich zielen, erodieren. Das Recht verliert seine Verbindlichkeit. An seine Stelle treten diplomatische Manöver oder – frei nach Carl Schmitt – die machtpolitische Logik des Ausnahmezustands. Die langen Schatten von 1914, schrieb vor einiger Zeit der Historiker Michael Stürmer, lägen, auch wenn man sie im grellen Tageslicht kaum wahrnehme, noch immer auf Europa: Es sei wahrhaft tragisch zu nennen, dass die gemeinsame europäische Währung, »gedacht als goldener Reif um Europa, zum Reibeisen geworden« sei.4
Die historischen Parallelen zu der Zeit vor 1914 spielen allerdings in den aktuellen deutschen Diskussionen über Europas Zukunft kaum eine Rolle. Andernorts ist die historische Situation vor dem Ersten Weltkrieg stärker präsent. Nicht zufällig drohte der französische Staatspräsident François Mitterrand dem deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher im November 1989, wenn sich Deutschland vereinige, bevor die Einigung Europas erreicht sei, werde es sich, wie 1913, einer Triple Entente aus Frankreich, England und Russland gegenübersehen – »und das werde im Krieg enden«.5 Als Genscher Ende 1991 drängte, die Unabhängigkeit Sloweniens und Kroatiens möglichst bald anzuerkennen, bemerkte Mitterrand zum damaligen britischen Außenminister Douglas Hurd, man habe es mit einer Neuauflage von 1914 zu tun: »Mais vous comprenez, Monsieur le Ministre, c’est quatorze encore une fois.«6
In deutschen Diskussionen sind derartige Konnotationen weitgehend unter den Trümmern des Zweiten Weltkrieges verschüttet und von den Verbrechen des Nationalsozialismus überlagert. Der Große Krieg von 1914 bis 1918 kommt, wenn überhaupt, als eine Art Probelauf für den noch größeren von 1939 bis 1945 in den Blick. Wenn es um die historische Begründung der europäischen Einigung geht, ist die Rede meist vom Wiederaufstieg des Kontinents aus den Trümmern zweier verheerender, von Deutschland angezettelter Kriege, der über verschiedene Zwischenstadien irgendwann einmal auch zur politischen Einheit Europas führen werde. Gemäß dieser Deutung überwanden die europäischen Nationen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihre Feindschaft durch supranationale Zusammenarbeit: zuerst in der Montanunion, später in der Wirtschaftsgemeinschaft und schließlich in der angeblich mehr oder weniger notwendig daraus folgenden Währungsunion. Rechtsstaat, Demokratie, Sicherheit und Wohlstand seien in Europa seit 1945 dadurch gewährleistet worden, dass die Staaten nationale Interessen zugunsten des großen europäischen Ganzen hintanstellten. Nur auf diese Weise hätten sie jene kritische Größe erreichen können, die notwendig sei, um in Weltpolitik und Weltwirtschaft als gleichberechtigte Mitspieler neben den Vereinigten Staaten, Russland oder China aufzutreten.
Für die Bundesrepublik brachte das Projekt Europa in dieser Lesart nicht nur die schrittweise Rückgewinnung staatlicher Souveränität und Schutz vor der Sowjetunion im Kalten Krieg, sondern auch die Versöhnung mit Frankreich, den Ausweg aus einer gefährlichen außenpolitischen Isolierung und die Erlösung aus jener halbhegemonialen Position, in der sich Deutschland seit 1871 befunden hatte: zu schwach, um den Kontinent zu dominieren, und zu stark, um sich in das europäische Mächtegefüge einzuordnen. In gewisser Weise erscheint die europäische Einigung als logische Fortsetzung, Konsequenz und schließlich Ersetzung der deutschen Nationalgeschichte.
Das Problem dieser gängigen Interpretation besteht darin, dass sie mit den Entwicklungen der vergangenen Jahre immer weniger in Einklang zu bringen ist. Die überkommenen historischen Begründungen der europäischen Einigung, so lautet eine These dieses Buches, verkehren sich in der aktuellen Krise ins Gegenteil. Das gilt für den Abbau zwischenstaatlicher Konflikte ebenso wie für die Bewahrung von Recht und Demokratie und die Mehrung von Sicherheit und Wohlstand. Trotzdem wird, wer an der herkömmlichen Sichtweise zweifelt, schnell als geschichtsvergessen und perspektivlos, wenn nicht gar als Anti-Europäer, »Euro-Nörgler«, professoraler »Besserwisser« oder »Nationalstaatsorthodoxer« abgestempelt.
Fehlentwicklungen festzustellen und nach Alternativen zu suchen bedeutet jedoch nicht, dass man automatisch gegen eine europäische Währung, gegen die Europäische Union oder gar gegen »Europa« ist. Ein zentrales Problem der aktuellen Diskussionen, so eine weitere These dieses Buches, besteht gerade darin, dass allzu oft verschiedene Dinge teils sprachlich leichtfertig, teils in politischer Absicht miteinander vermischt werden, die man genau unterscheiden muss, um die Wirklichkeit zu verstehen und haltbare Lösungen zu finden. Der Euroraum ist eben nicht mit der Europäischen Union insgesamt gleichzusetzen. Die EU sollte man nicht mit Europa und Europa nicht mit der westlichen Wertegemeinschaft verwechseln.
Die Realität der EU ist auch nicht identisch mit dem Mythos »Europa«, den mehrere Generationen europäischer Idealisten gepflegt haben. Der Prozess der europäischen Einigung verlief weniger geradlinig und kontinuierlich, als uns der Mythos glauben machen will.7 Nicht nur hochherzige Ideale haben ihn geprägt, sondern mindestens so sehr realistisches Kalkül. Mitunter stießen idealistische Vorstellungen einen weiteren Integrationsschub an. Doch verhakte sich die ursprüngliche Vision später oft in den Realitäten und Alltäglichkeiten der europäischen Politik. So geschah es nach dem Entstehen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), die sich nicht, wie von Walter Hallstein und anderen erhofft, zur Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) ausbauen ließ. Ähnlich lagen die Dinge dreißig Jahre später bei der Währungsunion, aus der nicht die von Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher erträumte Politische Union erwuchs, oder beim europäischen Konvent, der eben keine gemeinsame europäische Verfassung hervorbrachte.
Die europäische Integration war keine lineare Fortschrittsgeschichte, sondern vollzog sich in Schüben und Sprüngen, nicht teleologisch auf das ein für alle Mal vorgegebene Ziel eines supranationalen Bundesstaates hin, sondern zukunftsoffen: in Reaktion auf unvorhersehbare äußere Ereignisse, in Anpassung an veränderte politische, ökonomische, soziale, auch weltanschauliche Rahmenbedingungen. Es wäre falsch, realitätsblind an überkommenen Geschichtsbildern festzuhalten, die eine Alternativlosigkeit der Entwicklung vorgaukeln. Vielmehr gilt es, genau zu analysieren, unter welchen konkreten Umständen sich der Integrationsprozess historisch beschleunigte, wann und weshalb er stockte, die Richtung wechselte, seinen Charakter veränderte.
Die entscheidenden Transformationsphasen fielen dabei aus deutscher Sicht in die Amtszeiten der drei wichtigsten christdemokratischen Regierungschefs: Konrad Adenauer, Helmut Kohl und Angela Merkel. Das gilt für die 1950er Jahre ebenso wie für die Zeit seit Mitte der 1980er Jahre bis zum Abschluss der Verträge von Maastricht (1992) und Amsterdam (1997) und schließlich jüngst wieder für die Phase seit Beginn der aktuellen Krise 2010. In diesen Zeitspannen wurden die bedeutsamsten europäischen Initiativen gestartet, die größten Triumphe gefeiert und die schlimmsten Fehlschläge erlitten: die Montanunion des Schuman-Plans 1950, die gescheiterten Pläne einer integrierten Europa-Armee und einer Europäischen Politischen Gemeinschaft in der ersten Hälfte der 1950er Jahre, die erfolgreiche Etablierung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ab 1958, der europäische Binnenmarkt mit der Einheitlichen Europäischen Akte von 1986, die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion in den 1990er Jahren, der gescheiterte Verfassungsvertrag von 2005 und zuletzt die aus der Not geborenen, in ihren Konsequenzen aber nicht minder weit reichenden Maßnahmen der verschiedenen Rettungspakete in der europäischen Schuldenkrise.
Auch wenn die deutschen Regierungen gern auf die Kontinuität ihrer Europapolitik verwiesen, fallen in der historischen Rückschau mindestens ebenso sehr die Brüche und tektonischen Verschiebungen auf. Manchmal wird sogar von einer »zweiten Gründung« der europäischen Integration seit Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre gesprochen.8 Tatsächlich unterschied sich das karolingische Adenauer-Europa des Kalten Krieges fundamental von dem nach Süden, Norden und Osten geographisch erweiterten und zugleich institutionell vertieften Europa, das Helmut Kohl hinterließ. Im Europa der Sechs war die Entscheidungsfindung auf europäischer Ebene noch relativ einfach. Im Europa der 28, dessen voller Umfang erst nach Kohls Amtszeit mit den Osterweiterungen 2004, 2007 und 2013 erreicht wurde, ist sie äußerst langwierig und zum Teil kaum noch möglich.
Zudem lehren Geschichte und Psychologie, dass der Zusammenhalt einer Gruppe enger ist, wenn es einen äußeren Feind gibt. Mit dem Wegfall der Bedrohung durch die Sowjetunion musste sich die Europäische Gemeinschaft, deren Existenz im Kalten Krieg immer auch durch die Magnettheorie auf der Basis westlichen Wohlstands legitimiert wurde, teilweise neu erfinden. Ein neuer Feind vom Bedrohungspotential der Sowjetunion ist dabei vorerst nicht in Sicht. Die Erwartung von Jürgen Habermas und Jacques Derrida, aus der gemeinsamen Opposition gegen den amerikanischen Militarismus im Irakkrieg könne eine neue europäische Identität entstehen, hat sich glücklicherweise nicht erfüllt.9 Und China ist auf absehbare Zeit mindestens ebenso sehr Handelspartner wie strategische Gefahr.
Ein weiterer zentraler Unterschied war die Verlagerung des politischen Gleichgewichts in der europäischen Staatenwelt. In Adenauers Europa blieb die Bundesrepublik im Zweifel stets auf den militärischen Schutz der Alliierten angewiesen. Diese Abhängigkeit glich die wachsende deutsche Wirtschaftskraft aus. Spätestens mit dem Ende des Kalten Krieges und der deutschen Wiedervereinigung nahm jedoch die Bedeutung des Militärischen ab und die Ökonomisierung der europäischen Politik zu, auch wenn uns die Konflikte auf dem Balkan, in Afghanistan und im Irak klar vor Augen führen, dass ohne die USA militärisch weiterhin so gut wie nichts geht.
Nicht nur Frankreich und die kleineren Mitgliedstaaten machten sich Sorgen wegen der Verschiebung der europäischen Machtbalance durch die deutsche Einheit. Auch der Bundeskanzler sah die Entwicklung mit Sorge. Kohls Lösung bestand nicht nur darin, die deutsche Währung in Maastricht zu europäisieren. Er wollte überdies mit der Schaffung einer unumkehrbaren Politischen Union das Prinzip des Mächtegleichgewichts auf dem Kontinent ein für alle Mal aufheben. Sein Angriff auf das konstituierende Prinzip der neuzeitlichen Staatenwelt scheiterte freilich am Willen der anderen Europäer. Statt ein neues, wohlaustariertes Gleichgewicht zu schaffen, führten der Maastrichter Vertrag und die Währungsunion auf der einen Seite zur verstärkten Wirtschaftsdominanz Deutschlands und auf der anderen zum institutionellen Übergewicht Frankreichs und der krisengeschüttelten Südländer im EZB-Rat.
Dieses von niemandem gewollte Ergebnis, so bemerken wir heute mit einigem Schrecken, ist in sich so wenig kohärent und tragfähig, dass es an seinen inneren Widersprüchen zu zerbrechen droht. Die Spannungen sind nicht nur im Verhältnis der europäischen Staaten zueinander zu spüren, sondern mindestens ebenso sehr innerhalb der einzelnen Staaten und Gesellschaften selbst. Entsprechend tiefe Spuren hat die Krise in den vergangenen drei Jahren in der Innenpolitik der meisten europäischen Länder hinterlassen. In aller Regel wurden dabei jene Parteien und Politiker vom Wähler belohnt, die sich gegen die EU, gegen »Europa« oder auch gegen Deutschland positioniert hatten.
Am deutlichsten waren die Verwerfungen in den Staaten zu spüren, die am tiefsten im Sumpf der staatlichen oder privaten Schulden zu versinken drohten. In Griechenland katapultierte die Schuldenkrise die Sozialistische Partei aus der Regierungsverantwortung an den Rand des politischen Abgrunds. Hatte sie bei der Wahl im Herbst 2009 noch die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament errungen, so gehören ihr seit dem Juni 2012 nur noch 33 von 300 Abgeordneten an. Der linke Populist Alexis Tsipras hingegen führte seine Partei fast aus dem Nichts auf den zweiten Platz. In Irland erging es Fianna Fáil, traditionell eine der beiden großen irischen Volksparteien, nicht anders. Auch sie wurde für die Umsetzung der durch die internationalen Rettungsmaßnahmen diktierten Austeritätspolitik abgestraft und besitzt seit den Wahlen vom Februar 2011 im irischen Unterhaus nur noch 20 von 166 und im Oberhaus 14 von 60 Sitzen.
Portugals Premierminister José Sócrates trat im März 2011 zurück, nachdem die Oppositionsparteien weitere Sparmaßnahmen abgelehnt hatten, die durch die Verschuldung des Landes nötig geworden waren. In Italien musste Silvio Berlusconi im November 2011 unter dem Druck der Krise abtreten. Ihm ist aber bei den Neuwahlen im Februar 2013 mit einem anti-europäischen und anti-deutschen Wahlkampf eine bemerkenswerte Rückkehr gelungen, während die Technokraten-Regierung um Mario Monti für ihren mit Steuererhöhungen verbundenen Konsolidierungskurs vom Wähler bestraft wurde. Die von Monti ins Leben gerufene Partei blieb unter zehn Prozent der Stimmen.
Nicht nur die überschuldeten Staaten an der südlichen und westlichen Peripherie Europas erlebten tektonische Verschiebungen der innenpolitischen Verhältnisse. In Frankreich hatte Präsident Nicolas Sarkozys UMP bereits bei den Regionalwahlen im März 2011 eine schwere Niederlage erlitten, nicht zuletzt gegen den rechtsextremen Front National. Im Jahr darauf verlor der Präsident selbst sein Amt gegen den Sozialisten François Hollande, der sich scharf von Sarkozys Politik distanzierte und insbesondere das gemeinsame Krisenmanagement mit Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisierte. In den Niederlanden war die Minderheitsregierung von Premier Mark Rutte bis September 2012 auf den Populisten Geert Wilders angewiesen, der mit anti-europäischen Parolen Stimmung macht.
In Belgien verhinderten die flämischen Nationalisten ein Jahr lang die Bildung einer Regierung – selbst für das leidgewohnte Belgien eine extrem lange Zeit der Unsicherheit. In Finnland verfünffachte die Anti-Euro-Partei der Wahren Finnen im April 2011 ihren Stimmenanteil und wurde zur drittstärksten Kraft. Bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr darauf belegte ihr Spitzenkandidat Timo Soini mit knapp zehn Prozent der Stimmen immerhin noch den vierten Platz. Außerhalb der Eurozone geraten die ohnehin europaskeptischen Konservativen in Großbritannien unter immer stärkeren Druck der United Kingdom Independence Party (UKIP), die sich für einen Austritt des Landes aus der EU stark macht.