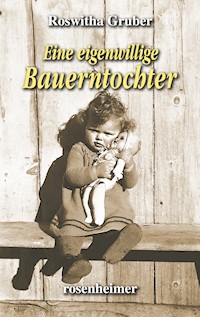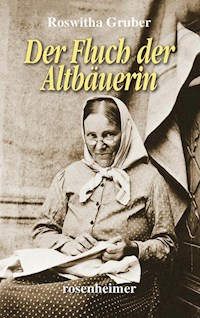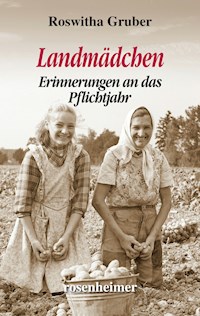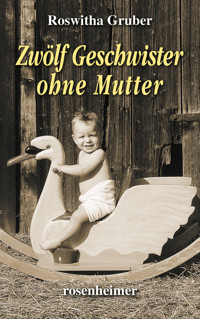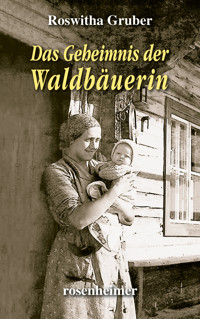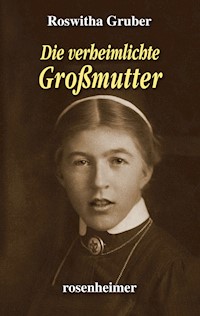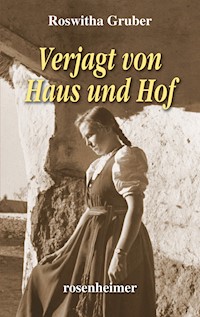16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rosina, eine Bauerntochter aus Grünbach, arbeitet als Zimmermädchen beim "Unterwirt" zu Reit im Winkl. Dort begegnet ihr der gutaussehende Holzknecht Sepp Fischer, lediges Kind einer Köchin und eines Braumeisters aus Rosenheim. Bereits nach kurzer Zeit ist Rosina schwanger. Leider kann das junge Paar nicht heiraten, weil ihnen die finanziellen Mittel fehlen. Daher kommt die kleine Maria 1904 unehelich zur Welt und wird in eine Pflegefamilie gegeben. Als Rosina 1909 das zweite Kind von Sepp erwartet, können sie endlich heiraten. Mittlerweile hat der junge Mann nämlich eine besser bezahlte Arbeit gefunden und eine kleine Wohnung. Ein Jahr nach der Hochzeit kommt Sepp jun. Zur Welt. Als sein Vater, wie so viele junge Männer, 1915 in den Krieg ziehen muss, steht plötzlich ein 14-jähriger Bursche vor Rosina. Dieser stellt sich als Alois, Sohn einer Sennerin vor. Rosina erschrickt, denn er sieht aus, als wäre er ihrem Mann aus dem Gesicht geschnitten. Warten noch weitere solch unliebsame Überraschungen auf Rosina?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2023
© 2023 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim
www.rosenheimer.com
Titelfoto: © Privatarchiv der Familie Garmaier
Lektorat: Christine Rechberger, Rimsting
eISBN: 978-3-475-54958-8
Inhalt
Vorwort
Ursula
Sepp
’s Puppei
Heimliches Rauchen
Der Tod des Königs
Das Feuer
Lungenentzündung
Ohrenschmerzen
Waldhündle
Rosina
Der Vollbart
Majestätsbeleidigung
Das Fresspaket
Ein Wildschütz
Theres
Meines Vaters Kinder
Rosi
Heinrich
Sepp jun.
Gretl
Mein Pflichtjahr
Ludwig
Mein weiterer Lebensweg
Alois
Heiner
Anna
Maria Liebharda
Meines Vaters Enkelkinder
Vorwort
Vor 23 Jahren sind wir nach Reit im Winkl gezogen. Eine der ersten Personen, die ich dort kennenlernte, war Resi Zeus. Wir freundeten uns an und trafen uns mit unseren Ehemännern mal bei ihr und mal bei uns. Jedes Mal erzählte sie mir ein bisschen aus ihrem Leben, was für mich höchst interessant war. Im vorigen Jahr fragte ich nun, ob es ihr recht wäre, wenn ich ein Buch über ihre Familie schreibe. Sie war sofort einverstanden. Ab da besuchte ich sie öfters. Sie erzählte, und ich machte eifrig Notizen. Was dabei herausgekommen ist, liegt jetzt vor Ihnen. Nun wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung.
Roswitha Gruber
Ursula
Resi Zeus erzählt:
Der Gartner-Bauer Pankraz Fischer, geboren am 10. November 1816, erbte von seinem Vater ein mittelgroßes Anwesen in der Dorfmitte von Reit im Winkl. Am 10. November 1847 vermählte er sich mit der Angerbauertochter Ursula Posch aus dem Ortsteil Entfelden. Ursula brachte zehn Kinder zur Welt, von denen drei bei der Geburt oder kurz danach starben. Über die meisten dieser Kinder ist mir nichts bekannt. Nur über die beiden Töchter Ursula, geboren 1852, und Elisabeth, geboren 1857, habe ich Näheres erfahren.
Ursula, die älteste Tochter, hatte wenig Interesse an der Landwirtschaft. Sie wollte weder als Magd auf dem elterlichen Hof dienen, noch wollte sie auf einen Hochzeiter warten, der ihr Einheirat bot. Gleich nach ihrer Schulentlassung »wanderte« sie aus nach Rosenheim, wo sie Anstellung im Haushalt eines Brauereibesitzers fand. Dort sollte sie als Unterstützung der alten Köchin Alberta arbeiten. Alberta war eine vernünftige Person. Sie ließ ihr Küchenmädchen nicht nur »niedere Dienste« verrichten wie Kartoffelschälen, Gemüseputzen oder Geschirrspülen, sie zog sie auch immer wieder hinzu, wenn sie die Speisen zubereitete. So lernte Ursula von ihr alles, was eine gute Köchin können muss. Als die lang gediente Küchenfee aus gesundheitlichen Gründen ihre Stelle aufgeben musste, brauchte die Hausfrau nicht lange nach einer Nachfolgerin Ausschau zu halten. Sie hatte beobachtet, dass ihr Küchenmädchen schon genauso gut kochte wie die alte Alberta. Also wurde Ursula die neue Köchin. Damit stieg nicht nur ihr Ansehen bei der übrigen Dienerschaft, sondern auch ihr Einkommen. Zu ihrer Entlastung wurde ihr schon bald ein Küchenmädchen zur Seite gestellt.
Anders als andere Herrschaften in jenen Jahren, kannten der Brauereidirektor und seine Frau keine Standesdünkel. In ihrer Küche wurden für alle Mitarbeiter dieselben Speisen gekocht wie für die Familie. Die Küche war auch groß genug für einen langen Esstisch, an dem alle 15 Personen Platz hatten. Außer dem Hausherrn, seiner Frau und den vier Kindern waren das die fünf Brauereiangestellten, das Hausmädchen, das Kindermädchen, die Köchin und das Küchenmädchen. Sobald Ursula und ihre Gehilfin das Essen aufgetragen hatten, setzten sie sich zu den anderen und speisten in fröhlicher Runde mit.
Da der Brauereibesitzer mit der Produktion bald nicht mehr nachkam, stellte er mit Sepp Hellinger einen jungen Braumeister ein. Schnell erkannte er, dass er mit diesem keinen Fehlgriff getan hatte. Sepp war nicht nur fleißig, er entwickelte auch eigene Ideen und setzte sie um. Nun saßen also 16 Personen am Tisch. Sepp gefiel die junge, hübsche Köchin, die zudem sehr tüchtig zu sein schien, ausnehmend gut. Am Tisch versuchte er immer wieder, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Ihr war das nicht unangenehm. Eines Tages, als er einen Moment mit ihr in der Küche allein war, fasste er sich ein Herz und fragte sie, ob sie an ihrem freien Sonntagnachmittag einen Spaziergang mit ihm machen wolle. Er sieht nicht übel aus, dachte sie, und immerhin ist er Braumeister. Also sagte sie frohen Herzens zu.
Er hatte einen Treffplatz gewählt, der so weit von der Brauerei entfernt war, dass niemand von der Familie und den Mitarbeitern sie sehen würde. Während sie durch die Straßen der Stadt schlenderten, erzählte er ihr über seine Herkunft und sie über die ihre. Sie stellten fest, dass sie ähnliche Wurzeln hatten. Er, zwei Jahre älter als sie, war der dritte Sohn eines Bauern mit einem Betrieb mittlerer Größe, unweit von Rosenheim. Genau wie sie hatte er wenig Interesse an der Landwirtschaft gezeigt und war schon früh aus dem Haus gegangen, um eine Lehre in einer Münchner Brauerei zu machen.
Der Spaziergang und die Gespräche hatten beiden so gut gefallen, dass sie beschlossen, das Treffen in 14 Tagen, wenn Ursula wieder ihren freien Nachmittag hatte, zu wiederholen. Diesmal wanderten sie aus der Stadt hinaus und ergingen sich zwischen Wiesen und Feldern. Inzwischen hatte Sepp so viel Zutrauen zu Ursula gewonnen, dass er seine Zukunftspläne vor ihr ausbreitete.
»Hier in der Brauerei kann ich nichts werden«, begann er.
»Wieso?«, fragte die Köchin erstaunt. »Du hast es doch weit gebracht. Immerhin bist du in jungen Jahren schon Braumeister.«
»Ja, schon«, gab er zu. »Aber ich sehe keine weiteren Aufstiegschancen. Bis an mein Lebensende würde ich hier Angestellter bleiben müssen. Das gefällt mir nicht. Ich will weiterkommen. Was mir vorschwebt, wäre eine eigene Brauerei zu besitzen, mein eigener Herr zu sein und Chef über viele Untergebene.«
»Das muss wohl ein schöner Traum bleiben«, meinte seine Begleiterin lächelnd. »Du hast keinen Vater, der dir eine Brauerei vererben kann, und als Angestellter wirst du nie so viel verdienen, dass du eine eigene Firma gründen kannst.«
»Das stimmt. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit«, flüsterte er geheimnisvoll, obwohl niemand in der Nähe war, der das hätte hören können.
»Und die wäre?«
»Seit ich in Lohn und Brot bin, spare ich ziemlich eisern. Sobald ich genug beisammen habe, werde ich nach Amerika auswandern. Man hört immer wieder, Amerika sei das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Dort hat jeder, der arbeiten kann und arbeiten will, eine Chance. In diesem Land will ich mich selbstständig machen.«
»Wie willst du das schaffen, in einem fremden Land, dessen Sprache du noch nicht mal beherrschst, mit dem wenigen Geld, das dir nach der Bezahlung der Überfahrt noch bleibt?«
»In Amerika kann man für ein paar Pfennige Land kaufen. Dort werde ich eine Brauerei bauen und echtes bayerisches Bier brauen. Das wird bei den Amerikanern gut ankommen, und ich werde in kurzer Zeit ein wohlhabender Mann sein.« Ursula hörte sich das alles an, lächelte nachsichtig und dachte: Der spinnt.
Doch bei jedem weiteren Spaziergang sprach er mit einer solchen Begeisterung davon, dass sie erkannte, wie ernst es ihm damit war. Ihre Pläne dagegen sahen ganz anders aus. Sie träumte von einer gemeinsamen Zukunft mit ihm. Denn an ihm passte ihr alles: sein Aussehen, sein Beruf, seine Tüchtigkeit. Mit einem solchen Mann konnte man unbesorgt eine Familie gründen. Das Einzige, was sie an ihm störte, war, dass er so hartnäckig von seinen Auswanderungsplänen sprach. Deshalb protestierte sie eines Tages: »Du kannst nicht einfach auswandern. Du kannst mich doch nicht verlassen, jetzt, wo ich mich in dich verliebt habe.«
»Hast du das wirklich?«, strahlte er sie an. »Sag das noch mal!«
In anderen Worten wiederholte sie lächelnd: »Ich liebe dich.«
»Damit machst du mich zum glücklichsten Menschen der Welt! Ich liebe dich nämlich auch. Von dem Augenblick an, als ich dich zum ersten Mal am Küchenherd sah, dachte ich: Das ist eine Frau, die zu dir passt.«
Gleich darauf sprach er die Worte aus, auf die sie schon lange gewartet hatte: »Willst du mich heiraten?«
Kaum, dass sie ihr Ja gehaucht hatte, riss er sie in die Arme und drückte ihr ein heißes Busserl auf die Lippen. Nun glaubte sie, dass er nach diesem Liebesgeständnis und dem Heiratsantrag gewiss in der Heimat bleiben würde. Zu ihrer Enttäuschung reagierte er jedoch völlig anders, als sie erwartet hatte. Noch bevor sie dazu kam, ihn zu bitten, ihr zuliebe auf die Auswanderung zu verzichten, sprudelte er heraus: »Du brauchst keine Angst zu haben, ich werde dich nicht zurücklassen, wenn ich nach Amerika gehe. Du bist ein fester Teil in meinem Plan. Allein auswandern ist nicht gut. Deshalb war ich schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einer Frau, mit der man ein solches Wagnis eingehen kann. In der Küche des Braumeisters habe ich dich lange genug beobachtet, um zu erkennen, dass du tüchtig bist, dass du zupacken kannst und dass du eine Frau bist, mit der man die Welt erobern kann.«
Diese Worte schmeichelten ihr zwar, aber viel lieber hätte sie von ihm gehört, dass er sich mit ihr ein Leben in der Heimat aufbauen wolle. »Ja, willst du denn wirklich nach Amerika auswandern?« Tiefe Enttäuschung schwang in ihrer Stimme mit.
Diese schien er glatt zu überhören. Denn begeistert fuhr er fort: »Auf jeden Fall! Nun weiß ich doch wenigstens, für wen ich das alles auf mich nehme, das unermüdliche Arbeiten, die abenteuerliche Überfahrt und den ungewissen Neubeginn.«
»Aber du weißt ja gar nicht, ob ich mit dir auswandern will. Vor dem fremden Land habe ich Angst und vor der Fahrt über das große Wasser ebenfalls«, wandte sie ein.
»Freilich willst du mit. Du bist couragiert genug für ein solches Abenteuer. Du wirst sehen, in dem neuen Land wird es dir gefallen.«
Darauf antwortete sie nicht. Über seine Worte musste sie erst ausgiebig nachdenken. Das tat sie am Abend in ihrer Kammer. Sie nach Amerika? Das war undenkbar. Von diesem Land wusste sie nicht viel mehr als den Namen und dass schon einige Menschen dorthin ausgewandert waren. Doch das waren alles arme Teufel gewesen, Leute, die hier nicht einmal satt zu essen hatten. Nie hatte sie erfahren, wie es ihnen auf dem fernen Kontinent ergangen war. Niemals hatte sie eine Rückmeldung darüber bekommen, ob sie drüben wirklich ihr Glück gemacht hatten oder ob sie »untergegangen« waren.
Ihr Sepp hatte nicht nur einen Beruf, von dem er eine Familie gut ernähren konnte, es war auch eine angesehene Tätigkeit und zudem krisensicher, denn Bier wurde in Bayern immer getrunken. Nichts zwang ihn also, sich auf ein solches Abenteuer einzulassen. Sie musste versuchen, ihm das auszureden. Sollte ihr das nicht gelingen, würde sie ihn vor die Wahl stellen: Entweder Amerika oder ich! Mit diesem Gedanken schlief sie ein.
Am anderen Morgen, als sie ihn beim Frühstück wiedersah, wurde sie schwankend. Angenommen, er würde sich gegen sie entscheiden, was war dann? Würde sie tatsächlich auf ihn verzichten wollen? Diese Frage stellte sie sich in den folgenden 14 Tagen immer wieder. Von der Familie und der Belegschaft hatte noch niemand mitbekommen, dass sie ein Liebespaar waren, weil sie sich bei Tisch auf jede Weise zurückhielten, kein verliebter Blick, kein privates Wort und erst recht keine zärtliche Berührung. Daher merkte auch niemand etwas von Ursulas inneren Kämpfen. Wie jeden Tag erledigte sie gewissenhaft ihre Arbeiten, die sie etwas von ihrem Herzensproblem ablenkten. Als Sepp sie nach zwei Wochen wieder an ihrem geheimen Treffpunkt abholte, war sie dennoch wild entschlossen, sollte er sich seine »gspinnerte« Idee nicht ausreden lassen, ihn vor die Entscheidung zu stellen.
Auf ihrem Weg Richtung Wald versuchte sie, ihn von seinen Auswanderungsgedanken abzubringen, indem sie ihn mit beredten Worten auf die Gefahren der Überfahrt hinwies, ebenso auf die Unsicherheit, auf die er sich einlassen würde. Dann schilderte sie ihm die Vorteile, die ihm die Heimat bot: »Du behältst dein sicheres Einkommen. Du bleibst in der Nähe von Freunden und Verwandten. Wenn wir beide weiterhin so eifrig sparen, werden wir uns bald ein Häuschen leisten können, mit einem Garten drum herum. In diesem können unsere Kinder glücklich spielen.«
Ihre Ausführungen hörte er sich zunächst kommentarlos an. Dann entgegnete er, ihre Planungen seien lieb und nett, aber dabei würde er immer ein armer Häusler bleiben und sich vorkommen wie ein Adler, dem man die Schwingen gestutzt habe. Er fühle sich zu Größerem berufen und wisse, dass er die Fähigkeit und die Kraft habe, mehr aus seinem Leben zu machen.
Mittlerweile hatten sie den Wald erreicht. Schweren Herzens erkannte Ursula, dass sie ihrem geliebten Sepp selbst mit den besten Argumenten nicht beikommen konnte. Zu ihrem Bedauern sah sie keine andere Möglichkeit, als ihn vor die Wahl zu stellen: Amerika oder ich. Sie holte tief Luft, um den folgenschweren Satz vorzubringen.
Just in dem Moment zog er sie zärtlich in die Arme und bedeckte ihre Wangen, ihre Stirn und ihren Mund mit Küssen. Da spürte sie ihren Widerstand dahinschmelzen. Als er auch noch sagte: »Was bin ich doch für ein Glückspilz, dass der liebe Gott mir eine solche Frau zur Seite gestellt hat«, verlor ihr Aufbegehren vollends seine Kraft. Sie spürte, dass sie mit jeder Faser an diesem Mann hing, und wollte es nicht riskieren, ihn durch ein Ultimatum zu verlieren. Die Worte, die ihr bereits auf der Zunge lagen, schluckte sie hinunter und sie dachte: Heute und morgen wird er ja noch nicht abreisen – bis es wirklich so weit ist, kann er es sich vielleicht noch anders überlegen.
Nachdem ihre Gedanken diesen Weg eingeschlagen hatten, genoss sie den Waldspaziergang, Sepps Aufmerksamkeit und auch seine weiteren Zärtlichkeiten.
Bis sie sich das nächste Mal trafen, war es November geworden. Der erste Schnee war gefallen, und es war rau und unwirtlich im Freien. Deshalb wartete Sepp mit einem anderen Vorschlag auf: »Wollen wir nicht zu mir gehen?«
»Du traust dich wirklich, mit mir ins Gesindehaus zu gehen?«, fragte sie erstaunt. Über das Thema Wohnen hatten sie bisher nie gesprochen. Sie war der Annahme gewesen, dass er, wie alle Brauereiangestellten, ein Zimmer im Gesindehaus habe. Seit sie als Köchin arbeitete, bewohnte sie ein Zimmer im Haupthaus. Schnell klärte er sie auf: »Nicht, dass du meinst, ich sei hochnäsig, aber für einen Braumeister schickt es sich nicht, mit den Arbeitern auf einer Stufe zu stehen. Da legt schon der Brauereibesitzer großen Wert drauf. Für mich hat er ein kleines möbliertes Zimmer in der Stadt angemietet.«
Neugierig geworden folgte Ursula ihm. Über eine knarrende Treppe führte er sie in den ersten Stock eines Mehrfamilienhauses. Interessiert schaute sie sich um. Was sie sah, gefiel ihr. Das Zimmer war zwar winzig, aber gemütlich. In einer Ecke stand ein Bett, sorgfältig mit einer Tagesdecke verhüllt, daneben ein Nachtkastl. Gegenüber befand sich ein Waschtisch, auf dem eine irdene Schüssel und eine irdene Kanne standen. In einer anderen Ecke gab es einen Ofen mit einer Holzkiste daneben. Im Ofen war noch etwas Glut, und Sepp legte gleich einige Scheite nach, sodass sich bald eine behagliche Wärme verbreitete.
Einen Kleiderschrank gab es nicht, an der Tür befanden sich ein paar Haken, an denen einige Kleidungstücke hingen. Das Fenster zierten weiße spitzenbesetzte Scheibengardinen, rechts und links davon hingen dunkle Vorhänge von undefinierbarer Farbe. Ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen ergänzte die Einrichtung. Zunächst nahmen die beiden Verliebten auf den Stühlen Platz. Diese wurde ihnen aber mit der Zeit zu hart. Deshalb schlug der junge Mann vor, sich aufs Bett zu setzen. Er nahm die Tagesdecke ab, faltete sie sorgfältig und legte sie auf einen der Stühle.
Sepp zog seine Braut in die Arme und küsste sie leidenschaftlich. Dabei blieb es jedoch nicht. Als er begann, sie auszukleiden, wehrte sie sich: »Nein, Sepp! Wir müssen vernünftig sein! Ich kann es mir nicht leisten, ein Kind zu bekommen.«
»Das weiß ich. Aber keine Angst, da wird schon nichts passieren. Ich passe auf.« So ließ sie es denn über sich ergehen und biss die Zähne zusammen, als sie einen leichten Schmerz verspürte.
Ängstlich beobachtete sie in den folgenden Tagen ihren Körper und atmete auf, als nach einer Woche ihre Blutung einsetzte. Demnach hatte er Wort gehalten und tatsächlich aufgepasst. Also war sie bei ihrem nächsten Treffen in seinem Zimmer wesentlich entspannter, und es machte ihr sogar Spaß, mit ihm zu verschmelzen. So vergingen der November, der Dezember und der Januar. Die beiden Turteltauben genossen ihre junge Liebe, und vom Auswandern wurde nicht mehr gesprochen. Im Februar aber wartete die junge Köchin vergeblich auf das Einsetzen ihrer Tage. Ach was, versuchte sie sich selbst zu beruhigen, die können schon mal Verspätung haben. Als sie im März erneut ausblieben, sah sie sich genötigt, Sepp davon zu erzählen. Der schien aber keineswegs so entsetzt, wie sie befürchtet hatte. Im Gegenteil, er zeigte sich eher erfreut: »Nun wissen wir beide wenigstens, dass wir nicht unfruchtbar sind.«
Dass seine Verlobte ein Kind erwartete, ließ den jungen Braumeister nicht von seinem Entschluss abbringen – wie seine Braut insgeheim gehofft hatte.
»Und was ist mit Heiraten?«, fragte sie verunsichert.
»Keine Sorge! Freilich heiraten wir und zwar in Amerika. Das Kind soll in diesem Land zur Welt kommen. Dann ist es ein echter amerikanischer Staatsbürger und hat eines Tages sogar die Chance, Präsident zu werden.«
»Du hast den Gedanken ans Auswandern also noch immer nicht aufgegeben?«
»Natürlich nicht! Nun, da ich Familienvater werde, ist mir eine Existenzgründung auf der anderen Seite vom großen Teich noch wichtiger. Sobald die Frühjahrsstürme vorüber sind, werde ich die Überfahrt wagen. Von drüben schreibe ich dir sofort, wenn ich für uns ein angemessenes Zuhause gefunden habe. Dann kommst du nach, noch bevor die Herbststürme eingesetzt haben.«
Bereits am folgenden Tag kündigte Sepp seine Stelle, und Ursula gestand ihrer Chefin, dass sie ein Kind erwartete. Sie bat darum, noch so lange in ihren Diensten bleiben zu dürfen, bis ihr Verlobter sie nachkommen lasse. Es war ihr nämlich wichtig, noch so viel wie möglich zu verdienen, damit sie in Amerika nicht mit leeren Händen ankommen würde. Die Chefin bedauerte, ihre tüchtige Köchin schon so bald zu verlieren. Als sie aber merkte, wie wild entschlossen Ursula war, wollte sie ihr keine Steine in den Weg legen.
Beim Schreiner gab der verliebte Auswanderer eine Reisekiste in Auftrag und packte Mitte April alles hinein, was für ihn wichtig war: seine Kleidung, seine Papiere, sein Geld und den Schlafsack, den seine Mutter eigens für ihn genäht hatte. Die Kiste beförderte er mit dem Handwagen, den er sich vom Braumeister geliehen hatte, zum Bahnhof. Ursula würde den Wagen wieder zurückbringen, denn selbstverständlich begleitete sie ihren Liebsten zum Bahnsteig, wo sie sich tränenreich von ihm verabschiedete.
»Ah, geh, wein doch nicht, Herzerl. Es ist doch kein Abschied für immer. In ein paar Monaten werden wir wieder beisammen sein und ein glückliches Leben beginnen.«
Während er diese Trostworte sprach, war ihm eigentlich selbst zum Weinen zumute. Schnell bestieg er den Waggon und trat ans Fenster. Schon setzte sich der Zug dampfend und schnaubend in Bewegung. Mit ihrem Taschentuch winkte sie ihm nach, bis er um die Biegung verschwunden war.
Eine gute Woche nach Sepps Abreise schob der Brauereidirektor beim Mittagessen einen Brief neben den Teller seiner Köchin. »Für mich?«, fragte sie ungläubig. Der Chef nickte. »Wenn du die Ursula Fischer bist, dann ist der Brief für dich.«
Noch immer ungläubig drehte sie das Kuvert um. Als Absender war angegeben: Josef Hellinger, zurzeit Hamburg, Auswandererbaracke. Sofort klopfte ihr Herz schneller. Am liebsten hätte sie den Brief gleich aufgeschlitzt. Da sie aber aller Augen neugierig auf sich gerichtet sah, steckte sie ihn in ihre Schürzentasche und tat uninteressiert.
Nach dem Abspülen konnte sie ihn in aller Ruhe lesen.
Hamburg, den 17. April 1877
Liebe Ursula!
Ehe ich an Bord gehe, will ich dir schreiben, wie es mir bisher ergangen ist. Für die Bahnfahrt nach Hamburg habe ich zwei Tage gebraucht. Weil ich einen Frachtsegler nehmen will (das ist die billigste Art, über den Atlantik zu kommen), landete ich in der Auswandererbaracke. Hier warten nicht nur Hunderte Menschen auf eine Passage, sondern auch Ratten, Läuse und Flöhe. Ich bin froh, dass du dies alles nicht mitzuerleben brauchst. Du musst bei deiner Überfahrt unbedingt einen Dampfer wählen. Die Passagiere der Frachtdampfer werden schon während ihrer Wartezeit besser untergebracht. Auch soll es auf den Dampfschiffen wesentlich komfortabler zugehen als auf den Seglern. Abgesehen davon dauert die Überfahrt mit einem Dampfer nur etwa zwei Wochen, während ich, wie man mir versicherte, mit dem Segler mindestens sechs Wochen auf See sein werde. Sofern keine günstigen Winde wehen, kann es bis zu zehn Wochen dauern, bis wir den Hafen von New York anlaufen. Allerdings kostet die Fahrt mit einem Dampfer auch ein Vielfaches von dem, was ich für meine Passage hinlegen musste. Trotzdem beschwöre ich dich, nimm für deine Überfahrt auf jeden Fall einen Dampfer.
Bis du von mir ein Lebenszeichen aus Amerika bekommst, musst du viel Geduld aufbringen. Denn ein Brief von dort wird ebenfalls sechs bis zehn Wochen unterwegs sein. Bis er bei dir ankommt, kann es bereits Ende September sein. Zu diesem Zeitpunkt scheint mir eine Reise in deinem Zustand nicht ratsam, sonst wird unser Kind womöglich noch auf dem Schiff geboren. Dieser Gedanke bereitet mir Sorgen. Deshalb rate ich dir, solltest du im August die Überfahrt nicht antreten können, warte bis Mitte April im Jahr darauf.
Nun sei gegrüßt, mein geliebtes Herz. Pass gut auf dich und unseren Spatzl auf. Sobald ich New York erreicht habe, werde ich schreiben.
Liebe Grüße und ganz viele Bussis,
Dein Sepp
Über diesen Brief freute sich Ursula sehr und wurde auch etwas ruhiger. Denn seit sie ihren Verlobten zum Bahnhof begleitet hatte, war sie von ihren Gefühlen hin- und hergerissen worden. Einerseits brach es ihr fast das Herz, dass ihr Geliebter nun fern von ihr war und sich auf einer abenteuerlichen Reise befand, andererseits wusste sie es zu schätzen, dass sie noch in der Geborgenheit der Heimat bleiben konnte. Um sich Sepps Worte zu verinnerlichen, las sie seine Zeilen immer wieder mal durch.
Das Einzige, was sie für ihn tun konnte, war, für eine glückliche Überfahrt zu beten. Ansonsten übte sie sich in Geduld. Sie rechnete sich aus, frühestens Ende Juli eine Nachricht von ihm bekommen zu können. Ihre Arbeit half ihr über die schlimmen Stunden hinweg. In ihrer Freizeit häkelte sie winzige Kleidungsstücke aus Wolle: Mützchen, Jäckchen, Schühchen. Ihre Herrin, die ihre Familienplanung abgeschlossen hatte, bot ihr die abgelegte Kindswäsche an, die Ursula dankbar annahm.
Drei Monate waren seit Sepps Abreise nach Hamburg vergangen, und die Köchin wartete jeden Tag sehnsüchtig auf den Postboten. Aber nie hatte er etwas für sie dabei. Woche um Woche verging. Als sich der August seinem Ende näherte, war ihr klar, dass sie mit der Auswanderung bis zum nächsten Frühjahr warten musste.
Ende September, es waren gut fünf Monate seit Sepps Brief aus Hamburg vergangen, ließ der Direktor seine Köchin am Nachmittag durch einen Lehrbuben in sein Kontor rufen. So etwas war noch nie vorgekommen. Was hatte das zu bedeuten? Während sie dem Buben folgte, war ihr sehr beklommen zumute. Beim Eintreten ins Büro erblickte sie eine Kiste, die auf dem Boden neben dem Schreibtisch stand und die sie sofort als das Eigentum ihres geliebten Sepp erkannte. Sie wankte. Hätte ihr Herr sie nicht geistesgegenwärtig aufgefangen, wäre sie zu Boden gesunken.
Fürsorglich setzte er die Bewusstlose auf seinen Sessel und fächelte ihr unbeholfen mit einem Blatt Papier Luft zu. Gleichzeitig befahl er dem Lehrbuben: »Ruf meine Frau. Das ist Weiberkram. Sie kennt sich damit besser aus.«
Als die Frau erschien, schlug Ursula schon wieder die Augen auf und fragte: »Wie bin ich hierhergekommen?« In dem Moment fiel ihr Blick erneut auf die Kiste, und sie brach in Tränen aus. Das machte den Herrn des Hauses noch hilfloser. »Lass sie nur weinen«, sagte seine Frau. »Das löst ihren Schmerz.« Sie hatte nämlich ihrerseits die Kiste erblickt, und ihr war ebenfalls klar, was das zu bedeuten hatte. Zwei Aufkleber fielen ihr ins Auge. Auf dem einen stand: »Josef Hellinger, von Hamburg nach New York«, auf dem anderen: »Von New York nach Hamburg«. Darunter folgte Ursulas Adresse.
Als die Köchin ihre Tränen so weit abgetrocknet hatte, dass sie wieder etwas sehen konnte, zitterte sie aber noch zu sehr, um die Kiste selbst öffnen zu können. Deshalb war sie ihrem Dienstherrn dankbar, dass er das für sie übernahm. Obenauf lag ein Brief von der Reederei:
New York, den 29. Juni 1877
Sehr geehrtes Fräulein Fischer!
Aus den Papieren des Josef Hellinger war zu ersehen, dass Sie die Verlobte sind. Da wir keine andere Adresse fanden, senden wir Ihnen seine Sachen zu, in der Annahme, dass das so in Ordnung ist. Oben genannter Passagier hatte am 29. April 1877 mit einem unserer Segler die Überfahrt nach New York angetreten. Leider war schon bald auf dem Schiff Typhus ausgebrochen. Dadurch wurde über die Hälfte der Passagiere und ebenfalls ein Großteil der Mannschaft hinweggerafft. Mit großem Bedauern teilen wir Ihnen mit, dass auch Ihr Verlobter darunter war. Wie alle anderen Typhus-Opfer, wurde er direkt auf See bestattet.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Müller, in Vertretung für die Reederei
Ursula konnte den Brief nicht in einem Zuge lesen, immer wieder verschwammen die Buchstaben vor ihren Augen. Beim Durchsehen des Kisteninhalts vermisste sie lediglich den Schlafsack. Darin war Sepp vermutlich gestorben, und man hatte ihn gleich in diesem über Bord geworfen. Alles andere war vorhanden. In seinem »guten Anzug« fand sie sogar das eingenähte Geld. Das verwende ich für unser Kind, dachte sie nur und brach erneut in Tränen aus. Ihre Herrin, zum Glück eine einfühlsame Person, führte Ursula in ihre Kammer und packte sie ins Bett. »Du kommst erst wieder runter, wenn du dich besser fühlst.«
In den folgenden Tagen war es nur der Gedanke an ihr Kind, der die Köchin aufrecht hielt. Gewissenhaft ging sie ihrer Arbeit nach, machte sich aber immer wieder Gedanken, was aus ihr und ihrem Kind werden sollte. Nun wurde es in der damaligen Zeit in der dienenden Klasse nicht als Schande angesehen, ein lediges Kind zu haben. Das Problem war nur, wer sollte sich darum kümmern, wenn die Mutter gezwungen war, ihrem Broterwerb nachzugehen?
Die Frau des Braumeisters war es, die nach einigen Tagen die Initiative ergriff: »Nach deinen Angaben habe ich ausgerechnet, dass das Kind Ende Oktober zur Welt kommen wird. Du kannst gerne bei uns in Stellung bleiben, wenn du das Kind anderswo zur Welt bringst und einen Pflegeplatz findest. Mein Vorschlag: Frag doch mal bei deiner Mutter an.«
Noch am selben Tag sandte Ursula ihrer Mutter einen Brief mit der entsprechenden Anfrage. Sie war sehr erleichtert, als nach wenigen Tagen eine positive Antwort eintraf.
Bisher hatte die Köchin Ursula ihr Küchenmädchen immer wieder mal ein einfaches Gericht zubereiten lassen. Nun aber begann sie damit, ihr gezielt das Kochen beizubringen, damit sie in der Lage sein würde, Familie und Belegschaft der Brauerei mit guten Mahlzeiten zu versorgen, während sie in ihrem Elternhaus ihr Kind zur Welt brachte.
Am 19. Oktober veranlasste die Hausherrin ihre Köchin, die Reisetasche zu packen. Sie drängte sie, schon früher nach Hause zu fahren, denn Kinder würden sich nicht immer an den vermeintlichen Termin halten. In den frühen Morgenstunden des folgenden Tages begleitete ein Lehrling Ursula mit einem Handwagen, auf dem ihre Reisetasche und Sepps Kiste lagen, zur Poststation. Dort bestieg sie die Postkutsche, die sie nach Reit im Winkl bringen sollte.
Hatte sich ihre Herrin verrechnet, oder lag es daran, dass die Kutsche sie ordentlich durcheinanderschüttelte auf der holprigen Fahrbahn? Denn gegen Ende der Reise setzten unverkennbar die Wehen ein. An der Zielstation bat sie den Postillion, er möge ihr Gepäck im Gasthof zur Post abstellen. Ihr Vater werde es von dort abholen. Sie selbst schaffte es mit letzter Kraft, ihr Elternhaus, das nicht allzu weit entfernt lag, zu erreichen. Die Mutter gab dem Vater, der sich sogleich mit seinem Handwagen auf den Weg machte, den Auftrag, auf dem Rückweg die Hebamme mitzubringen. Wenig später war sie schon zur Stelle. In den frühen Morgenstunden des 21. Oktober 1877 kam dann ein Bub zur Welt, zwar etwas mager, aber rundum gesund. Zum Andenken an seinen Vater gab ihm die junge Mutter den Namen Sepp. Dieser Sepp sollte mein Vater werden. Demnach war Ursula, seine Mutter, meine Großmutter. Drei Wochen nach seiner Geburt rumpelte Ursula mit der Postkutsche zurück nach Rosenheim.
Einige Jahre später fand sie doch noch ein bescheidenes Glück. Sie heiratete den Bergmann Röpfl und zog mit ihm nach Miesbach, wo er seinen Lebensunterhalt in einem Kohlenbergwerk verdiente. Dort wurde seit 1849 Braunkohle gefördert, die wegen ihres schwarzglänzenden Aussehens auch Pechkohle genannt wurde und einen etwas höheren Heizwert als die übliche Braunkohle hatte. Dieses Werk beschäftigte zeitweilig etwa ein Drittel der Bevölkerung von Miesbach. Im Jahre 1911 musste es leider geschlossen werden, weil sich der Abbau nicht mehr lohnte. Ursulas Ehemann wechselte, wie viele seiner Kumpels, in das Bergwerk nach Hausham. Die Entfernung von fünf Kilometern bedeutete kein Problem, da es mittlerweile eine Bahnverbindung zwischen Miesbach und Hausham gab.
Mit ihrem Ehemann hatte Ursula keine Kinder. Ihm wäre es recht gewesen, wenn sie ihren Sohn zu sich genommen hätte. Sie wollte ihn jedoch nicht aus seinem gewohnten Umfeld reißen. Auch wollte sie es ihrer Mutter nicht antun, ihr den Buben wegzunehmen, da er endlich in dem Alter war, dass er sich nützlich machen konnte. Den Kontakt zu ihrem Sohn behielt sie immer bei, auch wenn es für sie sehr schwierig war. Die siebzig Kilometer zwischen Miesbach und Reit im Winkl waren unter den damaligen Verhältnissen eine beachtliche Entfernung.
Als der Sohn schon mehrfacher Familienvater war und die Mutter die Strapazen einer Reise nicht mehr auf sich nehmen konnte, besuchte er sie immer wieder mal mit dem Radl. Fuhr er per Bus und Bahn hin, nahm er stets eines von uns Kindern mit. Die alte Frau freute sich, wenn sie ein Enkelkind um sich hatte, und ich genoss es sehr, bei dieser sehr lieben Oma zu sein.
Da sie erst 1940, im hohen Alter von 88 Jahren starb, hatte sie mir vorher noch ihre Lebensgeschichte erzählen können.
Sepp
Als der kleine Sepp ein halbes Jahr alt war, gab es im Gartner-Haus erneut Nachwuchs. Tochter Elisabeth, Jahrgang 1857, brachte am 21. Mai 1878 ebenfalls ein lediges Kind zur Welt, nämlich Maria. Elisabeth ging einige Wochen nach der Geburt ihres Kindes aus dem Haus, um sich bei einem Großbauern ihren Lebensunterhalt zu verdienen. So wuchsen Cousin und Cousine unter der Obhut der Großeltern auf. Die beiden jungen Mütter kamen jedoch immer wieder mal nach Hause, um nach ihren Kindern zu sehen. 1881, also drei Jahre nach Marias Geburt, brachte ihre Mutter Elisabeth in ihrem Elternhaus wieder eine ledige Tochter zur Welt, die sie Elisabeth nannte. Dieses Kind starb 1889 mit sechs Jahren an Diphterie.
Sepp muss ein aufgewecktes Kerlchen gewesen sein. Er hatte eine gute Beobachtungsgabe, gepaart mit einem ausgezeichneten Gedächtnis. An den langen Winterabenden erzählte er uns Kindern gerne Erlebnisse aus seiner eigenen Kindheit.
’s Puppei
Eine der Geschichten, die ich besonders gern hörte, war die von einem Versehgang. So nannte man es, wenn der Pfarrer einem Schwerkranken die Sterbesakramente brachte, um ihn für seine letzte Reise zu stärken. Zur damaligen Zeit war es bei uns der Brauch, dass der Priester über seiner schwarzen Kleidung einen weißen, mit langen Spitzen besetzten Überwurf trug, genannt Rochett. So war schon von fern zu erkennen, dass er sich auf einem Versehgang befand. Doch damit nicht genug. Damit es jeder Passant wirklich sehen und hören konnte, dass ein Geistlicher zu einem Sterbenden unterwegs war, mussten zwei Ministranten vor ihm hergehen, von denen einer eine Laterne trug mit einer brennenden Kerze darin, und der andere ein Glöcklein, mit dem er ständig läutete. Die Leute am Straßenrand knieten ehrfürchtig nieder, um zu beten. Menschen, die das Läuten im Haus vernahmen, kamen heraus, knieten ebenfalls nieder und beteten für die arme Seele, bis der Pfarrer außer Sichtweite war.
Die heilige Wegzehrung, wie man die Kommunion auch nannte, trug der Pfarrer sorgsam mit beiden Händen. Sie befand sich in einem kleinen goldenen Behälter, eingebettet in eine Hülle aus wertvollem Stoff, der reich mit christlichen Motiven bestickt war und Bursa genannt wurde. Der kleine Sepp, der das zum ersten Mal sah, muss diese für eine Puppe gehalten haben. Eilig lief er auf den geistlichen Herrn zu, zupfte ihn an seinem Gewand und bat: »Gib mir das Puppei.«
»Bist du narrisch word’n?«, fauchte ihn Hochwürden an. »Schleich di!«
Tief enttäuscht rannte der Dreijährige zu seiner Großmutter, wo er Trost suchte. Die Geschichte hat er sein Lebtag nicht vergessen. Ein heutiger Pfarrer hätte ihm wahrscheinlich, statt ihn so barsch anzufahren, erklärt: »Ah, geh, Bub, das ist doch kein Puppei, das ist der liebe Heiland, den muss ich zu einem kranken Menschen tragen.« Das hätte sich das Kind vermutlich auch gemerkt, aber mit positiven Gefühlen.
Heimliches Rauchen
1883 kam Sepp in die Schule und scharte gleich eine Menge Freunde um sich, mit denen er so allerlei anstellte. Es war nur gut, dass seine liebe Großmutter meist nichts davon erfuhr. Als er acht oder neun Jahre alt war, trafen sich die Freunde gerne in einem alten Schützengraben, der sich nicht allzu weit vom Dorf entfernt befand. Der rührte wohl noch von einem Krieg her, den die Bayern gegen die Österreicher ausgefochten hatten. Dieser Graben war ein beliebter Spielplatz für die männliche Dorfjugend. Vor allem nutzten die Schulbuben ihn, um dort heimlich zu rauchen, wenn es einem von ihnen gelungen war, dem Vater oder dem Opa eine Zigarette zu stibitzen. Eines Tages nun stand plötzlich wie ein Rachegott der Lehrer vor den erschrockenen Buben. Mit Donnerstimme verkündete er: »Das wird ein Nachspiel haben! Morgen in der Schule!«
Die kleinen Burschen konnten sich ausmalen, was sie erwarten würde: Der Lehrer würde ihren Allerwertesten mit dem Rohrstock traktieren. Also beratschlagten sie, welche Vorsichtsmaßnahme angebracht wäre.
Bevor sich Sepp am folgenden Morgen auf den Schulweg begab, zog er seine Sonntagshose an und darüber seine Schulhose. Zur Sicherheit stopfte er an seiner Kehrseite ein kleines Sofakissen zwischen die beiden Hosen. Die anderen »Rauchergenossen« waren auf die gleiche Weise ausgestattet, als sie den Schulraum betraten. Der Lehrer, dem sofort auffiel, dass seine Schüler an ihrer rückwärtigen Körperpartie über Nacht stark zugenommen hatten, sah von der angekündigten Bestrafung ab. Die Buben, die glaubten, der Lehrer habe seine Androhung vergessen, fühlten sich sicher und ließen am nächsten Tag die »Polsterung« weg. Darauf hatte der Lehrer nur gewartet. Einen nach dem anderen legte er nun übers Knie und prügelte die armen Sünder.
Der Tod des Königs
Wie wir alle wissen, ertrank der bayerische König Ludwig II. im Jahre 1886 im Starnberger See, der damals noch Würmsee genannt wurde. Sepp war gerade in der dritten Klasse, als der Lehrer diese ungeheuerliche Nachricht verkündete. Den Schüler Sepp beeindruckte das nicht besonders. Als es aber hieß, dass am 19. Juni, am Tag der Beerdigung des Königs, schulfrei sei, entkam ihm ein Jubelschrei. Immer wieder schwärmte er uns Kindern später von dem schulfreien Tag vor.
Echte Trauer aber empfand er noch im selben Jahr, als sein Großvater Pankraz ganz überraschend starb. Das war ein herber Verlust für den Buben. An seinem Opa hatte er sehr gehangen und in ihm einen Vater, einen Lehrmeister und ein Vorbild gesehen. Die Oma bewirtschaftete fortan den Hof mit ihrem ältesten Sohn Pankraz, der 1853 geboren war, allein weiter. Pankraz, ein kräftiger Bursche, erledigte alle Aufgaben im Stall und auf dem Feld, die man ihm anschaffte. Er war ein gutmütiger netter Kerl, war aber nicht in der Lage, selbst Entscheidungen zu treffen. Deshalb kam er als Hoferbe nicht infrage.