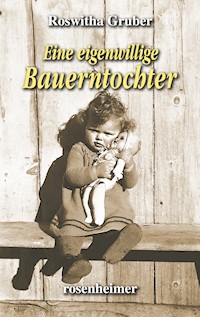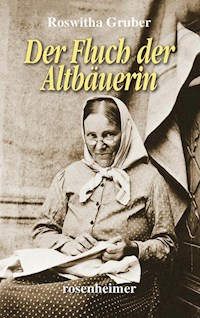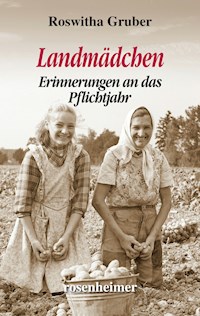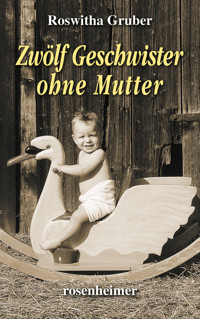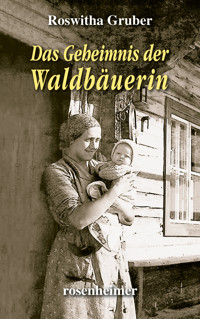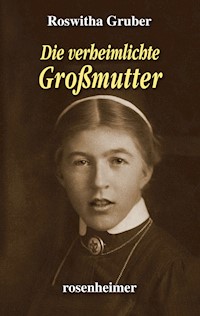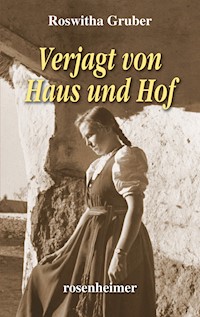16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Den Traummann oder die Traumfrau zu finden, ist bekanntlich gar nicht so einfach. Und manchmal muss man dem Glück eben ein wenig auf die Sprünge helfen. Die Suche nach dem richtigen Partner hat sich die Heiratsvermittlerin Sabine Engelhardt zum Beruf gemacht. Nicht immer waren ihre raffinierten Verkupplungsversuche erfolgreich, doch viele einsame Herzen fanden mit ihrer Hilfe den idealen Lebensgefährten. Dieses Buch ist eine Fundgrube für Amüsantes und Kurioses aus dem Alltag einer Heiratsvermittlerin, deren Job so gar nicht alltäglich ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Roswitha GruberSabine Hehle
Sehnsuchtnach Liebe
Eine Heiratsvermittlerin erzählt
In diesem Buch sind authentische Fälle dargestellt. Die Personennamen, die Einzelheiten des Geschehens und die Orte der Handlung sind fiktiv.
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2005
© 2021 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim
www.rosenheimer.com
Lektorat: Simone Gundi, München
Titelfoto: age/mauritius-images
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
eISBN 978-3-475-54918-2 (epub)
Inhalt
Eine bedeutsame Begegnung
Wie die Jungfrau zum Kind
Nora und Heiner
Das Gebiss im Nachttisch
Der »Frühsteher«
Auf eigenen Beinen
Der Eilauftrag
Single-Reisen
»Ich schenk’ dir einen Rosengarten«
Geld im Weinberg
Vernissage
Privatgalerie
Trotz Krankheit zum Glück
Briefaktionen
»Herzblattl« oder Die Frau, die nicht Nein sagen kann
Der Familienrat
Der rote Motorroller
Neue Währung: Aktenordner
Der Mensch denkt …
Lehrgeld
Ein warnendes Beispiel
Das »Madonnenbild«
Es ist nicht gut,dass der Mensch allein bleibt.Gen. 2,18
Eine bedeutsame Begegnung
Jedes Jahr genieße ich es, auf der Frankfurter Buchmesse zu sein. Nicht nur, weil ich Bücher über alles liebe, es reizt mich auch das Flair in den riesigen Hallen. Dort habe ich immer das Gefühl von großer weiter Welt. Von dem Tag an aber, an dem mein erstes eigenes Buch dort präsentiert wurde – ein Ratgeber für Frauen in der Lebensmitte –, besaß die Buchmesse für mich noch viel mehr Anziehungskraft.
Mehrere Jahre später, im Oktober 2003, nachdem in der Zwischenzeit einige Romane von mir in einem anderen Verlag erschienen waren, weilte ich während der gesamten Messezeit mit meiner Verlegerin an deren Stand. Zum einen wollte ich ihr ein bisschen zur Hand gehen, zum anderen genoss ich es, gewissermaßen ein Bestandteil der Messe zu sein und alles von Anfang bis Ende mitzuerleben. Und wer weiß – vielleicht ergab sich ja auch der eine oder andere interessante Kontakt.
Als Blickfang in »unserem« Stand diente eine Schaufensterpuppe. Dieser hatte meine Verlegerin ihr eigenes Brautkleid angezogen und sie mit Schleier und Myrtenkranz geschmückt. Der besondere Gag an dieser Braut war jedoch, dass sie ein Gewehr in Händen hielt. Damit entsprach sie genau dem Titelbild auf meinem Roman »Ehemann ade – aber wie?«.
Viele Leute blieben schmunzelnd stehen, viele Kameras wurden gezückt. Am späten Nachmittag des Besuchersonntags, als die Messe sich schon ihrem Ende zuneigte, beobachtete ich eine Frau, die zielstrebig auf unseren Stand zukam. Mit dem Zeigefinger deutete sie auf einen der Bände von »Ehemann ade« mit den Worten: »Das Buch muss ich haben!«
Lächelnd reichte ich es ihr mit der Bemerkung: »Falls Sie vorhaben sollten, Ihren Mann zu beseitigen, muss ich Sie enttäuschen. Das ist ein Roman und kein Ratgeber.«
»Nein, deswegen brauche ich es nicht. Mit meinem Mann bin ich sehr glücklich. Das Buch interessiert mich aus beruflichen Gründen.«
In welchem Beruf würde einem ein solches Buch von Nutzen sein? Interessiert erkundigte ich mich: »Was machen Sie beruflich?«
»Ich bin Heiratsvermittlerin.«
Diese Aussage ließ mich herzhaft auflachen. Ich hielt sie für einen Scherz.
»Nein, im Ernst, ich war wirklich viele Jahre lang als Heiratsvermittlerin tätig. Aus gesundheitlichen Gründen musste ich den Beruf leider aufgeben.«
Da sie so munter und scheinbar gesund vor mir stand, hätte ich gerne gefragt, an welcher Krankheit sie leide, aber ich traute mich nicht. Stattdessen sagte ich: »Das verstehe ich nicht. Als Heiratsvermittlerin sollte es doch Ihr Bestreben sein, Menschen zusammenzubringen. Deshalb verwundert es mich, dass Sie wissen wollen, wie man einen Ehemann wieder los wird. Das passt doch nicht zusammen!«
Sie schmunzelte: »Wer weiß, vielleicht besteht doch ein Zusammenhang. Dieses Buch muss ich jedenfalls haben.«
Nachdem ich ihr eine Widmung hineingeschrieben hatte, überreichte ich es ihr. Sie gab mir noch ihre Visitenkarte und bat um die meine. Tief befriedigt zog sie mit ihrem Buch unter dem Arm von dannen.
Diesen Vorfall hatte ich bald vergessen. Denn gleich im Anschluss an die Messe unternahm ich in Begleitung meines Mannes eine ausgedehnte Lesereise, von der wir erst Mitte November wieder nach Hause zurückkehrten.
Am Vormittag des 19. Novembers dann meldete sich bei mir am Telefon jemand mit »Sabine Engelhardt«. Der Name sagte mir zunächst nichts. Aber dann beschrieb sie die kleine Szene am Bücherstand auf der Frankfurter Messe: »Ich war diejenige, die den ›Ehemann‹ unbedingt haben musste.«
Da dämmerte es mir. »Und, haben Sie ihn gelesen?«
»Gelesen ist nicht der richtige Ausdruck. Verschlungen habe ich ihn. Er ist super. Die Art, wie Sie schreiben, gefällt mir.«
Artig bedankte ich mich für das Kompliment. Eine solche Rückmeldung tut einem Autor immer gut. Damit, dachte ich, sei das Gespräch beendet. Aber es fing erst richtig an.
Wie sie bereits erwähnt habe, sei sie viele Jahre in der Partnervermittlung tätig gewesen und habe dadurch Einblick in zahlreiche Schicksale gewonnen. Es sei viel zu schade, dass diese interessanten Geschichten nun in ihren Aktenordnern schlummerten. Ob ich sie nicht zum Leben erwecken wolle?
»Wie meinen Sie das?«, fragte ich überrascht.
»Sie könnten ein Buch darüber schreiben.«
Warum sie das nicht selber tue, wunderte ich mich. Denn ich verspürte keine Lust, mich auf ein so fremdes Gebiet zu begeben. Außerdem hatte ich in meinem Schrank noch mehrere Ordner mit meinem gesammelten Stoff stehen, der nur darauf wartete, zu Romanen verarbeitet zu werden.
»Weil ich das nicht kann«, war ihre offene Antwort. »Ich habe es versucht, aber das wird nichts. Ich kann nicht schreiben. Bei mir würde das ein solches Durcheinander, dass kein Mensch es versteht.«
Sie hatte Recht. Sie konnte wirklich nicht schreiben. Das erkannte ich später, als ich ihre ersten Versuche auf diesem Gebiet zu Gesicht bekam. Aber erzählen konnte sie, wunderbar erzählen. Das musste man nutzen.
Aber ehe es so weit war, galt es, einige Hürden zu überwinden. Die erste Hürde war meine immer noch ablehnende Haltung. Nur um das Gespräch mit ihr zu beenden und um die gute Frau nicht zu kränken, versprach ich ihr, ich werde darüber nachdenken.
Das tat ich dann auch, am Nachmittag bei meinem täglichen Spaziergang.
Am Abend rief Frau Engelhardt wieder an. Mein Mann wurde schon brummig: »Was will die denn schon wieder? Die soll dich in Ruhe lassen.«
Wie ich mich entschieden habe, wollte sie wissen.
»Dazu kann ich noch nichts sagen«, wich ich aus. »Ich müsste mir das Material erst mal ansehen.«
»Gut, dann besuchen Sie uns am nächsten Wochenende.«
Das war die zweite Hürde: die große räumliche Entfernung. Sie lebte mittlerweile in Engen, im schönen Hegau, und ich in Reit im Winkl. Das sind mit dem Auto gut und gerne fünf Stunden Fahrt, weil es keine direkte Autobahnverbindung dorthin gibt.
Dennoch versuchte ich, meinem Mann die Fahrt schmackhaft zu machen.
»Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich habe keine Zeit«, lehnte er kategorisch ab.
»Das macht gar nichts. Dann fahre ich eben allein.«
Das wollte er schon gleich gar nicht. Er sehe überhaupt nicht ein, dass er hier allein zu Hause herumsitze. Um mich endgültig abzuschrecken, malte er mir die Gefahren auf der winterlichen Straße in den düstersten Farben aus.
Am folgenden Abend meldete sich die ehemalige Heiratsvermittlerin erneut. Sie reagierte tief enttäuscht auf meine Mitteilung, dass ich nicht komme. Deshalb fügte ich tröstend hinzu: »Im kommenden Juni machen wir eine Lesereise durch Ihre Region. Dann ergibt sich bestimmt die Gelegenheit zu einem Besuch in Engen. Dann schaue ich mir Ihre Unterlagen gerne an.«
»So lange kann ich nicht warten. Die Sache drängt. Ich bin krank.«
Nun wollte ich aber doch wissen, was ihr fehlte. Sie erzählte mir, dass bei ihr vor einigen Jahren im Kopf ein Aneurysma geplatzt sei. Wochenlang hatte sie im Koma gelegen. Durch die Kunst der Ärzte gelang es, sie wieder so weit herzustellen, dass sie ein fast normales Leben führen kann. Nur – ihren Beruf darf sie nicht mehr ausüben. Sie darf sich keiner Belastung mehr aussetzen.
Natürlich könne sie trotzdem uralt werden. Aber sie wolle nichts auf die lange Bank schieben. »Ich werde sehen, was sich machen lässt«, waren ihre Worte am Ende unseres Telefonats.
Nach einer Stunde war sie erneut in der Leitung: »Ich habe die Sache mit meinem Mann besprochen. Wir kommen am Sonntag zu Ihnen.«
Das sei doch viel zu strapaziös, die Hin- und Rückfahrt am selben Tag zu machen, gab ich zu bedenken. Wenn sie schon die weite Fahrt auf sich nehmen wolle, dann solle sie doch schon am Samstag kommen und bei uns übernachten. Dann hätten wir den ganzen langen Abend für ein Gespräch. Am Sonntag könnten sie dann in aller Ruhe zurückfahren.
Leider aber war aus beruflichen Gründen ihr Mann am Samstag noch nicht abkömmlich.
Mein allgegenwärtiger Ehemann, der dieses Gespräch mit angehört hatte, legte sofort los: »Was fällt dir ein, diese Leute einzuladen? Die kenne ich doch überhaupt nicht!«
»Dann lernst du sie eben kennen. Ihn kenne ich ja auch nicht. Aber sie ist sehr nett. Sie ist eine sehr lebhafte, umgängliche Person. Außerdem bin ich nicht an ihr interessiert, sondern an ihren Geschichten.«
»Das kommt überhaupt nicht in Frage, dass du für die ein Buch schreibst.«
»Ich schreibe nicht ›für die‹«, verteidigte ich mich, »sondern wir schreiben gemeinsam. Sie will mir den Stoff liefern, und ich bringe ihn in die richtige Form. Falls er mir zusagt.«
Diesen Nachsatz hatte ich noch angehängt, weil ich merkte, dass er partout gegen dieses Projekt war. Dennoch protestierte er den ganzen Abend weiter.
»Warum bist du eigentlich so dagegen?«, wollte ich schließlich wissen.
»Du hast genug anderes zu tun. Du verzettelst dich nur. Auch hier im Haus gibt es noch viel Arbeit.«
Um des lieben Friedens willen räumte ich schließlich ein: »Wahrscheinlich übernehme ich die Aufgabe eh nicht. Ich schaue mir das Material eigentlich nur an, damit die gute Frau endlich Ruhe gibt.«
Bevor das Ehepaar Engelhardt am frühen Sonntagnachmittag bei uns eintraf, impfte mein Mann mir nochmals ein: »Also, du lehnst auf jeden Fall ab. Sag ihr klipp und klar, dass du so etwas nicht machen willst.« Aber immerhin machte er bei der Begrüßung eine einigermaßen freundliche Miene.
In der Küche hatte ich einen kleinen Imbiss vorbereitet, für den sich Frau Engelhardt aber keine Zeit nahm. Sie wollte mir unbedingt erst ihre Unterlagen zeigen. Das waren mehrere gewichtige Aktenordner, die sie mitschleppte.
»Das ist nur ein Bruchteil von dem, was ich an Material habe«, erklärte sie mir.
Kurz entschlossen schoben wir unsere Männer in die Küche und begaben uns in mein Arbeitszimmer. Dort konnten wir ungestört reden. Sabine legte mir nicht nur ihre Entwürfe zu einem Buch vor, sie zeigte mir auch Erhebungsbögen, Karteikarten und zahlreiche Briefe ihrer ehemaligen Klienten. Das sah alles äußerst interessant aus. Die Sache begann mich zu reizen. Zudem sprudelte es nur so aus ihr heraus.
Ja, das war wirklich ein Stoff, den man nicht brachliegen lassen sollte. Ich war so gefesselt, dass ich Raum und Zeit vergaß. Beim ersten Blick auf meine Uhr stellte ich erschrocken fest, dass über zwei Stunden vergangen waren. O Gott, die armen Männer! Die warteten hungrig in der Küche am gedeckten Tisch.
Inzwischen waren Sabine und ich per Du. Wir hatten in diesen zwei Stunden so viel Seelenverwandtschaft entdeckt, dass wir uns trotz des Altersunterschieds von 17 Jahren wie Schwestern fühlten.
»Sabine, ich mache es«, sicherte ich ihr zu, bevor wir mein Zimmer verließen. »Das soll aber fürs Erste unter uns bleiben. Mein Mann steht dieser Sache sehr ablehnend gegenüber.«
»Warum?«, wollte Sabine wissen.
»Das weiß ich auch nicht so recht. Er meint, ich hätte schon genug Arbeit. Wahrscheinlich hat er Angst, dass ich dann gar keine Zeit mehr für ihn habe!«
Während unserer Mahlzeit in der Küche gab es nur Smalltalk, und wir erwähnten unser Projekt mit keiner Silbe. Nachdem die Gäste sich verabschiedet hatten, wollte mein Mann wissen, wie ich mit Frau Engelhardt verblieben sei.
»Du hattest Recht«, sagte ich diplomatisch. (Es ist immer gut an, Männern Recht zu geben!) »Das ist wirklich keine Aufgabe für mich.«
Damit gab er sich zufrieden.
Da er mir offensichtlich nicht getraut hatte, hatte er die Gelegenheit in der Küche genutzt, um Sabines Ehemann entsprechend zu bearbeiten. Das erfuhr ich aber erst am nächsten Tag per Telefon.
Jetzt wurde mir auch klar, warum er sich so gutwillig mit dem völlig fremden Mann in die Küche hatte abschieben lassen. Während Sabine und ich nämlich in meinem Zimmer den Schlachtplan für unsere Zusammenarbeit entworfen hatten, war mein Mann nicht untätig gewesen. Er hatte Gerd beschworen, seiner Frau dringend von einer Zusammenarbeit mit mir abzuraten. Das wäre nichts für mich, für so ein Thema fehle es mir an Erfahrung.
»Jetzt gerade!«, war Sabines Kommentar. »Ich habe eigens eines deiner Bücher gelesen, um mich davon zu überzeugen, dass du schreiben kannst.«
Nun standen wir vor der nächsten Hürde: Wie sollte ich an meinen Stoff kommen? Schicken durfte sie mir nichts, das wäre meinem Mann aufgefallen. Telefonieren war auch schwierig, weil mein Angetrauter immer als Erster ans Telefon stürzt. Heimliches Anrufen meinerseits kam auch nicht in Frage. Zum einen, weil er meist anwesend ist, zum anderen, weil ihm bei der monatlichen Kontrolle der Telefonrechnung sofort auffallen würde, wenn ich eine gewisse Nummer immer wieder anriefe.
Die Lösung war der Computer! Der ist vor meinem Mann sicher, weil er sich noch nicht mal in die Nähe eines solchen Gerätes traut. Er weiß weder, wie man es anschaltet, geschweige denn, wie man etwas aufruft.
Damit hatten wir ein Medium gefunden, mit dem wir uns unauffällig austauschen konnten. Am späten Abend, wenn mein Mann vor dem Fernseher saß oder bereits schlief, druckte ich die von Sabine fast täglich erscheinenden E-Mails aus.
Bis März des folgenden Jahres arbeiteten wir – mit einigen Unterbrechungen – auf diese Weise, aber irgendwie kamen wir nicht so recht weiter. Zu viele Fragen blieben offen. Das persönliche Gespräch ist eben durch nichts zu ersetzen.
Da fasste Sabine wieder spontan einen Entschluss. Sie wollte im Mai mit ihrem Mann in Reit im Winkl Urlaub machen und bat mich, ihr in meiner Nähe eine kleine Ferienwohnung für vierzehn Tage zu buchen.
Dieses Quartier war schnell gefunden, in einem Bauernhof, nur fünf Minuten zu Fuß von meinem Haus entfernt.
Mitte Mai trafen Sabine und ihr Mann ein. Als Erstes deponierte ich in ihrer Wohnung meinen Kassettenrecorder mit vielen leeren Kassetten sowie Papier und Bleistifte. Ab da marschierte ich jeden Morgen zu dem Bauernhof, während mein Mann noch schlief. Sabine erzählte mir jedes Mal zwei Stunden lang auf Band, und ich machte mir Notizen dazu, damit ich mich später auf den vielen besprochenen Bändern leichter zurechtfinden würde.
Aber nicht nur die beiden Morgenstunden nutzten wir zur Arbeit. Auch am Nachmittag saß ich bei Frau Engelhardt und interviewte sie, statt meinen üblichen Spaziergang von anderthalb Stunden zu absolvieren. Zusätzlich ergab sich noch so manche Abendstunde zur gemeinsamen Arbeit, wenn mein Angetrauter z. B. zur Kirchenchorprobe musste.
So hatte ich nach zwei Wochen alles Wichtige im Kasten. Und mein Mann hatte nicht das Geringste von meinen Aktivitäten mitbekommen.
Nun galt es, das ganze Material zu sichten, das heißt abzuhören und zu ordnen. Das war jedoch nur möglich, wenn mein sehr anhänglicher Gemahl nicht in meinem Arbeitszimmer saß. Das heißt, ich musste die Nacht zum Tage machen. Die Kassetten konnte ich nur abhören, wenn er schlief oder gerade außer Haus war.
Dazwischen waren aber immer wieder Rückfragen bei Sabine nötig, die wir möglichst per E-Mail erledigten. Oder wir telefonierten abends, wenn die Luft »rein« war.
Nachdem alle Seiten handschriftlich verfasst waren, gab ich sie in den Computer ein. Auch das geschah wieder in Nachtarbeit. Und als endlich alles ausgedruckt war, stand mir noch die Aufgabe bevor, das dicke Manuskript unbemerkt zur Post zu schaffen. Das wollte ich bei meinem nächsten Lebensmitteleinkauf bewerkstelligen.
Da tat sich eine neue Schwierigkeit auf: Mein Mann wollte unbedingt mit ins Dorf fahren, weil er plötzlich noch einiges zu erledigen hatte.
Nun ist ein Aktenordner keine Kleinigkeit, den man mal eben in der Handtasche verschwinden lässt. Was tun? Zum Glück hatte ich einige Briefe fertig gemacht, die ebenfalls zur Post mussten. Die Briefe und mein fertiges Paket steckte ich in eine der Baumwolltaschen, die man zum Einkaufen benutzt. Diese verstaute ich in einer Kühlbox und schmuggelte darin mein Manuskript unbemerkt ins Auto. Am Postamt dachte mein Göttergatte aber gar nicht daran, seiner Wege zu gehen und seine Dinge zu erledigen, wie ich gehofft hatte. Nein, er wartete im Auto so vor dem Postgebäude, dass er mich beim Betreten und Verlassen desselben stets sehen konnte. Dabei konnte ich noch froh sein, dass er nicht mit hinein wollte.
Ich konnte schlecht die Kühltasche mit ins Postamt nehmen, ohne Verdacht zu erregen. Nun hieß es »cool« bleiben! Ich stieg aus und machte mich auf dem Rücksitz an der Kühlbox zu schaffen. Das heißt, ich klappte deren Deckel auf, entnahm ihr meine Stofftasche und spazierte wie selbstverständlich damit in die Post. Allerdings zitterte ich innerlich. Erst als die Paketkarte ausgefüllt, der Stempel aufgedruckt und der Abschnitt in meiner Handtasche verstaut war, konnte ich aufatmen.
Auf diese abenteuerliche Weise ist das vorliegende Werk entstanden: Die Erinnerungen der Heiratsvermittlerin Sabine Engelhardt.
Wie die Jungfrau zum Kind
Heiratsvermittler gab es zu allen Zeiten und in allen Kulturen. Wenn man es genau nimmt, gab es Heiratsvermittlung sogar schon im Paradies. »Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt«, sagte sich der Herr und führte dem Adam ein Weib zu. Der erste Mensch war also nicht genötigt, sich seine Gefährtin selbst zu suchen. Zugegeben, die Auswahl war damals äußerst gering.
Aber Spaß beiseite! Wir lesen sowohl in der Bibel als auch in weltlichen Schriften, dass Ehen häufig durch Dritte gestiftet wurden. Meist waren es die Eltern, die schon frühzeitig den Lebenspartner für ihr Kind aussuchten. Oft waren es Verwandte, die sich bemühten, zwei junge Menschen zusammenzuführen. Vielfach waren es aber auch fremde Personen, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten – gegen Entgelt –, einen Hochzeiter zu besorgen.
Das so genannte Verkuppeln geschah in allen gesellschaftlichen Schichten. Im Bauernstand war es ebenso üblich wie im Bürgertum oder im Adel. Während es in der ärmeren Bevölkerung darum ging, überhaupt einen Partner zu finden, ging es in den besitzenden Schichten hauptsächlich darum, dass Land zu Land, dass Geld zu Geld kam.
Die Form des Heiratsmarktes wandelte sich mit den Möglichkeiten der Kommunikation. Bestand die Vermittlung zunächst nur darin, mündliche Absprachen zu treffen, so kam bald die schriftliche Form hinzu. Es wurden Verträge geschlossen.
Mit Erscheinen der Zeitungen fand man auch bald Heiratsgesuche darin.
1695 erschien in England die erste bekannte Heiratsanzeige in der Zeitung »Sammlung für den Fortschritt in Landwirtschaft und Handel«. Ein junger Mann suchte darin eine Dame, die mindestens 3000 Pfund besitzen sollte. Heiratsannoncen waren zunächst ein Vorrecht der Männer. Suchanzeigen von Frauen tauchten erst einige Jahrzehnte später auf.
Zur damaligen Zeit stand die materielle Ausstattung in den Anzeigen im Vordergrund, während heute doch eher das äußere Erscheinungsbild und romantische Erwartungen beschrieben werden.
Die erste überlieferte Heiratsanzeige in einer deutschen Zeitung erschien im Juli 1732 in den »Frankfurter Wöchentlichen Frag- und Anzeigungsnachrichten« – hier gab allerdings ein Heiratspaar seine Verehelichung bekannt.
Dass später eine Flut von Heiratsanzeigen erschien, dass Eheanbahnungsinstitute wie Pilze aus dem Boden wuchsen, ist wohl jedem bekannt. Und dass heute der Computer und das Internet für die Partnersuche genutzt werden, ist eine logische Folge der technologischen Entwicklung.
Dass aber ich eines Tages dem Gewerbe einer Heiratsvermittlerin nachgehen würde, wurde mir wahrlich nicht an der Wiege gesungen. Es ist sogar fraglich, ob an meiner Wiege jemals gesungen worden ist, falls ich überhaupt in einer solchen gelegen war. Denn dass ich ein ungeliebtes Kind war, bekam ich schon in sehr jungen Jahren zu spüren.
Umso erstaunlicher ist es, dass ich ausgerechnet einen Beruf ergriffen habe, bei dem sich alles um die Liebe dreht. Ja, bei dem man sozusagen von der Liebe lebt.
Vielleicht bin ich ja, weil ich selbst in puncto Liebe so lange Zeit zu kurz gekommen war, für diese Aufgabe prädestiniert. Wie auch immer, zu diesem Beruf kam ich wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kind.
Heute spricht ja kaum noch jemand von »Heiratsvermittlerin«. In unserem modernen Sprachgebrauch hat sich die Bezeichnung Partnervermittlung eingebürgert. Denn vielen Menschen ist nicht mehr der Trauschein wichtig oder eine Hochzeitsfeier, für sie zählt hauptsächlich die harmonische Zweisamkeit.
Durch Zufall – oder war es Fügung? – machte ich die Bekanntschaft einer Frau, die für ein großes Schweizer Partnervermittlungsinstitut tätig war. Sie fragte mich allen Ernstes, ob ich nicht in die Firma einsteigen wolle.
»Partnervermittlung? Ach du liebe Güte!«, äußerte ich mit einer gewissen Verachtung in der Stimme. Das hätten wohl die meisten an meiner Stelle getan, wenn ein solches Ansinnen an sie herangetragen worden wäre.
Nein, Partnervermittlung wäre wahrscheinlich das Letzte, was ich machen würde. Warum sollte ich in einen Beruf einsteigen, der nur belächelt wird, über den man die Nase rümpft oder gar lauthals schimpft? Nein, nein, das war mir alles zu unsolide, zu dubios.
Als die Dame mir aber aufzeigte, dass Partnervermittlung nicht nur eine spannende Angelegenheit war, sondern man damit auch ganz ordentlich Geld verdienen könne, sah ich die Sache plötzlich ganz anders. Für die Summe, die sie mir – bei entsprechendem Engagement – als möglichen Monatsverdienst nannte, hatte ich bisher lange arbeiten müssen. Nun packte mich doch die Neugier.
»Wie läuft das denn ab? Was müsste ich dafür tun?«, wollte ich wissen.
Es gäbe im Institut einen riesigen Pool, beschrieb sie mir, den so genannten Dienstleistungspool. Dieser gab der Agentur ihren Namen: DLP. In diesem Pool befänden sich die Adressen von zurzeit etwa 16 000 Klienten. Meine Aufgabe wäre keine andere, als dem Pool neue Kundenadressen zuzuführen. Das Institut würde sich um alles Weitere kümmern. Von der Aufnahmegebühr, die jeder angeworbene Mann und jede angeworbene Frau an die DLP zahlen müsse, würde ich 45 % erhalten.
Ich rechnete durch, dass ich bereits mit einer nicht besonders großen Zahl von neuen Klienten einen ordentlichen Monatsverdienst erreichen könnte. Ein angeworbener Mann würde mehr bringen als eine angeworbene Frau, da es im Adressenpool offensichtlich einen Männerüberschuss gab. Männer mussten daher für die Aufnahme in die Kartei mehr bezahlen als Frauen.
Meine Gedanken überschlugen sich: Das konnte doch nicht so schwer sein, jeden Tag mindestens einen neuen Kunden zu gewinnen. Bei zwanzig Arbeitstagen ergab das eine geradezu Schwindel erregende Summe! Nun gut, sicher gab es Tage, an denen nichts lief, außerdem hatte man auch mal Urlaub oder war krank.
Dennoch, das Angebot war so verlockend, dass ich den Vertrag stehenden Fußes unterschrieben hätte. Aber es gab einen Pferdefuß bei der Sache. Dieser bestand in einer so genannten Franchise-Gebühr. Ich hätte sofort mehrere tausend Mark auf den Tisch des Hauses legen müssen. Aber wer hat schon eine solche Summe übrig?
Völlig ernüchtert wollte ich schon Abstand von der Idee nehmen, weil ich sie für unsolide hielt. Das äußerte ich auch. Aber man belehrte mich darüber, dass Franchising heutzutage eine ganz normale und solide Form von Geschäftsbeziehung sei. Der Franchise-Geber – also in diesem Fall die Schweizer Agentur – habe schließlich das Geschäft aufgebaut, investiert und trage ein großes Risiko. Daher sei es nicht mehr als recht und billig, dass ein Franchise-Nehmer zu Beginn der Geschäftsbeziehungen eine Einstandsgebühr zahle. Das bringe ihm schließlich ungeheure Vorteile: Er dürfe dafür den Namen des Gebers verwenden, dessen Markenzeichen und sein Know-how. Wenn es zu Rechtsstreitigkeiten käme, würde der Geber diese für den Nehmer austragen. Dennoch bleibe der Franchise-Nehmer sein eigener Herr, handle auf eigenen Namen und eigene Rechnung.
Das leuchtete mir schon alles ein. Dennoch wollte ich das erst mit Gerd, meinem Mann, besprechen. Dem erschien die Sache gut, er war bereit, die Franchise-Gebühr zu zahlen, und ich unterschrieb den Vertrag.
Mit dieser Unterschrift stürzte ich mich in das große Abenteuer, das da heißt: Partnervermittlung.
Ehe ich mich jedoch an die eigentliche Arbeit machen konnte, musste ich dieses »Handwerk« von der Pike auf erlernen. Natürlich ist Partnervermittlung kein anerkannter Lehrberuf, und es gibt keine Lehre im eigentlichen Sinne. Diese Firma hatte aber ihr eigenes, selbst erarbeitetes Konzept, nach welchem sie motivierte Menschen wie mich in einer Art Schnellkurs auf die zukünftige Aufgabe vorbereitete. Auf die Einzelheiten dieser Schulung werde ich in einem späteren Kapitel zu sprechen kommen.
Zunächst möchte ich Ihnen verraten, was mich auf die Idee gebracht hat, dieses Buch zu schreiben:
Über Partnervermittlungsagenturen wird heute im Allgemeinen geschimpft und gelästert. Aber nicht nur mündlich, sondern vor allem schriftlich. Es gibt eine Menge Publikationen, die an diesen Instituten kein gutes Haar lassen. Diesen will ich mit meinem Buch ein Gegengewicht bieten. Das kann ich mir deshalb erlauben, weil ich lange genug in diesem Gewerbe tätig gewesen bin. Dadurch habe ich erlebt, wie notwendig solche Einrichtungen für Menschen ohne Partner sind. Zwischen den Zeilen werde ich Ihnen einiges über die Geschäftspraktiken der Partnervermittlungen im Allgemeinen und über die meinen im Besonderen verraten. Sie sollen erkennen, was ein gutes Institut von einem schlechten unterscheidet. Denn dass es schwarze Schafe unter den Vermittlungsinstituten gibt, steht außer Frage. Es gibt aber ebenso viele grundsolide und engagierte Vermittler.
Betrüger findet man jedoch nicht nur unter den Vermittlern. Auch unter den Klienten gibt es eine ganze Menge davon. Von solchen werde ich ebenfalls berichten. Kurzum, ich habe die Absicht, Ihnen nicht nur Unterhaltsames und Amüsantes aus meiner Arbeit zu erzählen, sondern Sie auch ein wenig über dieses Gebiet aufzuklären, damit Sie im Falle einer Partnersuche ohne Schaden daraus hervorgehen. Ja, mehr noch, ich möchte erreichen, dass Ihre Suche von Erfolg gekrönt sein wird.
Wie bereits dargelegt, stand ich diesem Gewerbe zunächst sehr skeptisch, ja ablehnend gegenüber. Anfänglich überzeugten mich hauptsächlich die versprochenen Einnahmemöglichkeiten. Inzwischen aber ist es für mich der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann – und das sicher nicht des Geldes wegen.
An selbst erlebten Geschichten werde ich aufzeigen, wie wichtig Partnervermittlung ist, wie schön und beglückend sie sein kann und wie viel Gutes sie bewirkt. Wie das wirkliche Leben enthalten meine Berichte Kurioses und Banales, Heiteres und Ernstes, Ermutigendes und Enttäuschendes, Erfreuliches und Trauriges – sowie jede Menge Überraschendes.
Nora und Heiner
Nachdem ich mich bei der Schweizer Partnerschaftsvermittlung DLP eingekauft und das Wichtigste in groben Zügen erlernt hatte, bekam ich von der Agentur sechs Startadressen. Das heißt, man schickte mir sechs Fragebogen zu. Drei davon waren von männlichen, drei von weiblichen Partnersuchenden ausgefüllt worden. Nun war es an mir, aus diesen spärlichen Angaben zündende Anzeigen für die örtliche Zeitung zu formulieren.
Das ist kein Problem, dachte ich. Das war ja eines der ersten Dinge, die wir in unserer Ausbildung gelernt hatten. Voller Optimismus setzte ich mich an meinen Schreibtisch, kaute eine Zeitlang auf meinem Bleistift herum. Schließlich stand auf meinem Blatt folgendes Ergebnis:
Emil, 57, 180, dunkelhaarig, Hobbys:
Briefmarkensammeln u. Radfahren,
sucht nette Frau passenden Alters mit
ähnlichen Interessen.
Stolz las ich mein Werk durch. Alles Quatsch! Das war nicht zündend. Auf eine solche Annonce würde ich mich nicht melden. Und wenn ich das nicht tat, würden es andere Frauen auch nicht tun. Sinn und Zweck dieser Übung aber war es, dass sich viele, viele meldeten. Nur diese würden meinen finanziellen Einsatz lohnen.
Enttäuscht musste ich erkennen, dass Anzeigen zu entwerfen doch ein Problem war. Von dem bisschen, das wir in der Schulung gelernt hatten, war so gut wie nichts hängen geblieben. Es waren einfach zu viele Informationen in zu kurzer Zeit auf uns hernieder geprasselt. Wie also sah eine zündende Anzeige aus?
Kurz entschlossen erstand ich am nächsten Kiosk eine druckfrische Tageszeitung. Glücklicherweise war es Samstag, und samstags sind Tageszeitungen immer gespickt mit einsamen Menschen, die einen Partner suchen. Also vertiefte ich mich in das Studium dieser Annoncen.
Sehr schnell erkannte ich, dass sie von sehr unterschiedlicher Qualität waren. Nur wenige sprachen mich an. Bei diesen machte ich ein Kreuzchen. Dann wagte ich meinen zweiten dichterischen Versuch. Auf jeden Fall musste ich den Namen ändern. Emil – wer will schon einen Emil?
Den wirklichen Namen des Kunden konnte ich natürlich nicht nehmen. Denn es sollte niemand dahinterkommen, dass er auf Partnersuche war. Also schrieb ich:
Heiner, 57, 180, Witwer, ein Mann für
alle Jahreszeiten, sucht eine Frau für
Frühlingsgefühle, Sommernachtsträume,
Herbststürme und eine winterfeste
Partnerschaft. Gib uns eine Chance und
ruf mich gleich an über …
Als Nächstes machte ich mich über den Fragebogen einer gewissen Lina her. Der Name Lina lockt auch niemanden hinter dem Ofen hervor. Ich verwandelte ihn in Nora – Nora klingt gut, ein bisschen romantisch, ein bisschen geheimnisvoll.
Nora, 57, bei 1,62 m eine schlanke
Erscheinung, aufgeschlossen, zärtlich
u. humorvoll, sucht nach großer
Enttäuschung einen aufrichtigen, zuverlässigen
Partner, den sie liebevoll
umsorgen darf.
Nachdem ich vier weitere – meiner Meinung nach – wohlklingende Annoncen gedichtet hatte, gab ich diese per Fax an ein samstags erscheinendes Wochenblatt auf.
Am Samstag ab 10 Uhr saß ich fiebernd am Telefon. Bis Mittag kamen nur vereinzelte Anrufe herein. Ich war schon ziemlich enttäuscht. Waren meine Anzeigen doch nicht so zündend, wie ich geglaubt hatte? Oder war der Partnerschaftsmarkt doch kein so lukratives Geschäft, wie man mich glauben gemacht hatte?
Nach 14 Uhr aber war der Teufel los. Ein wahrer Ansturm. Ich kam kaum noch mit dem Aufschreiben nach, ganz zu schweigen davon, mich mit den einzelnen Anrufern näher zu beschäftigen.
Erst nach 20 Uhr ließ der Sturm nach. Danach hatte ich endlich Zeit, mein Material zu sichten. Ich bildete auf meinem Schreibtisch sechs Stapel: einen für Heiner, einen für Nora, einen für Hilde, einen für Eberhard, einen für Traudl, einen für Anderl. Den mit Abstand dicksten Stapel hatte Heiner, gefolgt von Nora.
Am Sonntag und Montag gesellten sich noch weitere Anfragen dazu, und ab Montag kamen zudem einige Briefe an.
Meine abschließende Bilanz sah folgendermaßen aus: Auf Heiner hatten sich 58 Frauen gemeldet, auf Nora 41 Männer. Auch für jeden anderen Klienten gab es einige Interessenten, aber nicht annähernd so viele. Hatte ich bei diesen nicht den richtigen Ton getroffen? Oder gehörten gerade Nora und Heiner zu der Altersgruppe, in der es die meisten einsamen Menschen gab?
Wie auch immer, ich war höchst zufrieden mit meinem Erfolg und freute mich auf die ersten Einnahmen.
Meine Aufgabe in den nächsten Tagen würde darin bestehen, mit jedem Einzelnen der Interessenten ein persönliches Gespräch zu führen. Dazu war es äußerst wichtig, die Person in ihrer Wohnung zu besuchen. Dadurch lernte man gleich das Umfeld kennen und konnte überprüfen, ob der Anrufer glaubwürdig war. Außerdem würde er sich in seinen eigenen vier Wänden sicher genug fühlen, um seine Vorstellungen über einen zukünftigen Partner darzulegen.
Dass Männer und Frauen so unterschiedlich »gehandelt« werden, liegt daran, dass in der Regel die Männer diejenigen sind, die das Geld haben. Frauen dagegen, egal, ob verwitwet oder geschieden, sind finanziell meist im Nachteil. Von der Rente ihres Mannes erhalten sie nur 60 Prozent als Witwenrente. Und geschiedene Frauen erhalten häufig nur einen geringen Unterhalt. In der Frauengeneration, die damals überwiegend unsere Klientel bildete, gab es nur wenige Frauen, die sich durch Berufstätigkeit eine eigene Rente verdient hatten. Viele von ihnen gehörten zu den so genannte Trümmerfrauen, die nach dem Krieg den Wiederaufbau geleistet und zudem eine Reihe Kinder großgezogen hatten.
Für die ungleiche finanzielle Behandlung von Seiten der Vermittlungsinstitute gibt es noch einen weiteren wichtigen Grund: Männer sind durchwegs schneller darauf aus, wieder eine Partnerin zu finden. Bei jüngeren Männern bildet häufig Wunsch nach einer Familie die treibende Kraft, bei älteren Männern der Wunsch nach Versorgung.
Frauen dagegen finden in der Regel schwerer den Weg zur Partnervermittlung. Haben sie diesen Schritt aber endlich gewagt, darf man sie nicht durch überhöhte Geldforderungen verprellen. Oft muss man sogar noch zusätzliche Zugeständnisse machen. Doch davon später.
Sorgfältig ging ich meine Unterlagen durch, um die Termine zu koordinieren. Ich wollte sie so legen, dass ich die Interessenten der Reihe nach aufsuchen konnte. Das würde mir Zeit und Spritkosten ersparen.
Bald machte ich eine überraschende Entdeckung: Unter den Damen, die sich auf »Heiner« gemeldet hatten, befand sich auch »Nora«. Natürlich unter ihrem wirklichen Namen. Das war für mich interessant. Nora fuhr also zweigleisig. Ihr genügte es nicht, eine Partnervermittlung für sich arbeiten zu lassen, sie meldete sich auch noch auf Zeitungsanzeigen.
Beim Durchsehen der männlichen Bewerber machte ich eine weitere aufregende Beobachtung: »Heiner« hatte sich doch tatsächlich auf das Inserat von »Nora« gemeldet. Auch er fuhr also zweigleisig, um der Liebe auf die Sprünge zu helfen.
Am liebsten wäre ich auf der Stelle zu den beiden gefahren, um mit ihnen ein Gespräch zu führen und um sie einander vorzustellen.
Aber gerade zu diesen beiden brauchte ich nicht. Das wäre vertane Zeit gewesen; sie »schwammen« ja bereits in dem großen Pool. Es waren so viele andere, dass ich gar nicht wusste, wie ich durchkommen sollte. Ich hatte 120 Adressen abzuarbeiten! Selbst wenn ich auf jede nur eine halbe Stunde verwandte – die Fahrtzeiten dazwischen nicht mitgerechnet –, würde ich 60 Stunden brauchen, um mit allen durchzukommen. Wie sollte ich die in einer Woche unterbringen? Denn nächste Woche gab es wieder neue Inserate, neue Adressen.
So schlimm, wie ich mir das vorgestellt hatte, wurde es dann doch nicht. Ja, es wurde für mich sogar ziemlich enttäuschend. Denn von meinen 120 Interessenten fiel schon fast die Hälfte weg, als ich bei ihnen anrief, um einen Besuchstermin zu vereinbaren. Bei den einen hieß es: »Kein Anschluss unter dieser Nummer.« Andere drehten und wanden sich bei dem Wort Hausbesuch. Die Mühe wollten sie mir ersparen. Ich solle ihnen nur die Telefonnummer des Inserierten überlassen. Um den Rest würden sie sich dann selbst kümmern. Oder sie wollten mich irgendwo sonst treffen – aber auf keinen Fall in den eigenen vier Wänden. Da halfen selbst meine zuckersüßesten Worte nichts. Solche Kunden wurden gleich – wie wir das gelernt hatten – als keinen Erfolg versprechend ausgemustert.
Im Laufe meiner Berufspraxis kam ich dann dahinter, dass von diesen Interessenten nicht wenige in Haftanstalten einsaßen, in einem Heim lebten oder verheiratet waren. Ein Hausbesuch kam da nicht in Frage!
Andere sagten klipp und klar Nein. Den Besuch einer Partnervermittlerin lehnten sie ab. Sie hätten sich nur auf die Anzeige einer bestimmten Person gemeldet, von dieser solle ich ihnen die Adresse oder wenigstens die Telefonnummer geben. Nicht mit mir. Damit hätte ich mich ja um meine Vermittlungsgebühr gebracht.
Auch gut, dachte ich, das erspart mir eine Menge Arbeit. Aus meinem ganzen Fundus blieben nur 62 Adressen übrig. Diese in den nächsten Tagen zu besuchen, war gerade Arbeit genug. Sehr schnell musste ich nämlich erkennen, dass ich das alles viel zu blauäugig eingeschätzt hatte. Mit einer halben Stunde pro Person kam ich bei weitem nicht aus. Ich war froh, wenn ich vier bis fünf Leute am Tag schaffte, und kam danach wie erschlagen nach Hause. Natürlich gab es auch keine freien Wochenenden mehr für mich.
Falls Sie nun glauben, jeder der 62 Besuchten habe einen Vertrag unterschrieben und mir bereitwillig die Aufnahmegebühr bezahlt, so ist das weit gefehlt. Trotz all meiner Beredsamkeit gelang es mir nicht immer, die Bedenken gegen Partnervermittlungsinstitute zu zerstreuen, das Misstrauen zu beseitigen.
Dennoch konnte sich meine Bilanz sehen lassen: Nach zwei Wochen harter Arbeit und nach vielen hundert Kilometern Fahrt hatte ich 22 Verträge in der Tasche.
Gar nicht lustig fand ich es, dass ich alle ausgefüllten Fragebogen meiner Klienten abgeben musste, damit sie in den großen Pool kamen. Das störte mich schon irgendwie. Wie sollte der Computer wissen, wer zu wem passte? Er würde die Menschen nach Alter, Größe, Gewicht und Lieblingsfarbe, vielleicht auch noch nach Beruf und Hobby einander zuteilen. Ein Mensch lässt sich jedoch nicht auf diese wenigern Merkmale reduzieren. Jeder bringt seine Vergangenheit mit, sein Milieu, seine Träume, seine Hoffnungen. Dass diese Gegebenheiten zusammenpassen, ist meines Erachtens für das Gelingen einer Partnerschaft von weit größerer Bedeutung als das Gewicht oder die Haarfarbe.
Es tat mir also wahnsinnig Leid, dass diese Menschen wieder aus meinem Gesichtskreis verschwanden