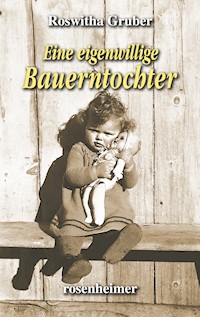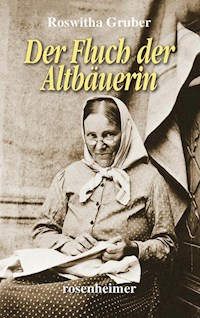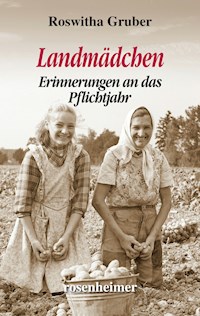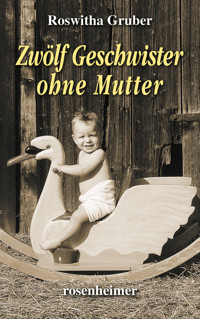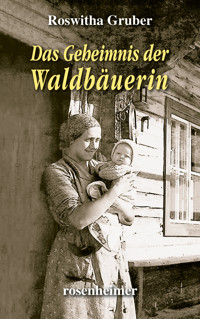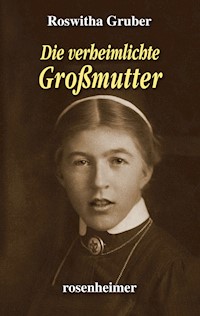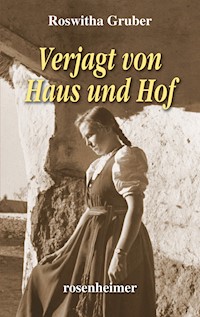16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Für die Familie Edelhofer steht der Hof über allem. Stets kommen er und die Gemeinschaft vor dem Schicksal des Einzelnen. Die Menschen, die auf ihm wohnen, erleben persönliche Tragödien, aber auch viel Freude und Liebe. So erzählt Roswitha Gruber von einem Leben voll Arbeit und Pflicht. Auf faszinierende Weise berichtet sie von schweren Aufgaben und Entscheidungen genauso wie von den schönen Erlebnissen. Dem Leser wird ein berührender Einblick in das Leben einer Familie auf ihrem Einödhof gewährt. Roswitha Gruber widmet sich der Schilderung starker Frauen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Für jeden ihrer Romane nähert sie sich in intensiven Gesprächen dem Schicksal ihrer Protagonistinnen an. Roswitha Gruber lebt und arbeitet in Reit im Winkl.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
LESEPROBE zu
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2015
© 2015 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim
www.rosenheimer.com
Titelbild: © Bundesarchiv, Bild 183-V00023 / Fotograf: Schaaf
Lektorat und Bearbeitung: Christine Weber, Dresden
Worum geht es im Buch?
Roswitha Gruber
Ein Bauernleben
Für die Familie Edelhofer steht der Hof über allem. Stets kommen er und die Gemeinschaft vor dem Schicksal des Einzelnen. Die Menschen, die auf ihm wohnen, erleben persönliche Tragödien, aber auch viel Freude und Liebe. So erzählt Roswitha Gruber von einem Leben voll Arbeit und Pflicht. Auf faszinierende Weise berichtet sie von schweren Aufgaben und Entscheidungen genauso wie von den schönen Erlebnissen. Dem Leser wird ein berührender Einblick in das Leben einer Familie auf ihrem Einödhof gewährt.
Roswitha Gruber widmet sich der Schilderung starker Frauen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Für jeden ihrer Romane nähert sie sich in intensiven Gesprächen dem Schicksal ihrer Protagonistinnen an. Roswitha Gruber lebt und arbeitet in Reit im Winkl.
Inhalt
Die Vorgeschichte
Ottilie erzählt
Das verschenkte Kind
Kinderzeit
Ein Brief mit Folgen
Toni erzählt
Auf dem Hof der Vorväter
Die Schulzeit
Beim Besenbinden
Die Rauferei
Der Pfarrermord
Die Drohung
Mein tüchtiger Onkel
Im Zweiten Weltkrieg
Der Bauer Lenz
Die Hinrichtung
Die Beschuldigung
Der Busfahrer
Dem Tod nahe
Wieder daheim!
Das Leben geht weiter
Meine Schwester Margret
Auf Freiersfüßen
Resi erzählt
Ein langer Weg zum Glück
Toni kommt wieder zu Wort
Im Ehestand
Mein wunderbarer Vater
Ottilie berichtet weiter
Und es wird gut
Toni blickt noch einmal zurück
Auf dem Altenteil
Die Vorgeschichte
An einem Sonntagnachmittag im Mai 2012 beobachtete ich vom Fenster meines »Dichterstübchens« aus, wie sich ein mir unbekanntes Paar auf unser Haus zubewegte. Da wir so abgeschieden wohnen, kommt es äußerst selten vor, dass sich jemand hierher verirrt. Und weil man die Haustürglocke im ersten Stock nicht hört, eilte ich gleich nach unten, um die Tür zu öffnen. Verlegen lächelnd, standen sie davor: ein älteres Ehepaar, das sich als »Herr und Frau Edelhofer« vorstellte.
Nach der Begrüßung hielt er mir eine Plastiktüte entgegen, mit den Worten: »Wir haben da mal ein bisschen aus unserem Leben aufgeschrieben. Vielleicht können Sie ein Buch daraus machen.«
»Das schaue ich mir gern mal an.« Damit bat ich das Ehepaar in meine Küche – den einzigen Raum, der in dieser Jahreszeit um diese Tageszeit beheizt ist. Bevor ich einen Blick in die beschriebenen Seiten warf, stellte ich eine Frage, die ich bisher noch niemandem gestellt hatte, der mir seine Geschichte angeboten hatte: »Warum möchten Sie, dass aus Ihrer Lebensgeschichte ein Buch wird?«
»Als wir aufs Altenteil gingen, habe ich aus Langeweile angefangen, meine Lebensgeschichte aufzuschreiben«, gestand die Frau. »Nun denke ich, dass sie auch für andere interessant sein könnte.«
»Ja«, fügte der Mann hinzu, »und ich kam erst auf die Idee, etwas aufzuschreiben, als unsere Enkel immer wieder Fragen nach der Vergangenheit stellten.« Er hielt einen Moment inne und nahm einen Schluck von dem Wasser, das ich mittlerweile vor sie hingestellt hatte. »Noch bin ich da, um so etwas beantworten zu können. Aber wer weiß, wie lange noch.«
Seine Frau bekräftigte das durch Kopfnicken. »Deshalb möchten wir, dass das alles festgehalten wird. Aber so, wie wir das aufgeschrieben haben, lässt sich das nicht gut lesen.«
»Ich habe noch einen zweiten Grund«, bekannte der Mann. »Ich denke, dass meine Erlebnisse für junge Menschen eine Warnung sein könnten, nie wieder einen Krieg anzufangen.«
Meine Neugier war geweckt. Bevor ich aber einen Blick in die handbeschriebenen Blätter warf, wollte ich wissen: »Wie sind Sie ausgerechnet auf mich gekommen?«
Nun erklärte der Mann, er habe einige von meinen Büchern gelesen, weil ihn die Titel angesprochen hätten. »Die Art, wie Sie schreiben, gefällt mir.«
Mich interessierte noch, woher diese Leute kamen, denn ihrer Sprache nach stammten sie nicht aus Reit im Winkl. In einem kleinen Ort im Landkreis Mühldorf seien sie zu Hause.
»Das liegt ja nicht gerade um die Ecke«, stellte ich fest. »Warum haben Sie extra den weiten Weg bis hierher gemacht? Das Manuskript hätten Sie doch auch mit der Post schicken können.«
»Das stimmt. Aber wir weilen gerade zur Kur in Bad Reichenhall. Von da ist es ja nur ein Katzensprung. Außerdem wollte ich Sie kennenlernen«, er lächelte verlegen.
Ich blätterte in den dicht beschriebenen Seiten, um mir einen ersten Eindruck zu verschaffen. Die alten Leutchen saßen schweigend dabei.
»Da gibt es aber viele Lücken in Ihrer Geschichte«, wandte ich mich endlich an die beiden. »Deshalb werde ich Ihnen, noch bevor ich mit dem Schreiben beginne, viele Fragen stellen müssen.«
»Das ist kein Problem. Sie können uns gerne für ein paar Tage auf unserem Einödhof besuchen. Dann werden wir alles beantworten«, bot er mir an.
»Das wird nicht nötig sein, das lässt sich sicherlich alles telefonisch regeln«, wehrte ich ab. »Möglicherweise komme ich aber doch auf Ihr Angebot zurück.«
Ein Jahr später saß ich mit meinem Mann wirklich in der Stube des alten Einödhofes, und das alte Ehepaar beantwortete mir alles, was ich wissen wollte.
Einige ihrer Enkelinnen waren rührend um uns bemüht. Sie sorgten für Speise und Trank und bezogen im Gästezimmer die Betten für uns. Auf dem Nachttisch fanden wir ein von ungelenker Kinderhand geschriebenes »Programm« für den folgenden Tag. Darauf war unter anderem vermerkt, wann und wo das Frühstück einzunehmen sei. Am nächsten Morgen nahmen wir ein üppiges Frühstück ein: Noch bevor sie zur Schule aufgebrochen waren, hatten die Mädchen alles liebevoll auf dem Küchentisch aufgebaut.
Nach dem Frühstück ging das Frage- und Antwortspiel mit »Oma und Opa« weiter.
Auf einige Fragen aber mussten mir die beiden die Antworten schuldig bleiben, was ihnen sichtlich leidtat, und mir natürlich auch. Plötzlich hatte Toni – mittlerweile waren wir längst per Du, weil sich dabei solch familieninterne Dinge besser besprechen lassen – eine Idee: »Du solltest zu meiner ältesten Schwester gehen, die weiß gewiss einiges mehr als ich.«
»Wie alt ist deine Schwester?«, fragte ich verblüfft, denn Anton selbst war bereits achtundachtzig.
»Die Ottilie ist dreiundneunzig.«
»Und du meinst, die kann mir noch was erzählen?« Er nickte. »Dann sollte ich heute noch zu ihr hin«, war meine spontane Reaktion, »wo ich schon mal in der Gegend bin.«
Toni rief sogleich bei ihr an, um unseren Besuch anzukündigen.
Wenig später schon waren wir auf der Suche nach ihrem Einödhof. Dieser lag so versteckt, dass wir trotz Tonis genauer Beschreibung Mühe hatten, ihn zu finden. Nachdem wir an die Tür geklopft hatten, wunderte ich mich, dass sich kurz darauf im Haus tatsächlich etwas regte. Eine hübsche junge Frau öffnete. Es stellte sich heraus, dass sie eine Enkelin der alten Dame war und das Anwesen mit ihrem Mann übernommen hatte. Sie führte uns in die Stube, deren Einrichtung urgemütlich war. Neben dem dunkelgrünen Kachelofen saß Ottilie in ihrem wuchtigen Ohrensessel, wie ich mir immer die Großmutter aus den Märchen vorgestellt hatte. Wir machten es uns auf dem altertümlichen Sofa bequem, und ich begann, meine Fragen zu stellen.
Ich war überrascht, dass mir die alte Dame noch all das aus ihrer Kindheit berichten konnte, was ihr Bruder – da er ja einige Jahre jünger war als sie – nicht mitbekommen oder gar schon vergessen hatte.
Ein Jahr nach diesen Besuchen, als es endlich ans Schreiben ging, rief ich Toni und seine Frau Resi sowie seine Schwester Ottilie immer wieder mal an, weil mir noch wichtige Einzelheiten fehlten. Was dabei herausgekommen ist, lege ich Ihnen mit diesem Buch vor.
Zunächst lasse ich Ottilie von ihrer Kindheit auf dem Einödhof erzählen, danach kommen auch Toni und seine Frau Resi zu Wort.
Viel Freude beim Lesen wünscht IhnenRoswitha Gruber
Ottilie erzählt
Das verschenkte Kind
Meine Eltern, Therese und Josef, haben im Januar 1920 geheiratet, und nach schicklichen zehn Monaten kam ich auf die Welt. Wenn ich den Aussagen meiner Mutter glauben darf, waren beide nach meiner Geburt ein wenig enttäuscht, weil ich kein Bub geworden war. Die Mutter war vielleicht noch ein bisschen mehr enttäuscht als mein Vater. Er muss nämlich versucht haben, sie zu trösten: »Mach dir nichts draus, Therese«, soll er gesagt haben, »der Bub kommt schon noch. Schau, das Kindermädchen ist schon mal da für den Rest der Kinder, die noch kommen wollen.«
Im Oktober des folgenden Jahres lag schon wieder ein Mädchen in der Wiege. Verständlicherweise war der Vater darüber traurig, die Mutter aber wesentlich mehr als er. Sie hatte so sehr mit einem Buben gerechnet, dass sie sich gar keinen Mädchennamen überlegt hatte. Weil aber die Hebamme drängte, sagte sie schließlich: »Nimmst halt meinen Namen, weil es eh wurscht is.« Das hat sie mir später erzählt.
Das Mädel wurde dann Resi gerufen, und die Mutter ließ das arme Kind ziemlich links liegen. Ihre Laune hob sich erst wieder, als am 23. April 1923 endlich der ersehnte Stammhalter in der alten Familienwiege lag. Selbstverständlich bekam er den Namen Josef, nach seinem Vater. Dessen Vater hatte schon Josef geheißen. Davor hatte es eine Reihe von Antons gegeben und davor eine Reihe von Hoferben mit dem Namen Hans, wie man aus unserer Familienchronik ersehen kann. Dass der Vorname des Hofbesitzers von Zeit zu Zeit wechselte, lag daran, dass nicht immer der Erstgeborene seinem Vater auf den Hof folgte. Wenn eine Krankheit oder der Krieg ihn hinweggerafft hatte, kam der Zweit- oder gar der Drittgeborene zum Zug. Aber immer in all den Jahrhunderten, soweit Aufzeichnungen vorhanden sind, hat es auf dem Edelhof einen männlichen Edelhofer gegeben.
Zurück aber zu meinem kleinen Bruder Josef. Damit man ihn nicht mit dem Vater verwechseln konnte, war sein Rufname bald Sepp. An seine Ankunft in unserer Familie kann ich mich verständlicherweise nicht erinnern, zu der Zeit war ich selbst ja erst zweieinhalb Jahre alt. Als aber knapp zwei Jahre darauf, am 22. Februar 1925, meinen Eltern ein weiterer Sohn geschenkt wurde, ist mir das lebhaft im Gedächtnis geblieben. Ich erinnere mich noch an die strahlenden Gesichter meiner Eltern, als mein Vater die kleine Resi und mich an die Wiege führte, mit den stolzen Worten: »Da schaut, Dirndln, das ist unser zweiter Bub.«
Da der Name des Vaters bereits vergeben war, wurde der Kleine Anton genannt, nach dem jüngeren Bruder meines Vaters, der auch sein Taufpate wurde. Alle riefen den Buben nur Toni.
Was mir aber noch wesentlich deutlicher in Erinnerung blieb, ist das, was etwa ein Dreivierteljahr später geschah. Es muss ein Samstagabend Anfang November gewesen sein. Mutter und Großmutter hatten noch in der Küche zu tun, während wir Kinder schon alle in unseren Betten lagen. Plötzlich vermisste ich meine Lumpenpuppe. Die musste ich draußen beim Spielen – es war ein sonniger Herbsttag gewesen – liegen gelassen haben, als wir zum Nachtessen gerufen worden waren. Also schlich ich mich leise nach unten, öffnete vorsichtig die Haustür und fand meine Puppe tatsächlich auf der Hausbank, die vor dem Küchenfenster stand, sodass der matte Lichtschein von der Petroleumlampe auf sie fiel. Glücklich klemmte ich sie mir unter den Arm und wollte genauso unbemerkt wieder in mein Bett schleichen. Doch in dem Moment, als ich an der Küchentür vorbeikam, die nur angelehnt war, vernahm ich die besorgte Stimme meiner Großmutter: »Und du willst das Kind wirklich deiner Schwester Anna schenken?«
»Warum nicht?«, antwortete die Mutter ungerührt. »Ich hab schon vier Kinder, und es können leicht noch ein paar dazukommen. Bei meiner Schwester aber ist der Zug abgefahren.«
Mehr bekam ich nicht mit, denn ich hörte, dass sich Schritte der Tür näherten. Also huschte ich, so schnell ich konnte, die Treppe hinauf. Im Bett dachte ich dann noch lange über das Gehörte nach. Die Mutter wollte also ein Kind verschenken? Welches? Einen der Buben bestimmt nicht. Dazu hing sie viel zu sehr an ihnen. Also kam nur eine von uns beiden Dirndln infrage. Meinte sie etwa mich? Warum wollte sie das tun? Und welcher Zug war abgefahren?
Ich kannte Mutters Schwester, die Anna, mochte sie jedoch nicht besonders gern, weil sie nicht sehr nett war. Sie war erst kürzlich bei uns gewesen mit ihrem kleinen Buben, dem Otto. Er war etwas über ein Jahr alt, eigentlich ein herziges Kerlchen. Sollte ich für den etwa die Kindsmagd machen? Wer aber machte dann die Kindsmagd bei meinen beiden Brüdern? Ob sich die Mutter dann die Resi dazu abrichten würde?
Am anderen Morgen wachte ich munter auf und dachte, das alles sei nur ein böser Traum gewesen.
Doch nach dem Mittagessen putzte meine Mutter die Resi fein heraus – was man damals halt unter »fein« verstand. Meine Schwester bekam ihr Sonntagsgewand an und sogar Schuhe. Das fand ich sonderbar, denn im Sommer liefen wir Kinder normalerweise barfuß herum und im Winter auf Strümpfen. Noch sonderbarer fand ich es, dass die Mutter Resis Werktagsgewand, ein bisschen Unterwäsche, Wollsocken und Wollstrümpfe in ein großes rot kariertes Tuch packte. Als sie dann der Großmutter zurief: »Du kannst das Wagerl holen, die Resi ist fertig«, überkam mich eine Art Panik. Ich stürzte mich auf meine Schwester, die sich völlig arglos von meiner Mutter hatte zur Haustür führen lassen, und umklammerte sie mit beiden Armen.
Da nahte die Großmutter auch schon mit dem Wagen, der auf den dicken hellen Kieselsteinen, mit denen der Hof gepflastert war, ganz schön bollerte. Die Mutter legte eine Decke hinein und forderte die Resi auf, einzusteigen. Das ließ sich die nicht zweimal sagen, denn ein Ausflug mit der Großmutter, noch dazu im Wagerl, schien doch sehr verlockend. Ich aber wollte sie nicht loslassen, weinte herzzerreißend und flüsterte ihr zu: »Nicht einsteigen! Bleib hier!«
Da riss die Mutter mich gewaltsam los und herrschte mich an: »Bist du narrisch geworden, was ist nur mit dir los? Vergönnst du deiner Schwester den kleinen Ausflug nicht? Ein andermal wirst schon du an die Reihe kommen.«
Nein, nein, schrie es in meinem Innern, ich will nicht auch noch verschenkt werden! In meiner Hilflosigkeit weinte ich weiter. Auf die Fragen meiner Mutter konnte ich doch keine Antworten geben, damit hätte ich mich ja verraten. Dann hätte sie gewusst, dass ich am Vorabend gelauscht hatte. Und Lauschen war uns von klein auf als etwas äußerst Verwerfliches hingestellt worden.
Den ganzen Tag über konnte ich nicht mehr froh werden. Während ich in der Küche auf meine beiden kleinen Brüder aufpassen musste, lief ich immer wieder zum Fenster, um zu schauen, ob die Großmutter nicht bald zurückkäme. Noch immer hegte ich die stille Hoffnung, dass ich mich vielleicht doch geirrt hatte und die Großmutter meine Schwester wohlbehalten zu uns zurückbrächte.
Nach Stunden endlich sah ich sie in den Hof einbiegen. Müde zog sie den leeren Handwagen hinter sich her. Da quollen mir erneut die Tränen aus den Augen. Als Großmutter mich weinen sah, tätschelte sie mir hilflos die Wange. Die Mutter aber sagte: »Lass sie nur. In ein paar Tagen wird sie es vergessen haben.«
Um der Mutter und mir eine weitere Szene zu ersparen, zog ich mich noch vor dem Nachtessen in mein Bett zurück. Mit meiner Schlumpelpuppe im Arm weinte ich mich in den Schlaf.
Am nächsten Morgen gähnte mich als Erstes Resis leeres Bett an, und ich hatte ein Gefühl in der Brust, als lagere dort ein schwerer Klumpen. Aber nicht nur mein Kummer war es, der mich bedrückte, sondern vor allem auch die Sorge um meine arme Schwester. Wie musste sie sich fühlen? Wie würde es ihr dort ergehen – wehrlos der Tante, dem Onkel, dem fremden Hof ausgeliefert?
In den folgenden Tagen erledigte ich schweigend meine kleinen Pflichten, stets bemüht, meiner Mutter so wenig wie möglich unter die Augen zu treten. Mir war klar, dass ich auf meine Fragen keine wahrheitsgemäßen Antworten erwarten konnte. Wenn ich etwas über das Schicksal meiner Schwester erfahren wollte, musste ich Geduld haben. Irgendwann, wenn ich mal mit der Großmutter allein war, wollte ich sie fragen. Sie war eine liebe Frau. Mit ihr konnte man nämlich reden. Sie fuhr einem nicht gleich über den Mund, wenn man ihn mal aufmachte. Sie war es auch, die mir von ihrem Mann, meinem Großvater, erzählt hatte. Dieser muss ein schöner und tüchtiger Mann gewesen sein, denn wenn sie von ihm sprach, geriet sie immer ins Schwärmen. Er war bereits ein Jahr vor meiner Geburt gestorben. Allein dieser Tatsache war es zu verdanken, dass meine Eltern endlich hatten heiraten können. Da mein Großvater sich damals nicht dazu durchringen konnte, seinen Hof zu Lebzeiten zu übergeben, wurde mein Vater erst nach dessen Tod Bauer auf dem Edelhof. Erst dann war er in der Lage, eine Familie zu gründen.
Rückblickend kann ich nicht verstehen, wie es meine Mutter fertigbrachte, einfach ein Kind wegzugeben, wo sie doch so furchtbar fromm war? Nicht nur, dass sie jeden Morgen in die Kirche eilte und uns Kinder am Sonntag mitzerrte, sobald wir in der Lage waren, die etwa zweieinhalb Kilometer zu marschieren – nein, es wurde auch jeden Tag der Rosenkranz gebetet. Nach dem Frühstück ein Gesetz, nach dem Mittagsmahl zwei Gesetze und nach dem Nachtessen ebenfalls zwei. Am Sonntagabend wurden sogar ein ganzer Rosenkranz gebetet und anschließend noch eine Litanei. Außerdem hatte sie zu dem Zeitpunkt, als sie die Resi verschenkte, doch erst vier Kinder. Nun gut, sie konnte ja nicht ahnen, dass noch eine ganze Menge folgen würde.
Wie auch immer, es sollten noch einige Wochen ins Land gehen, bis sich endlich eine Gelegenheit ergab, dass ich mit der Großmutter allein reden konnte. Es war am Heiligen Abend, die Stunde der Bescherung war vorüber. Selig hielt ich meine Schlumpelpuppe im Arm, die einige Tage zuvor verschwunden gewesen war und die ich – o Wunder – mit einem neuen Gewand unter dem Christbaum wiedergefunden hatte. Die Großmutter saß in ihrem Lehnstuhl und las eifrig in der Bibel, während meine Eltern, in ihr Festtagsgewand gekleidet, auf dem Sofa saßen.
Auf einmal erhoben sie sich, und die Mutter sagte: »So, Ottilie, ab ins Bett. Wir gehen jetzt in die Christmette.« Zur Großmutter gewandt, fügte sie hinzu: »Du wirst ja auch nicht mehr allzu lange aufbleiben. Achte darauf, dass alle Lichter aus sind.« Im Sommer hatten wir nämlich elektrischen Strom bekommen; das war eine feine Sache.
Folgsam erhob ich mich, wünschte allen artig eine gute Nacht und verzog mich nach oben. Ich kleidete mich aber nicht aus. In voller Montur legte ich mich ins Bett und lauschte. Als ich endlich die Haustür ins Schloss fallen hörte, sprang ich aus dem Bett und eilte – tapp, tapp – wieder nach unten. Ich hatte Glück: Die Großmutter studierte immer noch eifrig in der alten Familienbibel.
Sie hob den Kopf. »Ja, Ottilie, was ist denn mit dir los? Kannst nicht schlafen?«
»Ich muss mit dir reden.«
»Na, dann komm her.« Sie begab sich aufs Sofa, zog mich ganz dicht neben sich und legte einen Arm um mich. »So, Dirndl, was hast denn auf dem Herzen?«
Dieser freundlich gesprochene Satz ermunterte mich noch mehr, ihr endlich die Frage zu stellen, die mir schon seit Wochen auf der Seele brannte. »Warum hast du die Resi weggebracht?«
Diese unerwartete Frage schien ihr die Sprache zu verschlagen. Wie in Abwehr schlug sie sich beide Hände vor den Mund und schaute mich mit großen Augen an. Es dauerte einige Sekunden, bis sie sich wieder gefasst hatte. »Mei, Dirndl, dass du dich daran noch erinnerst? Deine Mutter denkt, das hättest du längst vergessen.«
»Wie soll ich das vergessen? Immer, wenn ich aufwache oder schlafen gehe, starrt mich das leere Bett an.«
»Du hast aber nie mehr nach deiner Schwester gefragt.«
»Warum sollte ich? Statt mir die Wahrheit zu sagen, hätte die Mutter doch nur mit mir geschimpft. Ach, Großmutter, ohne die Resi fühle ich mich so allein.«
»Ja, Dirndl, auch mir geht sie ab«, seufzte die alte Frau. »Aber du hast ja noch deine beiden kleinen Brüder.«
»Die können ja noch nicht sprechen. Mit der Resi aber konnte ich über alles reden.«
Irgendwie müssen meine Worte die Großmutter gerührt haben, denn plötzlich legte sie den Arm noch fester um mich, drückte mich an sich und flüsterte mit verschwörerischer Stimme: »Dirndl, ich werde dir alles erzählen. Aber du musst mir versprechen, dass du deiner Mutter kein Wörtl davon verrätst.«
Dieses Versprechen konnte ich der Großmutter leicht geben. Denn mit meiner Mutter redete ich kaum noch etwas, und über dieses Thema schon grad gar nicht. So erfuhr ich dann Folgendes: Tante Anna war um zehn Jahre älter als meine Mutter. Sie war erst ziemlich spät zum Heiraten gekommen und hatte nacheinander zwei Dirndln gekriegt. Die wären jetzt ebenso alt wie meine Schwester und ich, betonte die Großmutter. Innerhalb von einer Woche waren beide an Diphtherie gestorben. Das sei für meine Tante ein herber Schlag gewesen. Es grenze an ein Wunder, so drückte sich die Großmutter aus, dass die Anna überhaupt noch mal ein Kind bekommen hätte, den kleinen Otto. Der sei mittlerweile anderthalb Jahre alt.
»Darüber sollte sie doch sehr glücklich sein«, warf ich ein, weil ich wusste, wie viel unsere Buben meinen Eltern galten.
»Ja, schon. Sie hätte aber auch gern ein Dirndl gehabt«, erklärte mir die Großmutter. »Und weil deine Mutter Mitleid mit ihr hatte, hat sie ihr halt die Resi geschenkt.«
Das schien mir äußerst voreilig gehandelt zu sein, wie ich auch der Großmutter erklärte. Ich fügte hinzu: »Bei der Tante Anna kann doch auch noch ein Dirndl kommen.«
Wieder seufzte die alte Frau: »Nein, nein, der Zug ist endgültig abgefahren.«
Schon wieder war die Rede von diesem Zug, unter dem ich mir nichts vorstellen konnte. Mir fehlte aber der Mut, danach zu fragen, aus Angst, ich könne damit verraten, dass ich an der Küchentüre gelauscht hatte. Aber ehe mir eine andere, eine unverfängliche Frage einfiel, fuhr die Großmutter fort: »Außerdem, wenn sie jetzt ein kleines Dirndl bekäme, mit dem könnte sie nichts anfangen. Sie braucht doch eine Kindsmagd für den kleinen Buben. Dazu ist die Resi gerade im rechten Alter.«
Da waren wir wieder bei meinem eigentlichen Thema. »Ja, die Resi, was hat sie gesagt, als du sie einfach bei der Tante gelassen hast?«
»Anfangs hat sie ganz vergnügt mit ihrem kleinen Cousin gespielt, sodass wir beide dachten: Das passt schon. Nur …« Die Großmutter stockte, und mir war in dem Moment, als ob mir ein dicker Knödel im Hals stecke. Trotzdem rang ich mir eine Frage ab: »Was nur?«
»Als ich gehen wollte …« Der alten Frau fiel das Sprechen sichtlich schwer. Wahrscheinlich hatte sie ebenfalls einen Knödel im Hals.
Doch ich bohrte weiter: »Ich will es wissen, Großmutter, was war, als du gehen wolltest?«
»Ich wollte mich davonschleichen, damit die Resi nichts merkte. Aber sie muss was gespannt haben. An der Tür holte sie mich ein, packte mich bei der Hand und rief: ›Großmutter, nimm mich mit!‹ Statt meiner antwortete die Tante: ›Kind, das geht nicht, du bleibst jetzt hier. Du bist jetzt unser Kind. Du hast doch so schön mit dem Otto gespielt. Schau nur, wie traurig er ist, weil du wieder wegwillst.‹ Die Resi aber war nicht auf den Mund gefallen. ›Schau nur, wie traurig ich bin, wenn ich hierbleiben muss‹, bettelte sie weiter.« Trotz der traurigen Situation huschte der Großmutter ein Lächeln über die runzligen Züge.
»Wie ging es weiter?«, blieb ich beharrlich.
»Du weißt doch, dass ich ohne deine Schwester heimgekommen bin«, wich die Großmutter aus.
»Freilich weiß ich das. Jetzt will ich aber wissen, was die Resi gemacht hat, als du wirklich gegangen bist.«
»Diese Szene will ich dir lieber ersparen, Dirndl, um dich nicht traurig zu machen.«
»Wenn du es mir nicht sagst, bin ich noch viel trauriger«, erklärte ich ihr. »Ich stelle es mir nämlich sehr schlimm vor.«
Die Großmutter seufzte: »In Gottes Namen denn. Weil du gar keine Ruh gibst, will ich es dir sagen. Mit beiden Händen klammerte sich die Resi an meine Hand. Sie plärrte und schrie: ›Ich will mit! Großmutter, nimm mich mit, ich will nicht hierbleiben!‹ Da versuchte die Tante, das Kind mit einem Stück Schokolade von mir wegzulocken. ›Schau, Reserl, was ich hab! Ein Stück Schokolade für dich‹, sagte sie. ›Ich will keine Schokolade‹, rief das Dirndl verzweifelt. ›Ich will heim! Ich will zu meiner Mutter!‹ Daraufhin die Tante: ›Was willst denn bei der? Die hat dich doch hergeschenkt. Die will dich nicht mehr haben. Sei froh, dass du bei uns sein kannst. Du bist jetzt unser Kind und sollst es bei uns gut haben.‹ Sie näherte sich nun mit einer ganzen Rippe Schokolade. ›Schau, Dirndl, Schokolade! Eine ganze Rippe für dich allein.‹
Trotzig stampfte die Resi mit dem Fuß auf, schlug in Richtung Schokolade und rief: ›Geh weg mit deiner Rippe! Ich will heim! Ich will in mein Bett! Ich will zu meiner Ottilie!‹ Vor Schreck ließ die Anna die Schokolade fallen, packte das Kind mit beiden Händen und riss es von mir los. Ich aber verließ fluchtartig das Haus, nahm mein Wagerl und hastete davon. Nur weg, dachte ich, damit du die Klageschreie der Kleinen nicht mehr länger hören musst.« Als die Großmutter bis zu diesem Punkt gekommen war, versagte ihr die Stimme.
Ich selbst war auch nicht in der Lage, noch mehr zu hören. Hilfe suchend warf ich mich der alten Frau in die Arme und ließ meinen Tränen freien Lauf. Auch sie konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. Staunend nahm ich zur Kenntnis, dass auch erwachsene Menschen weinen können.
Für diesen Abend beendeten wir das Gespräch. Wir waren wohl beide ziemlich aufgewühlt, als wir zu Bett gingen. Trotzdem schlief ich bald ein.
Es mochte vielleicht ein halbes Jahr vergangen sein, da ergab es sich wieder einmal, dass ich mit der Großmutter unter vier Augen reden konnte. Seit Langem beschäftigte mich folgende Frage: »Warum hast du die Resi nicht einfach wieder mitgenommen, als sie gar so geplärrt hat?«
»Ja, Dirndl, denkst du denn immer noch an diese Geschichte?«, staunte sie.
»Großmutter, glaub mir, die werde ich, solange ich lebe, nicht vergessen.«
»Ja, Ottilie, mein erster Gedanke war auch: Nimm sie halt wieder mit. Im selben Moment aber dachte ich: Das wird nichts nützen. Deine Mutter ist die Bäuerin, sie hat das Sagen auf dem Hof und in der Familie. Wenn die sich was in den Kopf gesetzt hat, muss es genau danach gehen. Am Vortag hatte ich schon versucht, es ihr auszureden. Damit war ich nicht weit gekommen.
Stell dir vor, ich hätte das Reserl wieder heimgebracht – was meinst, was ich da zu hören gekriegt hätte? Das hätte ich ja noch in Kauf genommen. Aber das arme Dirndl! Die Mutter hätte es am nächsten Tag doch eigenhändig zum Hof ihrer Schwester zurückgebracht. Dann wäre der Schock für das Kind noch größer geworden. So hatte sie den Schmerz einmal hinter sich. Ich dachte, sie ist ja erst vier; sie wird sich in der neuen Heimat eingewöhnen und bald vergessen haben, woher sie eigentlich kommt.«
Mit dieser Erklärung war ich vorerst zufrieden.
Da ich den Eindruck hatte, dass es der Großmutter nicht unangenehm war, mit mir über dieses Thema zu reden, schnitt ich es in der Folgezeit immer wieder an, wenn ich mit ihr allein war. Heute vermute ich, dass es ihr sogar ausgesprochen guttat, sich das alles von der Seele zu reden. Sie hatte ja sonst niemanden, mit dem sie darüber sprechen konnte. Mit der Zeit kamen mir immer neue Fragen in den Sinn.
»Könnten wir die Resi nicht mal heimlich besuchen?«, schlug ich vor.
»Um Gottes willen, nein! Damit würden wir sie doch nur an den schmerzlichen Verlust von Familie und Heimat erinnern. Lass sie in Frieden.«
»Aber Großmutter, ich hab die Resi doch so gern. Und hier«, dabei deutete ich auf meine Herzgegend, »tut es so weh, wenn ich an sie denke und sie nicht sehen darf.«
»Ach, Kind, der Schmerz verliert sich auch einmal. Die Zeit heilt alle Wunden. Vielleicht kriegst du ja mal eine neue Schwester. Die wirst du dann auch bald gernhaben.«
»Aber die ist dann noch so klein, mit der kann ich nichts anfangen, und reden kann ich auch nicht mit ihr.«
Es dauerte einige Jahre, bis ich mir Gedanken darüber machte, welche Rolle eigentlich mein Vater bei der »Verschenkungsaktion« gespielt hatte. War er überrumpelt worden? Hatte er die Aktion gebilligt, oder war sie gar mit seinem Einverständnis geschehen?
Endlich bildete sich in mir die Überzeugung, dass er es vielleicht gar nicht bemerkt hatte, dass eine seiner Töchter fehlte. Denn er hatte ja nur Augen und Ohren für seine Buben, wie ich immer wieder beobachten konnte. Ich habe ihn nie danach gefragt. Und als ich seine Mutter, also meine Großmutter, danach hätte fragen mögen, war es zu spät. So unauffällig und still, wie sie gelebt hatte, war sie eines Nachts gestorben. Das war im Jahre 1929; ich war gerade mal neun Jahre alt. Wahrscheinlich war ich die Einzige, die wirklich um sie getrauert hat. Für mich war ihr Tod ein herber Verlust. Meine kleinen Geschwister bekamen es vielleicht noch nicht einmal mit, dass sie nicht mehr da war. Meinen Eltern ging sie vermutlich nicht sehr ab, weil sie schon seit zwei Jahren nichts mehr hatte arbeiten können.
Kinderzeit
Das Haus, in dem wir wohnten, so hatte es mir meine Großmutter erzählt, war im Jahre 1867 von meinem Urgroßvater erbaut worden, also vom Großvater meines Vaters. Er hatte damit den Vorgängerbau ersetzt, der noch ganz aus Holz konstruiert worden war. Das alte Haus sei nicht mehr bewohnbar gewesen, so hatte man es ihr erzählt. Das Fundament hätte sich an einer Seite gesenkt, der Wind pfiff durch alle Ritzen, und durch das Schindeldach habe es an mehreren Stellen hereingeregnet. Das »neue« war nun ein recht solides Haus. Es hatte ein stabiles Fundament und war von unten bis oben aus Bruchsteinen gemauert. Darauf hatte man kräftige Balken gesetzt und diese mit handgefertigten Dachziegeln gedeckt. Wenn man durch die schön geschnitzte Eichentür eintrat, befand man sich in dem Gewölbehausgang. Der hatte die stattliche Breite von 3,40 Metern. Am Ende des Ganges befand sich wieder eine Tür, die war natürlich nicht so prächtig wie am Eingang. Durch diese Tür gelangte man in den Wirtschaftshof. Rechterhand befand sich die Küche, die ebenfalls mit einer Gewölbedecke abgeschlossen war. An die Küche schloss sich die Stube an, die eine Holzbalkendecke hatte, die angeblich mit Ochsenblut gestrichen war. Von der Stube führte eine Tür direkt in den Pferdestall. So war das bei allen Bauernhäusern; man lebte sehr dicht mit seinen treuen Arbeitstieren zusammen.
Wahrscheinlich, so vermute ich heute, hat man den Rossstall gleich an die Stube angeschlossen, damit es die wertvollen Pferde im Winter nicht so kalt hatten. Andererseits wurde es auch in der Stube nie zu kalt, weil ja der Rossstall den Wind abhielt. Die Altvordern wussten wirklich, wie man energiesparend baut. Da könnten sich die heutigen Architekten eine Scheibe abschneiden.
Über dem breiten Küchenherd, in dessen beiden Wasserschiffen stets warmes Wasser zur Verfügung stand, befand sich der große Rauchfang. Darin hatten viele Schinken, Würste und Speckseiten Platz. Die Wohnstube wurde von einem mächtigen Kachelofen beheizt, der von der Küche aus beschickt wurde. Einige Jahre war es meine Aufgabe gewesen, immer dafür zu sorgen, dass genügend Holz rechts von dem Feuerloch aufgeschichtet war; auf der linken Seite stand eine Kiste mit Anmachholz und Papier. Das Wasser holten wir im Hof aus einem Brunnen. Aber noch ehe ich alt genug war, um Wasser tragen zu müssen, gab es bei uns eine umwälzende Neuerung. Im Sommer des Jahres 1925 verlegte man vom Brunnen aus eine Leitung bis zum Spülbecken in der Küche. Es wurde ein Wasserhahn angebracht, aus dem man jederzeit frisches Wasser zapfen konnte. Das war eine enorme Erleichterung für die ganze Familie. Im Herbst gab es eine weitere umwälzende Neuerung: Wir bekamen elektrisches Licht. Vorbei war es mit Kerzen und Petroleumlampen, die immer eine Brandgefahr bedeutet hatten. Und zudem war es viel heller.
In meiner frühen Kindheit gab es zum Frühstück entweder eine Milchsuppe oder eine Rührmillisuppe. Erstere bestand nur aus heißer Milch, in die man Graubrot einbrockte. Eine Rührmillisuppe dagegen machte wesentlich mehr Arbeit. Zu gleichen Teilen Milch und Buttermilch wurden miteinander aufgekocht und dann mit Mehl angedickt. Diese Suppe war bei uns sehr beliebt. Weil sie einen größeren Arbeitsaufwand erforderte, stellte man davon immer gleich eine größere Menge her. Sie ließ sich nämlich in der kühlen Speisekammer, Speis genannt, gut mehrere Tage aufheben.
Beliebt war natürlich auch saure Milch, die man anderswo Dickmilch nennt. Mit etwas Zucker bestreut, löffelte man sie sonntags aus kleinen Schüsseln als Nachtisch. Die anderen Milchspeisen dagegen wurden in einer großen Schüssel in die Mitte des Tisches gestellt, und dann löffelten alle daraus: Vater, Mutter, Großmutter und die Kinder ab einem gewissen Alter – ja, auch Knechte und Mägde, von denen man in meiner Kindheit noch mehrere hatte. Da hieß es sich beeilen, sonst bekam man zu wenig ab.
War die Schüssel leer, wischte jeder seinen Löffel an dem leinenen Tischtuch ab und legte ihn in die Tischschublade unter seinem Essplatz. Es gab also anschließend nicht viel abzuspülen. Nur die Schüssel war auszuschwenken.
Diese Art von Frühstück wurde beibehalten bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Krieg löffelten sogar die Kriegsgefangenen, die man uns zwangsweise als Arbeitskräfte zugewiesen hatte, mit uns aus einer Schüssel. Auch mittags aß man vor dem Krieg gemeinsam aus einem Topf. Da es meist eine Suppe gab, reichte dazu auch der Löffel. Das Tischtuch wurde jede Woche gewaschen. Das war’s dann. Nach Kriegsende kam erst die Mode auf, dass man zum Frühstück Brotscheiben mit Butter und Marmelade aß und dazu Kaffee trank.
In einer solchen Tisch- und Arbeitsgemeinschaft war eine Haus- und Hofordnung dringend nötig und auch auf jedem Bauernhof vorhanden, sonst wäre kein friedliches Miteinander möglich gewesen. Alle hielten sich daran. So musste der Rossknecht zum Beispiel, während alle anderen in der Küche beim Mittagsmahl saßen, den Rössern Futter in den Barn geben, damit diese zeitgleich mit den Menschen satt waren und am Nachmittag die schwere Arbeit wieder leisten konnten.
Im September 1926, ich war noch nicht ganz sechs Jahre alt, wurde ich eingeschult. Das fand ich ganz lustig. Nun war ich mit vielen gleichaltrigen Mädchen zusammen und vermisste meine Schwester nicht mehr gar zu sehr. Natürlich gab es auch Buben in der Klasse, aber die interessierten mich weniger. Mit den Mädchen konnte man in den Pausen so herrlich spielen, während ich daheim schon von klein auf den ganzen Tag eingespannt war – und wenn es auch nur die Tatsache war, dass ich auf meine Brüderchen aufpassen musste.
Eines Morgens, bevor ich meinen Schulweg antrat, gab die Mutter mir den Auftrag: »Geh zuerst zur Hebamme, und schick sie mir her.« Das befolgte ich brav.
Zu meiner Überraschung lag, als ich von der Schule kam, ein neues Kind in der Wiege, eine kleine Maria. Natürlich freute ich mich, dass ich wieder eine Schwester hatte. Aber Maria war nicht wirklich ein Ersatz für die Resi. Sie war noch so winzig, und es ließ sich mit ihr noch nichts anfangen. Ja, eigentlich bedeutete sie nur Mehrarbeit für mich. Denn nun hatte ich drei Kleinkinder hinter mir herzuziehen. Für mich blieb kaum die Zeit, meine Schulaufgaben zu machen.
Von da an gab mir die Mutter mit schöner Regelmäßigkeit einmal im Herbst vor dem Schulunterricht den Auftrag: »Geh zuerst zur Hebamme, und schick sie mir her.«
Und immer, wenn ich danach von der Schule nach Hause kam, war ein neuer Schreihals angekommen. Im Jahre 1926 war es die Maria gewesen, 1927 die Margret, 1928 die Katharina, 1929 die Elisabeth und 1930 die Anna. Daher glaubte ich viele Jahre lang, die Hebamme bringe die Kinder in ihrer großen braunen Tasche mit. Obwohl mit jedem neuen Dirndl meine Pflichten und meine Verantwortung wuchsen, liebte ich jedes Einzelne. Die Anna durften wir leider nur ein paar Wochen behalten, dann holte sie sich der liebe Gott zurück. Darüber war ich sehr traurig. Unserer Magd Gretl gelang es dann, mich zu trösten mit den Worten: »Nun habt ihr einen Engel im Himmel.«
Einige Wochen, nachdem wir die Anna begraben hatten, nahm mich meine Mutter mit in den Stall und versuchte, mir das Melken beizubringen. Da war ich gerade mal zehn. Anfangs war ich sehr stolz darauf, dass sie mir eine solche Aufgabe zutraute. Sie hatte eigens die bravste Kuh dafür ausgesucht. Dennoch musste ich meinen ganzen Mut zusammennehmen, mich unter das große braune Tier zu setzen, das ständig mit dem Schwanz hin- und herschlug. Mit meinen kleinen zarten Fingern ging ich zaghaft an die Sache heran.
»Du stellst dich aber ungeschickt an«, tadelte die Mutter. »Du musst fester zupacken.«
Das tat ich dann auch. Wie glücklich war ich, als der erste weiße Strahl in meinem Eimer landete! Dann molk ich tapfer weiter. Bis ich meinen vollen Eimer der Mutter präsentieren konnte, hatte sie längst alle anderen Kühe gemolken. Aber von Tag zu Tag ging mir das Melken besser von der Hand. So bekam ich bald eine zweite Kuh zugeteilt. Nachdem ich beide Kühe gemolken hatte, jammerte ich: »Mutter, mir tun die Hände so weh.«
»Das macht nichts. Mit der Zeit vergeht das wieder.«
Von da an hatte ich jeden Abend drei Kühe zu melken, und es dauerte gar nicht lange, da musste ich das auch schon morgens vor dem Unterricht tun.
Im Jahre 1931, nachdem der November ohne Besonderheiten vorübergegangen war, rechnete ich jeden Tag damit, dass mich die Mutter wieder zur Hebamme schicken würde. Als das aber bis Weihnachten noch nicht geschehen war, atmete ich erleichtert auf. Denn mein Arbeitspensum langte mir wirklich. Ja, irgendwie freute ich mich, weil die Mutter anscheinend zu der Einsicht gelangt war, dass wir nun genug Kinder hatten.
Doch ich hatte mich zu früh gefreut. Es war 1933, wenige Wochen vor meiner Schulentlassung. Am frühen Nachmittag hatte ich mit meinen Brüdern und mit meiner Schwester Maria den Schulweg zurückgelegt, da stießen wir an der Haustür fast mit der Hebamme zusammen. Mit ihrer großen Tasche kam sie aus dem Haus gestürmt. Sie nahm sich aber noch die Zeit, uns zuzurufen: »Geht mal gleich in die Schlafkammer der Mutter! Ein neues Dirndl ist angekommen.«
Das kann doch gar nicht sein, dachte ich. Es ist Anfang Juli, die Haupterntezeit steht vor der Tür, da wird sich doch die Mutter nicht mit einem neuen Kind belasten wollen. Ja, und dann beschäftigte mich noch die Frage, wer die Hebamme benachrichtigt hatte. Für mich gab es nur eine Erklärung: Sie musste zufällig vorbeigekommen sein, mit einem Kind in der Tasche, das sie anderswo nicht losgeworden war.
Außer Atem kamen wir am Bett der Mutter an. Matt lächelnd deutete sie auf die blau gestrichene Wiege, die schon ziemlich mitgenommen aussah. »Da, schaut euer Schwesterl an. Rosi heißt sie.«
Da lag tatsächlich ein kleines rosiges Wesen, das friedlich schlief. Bei seinem Anblick wurde ich sehr nachdenklich. Vielleicht war ja doch etwas an dem dran, worüber neulich einige Mitschülerinnen auf dem Pausenhof getuschelt hatten. Leider stand ich etwas zu weit weg, um alles mitzubekommen. Ich gehörte nämlich nicht zu diesem »ausgewählten« Kreis. Nur so viel hatte ich verstanden: dass bei der Liesl Müller zu Hause in der Nacht das sechste Kind angekommen war. Mitschülerin Irma hatte daraufhin die Wissende gespielt und gemeint, damit hätte sie gerechnet.
»Wieso das?«, bestürmten die anderen sie mit Fragen. Dann verstand ich etwas von Liesls Mutter und einem dicken Bauch.
»Was hat denn das damit zu tun?«, wollte die Liesl nun wissen.
Irma, ganz in ihrem Element, lachte sie aus: »Ja, weißt du nicht, dass die Kinder bei der Mutter im Bauch wachsen?«
Beschämt schüttelte die Liesl den Kopf, und ich schüttelte den meinen gleich mit.
»Und wie sollen sie da rauskommen?«, zeigte sich eine andere höchst interessiert. Da musste auch Irma passen. Man diskutierte, ob der Mutter vielleicht der Bauch aufgeschnitten werde wie bei dem Wolf im Märchen.
»Vielleicht ist es ja wie bei den Kühen, und das Kind kriecht bei der Mutter aus dem Arsch«, stellte eine zur Debatte.
Wie gesagt, ich gehörte nicht zu diesem Kreis, hatte aber lange Ohren gemacht. Das Gehörte konnte ich nicht recht glauben. Meine eigene Weisheit, dass die Hebamme die Kinder in ihrer Tasche mitbrachte, behielt ich für mich, denn ich glaubte selbst nicht mehr so richtig daran. Außerdem wollte ich nicht ausgelacht werden.
Nun aber, da bei uns ein neues Dirndl in der Wiege lag, zählte ich zwei und zwei zusammen. Das mit dem Bauch musste stimmen. Mir war nämlich seit einigen Wochen aufgefallen, dass die Mutter an Leibesumfang immer mehr zugenommen hatte. Auch kam es mir allmählich verdächtig vor, dass die Mutter immer dann über eine Woche im Bett liegen musste, wenn wieder ein Baby angekommen war.
Gewiss, als Kind, das auf einem Bauernhof aufgewachsen war, hatte ich schon öfter erlebt, auf welche Weise Kälber und Ferkel auf die Welt kamen. Auch bei unserem Hund und bei unseren Katzen hatte ich schon mitbekommen, wie sie Junge kriegen. Aber das waren doch Tiere! Nun sträubte sich in mir alles dagegen, anzunehmen, dass es bei den Menschen ebenso »tierisch« zugehen solle. Auch blieb noch die Frage offen, wie die Kinder in den Bauch der Mutter hineingelangten, wenn sie schon da herauskamen. Wieder drängte sich mir mein Wissen aus dem Tierreich auf: Die Kuh wurde vom Stier besprungen und die Sau vom Eber, damit es Nachwuchs gab. Sollte das bei den Menschen ähnlich sein? Nein! Diesen Gedanken wollte ich gar nicht zu Ende denken, so ungeheuerlich war er. Schade, dass meine Großmutter nicht mehr lebte, die hätte mir gewiss Antworten auf meine Fragen geben können.
Schon zwei Tage später ergab es sich, dass ich mit unserer neuen Magd – der Bärbel, die erst seit Lichtmess bei uns in Diensten stand – allein im Stall war, als bei einer Kuh das Kalben anfing. Weil uns die Gretl durch Heirat verloren gegangen war, hatte meine Mutter diese ältere Frau eingestellt. Es zeigte sich, dass sie, was das Kalben anging, nicht nur sehr erfahren war, sondern trotz ihrer fünfzig Jahre über eine erstaunliche Körperkraft verfügte. Sie wusste genau, was bei der Kuh zu tun war, und sie verstand es auch, mir mit wenigen Worten beizubringen, wo ich hinlangen musste.
Wir waren beide ganz stolz, dass wir es ohne Doktor oder ein anderes Mannsbild geschafft hatten, ein schönes gesundes Kuhkalb zur Welt zu holen. Von dieser erfahrenen Magd konnte ich bestimmt viel lernen. Daher wagte ich auch gleich eine Frage: »Sag mal, Bärbel, kommen die Menschenkinder auch beim Arsch raus?«
»Aber nein«, sie lachte. »Da würden sie ja voller Scheiße sein. Nein, nein, da gibt es einen Extra-Ausgang. Geburtskanal nennt man den. Der liegt zwischen den Beinen der Mutter, genau zwischen dem Arschloch und dem Loch zum Pieseln.«
Diese präzise Antwort ermutigte mich zu einer weiteren Frage: »Und wie kommen die Kinder in den Bauch rein?«
Da erklärte sie mir, dass sie auch über den Geburtskanal, den man auch Scheide nenne, hineinkämen und welche Rolle dabei die Männer spielten.
Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Also geht es bei den Menschen doch recht »tierisch« zu, dachte ich.
Sie erzählte mir auch noch etwas über monatliche Blutungen, die vier oder fünf Tage anhalten würden und dass sie völlig ungefährlich seien. »Du bist ja erst zwölf«, sagte sie. »Da hast du gewiss noch ein paar Jahre Zeit, bis die Tage bei dir anfangen.« Ab da aber solle ich mich vor jedem Mannsbild hüten, beschwor sie mich. Männer seien nämlich immer auf »das eine« aus, und hernach würden sie einen mit einem ledigen Kind sitzen lassen. Ihr sei es auch so ergangen. Sie habe ihr Kind in Pflege geben müssen, als Magd hätte sie es ja nicht bei sich behalten können. »Weißt, vorher versprechen sie einem die Heirat, damit sie ans Ziel kommen, und dann wollen sie davon nichts mehr wissen.« Dann gab sie mir noch einen guten Rat mit auf den Weg: »Lass dich also erst mit einem Mannsbild ein, wenn er vor dem Traualtar ja gesagt hat.«
Und da die Bärbel gerade in Plauderstimmung war, fragte ich sie, was es mit dem Zug auf sich habe, der abgefahren sei. Ja, man meine damit, dass die Frau aus dem gebärfähigen Alter heraus sei. Wenn eine Frau nämlich auf die fünfzig zugehe, würden die Monatsblutungen wieder aufhören, und dann könne sie keine Kinder mehr kriegen.
So sah das also aus! Diese neuen und, wie mir schien, lebenswichtigen Erkenntnisse wollte ich meinen kleinen Schwestern rechtzeitig weitergeben, damit sie nicht so dumm aufwuchsen wie ich.
Sie wollen wissen, wie es weitergeht?
Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!
Weitere E-Books von Roswitha Gruber
Die Kinder der Dienstmagd
eISBN 978-3-475-54356-2 (epub)
Die Magd Elisabeth und der Knecht Franz träumen davon zu heiraten. Als sich die Möglichkeit ergibt, einen Hof zu pachten, können sie als Bauersleute eine Familie gründen. Sie führen ein erfülltes Leben, bis ein Unglück Elisabeth und ihre Kinder zurück in den dienenden Stand zwingt. Einfühlsam und packend werden die Lebenswege von Elisabeths Nachfahren erzählt.
Erlebnisse einer Berghebamme
eISBN 978-3-475-54328-9 (epub)
Authentisch und lebendig berichtet Roswitha Gruber aus dem Leben der Geburtshelferin Marianne. Immer war sie zur Stelle, wenn eine werdende Mutter ihre Dienste benötigte. In ihren vielen Arbeitsjahren hat sie über 3000 Kindern geholfen, das Licht der Welt zu erblicken. Die bewegenden Schicksale der Menschen, die sich Marianne anvertraut haben, gehen jedem nahe.
Erinnerungen einer Bergbäuerin
eISBN 978-3-475-54336-4 (epub)
Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com