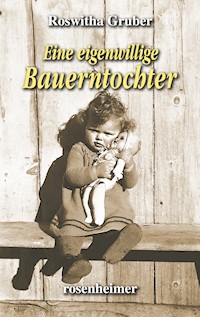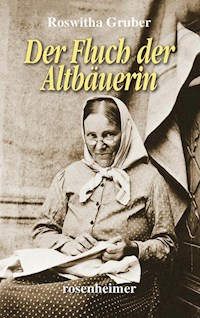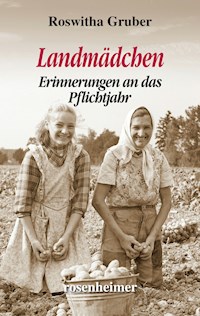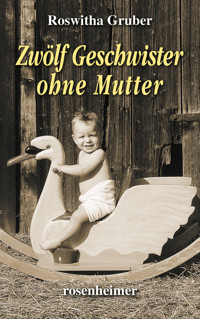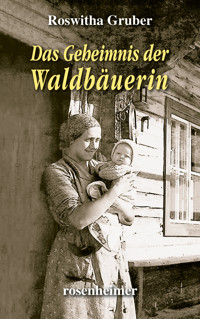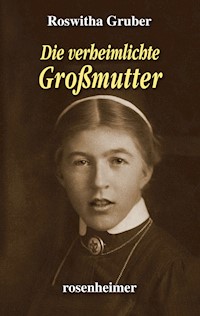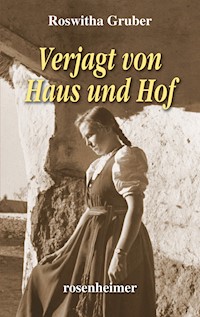16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sigune wächst auf dem Bauernhof ihrer Großeltern auf. Dort verbringt sie inmitten der ländlichen Idylle eine wohlbehütete Kindheit. Von klein auf wird sie in alle am Hof anfallenden Aufgaben integriert. Vor allem die Arbeit mit den Kühen, Schweinen, Ziegen und dem Federvieh bereitet Sigune viel Freude. Deshalb ist es ihr größter Wunsch, selbst einmal Bäuerin auf diesem Anwesen zu werden. Doch als Sigune dreizehn ist, endet ihr Traum jäh. Ihre Eltern zerren das sensible Kind auf die Show-Bühne.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
LESEPROBE zu
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2016
© 2016 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim
www.rosenheimer.com
Titelbild: © Bundesarchiv, Bild 183-73965-0001 / Fotograf: Riedel
Lektorat und Bearbeitung: Christine Weber, Dresden
Worum geht es im Buch?
Roswitha Gruber
Wo meine Heimat ist
Sigune wächst auf dem Bauernhof ihrer Großeltern auf. Dort verbringt sie inmitten der ländlichen Idylle eine wohlbehütete Kindheit. Von klein auf wird sie in alle am Hof anfallenden Aufgaben integriert. Vor allem die Arbeit mit den Kühen, Schweinen, Ziegen und dem Federvieh bereitet Sigune viel Freude. Deshalb ist es ihr größter Wunsch, selbst einmal Bäuerin auf diesem Anwesen zu werden. Doch als Sigune dreizehn ist, endet ihr Traum jäh. Ihre Eltern zerren das sensible Kind auf die Show-Bühne.
Roswitha Gruber widmet sich der Schilderung starker Frauen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Für jeden ihrer Romane nähert sie sich in intensiven Gesprächen dem Schicksal ihrer Protagonistinnen an. Roswitha Gruber lebt und arbeitet in Reit im Winkl.
Inhalt
Die Vorgeschichte
Sigune erzählt
Auf Opas Bauernhof
Lina erzählt
Geheimniskrämerei
Sigune erinnert sich
Lina erzählt weiter
Die Ferkelsau
Der Teufel im Plumpsklo
Hausmusik
»Geliebtes Fräulein Siska«
Sigunes Erinnerung
Sigune berichtet
Opa Sepp
Zwei Eiergeschichten
Das Laufstühlchen
Der spendable Briefträger
Die »Invasion«
Opas düsteres Geheimnis
Das Leben ging weiter
Das schwarze Schaf
Cindy und Bert
Die Großeltern Fritz und Mariechen
Nur Unsinn im Sinn
Helmut erzählt
Das »Scheesewähnsche«
Eine »Batschkapp« mit Inhalt
Die Kaffeekanne
Die Spiegelaffäre
Auf wackligen Beinen
Sigune denkt zurück
Krieg
Der Neubeginn
Auf Freiersfüßen
Sigune erzählt wieder
Meine Mutter, ein Zirkuspferd
Die Teufelspriesterin
Die lieben Verwandten
Meine Großeltern Fritz und Frieda
Die »Grombeerkieschelscher«
Edda, das geborene Funkenmariechen
Der Kaufladen
Meine Schulzeit
Vom Schweinestall ins Rampenlicht
Karneval das ganze Jahr
Ein Hund in Nöten
Aus der Traum
Deutsch-deutsche Freundschaft
Die Allgäuer Verlobung
Verlobung an der Biertheke
Oma Lina als Tugendwächterin
Glück und Leid
Mein armer Bruder
Oh, mein Papa!
»Der arme Unsereiner«
»Die doof’ Nuss«
»Der Hund Casanova«
Aus der Bahn geworfen
Mein Puppenhaus
Abschluss-Interview
Die Vorgeschichte
Es liegt schon einige Jahre zurück, da erhielt ich einen dicken Brief aus einem Ort mit dem schönen Namen Heiligenwald. Ein Blick in den Atlas verriet mir, dass dieser in der Nähe von Saarbrücken liegt. Neugierig öffnete ich das Kuvert und überflog die Seiten, die teils in Handschrift, teils mit dem Computer erstellt waren. Sigune, eine Frau mittleren Alters, Jahrgang 1959, hatte mir dieses Schreiben mit der Anfrage geschickt, ob ich nicht ein Buch daraus machen möchte.
Neugierig, wie ich war, begab ich mich schon bald darauf ins Saarland. Zum einen interessierte mich der Ort mit dem wohlklingenden Namen, zum anderen der Mensch, der hinter dieser Geschichte steckte. Bald hatte ich das Haus gefunden, das am Ortsrand lag, von wo aus man den Blick über Felder, Wald und Wiesen schweifen lassen kann. Auf der engen Treppe führte mich die Besitzerin hinauf in den ersten Stock.
Als ich in das kleine Wohnzimmer trat, kam ich aus dem Staunen nicht mehr heraus. Wäre ich ein vier- oder fünfjähriges Mädchen gewesen, dann hätte mich die Szenerie noch mehr beeindruckt. Ich hatte nämlich den Eindruck, eine Puppenstube zu betreten. Wohin das Auge reichte, überall Puppen! Doch nicht nur Exemplare in unterschiedlicher Größe und aus verschiedenen Epochen befanden sich in diesem Raum, auch andere Dinge aus der Puppenwelt, die jedes Mädchenherz höherschlagen lassen: ein Wägelchen, wie ihn kleine Mädchen schon vor hundert Jahren vor sich hergeschoben haben, ein Kinderbügeleisen, eine Puppenwiege, ein kleiner Herd, eine Wäschemangel, die allesamt wohl ebenfalls aus dieser Epoche stammten. Ausrangierte Gebrauchsgegenstände aus dem Erwachsenenleben waren ebenfalls aufgestellt und ließen den Raum wie ein liebevoll zusammengetragenes Museumspotpourri wirken. Das Prunkstück von allem bildete ein dreistöckiges Puppenhaus. Auf dieses werde ich im letzten Kapitel zu sprechen kommen.
In der »echten« Wohnung gingen wir weiter in den angrenzenden Raum, der ursprünglich ein Kinderzimmer gewesen sein musste. Es befanden sich noch ein Bett, ein Nachttisch, eine Kommode, ein Sessel und ein Wäschekorb darin, auch hier waren alle Möbelstücke über und über mit Puppen besetzt.
Warum, so fragte ich mich, hatte eine Frau von über fünfzig Jahren ihre Wohnung mit derart viel Kinderspielzeug eingerichtet, dass ihr selbst kaum Platz zum Wohnen blieb? Das sollte ich im anschließenden Gespräch erfahren …
Nachdem wir uns zwischen einige Puppen auf die Couch »gequetscht« hatten, wollte ich mir von Sigune aus ihrem Leben erzählen lassen. Aber noch ehe ich dazu kam, mein Tonbandgerät auszupacken, legte sie einen dicken Ordner vor mich hin. Dieser enthielt nicht nur ihre »gesammelten Werke«, sondern auch die ihrer Mutter.
Ich blätterte ein bisschen darin herum und wusste, daraus ließ sich etwas machen. Aber wie immer, wenn ich an einem Buch arbeite, waren noch viele Anrufe nötig, um mir einiges noch etwas genauer beschreiben zu lassen. Was dabei an Lustigem, Kuriosem und auch an Tragischem herausgekommen ist, können Sie auf den nächsten Seiten lesen.
Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung dabei.
Roswitha Gruber
Sigune erzählt
Auf Opas Bauernhof
Schon mein Start ins Leben war denkbar schlecht. Bei meiner Mutter, die noch gar nicht an Entbindung dachte, setzten am 22. Januar 1959 aus unerklärlichen Gründen plötzlich die Wehen ein. So schnell es ging, wurde sie mit Blaulicht und Tatütata ins Krankenhaus gebracht, und wenig später erblickte ich das Licht der Welt: ein mickriges Siebenmonatskind, das gerade einmal zwei Kilogramm wog, weshalb ich meine beiden ersten Lebensmonate in der Kinderklinik verbringen musste.
Das wäre nicht weiter schlimm gewesen, ich war mir dessen ja nicht bewusst. Schlimm finde ich nur, dass mein Leben sehr schmerzhaft begann. Wie mir meine Mutter Jahre später berichtet hat, ist in der Klinik nämlich ein Malheur passiert. Man hat mich zwar sogleich in einen wohltemperierten Inkubator, in einen »Brutkasten« für Frühgeborene, gesteckt. In diesem habe ich mich aber offenbar nicht lange aufgehalten.
Eine der Säuglingsschwestern muss einen Narren an mir süßem kleinen Püppchen gefressen haben, nahm mich aus dem schützenden Inkubator und trug mich herum. Damit ich aber die wohlige Wärme des Kastens nicht entbehren musste, packte sie eine Wärmflasche auf das Tragekissen, ehe sie mich darauflegte. Der überbesorgten Frau war die Wärmflasche aber viel zu heiß geraten.
Weil ich mich meiner Haut nicht anders zu wehren wusste – im wahrsten Sinne des Wortes –, schrie ich wie am Spieß. Das verstand die Pflegerin jedoch völlig falsch. Statt mich zurück in den Brutkasten zu legen, trug sie mich, um mich zu beruhigen, umso länger herum, wobei sie mich fest an sich drückte. Das muss meine Pein noch vergrößert haben, denn mein Protest wurde nur noch lauter. Ich schrie weiterhin aus vollem Halse. Deshalb meinte eine ihrer Kolleginnen, sie solle doch mal nachschauen, ob ich die Windel voll hätte.
Als die Schwester sich endlich dazu erbarmte, entdeckte sie die Bescherung: Meine linke Pobacke hatte eine arge Verbrennung erlitten. Das wäre auch nicht weiter tragisch gewesen, denn bis ich dann nach Hause entlassen wurde, war die Wunde längst verheilt. Es blieben auch keine Schmerzen zurück, sondern nur eine Brandnarbe.
Doch nach Jahren noch meinte meine Oma, sie müsste all ihren Verwandten und Bekannten, vor allem ihren Schwestern und Cousinen, zeigen, was man mir in der Kinderklinik angetan hatte. Wenn also Besuch kam, der meine Rückseite noch nicht kannte, forderte Oma mich auf, meinen Po zu entblößen, damit sich der Gast das »Schandmal« selbst ansehen konnte.
Mir, in meiner schüchternen Art, war das natürlich äußerst unangenehm. Zum Trost gab es meist anschließend von der Tante eine Tafel Schokolade für das »brave Mädchen«, was mich mit meinem Schicksal dann jedes Mal wieder versöhnte.
Heute sieht man das Brandmal noch immer, aber nur in der Sauna. Daher musste ich mir dort schon so manch dummen Spruch anhören, zum Beispiel: »Wie praktisch, Sigune, so erkennt man dich auch gleich von hinten.«
So witzig finde ich das gar nicht. Zum Glück fällt mir meist spontan ein Spruch ein, mit dem ich kontern kann: »Besser ein Mal auf einer Pobacke als eines auf einer Gesichtsbacke.« Mit dem versteckten Schönheitsfehler habe ich gelernt, zu leben.
Als mich meine Eltern kurz vor Ostern endlich aus der Kinderklinik abholen durften, zeigte die Waage immerhin das stolze Gewicht von acht Pfund an. Sie brachten mich auf den Bauernhof meiner Großeltern, wo Heinz, mein siebenjähriger Bruder, und Schwester Edda, die vier Lenze zählte, auf mich warteten.
Zu der Zeit besuchte Heinz bereits die zweite Klasse der Volksschule, Edda wurde zwei Jahre später eingeschult. Das bedeutete für mich, dass ich ohne Spielkameraden aufwuchs, als ich anfing, meine Umwelt bewusst wahrzunehmen. Obwohl meine Geschwister nur die Vormittage in der Schule verbrachten, waren sie für mich auch am Nachmittag nicht verfügbar. Entweder brüteten sie über den Hausaufgaben oder schwirrten aus zu ihren Freunden.
Ab meinem dritten Geburtstag hätte ich den Kindergarten besuchen dürfen, um dort Spielkameraden in rauen Mengen vorzufinden. Mein Großvater aber wollte nicht, dass ich dort hinging. Schon als bei meinem Bruder damals der Kindergartenbesuch anstand, muss er den Ausspruch getan haben: »Von meinen eigenen Kindern habe ich nicht viel gehabt, weil ich immer auf der Grube war. Deshalb will ich bei meinen Enkeln all das nachholen, was ich bei meinen Kleinen versäumt habe.«
Als nun die Diskussion entbrannte, ob ich in die Kinderbewahranstalt sollte oder nicht, führte er als Argument an: »Lasst dem Mädel doch noch ein bisschen Freiheit, ehe mit der Schule der Ernst des Lebens beginnt. Außerdem macht mir die Kleine so viel Pläsier.«
Weder seine Frau noch seine Tochter, also meine Mutter, wagten, ihm zu widersprechen. Ja, der Oma war diese Entscheidung gerade recht. Denn von dem Augenblick an, als sie mich zum ersten Mal in ihren Armen hielt, hatte sie mich in ihr großes Herz geschlossen.
Mit meiner Ankunft auf dem Bauernhof wurde es eng in dem kleinen Haus der Großeltern. Deshalb entschlossen sich Vater und Opa zu einem Anbau, der sich über beide Etagen erstreckte. Zu dieser Zeit installierten sie im Haus auch Bad und Toilette. Seit Opa das Haus hatte erbauen lassen, waren die Ansprüche an den Komfort doch etwas gestiegen.
Von da an gab es gewissermaßen zwei Wohnungen im Haus: Im Erdgeschoss lebten die Großeltern, in der ersten Etage meine Eltern mit uns Kindern. Aber ganz so strikt getrennt ging es nicht zu. Wir Kleinen hielten uns meist bei der Oma auf, denn sie hatte eine richtig große Küche und kochte für die ganze Familie. Im ersten Stock gab es nämlich nur eine Miniküche, in der die Mutter nicht viel mehr als Kaffee oder Tee zubereitete.
Rückblickend muss ich sagen, dass ich auf diesem Hof mit Lina und Sepp, den Großeltern mütterlicherseits, meine glücklichsten Jahre verbracht habe. Sie waren immer für mich da, während meine Eltern, die zwar ebenfalls auf dem Hof wohnten, für mich meist unsichtbar blieben. Der Vater war die ganze Woche über beruflich unterwegs, und meine Mutter verbrachte die meiste Zeit in einem kleinen Zimmer, das sie stolz »Atelier« nannte. Dort nähte sie den ganzen Tag über Gardinen oder Theaterkostüme. Uns Kindern war es strengstens untersagt, sie dort zu stören.
Auch am Abend, wenn die Nähmaschine endlich stillstand, hoffte ich vergeblich auf die Zuwendung der Mama. Wenn sie sich überhaupt jemandem zuwandte, dann ihrem Sohn. Der durfte beim Abendessen neben ihr sitzen; dem streichelte sie schon mal übers Haar; dem hörte sie zu, wenn er von seinen kleinen Tageserlebnissen berichtete; ihn nahm sie sogar ab und zu in den Arm. Wir Mädchen konnten dann nur neidvoll zusehen. Ob meine Schwester unter dieser Benachteiligung litt, weiß ich nicht. Vermutlich nicht, denn sie war aus ganz anderem Holz geschnitzt als ich und wesentlich robuster. Ich aber, das Sensibelchen, litt sehr unter dieser ungleichen Behandlung. Zum Glück kam ich bald dahinter, dass ich mir bei Oma und Opa die Streicheleinheiten holen konnte, die ich zum Überleben brauchte.
Papa kam meist erst am Freitagabend nach Hause, dann war es allerdings schon so spät, dass ich längst schlief. Auch am Samstagmorgen blieben meine Eltern für mich nicht ansprechbar. Gleich nach dem Frühstück verschwanden sie ins Wohnzimmer, wo sie stundenlang probten. Danach packten sie Kostüme und sonderbare Gegenstände in einen großen Reisekorb, den mein Vater in sein Auto wuchtete. In Omas Küche nahmen sie zwar noch am gemeinsamen Mittagessen teil, schlangen es aber hastig hinunter, bevor sie losbrausten zu ihren »Auftritten«, wie sie es nannten. Meist nahmen sie auch Heinz und Edda mit auf die Reise.
Ich aber blieb zurück bei Oma und Opa und ihren zahlreichen Tieren, was mir jedoch nicht unangenehm war. Im Gegenteil, sobald ich mit den Großeltern allein sein konnte, war für mich die Welt wieder in Ordnung – und das während des ganzen Wochenendes, denn Eltern und Geschwister tauchten meist erst am Sonntag spät in der Nacht wieder auf, wenn ich schon längst im Traumland weilte.
Großmutter war also meine wirkliche Bezugsperson. Sie war immer präsent; sie war es, die mich großzog; sie war der Mensch, durch den ich Laufen und Sprechen lernte. Von ihr erhielt ich auch meinen ersten »Benimmunterricht«. Oma konnte alles und wusste alles, und ich durfte mit jedem Kummer zu ihr kommen. Daher war sie der wichtigste Mensch in meiner Kindheit, ja, sie sollte bestimmend bleiben für mein ganzes Leben. Durch sie lernte ich nicht nur das Familienleben kennen, sondern auch die weit verzweigte Verwandtschaft.
Lina war nämlich ein ausgesprochener Familienmensch. Das bezog sich sowohl auf ihre Herkunft als auch auf die Familie, die sie mit Opa Sepp im Jahre 1921 gegründet hatte. Die Großmutter wurde nicht müde, mir von ihren Vorfahren zu berichten, aber auch von ihren Geschwistern, von denen immer wieder mal jemand zu Besuch kam. So waren mir bald die meisten von ihnen bekannt, mitsamt den Nachkommen. Omas Vorfahren lernte ich jedoch leider nicht mehr persönlich kennen, aber sie erzählte so lebhaft von ihnen, dass ich sie mir genauestens vorstellen konnte. Damit legte sie den Grundstein für mein späteres Interesse an der Ahnenforschung.
Von ihrem Großvater mütterlicherseits, dem Jacob Rink, wusste sie zu berichten, dass er 1845 in Wiesbach im Elsass geboren war. Im Alter von dreizehn Jahren wanderte er allein nach Schiffweiler im Saarland aus, um dort eine Stelle im Kohlebergwerk anzunehmen. Unterkunft fand er bei Verwandten seiner Mutter. Im Jahre 1867 heiratete er die gleichaltrige Maria Schmidt aus Pachten, das damals eine selbstständige Gemeinde war. Heute ist Pachten ein Stadtteil von Dillingen an der Saar.
Das Paar wurde mit Töchtern reich gesegnet, worüber Jacob nicht besonders glücklich war. Doch lange Zeit gab er die Hoffnung auf einen Sohn nicht auf. Irgendwann muss der Bub doch kommen, redete er sich ein und übte unverdrossen weiter. Wenn er auch keinen Bauernhof, geschweige denn ein Rittergut, zu vererben hatte, so sah er es doch als seine Pflicht an, den schönen Familiennamen »Rink« an eine nächste Generation weiterzureichen.
Nachdem aber nach siebzehn Jahren Ehe die achte Tochter in der Wiege lag, resignierte er. »Es soll eben nicht sein«, tröstete er zunächst sich selbst und dann seine Frau. »Jetzt ist Schluss mit dem Kinderkriegen«, versprach er ihr und hat sie von dem Tag an nicht mehr angerührt. Er war eben ein Mann mit Grundsätzen.
Seine Töchter Anna, Marie, Gret, Catherine, Anna-Maria, Bärbel, Fanni und Lina wuchsen munter heran. Obwohl sie Mädchen waren, hatte er viel Freude an ihnen, sodass er sich mit seinem Schicksal einigermaßen versöhnte. Eine endgültige Aussöhnung sollte auch noch erfolgen, aber wesentlich später.
Anna, Jacobs älteste Tochter, geboren 1869, sollte meine Urgroßmutter werden. Sie heiratete im Jahre 1889 den Bergmann Nikolaus Jochum, Jahrgang 1865, dessen Vater auch schon Bergmann gewesen war. Dreizehn Kinder entsprossen dieser Verbindung, wovon aber nur zehn die frühe Kindheit überlebten, darunter meine Oma Lina. (Alle Namen und Daten sind auf der Stammtafel zu finden.)
Lina war am ersten April 1901 in Schiffweiler zur Welt gekommen, aber alles andere als ein Aprilscherz. Man könnte sie eher als »Original« bezeichnen, als einen Menschen, der von Anfang an mit beiden Beinen im Leben stand. Als Sechste in der zehnköpfigen Geschwisterreihe musste sie schon früh lernen, sich durchzusetzen, und entwickelte sich zu einer starken Frau. In meiner Familie gab es mehrere selbstbewusste Frauen, die ich allesamt bewunderte, denn ich selbst sah mich als ausgesprochen schwaches und ängstliches Geschöpf. Lina aber war die stärkste Persönlichkeit von allen, und ich profitierte davon.
Nun lasse ich sie selbst zu Wort kommen.
Lina erzählt
Geheimniskrämerei
Als kleines Kind besuchte ich mit meiner Mutter Anna öfter die Großeltern Maria und Jacob Rink, die im Nachbardorf wohnten. Sie lebten in einem der armseligen Reihenhäuser zur Miete, welche die Bergwerksgesellschaft Mitte des 19. Jahrhunderts für ihre Arbeiter hingestellt hatte. Später konnten die Bewohner diese Häuser käuflich erwerben. An meine frühen Ausflüge dorthin erinnere ich mich nicht mehr, ein Besuch im Juli 1906 jedoch ist mir noch lebhaft in Erinnerung. Schon damals, mit meinen gut fünfeinhalb Jahren, machte ich mir Gedanken darüber – und es ist mir bis heute ein Rätsel –, wie die Großeltern in diesem winzigen Haus mit acht Töchtern leben konnten.
Bei unserem besagten Besuch trafen wir außer den Großeltern nur ihre ledigen Töchter Bärbel, Fanni und Lina an. Meine Tanten Marie und Gret, die schon lange verheiratet waren, wohnten nur ein paar Straßen weiter. Diese besuchten wir am selben Nachmittag ebenfalls. Meine Mutter hatte mir oft von vielen ihrer Kindheitserlebnisse mit den sieben Schwestern erzählt, daher waren mir nicht nur deren Namen geläufig, ich konnte sie auch alle in der richtigen Reihenfolge aufzählen.
Nachdem wir bei Marie und Gret gewesen waren, fragte ich arglos: »Besuchen wir jetzt Tante Catherine und Tante Anna-Maria?«
»Nein«, antwortete meine Mutter kurz angebunden und zog mich in Richtung ihres Elternhauses mit.
Das hinderte mich nicht daran, eine zweite Frage zu stellen: »Warum nicht?«
Einen Moment schien Mutter zu überlegen. »Das geht nicht.«
»Warum nicht?«, bohrte ich weiter.
»Das geht dich nichts an«, speiste sie mich kurzerhand ab.
Da werde ich schon noch dahinterkommen, nahm ich mir vor und klemmte mich hinter die Großmutter, sobald ich sie in die Finger bekam. Ich kannte sie als gutherzige Frau, doch ob meiner Frage nach den beiden Töchtern sah sie mich einen Moment lang erschrocken an. Dann fertigte sie mich mit den Worten ab: »Kinder brauchen nicht alles zu wissen.«
Nun blieb mir nur noch Tante Lina. Diese war nur siebzehn Jahre älter als ich und verhielt sich mir gegenüber eher wie eine große Schwester und nicht wie eine Tante. Aber auch bei ihr biss ich auf Granit. Auf meine Frage nach ihren beiden Schwestern antwortete sie verlegen: »Lina, das kann ich dir nicht sagen.« Dabei tätschelte sie mir liebevoll den Kopf. Spätestens in diesem Augenblick wurde mir klar, dass diese beiden Tanten ein Geheimnis umwehte.
Fest entschlossen, dieses zu enthüllen, wollte ich in Zukunft Augen und Ohren offen halten. Beinahe hätte ich es noch am selben Tag gelüftet. Als ich nämlich überraschend in die Küche trat, in der sich meine Mutter und meine Oma bei einer Tasse Malzkaffee lebhaft unterhielten, schnappte ich einige Wortfetzen auf, die eindeutig im Zusammenhang mit den verschwundenen Tanten standen. Doch sobald die beiden Frauen mich gewahrten, verstummten sie. Das war für mich der endgültige Beweis, dass sich um Catherine und Anna-Maria eindeutig etwas Mysteriöses rankte.
Als sehr aufgeschlossenes und wissbegieriges Kind störte mich diese Geheimniskrämerei der Erwachsenen gewaltig. Nun ja, für diesen Tag musste ich alles auf sich beruhen lassen. Am Abend trottete ich neben der Mutter die wenigen Kilometer schweigend nach Hause. Es sollte ganze acht Jahre dauern, bis ich eine endgültige Antwort auf meine Frage bekam.
In der Zwischenzeit war ich von vielem, das sich in meiner Familie ereignete, so in den Bann gezogen, dass ich die Geschichte von den »unsichtbaren« Tanten ganz vergessen hatte. Im November, nur wenige Monate nach dem Besuch bei den Großeltern, stieß ich, von einem Aufenthalt bei den Nachbarn kommend, an unserer Haustüre fast mit der Hebamme zusammen.
»Du hast ein Brüderchen bekommen«, rief sie mir hocherfreut zu, ehe der Nebel sie verschluckte.
»Wo ist das Brüderchen?«, bestürmte ich Marie, meine große Schwester, die am Küchentisch saß und gerade die beiden Kleinen, den Alois und den Klaus, fütterte.
»Wo soll es schon sein? Im Schlafzimmer der Mutter natürlich.«
So natürlich fand ich das gar nicht. Es hätte genauso gut in der Küche sein können oder im Bubenschlafzimmer. Sofort rannte ich die Treppe hinauf und in das Schlafzimmer der Eltern, wo ich die Mutter lächelnd in ihrem Bett vorfand.
»Halt, Lina! Nicht so stürmisch«, rief sie mir mit halblauter Stimme zu. »Sonst weckst du mir noch den kleinen Jakob auf.«
Nach dieser Ermahnung schlich ich auf Zehenspitzen an die braune Wiege heran und spähte hinein. Ein rosiges pausbäckiges Gesichtchen entdeckte ich zwischen den Kissen.
»Darf ich ihn mal auf den Arm nehmen, wenn er wach ist?«, bettelte ich.
»Natürlich«, antwortete die Mutter, »wahrscheinlich öfter, als dir lieb ist.«
Ihre Prophezeiung sollte sich wirklich erfüllen. Meine Aufgabe würde es fortan sein, diesen kleinen Erdenbürger zu betreuen, auch dann, wenn mir der Sinn gar nicht danach stand.
Er konnte gerade laufen, da lag ein neues Kind in der Wiege, diesmal ein Ännchen. Es sollte meine Pflicht werden, auch dieses zu betreuen. Dazu blieb mir aber nur am Nachmittag und an den Sonntagen Zeit, denn seit einem Jahr verbrachte ich meine Vormittage in der Schule.
Da sich so viel ereignet hatte, dauerte es mehr als zwei Jahre, bis ich mal wieder an einem Sonntag mit der Mutter den Großeltern einen Besuch abstattete. Diesmal fand ich in dem Bergmannshäuschen eine völlig andere Situation vor als beim letzten Mal. Bärbel und Fanni waren längst verheiratet und wohnten in einem Nachbardorf. Die Jüngste aber, Lina, war ihrer inneren Berufung folgend, in Steyl/Holland in den Karmeliterorden eingetreten. Es hieß, sie sei sehr glücklich dort.
Statt dieser drei Tanten traf ich zu meiner Überraschung zwei mir völlig fremde Frauen vor. Man erklärte mir, das seien Catherine und Anna-Maria. Darüber war ich so erfreut, dass ich gar nicht nachfragte, wo sie denn bei meinem letzten Besuch gesteckt hätten. Außerdem sprangen zwei fröhliche Buben durchs Haus, Jakob und Karl, die nur wenig älter waren als ich. Der eine nannte Catherine »Mama«, der andere sagte dies zu Anna-Maria. Sie wurden mir als meine Cousins vorgestellt, womit ich mich zufrieden gab, zumal ich wunderbar mit den beiden spielen konnte. Dass keine Väter vorhanden waren, darüber machte ich mir zu jener Zeit keine Gedanken. Väter befanden sich meist auf der Arbeit, sogar an Sonntagen. Denn so viel wusste ich schon, für Familienoberhäupter gab es nicht nur Nacht-, sondern auch Sonn- und Feiertagsschichten. Für diese brachten sie sogar etwas mehr Geld nach Hause.
Zwei Jahre nach dem Besuch hieß es, Catherine habe geheiratet. Dass man uns dazu nicht eingeladen hatte, wunderte mich gar nicht, zu den Hochzeiten der anderen Schwestern meiner Mutter hatten wir ja auch keine Einladungen erhalten. Damals war man so arm, dass man die Ausgaben für eine große Hochzeitsgesellschaft scheute.
Im Jahr darauf hieß es, Tante Catherine sei im Kindbett gestorben und das Neugeborene gleich mit. Zur Beerdigung gingen wir alle, das gehörte sich so. Anschließend beim Leichenschmaus – der ja viel billiger ausfiel als eine Hochzeitsfeier – waren alle Verwandten versammelt. Von all dem, was da geredet wurde, habe ich nur wenig mitbekommen. Mit meinen Gedanken weilte ich nämlich bei der verstorbenen Tante und deren verstorbenem Kind, denen mein ganzes Mitgefühl galt – und meinem Cousin Karl natürlich, der weinend am Grab gestanden hatte. Nun hatte der arme Kerl keine Mama mehr.
Bald schon wurden diese Grübeleien von neuen Ereignissen verdrängt. Unter anderem erreichte uns die frohe Kunde, Tante Anna-Maria habe endlich einen braven Ehemann gefunden und Jakob damit einen Stiefvater. Dieses Ereignis wurde einige Monate danach von einem anderen überlagert, nämlich von Hochzeitsvorbereitungen, die bei uns im Haus stattfanden. Marie, meine älteste Schwester, schickte sich an, ihren Nikolaus zu heiraten. Das war doch mal was! Eine Hochzeit bei uns zu Hause, an der wir alle teilnehmen durften!
Wenig später – noch bevor der große Krieg ausbrach – stand meine Schulentlassung an. Schon am nächsten Tag wurde ich zu einem Bauern im Ort geschickt, damit ich mir in den Sommermonaten mein Brot selbst verdiene. Im Winter sollte ich, so war es ausgemacht, und das entsprach auch meinem Wunsch, in Neunkirchen einen sechswöchigen Nähkurs besuchen. Damit ich den Hin- und Rückweg nicht in der Dunkelheit zurücklegen musste, sollte ich währenddessen bei einer Verwandten in Neunkirchen wohnen. Am liebsten hätte ich ja eine dreijährige Lehrzeit absolviert, um eine richtige Schneiderin zu werden, meine Mutter aber meinte, sechs Wochen Ausbildung seien genug, dann könne ich all das nähen, was für den Hausgebrauch nötig sei. Außerdem, so ihr Argument, könnte man es sich nicht leisten, drei Jahre lang das Lehrgeld für mich zu zahlen. Bei den Buben war das etwas ganz anderes, die brauchten eine fundierte Ausbildung, weil sie ja mal eine Familie ernähren sollten. Deshalb wurde bei ihnen nicht gespart.
Bevor die Mutter mich aber aus dem Haus entließ, womit ich für sechs Wochen ihrer Aufsicht entzogen sein würde, hielt sie es für notwendig, mir eine Art sexueller Aufklärung zu geben. Diese erschöpfte sich allerdings darin, dass sie mir Folgendes mit auf den Weg gab: »Lina, lass dich bloß mit keinem Kerl ein. Dabei kommt nichts Gutes heraus. Nur Ärger und Kummer und Verdruss, so wie es meinen Schwestern Catherine und Anna-Maria ergangen ist.«
Diese Äußerung ließ mich interessiert aufhorchen. Wie es schien, hatte sie gerade eine redselige Phase, deshalb hakte ich sofort nach: »Was war denn mit den beiden?«
Tatsächlich packte Anna, meine Mutter, aus, aber bestimmt nicht nur, um meine Neugier zu befriedigen. Wahrscheinlich vielmehr, weil sie der Ansicht war, ein drastisches Beispiel, noch dazu aus der eigenen Verwandtschaft, könne bei mir nachhaltiger wirken als eine bloße Warnung. Heute vermute ich sogar, sie war froh, sich das jahrelang gehütete Geheimnis endlich von der Seele reden zu können.
Demnach war Catherine, die Vierte in der Töchterreihe, gleich nach ihrer Schulentlassung zu einem Großbauern geschickt worden, wo sie sich als Magd verdingte. Viele Jahre war es gut gegangen. Doch zum Weihnachtsfest 1899 war sie nach Hause gekommen, mit einem dicken Bauch. Ob nun der Bauer der »Täter« gewesen war oder einer seiner Knechte, muss aus der verstörten Fünfundzwanzigjährigen nicht herauszukriegen gewesen sein. Ja, man vermutete gar, dass sowohl der Bauer als auch der eine oder andere seiner Knechte »die Hand im Spiel« gehabt hatten, sodass die Magd wirklich nicht zu sagen vermochte, wer der Vater des Kindes sei. Zumindest hatte die Bäuerin, als sie die Schwangerschaft bemerkte, meine Tante gefeuert.
Um nun sich und seiner Familie die Schande zu ersparen, dass ein Bankert in seinem Hause aufwachse, brachte Jacob seine Tochter gleich am übernächsten Tag in ein Heim für ledige Mütter, das von Nonnen geleitet wurde und entfernt genug lag, sodass Catherine dort in aller Heimlichkeit ihr Kind zur Welt brachte.
Nach der Entbindung konnte sie dort verbleiben, das Kleine unbemerkt aufziehen und sogar den Lebensunterhalt für sie beide in dem Heim verdienen. Sie musste nur, wie die anderen »gefallenen Mädchen« auch, die üblichen Hausarbeiten verrichten, auf den Feldern mitarbeiten und in der riesigen Waschküche helfen. In diesem Haus wurde nämlich nicht nur die gesamte Wäsche für ein nahe gelegenes Krankenhaus gewaschen, sondern auch für einige Hotels aus der Umgebung.
Der Hauptgrund, warum Jacob diese Tochter nicht im Haus behielt, war allerdings der, dass sich seine anderen Töchter nicht ermuntert fühlen sollten, dem Beispiel ihrer Schwester zu folgen.
Am 28. Februar 1900 wurde also in dem Heim für ledige Mütter ein gesunder Junge geboren, dem Catherine den Namen Karl gab. Davon erfuhr ihr Vater aber nichts, denn er hatte ihr jeglichen Kontakt zur Familie untersagt. Wie sie sich dabei fühlte, kümmerte ihn nicht.
Seine Vorsichtsmaßnahme, die Schwangere so schnell in die Verbannung zu schicken, hatte so gut wie nichts genützt. Es war noch kein halbes Jahr vergangen, da kam Anna-Maria, die in einem vornehmen Stadthaushalt gedient hatte, nach Hause, ebenfalls in anderen Umständen. Auch sie konnte angeblich keinen Kindsvater benennen. Obwohl bei ihr – zur Erleichterung des Vaters – von der Schwangerschaft noch nichts zu sehen war, hatte der nichts Eiligeres zu tun, als die zweite »gefallene« Tochter ebenfalls in das bewusste Heim zu bringen. Mitsamt ihrem Bündel lieferte er sie an der Pforte ab. Er machte sich auch nicht die Mühe, Catherine und sein Enkelkind zu besuchen. Ja, er fragte noch nicht mal nach, was es denn geworden sei und wie es den beiden ging.
Am 10. Dezember 1900, also nur knapp zehn Monate nach ihrer Schwester, gebar Anna-Maria ebenfalls einen Sohn, dem sie den Namen Jakob gab. Auch ihr hatte der Vater strikt verboten, Kontakt zur Familie aufzunehmen. So blieb auch sie in dieser Einrichtung, die ihr Anonymität, ein Dach über dem Kopf und das tägliche Brot bot.
Aus Angst, seinen drei jüngsten Töchtern könne ein ähnliches Schicksal widerfahren, kündigte er umgehend ihre Arbeitsstellen und beorderte sie schnellstens nach Hause. Damit sie aber daheim nicht untätig herumsaßen und sich ihren Unterhalt selbst verdienen konnten, ließ er sie in den Sommermonaten bei Bauern in der Umgebung als Tagelöhnerinnen arbeiten, sodass sie am Abend ins Elternhaus zurückkehren und unter seiner Aufsicht die Nacht verbringen konnten. Im Winter durfte mal die eine und mal die andere einen mehrwöchigen Nähkurs in einem Nonnenkloster besuchen, während die anderen zu Hause der Mutter halfen.
Jahre später, als die drei Jüngsten aus dem Haus waren – zweien von ihnen hatte der Vater einen ordentlichen Ehemann zugebracht, und die Letze war, wie wir wissen, ins Kloster gegangen –, überkam den Jacob so etwas wie Sehnsucht nach seinen beiden verstoßenen Töchtern. Oder war es sein schlechtes Gewissen, das sich rührte? Jedenfalls machte er sich auf den Weg, um sie nach Hause zu holen. Er staunte nicht schlecht, als ihm jede einen gesunden, wohlerzogenen Sohn präsentierte. Ganz gegen seine Gewohnheit drückte er die beiden Enkel voller Rührung an die Brust. Dabei soll sein erster Satz gewesen sein: »Endlich hab ich die Buben, die ich mir immer gewünscht habe.« Nach einiger Zeit muss er hinzugefügt haben: »Ich kann gar nicht begreifen, warum ich auf diese Freude so lange verzichtet habe.«
Als er seine beiden Töchter mit ihren Söhnen ins Elternhaus brachte, schloss seine Frau alle überglücklich in die Arme. Dann tat sie den Ausspruch: »Nun hast du doch endlich die Buben, die deinen Namen weitertragen.«
Da schlug er sich mit der Hand vor die Stirn und rief aus: »Du hast recht! Ja, was bin ich blöd gewesen!« Von da an war er mit seinem Schicksal völlig ausgesöhnt. Er soll seinen beiden Töchtern sogar dankbar dafür gewesen sein, dass sie ihre Kinder unehelich zur Welt gebracht und damit den Namen Rink weitergereicht hatten. Als die zwei bald darauf Ehemänner fanden, die sogar bereit gewesen wären, die Söhne zu adoptieren, beschwor der Vater sie, das nicht zuzulassen.
Nachdem Catherine im Jahre 1911 im Alter von siebenunddreißig Jahren gestorben war, nahm Jacob den Enkel Karl zu sich; zum einen, damit der arme Junge nicht bei seinem Stiefvater aufwachsen musste, zum anderen hatte er seine Freude daran, den Buben selbst großzuziehen.
Sigune erinnert sich
Vorstehende Geschichte erfuhr ich erst von meiner Oma, als ich bereits fünfzehn und reif genug für solche Enthüllungen war.
Von all ihren Geschwistern wusste mir Lina etwas zu berichten, Gutes und Schlimmes. Von Peter aber, ihrem ältesten Bruder, der mein Großonkel war, sprach sie stets mit besonderer Hochachtung, obwohl sie ihn kaum gekannt hatte.
Peter, im Jahre 1890 geboren, verließ nämlich bereits 1904 das Elternhaus, als seine kleine Schwester Magdalena, kurz Lina genannt, erst drei Jahre alt war. Durch Vermittlung eines Kaplans war er in die Klosterschule der Steyler Missionare in St. Wendel/Saar eingetreten. Nach dem Abitur ging er noch weiter von zu Hause weg, nach St. Gabriel in der Nähe von Wien, wo er sein Noviziat absolvierte. Dort legte er 1912 seine zeitlichen Gelübde ab und drei Jahre später die ewigen. Am ersten Oktober 1915 wurde er zum Priester geweiht und schon kurz danach im Ersten Weltkrieg als Militärgeistlicher eingesetzt, bevor er eine Stelle als Gymnasiallehrer in St. Wendel antrat. Von dort kam er 1926 nach Steyl in Holland ans Gymnasium, wo er mit nur kurzen Unterbrechungen bis an sein Lebensende blieb.
Er erteilte seinen Schülern eifrig Unterricht in den drei Fächern Musik, Deutsch und Biologie. In seiner Eigenschaft als Musiklehrer leitete er das Orchester und den Chor der Schule, studierte mit seinen Schülern Theaterstücke ein und gestaltete alle Feiern im Haus. Seine besondere Leidenschaft aber galt der Botanik. Über vierzig Jahre lang widmete er sich der Aufgabe, mit den Schülern einen botanischen Garten anzulegen. Im Jahre 1932 erfolgte durch Pater Peter der erste Spatenstich, und zwar in einem Gelände, das bereits Arnold Janssen (1837–1909), der Ordensgründer, als Garten angelegt hatte. Pflanzte Pater Jochum auf diesem Grundstück anfangs nur Gewächse, die im Freien gediehen – er benötigte sie als Anschauungsmaterial für seine Schüler –, so richtete er später auch Gewächshäuser ein. Als Erstes entstand ein Haus für große Pflanzen wie Palmen und Bananenstauden. Es folgten ein Kakteenhaus und ein Treibhaus für subtropische Pflanzen.
Jeden seiner Mitbrüder, den das Kloster als Missionar in andere Erdteile schickte, bat er darum, ihm zum Heimaturlaub Samen von landestypischen Pflanzen mitzubringen. So blühte in Steyl bald eine exotische Vielfalt, von der Ananasstaude bis zum Zitronenbaum. Vor allem gab es auch die herrlichsten Orchideenarten.
Da diese Anlage aber immer größere Ausmaße annahm, konnte es sich das Kloster bald nicht mehr leisten, sie zu unterhalten. Deshalb ging der botanische Garten in eine Stiftung über, die ihm – dem Gründer zu Ehren – den schönen Namen »Jochum-Hof« gab. Von da an war der Garten der Öffentlichkeit zugänglich, gegen Eintrittsgeld, versteht sich. Mit den Einnahmen wurde der Jochum-Hof nicht nur unterhalten, man konnte ihn sogar erweitern, was sehr im Sinne meines Großonkels war.
Zu seinem achtzigsten Geburtstag wurde Pater Jochum eine zusätzliche Ehre zuteil. Um sein Lebenswerk zu würdigen, weihte man in einer großen Feierstunde in seinem botanischen Garten eine Bronzebüste ein, die ihn darstellte. Das war aber noch nicht alles. Königin Juliana der Niederlande verlieh ihm den Verdienstorden als »Ridder in de Ordre von Oranje-Nassau«. Von diesem und der Bronzebüste konnte ich mich selbst überzeugen, und zwar bereits im zarten Alter von elf Jahren.
Doch schon Jahre vorher hatte ich diesen Großonkel kennengelernt. Mein Vater hegte eine große Schwäche für Holland – warum, weiß ich nicht. Jedenfalls kann ich mich an meine erste »Fernreise« noch lebhaft erinnern.
Ich war gerade mal viereinhalb Jahre alt, da packte Papa seinen VW-Kombi voll bis obenhin. Außer uns fünf Personen und dem benötigten Gepäck mussten auch noch ein Zelt, ein Campingtisch, fünf Klappstühle und fünf Schlafsäcke mit. So düste Papa nonstop nach Holland, direkt ans Meer. Mitten in den Dünen schlugen wir unser Lager auf. Mama und Papa schliefen hinten im Kombi und ich schlief auf den Vordersitzen. Meine Geschwister durften im Zelt gleich nebenan übernachten.
Am nächsten Morgen ging es ins Meer, was jedoch für mich alles andere als erfreulich war. Eigentlich wollte ich nur ein bisschen im seichten Wasser herumwaten. Doch die Wellen der steigenden Flut warfen mich Leichtgewicht immer wieder um, wodurch ich eine Menge Salzwasser zu schlucken bekam. Das behagte mir gar nicht, deshalb hielt ich mich bald nur noch in respektvoller Entfernung zum Wasser auf. Meine übrige Familie hatte jedoch großen Spaß daran, in den Wellen zu plantschen und zu schwimmen. Meine einzige Freude bei diesem Aufenthalt am Meer bestand darin, mit Edda Muscheln zu sammeln.
Auf der Rückreise machten wir Halt am Steyler Missionshaus, um den Onkel meiner Mutter zu besuchen, wobei er uns auch mit Stolz in seinem botanischen Garten herumführte.
Als ich elf war, machte ich eine zweite Reise zu Onkel Peter, die erste Bahnreise meines Lebens. Begleitet wurde ich von Jakob, dem jüngsten Bruder meiner Oma. Als Pater Jochums Gäste durften wir in der »Villa Elise« übernachten, einem schönen alten Prachtbau, der zum Kloster gehörte. Bei dieser Gelegenheit zeigte uns Pater Peter – nicht ohne Stolz – die Bronzebüste und den königlichen Orden.
Doch das alles konnte mich nicht über mein Heimweh hinwegtrösten, das mich bereits am zweiten Tage überfiel. Zum ersten Mal ohne Eltern und Geschwister unterwegs, und ohne Oma – das war zu viel für mich. Deshalb trat Jakob, der verständnisvolle Großonkel, die Heimreise bereits am dritten Tage an, also wesentlich früher als geplant. Wie war ich glücklich, wieder bei meiner Familie zu sein!
Wie bereits erwähnt, wurde bei Oma Lina das Familienleben großgeschrieben. Die Art, wie Lina mit unserer »Familie« lebte, bedeutete Geborgenheit und Sicherheit. Ja, sie vermittelte uns, dass Familie noch mehr war: ein Hort des Vertrauens und der Kommunikation.
Vor 1971 gab es bei uns noch keinen Fernsehapparat, der jegliche Kommunikation zwischen den Familienangehörigen verhindert hätte, weil alle stur in die Glotze gestarrt hätten, wie heute so oft. Als ich zwölf war, stellten meine Eltern der Oma einen Fernseher ins Wohnzimmer – man musste ja mit der Zeit gehen. Aber auch dann pflegte sie nach wie vor ihre alten Gewohnheiten. Den Kasten ließen wir meist aus, versammelten uns am Abend um den Küchentisch, machten Spiele oder redeten miteinander. Am allerschönsten war es, wenn Lina von früher erzählte. Dann lauschten wir wie gebannt und konnten gar nicht genug kriegen.
Eine unserer Lieblingsgeschichten war die von der »Ferkelsau« – zum Glück einer von den Berichten, den Lina am liebsten zum Besten gab. Weil ich die Geschichte so oft hörte, bleibt sie für mich unvergesslich. Sie ereignete sich, als Oma noch eine junge Frau war, aber schon in diesem Haus lebte.
Lina erzählt weiter
Die Ferkelsau
Es war Anfang der Dreißigerjahre, da wachte ich eines Nachts kurz vor drei Uhr, von innerer Unruhe getrieben, auf. Sogleich lief ich in den Schweinestall. Ich wusste nämlich, dass unsere große Sau kurz vor dem Werfen stand. Nach einer alten Faustregel trägt eine Sau drei Monate, drei Wochen und drei Tage, die waren gerade um. Natürlich halten sich nicht alle Säue an diese Regel.
Bei unserer Rosa war es tatsächlich so weit, ich kam keine Sekunde zu früh. Als ich den Schweinekoben betrat, war das erste Ferkel schon da. Um Platz fürs zweite Schweinchen zu schaffen, legte ich das Erstgeborene gleich bei seiner Mutter an. Dann ging es Schlag auf Schlag. Wie am Fließband kamen die quiekenden Tierchen auf die Welt. So sehr ich mich auch beeilte, ich schaffte es immer nur knapp, ein Ferkel an die Zapfstelle zu legen, da war das nächste schon da. Jedes Mal, wenn ich meinte, es sei das Letzte, hörte ich die Sau grunzen: »Noch, noch, noch!« Das Ferkeln schien schier kein Ende zu nehmen.
Nachdem ich das Zwölfte angelegt hatte, waren alle Nippel besetzt. Zu meiner Verblüffung ging es aber munter weiter. Es folgten ein dreizehntes und noch ein vierzehntes Schweinchen, auch diese beiden quiekten vor Hunger. Was tun? Prüfend guckte ich mir die Reihe der saugenden Ferkelchen an, um die zwei kräftigsten zu entdecken. Kurz entschlossen hängte ich diese ab und platzierte die beiden Neugeborenen an ihre Stelle.
Aufmerksam beobachtete ich eine Weile die zwölfköpfige Geschwisterschar. Alle hingen gierig an den Zapfhähnen, und die Mutter blieb friedlich liegen. Deshalb wagte ich es, sie mit ihrem Wurf allein zu lassen. Mich wieder aufs Ohr legen konnte ich aber nicht. Mir blieb noch die Aufgabe, die beiden zu versorgen, die ich gewaltsam von der Futterquelle entfernt hatte. Würde ich sie im Koben belassen, liefen sie Gefahr, zu verhungern. Es bestand aber auch das Risiko, dass die Mutter die überzähligen Tiere einfach totbiss.
Da unsere Ferkelsau nun mal vierzehn Junge geworfen hatte, entwickelte ich den Ehrgeiz, sie alle durchzubringen, und das nicht nur aus reiner Tierliebe. Jedes Schwein, das ich aufzog, bedeutete auch bares Geld. Die beiden überzähligen Kleinen nahm ich also mit in die Küche, füllte eine Säuglingsflasche mit angewärmter Ziegenmilch, setzte einen Schnuller auf und bot sie dem ersten Ferkel an.
Zu meinem Glück war es nicht wählerisch. Es war eine Freude, zu sehen, wie es kräftig am Schnuller saugte. Das andere konnte es kaum erwarten, bis es an die Reihe kam. Beide saugten so gierig, als ob es auf der Welt nichts Besseres gäbe als Milch aus der Flasche. Da hatte ich gewonnen.
Nun brauchten meine beiden Flaschenkinder auch einen Schlafplatz. Diesen richtete ich her, indem ich eine Holzkiste mit Stroh auslegte und neben den Küchenherd stellte. Wohlig kuschelten sie sich ins Stroh und schliefen bald friedlich ein. Endlich wollte ich meinen unterbrochenen Schlaf fortsetzen. Aber ein Blick auf die Uhr belehrte mich, dass es bereits halb sechs am Morgen war, also Zeit zum Aufstehen.
Als mein Mann in die Küche kam, zeigte ich ihm voller Stolz meine beiden »Pflegekinder« und berichtete ihm von der großen Ferkelei. Anschließend führte ich ihn in den Schweinestall. Er freute sich nicht nur, dass wir so viel »Schwein« gehabt hatten, sondern lobte mich auch, was für eine gute Bäuerin ich geworden sei, denn von zu Hause aus besaß ich ja keine Erfahrung mit Landwirtschaft und Viehzucht. Im Stall bei Rosa war alles friedlich, und ich beobachtete mit Genugtuung, dass die »Zwölferbande« wuchs und gedieh.
Meine beiden »Adoptivkinder« wilderte ich erst aus, als alle Schweinchen kräftig genug waren, um richtiges Schweinefutter zu fressen, sodass für sie keine Gefahr mehr bestand, im Stall zu verhungern oder von der Mutter totgebissen zu werden. Tatsächlich habe ich alle vierzehn Ferkel durchgebracht. Weder vorher noch nachher ist es bei uns vorgekommen, dass wir einen so großen Ferkel-Wurf hatten.
Später konnte ich sie gut verkaufen. Genau genommen verkaufte ich nur zwölf der Schweine, denn zwei behielten wir selbst, weil es bei uns zweimal im Jahr ein Schlachtfest gab.
In dem Kessel, in dem sonst das Schweinefutter gekocht wurde, bereiteten wir dann die »Worschdsopp« zu, also die Brühe, in welcher der Saumagen, das Wellfleisch sowie die Blut- und Leberwürste gesiedet wurden. Wie die Heuschrecken fielen dann die Verwandten und Nachbarn bei uns ein, mit Milchkannen und Töpfen ausgerüstet, um etwas von der Suppe zu ergattern. Umgekehrt gingen wir natürlich auch zu ihnen, um Wurstsuppe abzustauben, wenn sie geschlachtet hatten.
Es war üblich, dass jeder noch ein Leber- oder Blutwürstchen mitbekam. Die großen Würste aber und die schönen Schinken, die der Opa in seinem Räucherhäuschen räucherte, behielten wir für uns, denn der Winter war lang, und erst im nächsten Jahr zu Ostern würde eine weitere Sau fett genug fürs Schlachtfest sein.
Der Teufel im Plumpsklo
Über meinen Bruder Peter kann ich nichts Nachteiliges sagen; er war immer ein feiner Kerl. Mein zweiter Bruder aber, der Fritz, fünf Jahre älter als ich, hatte es faustdick hinter den Ohren. Von klein auf hatte er lauter »Deiweleien«, kleine Teufeleien, im Kopf und lernte unsere jüngeren Brüder rechtzeitig an, es ihm nachzutun.
Eines Sommerabends nach dem Abendessen, es war schon etwas dämmrig, suchte ich das stille Örtchen auf, das sich in unserem Garten in gebührendem Abstand zum Wohnhaus befand. Zu der Zeit muss ich zehn oder elf gewesen sein. An nichts Böses denkend, ließ ich meine Unterhose runter und richtete mich auf der kreisrunden Öffnung gemütlich ein. Während meiner Sitzung trällerte ich recht gut gelaunt ein fröhliches Liedchen vor mich hin.
Doch plötzlich stockte mir der Atem, unter mir war etwas! Etwas Krallenartiges hatte meinen Allerwertesten berührt! Auf meinen Schreckensschrei erfolgte ein mehrstimmiges schauriges Hohngelächter.
Wie von der Tarantel gestochen, fuhr ich in die Höhe, ließ meine Hose in der Eile am Boden liegen und rannte laut schreiend aufs Haus zu. Sofort stürmten alle in den Garten: der Vater, die Mutter und meine Schwestern. Sie dachten, es sei etwas Schreckliches passiert.
Völlig außer Atem keuchte ich: »Oje, ich glaab, de Deiwel is hinner mir her!«
»Ich glaab, den Deiwel kenn ich«, rief mein Vater und setzte sich mit Riesenschritten in Richtung Abort in Bewegung.
Sie wollen wissen, wie es weitergeht?
Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!
Weitere E-Books von Roswitha Gruber
Wir Bauernkinder
eISBN 978-3-475-54562-7 (epub)
Aus heiterem Himmel werden die zehn- und elfjährigen Schwestern Erna und Liesl auf den Hof ihres Onkels geschickt, um dort als Mägde zu arbeiten. Die beiden Mädchen begreifen schnell, dass sich ihr geordnetes Leben nun verändern wird. Besonders Erna geht immer mehr in der Rolle als Bäuerin auf. Doch ihr Vater hat andere Pläne mit seinen Töchtern …
Ein Bauernleben
eISBN 978-3-475-54441-5 (epub)
Für die Familie Edelhofer steht der Hof über allem. Die Menschen, die auf ihm wohnen, erleben persönliche Tragödien, aber auch viel Freude und Liebe. So erzählt Roswitha Gruber von einem Leben voll Arbeit und Pflicht. Auf faszinierende Weise berichtet sie von schweren Aufgaben und Entscheidungen genauso wie von den schönen Erlebnissen.
Die Kinder der Dienstmagd
eISBN 978-3-475-54356-2 (epub)
Die Magd Elisabeth und der Knecht Franz träumen davon, zu heiraten. Als sich die Möglichkeit ergibt, einen Hof zu pachten, können sie als Bauersleute eine Familie gründen. Sie führen ein erfülltes Leben, bis ein Unglück Elisabeth und ihre Kinder zurück in den dienenden Stand zwingt. Einfühlsam und packend werden die Lebenswege von Elisabeths Nachfahren erzählt.
Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com