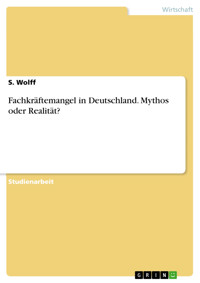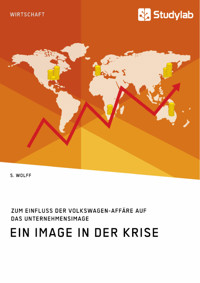
Ein Image in der Krise. Zum Einfluss der Volkswagen-Affäre auf das Unternehmensimage E-Book
S. Wolff
34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Volkswagen-Konzern hat ein akutes Problem: In den USA wurden im September 2015 Abgasmanipulationen von VW-Dieselmotoren festgestellt. Der Skandal weitete sich schnell international aus, was einen gravierenden Imageschaden sowie Vertrauensverlust zur Folge hatte. Volkswagen ist nicht nur ein fester Bestandteil der internationalen Wirtschaft und Industrie, sondern gilt auch als deutsches Traditionsunternehmen mit hohen Qualitätsansprüchen. Doch die VW-Krise hat nicht nur medial weite Kreise gezogen, sondern auch bei den Stakeholdern einen negativen Eindruck hinterlassen. Der richtige Umgang mit Stakeholdern kann darüber entscheiden, ob ein Unternehmen sich trotz einer Krise am Markt behaupten kann. S. Wolff erklärt deshalb, wie eine erfolgreiche Krisenkommunikation ausfallen sollte. Das Beispiel des VW-Konzerns liefert dazu ein Negativbeispiel, aus dem zukünftige Krisenmanager viel lernen können. Wolff zeigt auf, wie eine Stakeholder-Krise entsteht und wie sich diese erfolgreich abwenden lässt. Aus dem Inhalt: - VW-Krise; - Abgasskandal; - Volkswagen; - Stakeholder; - Krisenkommunikation
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2018 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Wissenschaftliche Relevanz
1.2 Forschungsfrage
1.3 Definition der verwendeten Begriffe
2 Die Volkswagen-Affäre
2.1 Der VW Konzern und die Unternehmenskultur
2.2 Krisenkommunikation
2.2.1 Bestandteile einer gelungenen Krisenkommunikation
2.2.2 Pressestimmen: Krisenkommunikation VW in der Praxis
2.2.3 Analyse der Krisenkommunikation VW
2.3 Imageschaden
2.4 Wirtschaftliche Konsequenzen
2.4.1 Jahresabschluss – Ausblick
3 Quantitative Befragung
3.1 Idee, Erläuterung und Ziel des Instruments
3.2 Pretest und Schlussfolgerung aus dem Pretests
3.3 Durchführung der Befragung
3.3.1 Auswertung der Ergebnisse
3.3.2 Fazit der Ergebnisse
4 Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang
Anhang 1: Vergleichende Analyse der Pressemitteilungen von VW
Anhang 2: Zusatzantworten der Online-Umfrage
Anhang 3: Auswirkungen einer Stakeholder-Krise (SurveyMonkey)
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Der Umgang mit Medien in Anlehnung an Garth 2008
Abbildung 2: Das Image-Indikatoren-Tableau nach Buss und Fink-Heuberger 2000
Abbildung 3: Assoziationen mit Volkswagen
Abbildung 4: Wie haben Sie vom Abgas-Skandal erfahren?
Abbildung 5: Beurteilung der Abgas-Affäre
Abbildung 6: Begründung der Beurteilung
Abbildung 7: Wie stehen Sie zu diesen Aussagen?
Abbildung 8: Wie stehen Sie zu diesen Aussagen?
Abbildung 9: Empfehlungen zur Krisenkommunikation
1 Einleitung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen einer Unternehmenskrise und dem daraus resultierenden Einfluss auf das Image eines Unternehmens. Die gesamte Arbeit ist in vier wesentliche Kapitel aufgeteilt: Der Einstieg beinhaltet zunächst die Einordnung der wissenschaftlichen Relevanz. Nachdem die Forschungsfrage und die verwendeten Begriffe definiert worden sind, wird im folgenden zweiten Kapitel auf die Krisenkommunikation eingegangen. Dazu werden zunächst die Bestandteile einer gelungenen Krisenkommunikation durch hinzugezogene Fachliteratur erläutert, woraufhin dann die Krisenkommunikation anhand des aktuellen Fallbeispiels Volkswagen untersucht wird. Dieser Abschnitt beinhaltet sowohl die Darstellung der Unternehmenskultur, die Auswirkungen auf das Unternehmensimage als auch einen Ausblick auf wirtschaftliche Konsequenzen für den Automobilhersteller. Um die Forschungsfrage beantworten zu können, widmet sich das dritte Kapitel der quantitativen Befragung zum Imageschaden des VW Konzerns. Neben der Erläuterung des Instruments, wird anschließend ein Pretest durchgeführt. Nach der Prüfung des Instruments wird die Befragung im Feld ausgeführt. Im nächsten Schritt werden die Ergebnisse ausgewertet, sodass ein Rückschluss zur Forschungsfrage ermöglicht wird. Im letzten Abschnitt des dritten Kapitels werden die Forschungsergebnisse zusammengefasst und auf mögliche Fehlerquellen verwiesen. Das letzte Kapitel beinhaltet ein Fazit der gesamten Arbeit.
1.1 Wissenschaftliche Relevanz
„Imagepflege ist keine Lackpflege, kein Aufpolieren von Oberflächenglanz, sondern eine Frage der Qualität der ganzen Konstruktion.“[1] Der Ex-Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz AG Niefer bringt es auf den Punkt: Das Unternehmensimage kann nicht nur die fundamentale Basis eines Unternehmens sein, sondern ist abhängig von der Qualität des gesamten Unternehmens. Der aktuelle Abgas-Skandal bei der Volkswagen AG kann das Unternehmensimage aus Sicht der Stakeholder verändert haben. Ob und in welchem Ausmaß Auswirkungen auf das Unternehmensimage von VW festzustellen sind, bezeichnet die wissenschaftliche Relevanz dieser Arbeit.
Der VW Konzern hat ein akutes Problem: In den USA wurden im September 2015 nach Ermittlungen der Umweltbehörde EPA[2] Abgasmanipulationen von VW-Dieselmotoren festgestellt. Der Skandal weitete sich schnell international aus, da bei insgesamt rund elf Millionen Autos[3] der Motortyp, der die Abgaswerte manipuliert, eingebaut worden sei. Auch die Bundesregierung zeigt sich empört über die bewusste Täuschung der Emissionswerte durch VW. Laut Umweltministerin Hendricks stehe der Ruf der Marke „Made in Germany“ auf dem Spiel, denn der Abgas-Skandal werfe einen Schatten auf die Versprechen deutscher Unternehmen, sobald sich ein Weltkonzern wie VW derart eklatant über Umweltregeln hinwegsetze.[4] Volkswagen ist somit nicht nur ein fester Bestandteil der internationalen Wirtschaft und Industrie, sondern gilt vielmehr als deutsches Traditionsunternehmen mit hohen Qualitätsansprüchen. Dass gerade der Volkswagen Konzern durch sukzessiv manipulierte Abgaswerte Schlagzeilen macht, erschüttert nicht nur die Politik, sondern die gesamten Stakeholder. Das Resultat der Krise scheint zunächst klar: negative Beurteilung in der Presse, Imageschaden und Vertrauensverlust.
Um die wissenschaftliche Relevanz dieser Arbeit weiter aufzuzeigen, sollen einleitend vor allem zwei Faktoren als bedeutend herausgestellt werden: Durch den Paradigmenwechsel in der Unternehmenskommunikation, gilt Kommunikation heute als enormer Wertschöpfungsfaktor eines Unternehmens. Durch verkürzte Reaktionszeiten – dank des Web 2.0 – und den damit verbundenen Legitimationszwang ist es für Unternehmen unerlässlich, auf Krisen mit der richtigen Kommunikation zum richtigen Zeitpunkt zu reagieren, um langfristige (Reputations-) Schäden zu verhindern. Der richtige Umgang mit Stakeholdern in einer Unternehmenskrise kann maßgeblich dazu beitragen, dass das Unternehmen weiterhin am Markt besteht, das Unternehmensimage wiederhergestellt und zukünftig neu gefestigt werden kann. Welche Auswirkungen hingegen eine gescheiterte Krisenkommunikation hervorruft, wird durch die im nächsten Abschnitt erläuterte Forschungsfrage am Beispiel der Unternehmenskrise des Volkswagen-Konzerns thematisiert. Neben der Relevanz von interner und externer Kommunikation mit den Stakeholdern steht das aktuelle Beispiel aus der Praxis der wissenschaftlichen, theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema gegenüber, um auf diese Weise die Auswirkungen einer Stakeholder-Krise auf das Image eines Unternehmens über die Grenzen des VW Konzerns hinaus darstellen zu können.
1.2 Forschungsfrage
In diesem Abschnitt soll die Forschungsfrage operationalisiert und erläutert werden. Da die VW-Krise nicht nur medial große (internationale) Wirkungskreise gezogen hat, sondern auch bei den Stakeholdern einen negativen Eindruck hinterlassen haben kann, soll die Arbeit im weiteren Verlauf herausstellen, welche Auswirkungen die Krisenkommunikation von VW auf das Unternehmensimage hat. Da es gerade in einer Krisensituation darauf ankommt, keine nachhaltigen Reputations- und Imageschäden auszulösen, wird aus aktuellem Anlass die Krisenkommunikation des VW Konzerns zur Untersuchung des Forschungsthemas herangezogen. Dabei steht die Frage, welche Auswirkungen die Stakeholder-Krise von VW auf dessen Unternehmensimage hat und vor allem inwieweit die Krisenkommunikation eine Korrelation zu den Auswirkungen auf das Unternehmensimage aufweist, im Fokus dieser Arbeit. Weiter gründet das Forschungsinteresse darin durch eine quantitative Befragung herauszufinden, wie sich der Zusammenhang zwischen einer gescheiterten Krisenkommunikation und Imageschaden im aktuellen Fallbeispiel von Volkswagen darstellt und, ob der Automobilhersteller überhaupt mit langfristigen Schäden rechnen muss. Um die Forschungsfrage intersubjektiv nachvollziehbar zu machen, werden im kommenden Abschnitt 1.3 die verwendeten Begriffe definiert.
1.3 Definition der verwendeten Begriffe
Die nachfolgenden Definitionen und Erklärungen der in der Forschungsfrage verwendeten Begriffe soll die einheitliche Interpretation dieser gewährleisten und zum besseren Verständnis dieser Arbeit beitragen. Dazu werden zunächst die Begriffe Krise, Stakeholder und (Unternehmens-)Image als auch die Abgrenzung zum Identity-Begriff erläutert. Auch der Begriff der Auswirkungen wird im folgenden Abschnitt genauer dargelegt.
Da sich die vorliegende Arbeit mit einer Unternehmenskrise beschäftigt, wird der Begriff „Krise“ zunächst hinsichtlich des Forschungsgegenstands definiert. Zur Einordnung des Begriffs, wird erst der Wortursprung erläutert, woraufhin es verschiedene Annäherungen an den Begriff mit Hilfe von Fachliteratur geben wird.[5]
Die Krise leitet sich aus dem Altgriechischen κρίσις (krísis) ab und bezeichnet übersetzt (u.a.) eine bedeutende Wendung in einer schwierigen Situation.[6] Konkret formuliert sind Krisen laut Krystek „ungeplante [...] Prozesse von begrenzter Dauer und Beeinflussbarkeit sowie mit ambivalentem Ausgang.“[7] Krisen sind zunächst Entwicklungen, „die größeren wirtschaftlichen Schaden und Reputationsverlust verursachen,“[8] und in der Lage seien, den Fortbestand eines Unternehmens substanziell und nachhaltig zu gefährden.[9] Zu unterscheiden sei dabei die hausgemachte von der operativen Krise.[10] Während bei operativen Krisen Ereignisse von außen auf das Unternehmen hereinbrechen, beispielsweise Unglücksfälle oder Entführungen, sind „hausgemachte“ Krisen selbstverschuldet. Um den weitgefassten Krisenbegriff näher einzugrenzen, soll außerdem die Abgrenzung des determinierten Ereignisses[11] dienen, das die regulären Geschäftstätigkeiten komplizieren kann. Inwieweit die Geschäftstätigkeiten eines Unternehmens beeinträchtigt werden können, hängt davon ab, in welcher Phase der Krise das Unternehmen steckt. Um die Phase der Krise bei VW genau zu definieren, dient die Einteilung in drei Krisen-Phasen: Während in der potenziellen Krise die Handlungsmöglichkeiten des Unternehmens noch groß seien, nehme die Möglichkeit zu Handeln in der latenten Krise bereits deutlich ab.[12] Der VW Konzern befindet sich bereits in der akuten Krise. Das bedeutet, dass die Öffentlichkeit bereits um die Abgas-Manipulationen durch die verbaute Software weiß. In dieser Phase habe das Unternehmen nur noch wenige Handlungsmöglichkeiten und gleichzeitig den größten Handlungsbedarf, da das Unternehmen in der akuten Krise unter erheblichem Druck von innen und außen stehe, Lösungen anzubieten.[13]
Als Stakeholder werden interne und externe Gruppen oder Einzelpersonen verstanden, die ein berechtigtes Interesse an einem Unternehmen und dessen Geschäftsverläufen haben. Die Anspruchsgruppen sind von den „unternehmerischen Tätigkeiten gegenwärtig oder zukünftig direkt oder indirekt betroffen.“[14] Darunter zählen beispielsweise Mitarbeiter, Anteilseigner, Geldgeber, Kunden, Lieferanten oder der Staat und die Politik.[15]
Stakeholder stellen externe Einflussgrößen für Unternehmen dar, die von großer Bedeutung sind. Diese sind maßgeblich daran beteiligt, ob sich das Unternehmen dauerhaft am Markt positionieren und sich gegen Wettbewerber durchsetzen kann. Aus diesem Grund sehe die Unternehmensführung einen Nutzen darin, mit allen Anspruchsgruppen in Verbindung zu treten und im Interesse aller Anspruchsgruppen angemessen und fair zu handeln.[16]
Ein weiterer zentraler Begriff dieser Arbeit ist außerdem das Unternehmens-image[17]. Wortetymologisch gesehen, stammt der Begriff aus dem Lateinischen „imago“, das mit Bild übersetzt werden kann.[18] Das heutzutage aus dem Englischen abgeleitete Wort „Image“ steht übersetzt (u.a.) für Bild, Vorstellung, Darstellung, Profil, Abbild und Erscheinungsbild.[19] Im Duden findet sich als Definition eine Vorstellung, ein (idealisiertes) Bild, das ein Einzelner oder eine Gruppe habe und als Bild in der öffentlichen Meinung.[20] „Image“ bezeichnet das „mentale Bild einer Person von einem Bezugsobjekt; dazu gehört alles, was die Person über das Objekt weiß, dazu glaubt, sich darunter vorstellt und damit verbindet.“[21] Während das Image also vorwiegend als Bild verstanden wird, ist es für Johannsen bereits im Jahr 1971 mehr als das: Image ist ein „komplexes, anfänglich mehr dynamisches, im Laufe seiner Entwicklung sich (stereotyp) verfestigendes und [...] zur Stabilität und Inflexibilität neigendes, aber immer beeinflussbares mehrdimensionales System, dessen wahre Grundstrukturen dem betreffenden Imageträger oft nicht voll bewusst sind.“[22] Johannsens Image-Definition berücksichtigt die Komplexität des Begriffs und stellt das Image erstmals als System dar, dessen sich Unternehmen bedienen. Neben dieses Verständnis, das Image als komplexes System zu deuten, stelle die Bildhaftigkeit, Sozialforscher Mayerhofer nach zu urteilen, ein weiteres wesentliches Merkmal des Imagebegriffs dar.[23] Das Image sei die Ganzheit objektiver und subjektiver, teilweise stark emotional getönter Vorstellungen, Erfahrungen, Ideen, Gefühle und Einstellungen einer Person bzw. einer Personengruppe von einem Meinungsgegenstand.[24] Dabei ist das entstandene Bild eines Unternehmens sowohl extern als auch intern von Aktivitäten des Unternehmens geprägt.
Diese Einflüsse tragen außerdem dazu bei, dass sich das interne und externe Umfeld emotional und kognitiv mit dem Unternehmen auseinandersetzt und so ein Fremdbild des Unternehmens entsteht. Das entstandene Fremdbild wiederum hänge eng „mit der Glaubwürdigkeit und dem Vertrauen“[25] zusammen, so Kiessling und Babel. Das Unternehmensimage ist zwar ein wesentlicher Teil der gesamten Corporate Identity – dennoch muss hier eine Abgrenzung erfolgen, da sie nicht deckungsgleich mit dem Image ist. Das „Corporate Image ist das Vorstellungsbild, das sich Kunden, Lieferanten, Kooperationspartner, Vertreter der Medien, die Gesellschaft (extern) und Mitarbeiter (intern) von der Einrichtung gemacht haben.“[26] Die Identity hingegen bezeichnet im begrifflichen Sinne, „das (wirtschaftliche) Handeln einer Gruppe von Einzelpersonen, die im Inneren eine Einheit bilden und nach außen als Ganzes von anderen unterschieden werden können.“[27] Ein gutes Image soll Reputation durch Wertkonsens in der breiten Öffentlichkeit aufbauen[28] und es gilt, „Vertrauensbindungen zu stärken, klar differenzierte Identifikationsmöglichkeiten für Teilöffentlichkeiten zu schaffen“[29] und darüber hinaus schließlich die „Handlungsfreiheiten einer Organisation zu erhöhen.“[30]
Auswirkungen lassen sich wie folgt definieren: Die laut Duden „sich auswirkende Folge“[31]
2 Die Volkswagen-Affäre
Das zweite Kapitel beinhaltet im ersten Abschnitt zunächst eine kurze Darstellung des gesamten Volkswagen Konzerns und dessen Unternehmenskultur. Im weiteren Verlauf wird der Fokus dann auf die Krisenkommunikation gelegt: Während in Kapitel 2.2.1 die Bestandteile einer gelungenen Krisenkommunikation dargelegt werden, wird die Krisenkommunikation von VW im Folgenden mit Hilfe von verschiedenen Pressestimmen genauer durchleuchtet. Im folgenden Kapitel 2.2.3 wird die Krisenkommunikation von VW im aktuellen Fall auf Grundlage der zuvor aufgestellten Faktoren einer gelungenen Krisenkommunikation, der dargestellten Pressestimmen und auf Basis einer vergleichenden Analyse dreier Pressemitteilungen von VW untersucht und abschließend bewertet. Nach der Analyse der Krisenkommunikation wird in Kapitel 2.3 die Konzentration zunächst auf den Imageschaden gelegt, woraufhin im nächsten Abschnitt 2.4 die wirtschaftlichen Konsequenzen der Stakeholder-Krise aufgezeigt und gedeutet werden. Der Ausblick des Jahresabschlusses in Kapitel 2.4.1 soll zur weiteren Vertiefung des wirtschaftlichen Schadens der Volkswagen AG dienen.
2.1 Der VW Konzern und die Unternehmenskultur
Um die Unternehmenskultur des Automobilherstellers genauer durchleuchten zu können, sollen zunächst verschiedene Kennzahlen zur Einordnung des Konzerns dienen. Daraufhin werden sowohl die Unternehmensziele als auch die Visionen kurz erläutert. Als besonders bedeutend sollen im Kontext dieser Arbeit und hinsichtlich der Unternehmenskultur vor allem die Unternehmensleitsätze und Verhaltensgrundsätze von Volkswagen betrachtet werden, die anhand des Verhaltenskodex und Nachhaltigkeitsberichts im folgenden Verlauf dargelegt werden. Vorab wird die rechtliche Unternehmensstruktur und Geschäftstätigkeit dargestellt, um zwischen der Volkswagen AG und dem Volkswagen Konzern differenzieren zu können.
„Die Volkswagen AG ist die Muttergesellschaft des Volkswagen Konzerns. Einerseits entwickelt sie Fahrzeuge und Komponenten für die Konzernmarken, andererseits produziert und vertreibt sie insbesondere Pkw und leichte Nutzfahrzeuge der Marke Volkswagen Pkw und Volkswagen Nutzfahrzeuge. In ihrer Funktion als Muttergesellschaft hält die Volkswagen AG [...] Beteiligungen an der Audi AG, [...] der Volkswagen Financial Services AG sowie an zahlreichen weiteren Gesellschaften im In- und Ausland.“[32]
Geleitet wird die Volkswagen AG vom Vorstand in eigener Verantwortung – auch der Aufsichtsrat sei in Entscheidungen, die von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen sind, so Volkswagen, unmittelbar eingebunden.[33] Der Volkswagen Konzern, so beschreibt es das Unternehmen selbst, ist ein Mehrmarkenkonzern, bei dem alle Marken in eigenen Gesellschaften rechtlich verselbstständigt sind. Sowohl die VW AG als auch der VW Konzern werden vom Vorstand der VW AG auf Grundlage der Satzung der VW AG und der durch den Aufsichtsrat erlassenen Geschäftsordnung für den Vorstand geleitet.[34] Von Januar 2007 bis zum 23. September 2015 war Herr Winterkorn Vorstandsvorsitzender der VW AG, der wegen des Abgas-Skandals zurücktrat.[35] Abgelöst wurde dieser vom bisherigen Porsche-Chef Müller, der nun „durch schonungslose Aufklärung und maximale Transparenz“ das „Vertrauen für den Konzern zurückgewinnen“[36] soll.
Volkswagen ist nach eigenen Angaben auf dessen Unternehmensseite einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas. Unter Betrachtung der folgenden Kennzahlen, wird die Größe des Konzerns deutlich: Im Jahre 2014 beispielsweise, lieferte das in Wolfsburg ansässige Unternehmen rund 10,137 Millionen Fahrzeuge an Kunden aus.[37] Im Jahr 2014 erzielte VW vor Steuerabzug Umsatzerlöse in Höhe von 202.458 Millionen Euro, nach Steuerabzug erwirtschaftete VW 11.068 Millionen Euro. Insgesamt zählen 118 Produktionsstätten auf vier Kontinenten zum VW Konzern, darunter sind 29 Produktionsstandorte in Deutschland. Die Belegschaft umfasse über 600.000 Mitarbeiter weltweit,[38] wovon, laut der Volkswagen Chronik, rund 300.300 Personen in den Auslandsgesellschaften beschäftigt sind. Bei der VW AG zählen insgesamt ca. 101.800 Personen zur Belegschaft, zum Volkswagen Konzern knapp 550.000.[39] Nicht nur Volkswagen Pkw, sondern auch „Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN“[40]