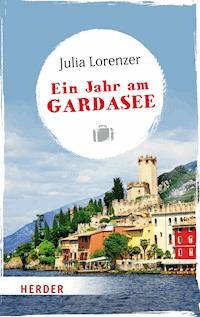
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HERDER spektrum
- Sprache: Deutsch
Endlich will sie ihn verwirklichen, den langgehegten Traum, nach Italien an den Gardasee zu ziehen. Und als das Schild "Rovereto sud – Lago di Garda nord" an ihr vorüberfliegt, ist die Sonne da. Kein Schnee mehr neben der Fahrbahn. Die grauen, schweren Wolken sind ebenso verschwunden wie der dichte Nebel, der den verschneiten Grenzübergang fast vollständig einhüllte. Ein Jahr am Gardasee beginnt, in dem Julia Lorenzer als Barista schuftet, mit Reisegruppen das Umland erkundet, den FC Bayern beim Training beobachtet und vom Fest der Santa Lucia verzückt wird. Das Gerücht stimmt – der Gardasee ist ein Paradies.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Julia Lorenzer
Ein Jahr am Gardasee
Impressum
Titel der Originalausgabe: Ein Jahr am Gardasee
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2017
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Designbüro Gestaltungssaal
Umschlagmotiv: © Freeartist – istock
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book): 978-3-451-81146-3
ISBN (Buch): 978-3-451-06884-3
Inhalt
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
ALS DAS SCHILD MIT DER AUFSCHRIFT „Rovereto sud – Lago di Garda nord“ an mir vorüberfliegt, ist es endlich so weit: Plötzlich ist die Sonne da. Kein Schnee mehr neben der Fahrbahn. Die grauen, schweren Wolken, die seit meiner Abfahrt in Rosenheim bedrückend tief am Himmel hingen, und der dichte Nebel, der das blaue „Italia“-Schild am verschneiten Brenner fast vollständig einhüllte, sind verschwunden. Noch ragen zwar rechts und links der autostrada die letzten Alpengipfel steil empor, doch im warmen Licht des Südens wirken die bewaldeten Bergflanken längst nicht mehr so düster und bedrohlich wie noch vor einigen Minuten.
„Ich bin da!“ Ein vorsichtiges Lächeln umspielt meine Lippen. Dann fällt mir ein, dass ich allein in meinem kleinen Auto sitze und dass meine einzigen Zuhörer die Koffer und Taschen sind, die sich hinter mir stapeln. Dass mich niemand kritisch beäugt und meine kindische Freude mit einem Stirnrunzeln oder irgendeinem abschätzigen Kommentar quittiert. Und da beginne ich, lauthals zu lachen.
Das Lachen hilft auch gegen das mulmige Gefühl in der Magengegend, das sich während der ganzen Fahrt einen erbitterten Zweikampf mit der Vorfreude auf mein neues Leben in Italien geliefert hat. Immerhin ist mein Entschluss, an den Gardasee zu ziehen, ziemlich überstürzt gefallen – obwohl ich dort doch überhaupt niemanden kenne. Sagt meine Mutter. Und es ist gut möglich, dass ich bald bereuen werde, den Job an der Schule hingeschmissen zu haben. Spätestens, wenn ich merke, dass in Italien, wo immerhin gerade eine schlimme Wirtschaftskrise herrscht, niemand auf eine etwas naive Deutsche gewartet hat, die gern im Süden leben und dort auch Geld verdienen möchte. Sagt Florian.
Tatsächlich habe ich alle ziemlich überrascht. Mich selbst eingeschlossen. Nicht mit der Offenbarung meiner Sehnsucht, einmal in Italien leben zu wollen. Damit liege ich allen, die mich kennen, seit Jahren in den Ohren. Unerwartet kam da schon eher mein plötzlicher Tatendrang und die Konsequenz, mit der ich von einem Tag auf den anderen meinen Umzug in die Wege geleitet und mich fürs Erste von meiner Familie, meinen Freunden und Florian – meinem Verlobten – verabschiedet habe, um am Gardasee ein neues Leben zu beginnen. Oder es zumindest zu probieren.
Bei der Ausfahrt „Affi – Lago di Garda sud“ verlasse ich die Autobahn. Jetzt sind es nur noch wenige Kilometer bis nach Lazise. In der kleinen Stadt am südöstlichen Ufer des Gardasees habe ich über das Internet eine bezahlbare Unterkunft gefunden: ein Zimmer, das von einem jungen Ehepaar untervermietet wird. Zentral im historischen Ortskern gelegen – das müsste doch etwas für mich sein!
Doch ein wenig aufgeregt bin ich schon. Francesca, mit der ich von zu Hause aus alles per E-Mail geklärt habe, erschien mir sehr sympathisch. Ihren Mann kenne ich noch überhaupt nicht. Ich steuere mein Auto über die kurvige Landstraße und sehe in der Ferne zum ersten Mal das blau funkelnde Wasser des Gardasees zwischen Zypressen und herrschaftlichen Villen aufblitzen. In den Weinbergen scheinen die blattlos und knorrig in Reih und Glied stehenden Weinstöcke ihren Winterschlaf zu genießen. Ich hoffe auf eine nette erste Begegnung mit meinen Vermietern. Schließlich werden diese in nächster Zeit auch meine Mitbewohner sein.
Wenige Minuten später betrete ich die Altstadt von Lazise durch ein imposantes Tor in der wuchtigen, zinnenbewehrten Stadtmauer. Dahinter herrscht Stille. Der Lärm der Hauptstraße – der „Gardesana“, die direkt vor der Mauer verläuft – ist nur noch als leises Rauschen im Hintergrund zu hören. Auf dem mit großen, dunklen Steinen gepflasterten Weg begegnet mir keine Menschenseele. Ein eisiger Windhauch zieht durch die engen Häuserschluchten. Ich schließe den Reißverschluss meiner Jacke bis zum Kinn und frage mich, ob ich eigentlich eine Mütze eingepackt habe. Dass es trotz der Sonne empfindlich kalt ist, habe ich bereits gemerkt, als ich auf dem Parkplatz außerhalb des Zentrums aus dem Auto gestiegen bin.
Mit einem Adresszettel in der Hand laufe ich los, in die Richtung, in der mein Zuhause für die nächsten Monate liegen müsste. Die meisten Geschäfte und Bars, an denen ich vorbeikomme, sind geschlossen. Als ich vor mehr als zehn Jahren das letzte Mal in Lazise war, herrschte hier überall sommerlicher Trubel, und man hatte Mühe, sich zwischen all den Menschen durchzukämpfen. Damals war ich eine von Tausenden Touristen, die in der Saison jeden Tag durch die mittelalterlichen Gassen strömen, an den Tischen vor den Bars am Seeufer Aperol trinken, Eis oder Pizza essen, Handtaschen und Schuhe in den Schaufenstern begutachten. Und was bin ich jetzt?
„Ciao, sono Francesca!“ Die fröhliche Stimme, die auf mein Klingeln antwortet, kommt von oben. Ich lege den Kopf in den Nacken und sehe eine dunkelhaarige Frau, die sich aus einem kleinen Fenster im zweiten Stock beugt und mir zuwinkt.
„Un attimo, arrivo subito!“
Eine Minute später öffnet sich die schwere Haustür, und vor mir steht eine sportlich gekleidete Italienerin etwa meines Alters, mit leuchtenden Augen und einer Aura der Herzlichkeit, die jede Unsicherheit meinerseits sofort spielend beiseitefegt.
„Giulia? Benvenuta, komm’ rein!“
Francesca führt mich durch einen winzigen Innenhof in ein schmales Treppenhaus.Während wir in den zweiten Stock hinaufsteigen, erkundigt sie sich nach meiner Anreise. Mein Italienisch ist noch ein bisschen eingerostet, und ich erkläre etwas holprig, dass ich eine problemlose Fahrt hatte und sehr froh bin, jetzt hier zu sein. Wir betreten die Wohnung und stehen in einer einfach, aber geschmackvoll eingerichteten Wohnküche, die deutlich größer ist, als ich nach der Beschreibung in Francescas Internet-Annonce zu hoffen gewagt hatte. Als ich ihr das sage, lacht sie erleichtert.
„Besser so, als wenn du jetzt enttäuscht wärst! Aber ich kann dich verstehen, mir gefällt es hier auch sehr gut. Allerdings ist das Haus alt, und das merkt man an allen Ecken und Enden. Vor allem jetzt, im Winter. Aber Luis – mein Mann – und ich, wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Ecco, das hier ist dein Reich!“
Mit diesen Worten öffnet Francesca eine weitere Tür und verschwindet in einem engen Korridor. Ich folge ihr, vorbei an einem winzigen Badezimmer, von dem ich erfahre, dass es zu meiner Verfügung steht, und befinde mich kurz darauf in einem kleinen Raum, der neben Bett, Schrank und Nachttisch gerade noch genug Platz für einen Sekretär aus dunklem Holz bietet. Ich gehe zum Fenster, sehe die rot gestrichene Fassade des gegenüberliegenden Hauses und – ein gutes Stück unter mir – die Gasse, durch die ich vor ein paar Minuten gekommen bin.
„Die Aussicht ist nicht gerade spektakulär“, meint Francesca, die in der Tür stehen geblieben ist. „Aber wenn du das Fenster öffnest, nach rechts schaust und dich weit hinauslehnst – ma attenzione, eh! –, dann hast du sogar Seeblick!“ Dann lachen wir beide, und ich bin mir jetzt schon sicher, dass ich mich in diesem Haus sehr wohlfühlen werde.
Nachdem ich mein Auto zum Ausladen des Gepäcks vorsichtig durch die engen Gassen gelenkt und alle Taschen und Koffer in meinem Zimmer verstaut habe, sitzen Francesca und ich am Küchentisch, jede von uns mit einer dampfenden Tasse Tee vor sich. Ich erfahre, dass Luis, Francescas Ehemann, Brasilianer ist. Er arbeitet von März bis Oktober als Koch in einem Restaurant ganz in der Nähe. Jedes Jahr im Winter versucht er, zumindest für einige Wochen in seine Heimat zu fliegen. Die letzten Male hat Francesca ihn begleitet. Brasilien gefällt ihr sehr, die Leute sind freundlich, und mit Luis’ Familie kommt sie bestens zurecht. Doch die Reise ist teuer, und diesmal hat es nicht für sie beide gereicht – außerdem konnte sich Francesca nicht so lange frei nehmen.
„Ich arbeite im Moment bei meinem Schwager Matteo. Der hat eine Versicherungsvertretung, und ich kümmere mich da ein bisschen um das Büro. Akten einsortieren, Telefondienst.“ Sie lacht wieder, doch diesmal mit bitterem Unterton.
Eigentlich hat Francesca Innenarchitektur studiert. Bis vor einem Jahr war sie bei einer Immobilienagentur in Verona angestellt. Doch dann kam die Krise – la crisi –, und sie wurde zusammen mit einem Drittel der Beschäftigten entlassen. In ihrem Metier etwas Neues zu finden, ist in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation beinahe aussichtslos, also reiht sie einen Gelegenheitsjob an den nächsten. Auch die Untervermietung ist für das Paar ein Mittel, sich in dieser schwierigen Situation etwas dazuzuverdienen. Francescas Traum ist es, eines Tages mit Luis ein eigenes Restaurant zu eröffnen, entweder am Gardasee oder, wenn es hier nicht bald wieder besser wird, vielleicht sogar in Brasilien. Chissà?
„Und du, Giulia? Was führt dich eigentlich hierher? Was hast du vor?“
Ich fühle mich durch die Frage etwas überrumpelt, obwohl sie doch im Grunde nicht überraschend kommt. Nach dem, was mir Francesca gerade erzählt hat, erscheinen mir meine Probleme in Deutschland plötzlich nicht mehr ganz so gravierend. Sie kommen mir jetzt beinahe ein wenig albern vor.
„Ich habe schon immer davon geträumt, einmal für längere Zeit in Italien zu leben“, erkläre ich. „Und in den letzten Monaten hatte ich meine ganz persönliche Krise, mit meiner Arbeit, meinem Freund, meinem Leben. Ich hatte das Gefühl, dass ich dringend etwas verändern muss. Den Gardasee und Lazise kenne ich noch von früher, als ich mit meinen Eltern und meinen beiden Schwestern hier im Urlaub war. Immer wieder habe ich darüber nachgedacht, ob das hier der richtige Ort für mich sein könnte. Also habe ich beschlossen, es einfach auszuprobieren.“
„Brava! Wenn man es nicht probiert, kann man es auch nicht wissen.“ Wieder strahlen mich Francescas Augen entwaffnend an. Sie hält mich offensichtlich weder für albern noch für naiv.
„Hast du Lust, mit mir zu essen? Ich mache die Pasta, und du erzählst weiter!“
Ich habe Kunstgeschichte studiert, mit der Vorstellung, eines
Tages Artikel und Bücher über die unzähligen faszinierenden Kulturstätten Italiens zu verfassen. Oder interessierten Reisenden vor Ort die Höhepunkte der Architektur, der Bildhauerei und der Malerei dieses wunderschönen Landes näherzubringen und nebenbei über die spannende und wechselvolle Geschichte der Städte und Landschaften südlich der Alpen zu referieren. Und vor allem: um selbst dort zu leben – nicht nur für einen oder zwei Monate, sondern mindestens für ein paar Jahre. Den unendlich langen deutschen Winter hinter mir zu lassen und stattdessen zu erleben, wie die Sonne schon im März beginnt, die Kälte mit Macht in die Schranken zu weisen. Lange Abende im Freien zu genießen. Überall dem fröhlichen, lebendigen Gesang der italienischen Sprache zu lauschen. Besuch von Bekannten aus Deutschland zu bekommen, mit ihnen an einem lauen Herbstabend durch malerische Gassen zu spazieren, um dann in einer kleinen Bar auf einen aperitivo einzukehren und schließlich festzustellen: „Ja, hier bin ich zu Hause!“ Vielleicht auch, um den Neid meiner Besucher zu spüren, den sie unter höflichen Komplimenten zu verbergen versuchen würden.
Vor allem in den frühen Versionen meiner mediterranen Zukunftsphantasie spielte auch ein italienischer Mann eine Rolle, in den ich mich unsterblich zu verlieben plante. Nicht einer von diesen Klischee-Gigolos – nein! Ein charmanter, gebildeter, humorvoller und stilvoller Mann aus gutem Hause sollte es sein, der in seinem Charakter südländische Leichtigkeit und Lebenskunst mit emotionaler Tiefe und verantwortungsbewusster Zuverlässigkeit vereinen und damit jedes Klischee Lügen strafen würde. Umwerfend aussehen durfte er natürlich trotzdem.
Als dann Florian in mein Leben trat, und ich mich in ihn verliebte, obwohl er sehr viel deutscher war, als ich mir meinen zukünftigen Mann jemals vorgestellt hatte, wurde die Rolle des italienischen Liebhabers aus meiner Vision gestrichen und nur noch in Phasen akuter Beziehungskrisen wiederbelebt. Dafür beharrte ich Florian gegenüber umso bestimmter auf dem Rest meiner Pläne: Immer wieder erklärte ich ihm, dass es mir ernst sei und dass ich auf jeden Fall einmal längere Zeit in Italien leben wolle.
„Natürlich können wir mal ein paar Monate da verbringen“, sagte der dann meistens. „Ich fände das ja auch interessant. Wirklich.“
Wobei mich der wenig begeisterte Ton in seiner Stimme eher misstrauisch machte. Und wenn ich nachfragte, wann es denn ungefähr so weit sein könnte, dann hatte er stets gute Gründe parat, warum es gerade in diesem Moment ganz unmöglich sei, eine Prognose abzugeben: Erst seine Doktorarbeit, dann der Job an der Uni, mit dem er doch gerade erst angefangen habe. Oder Probleme in seiner Familie. Oder. Oder. Oder.
Und ich ließ mich immer wieder vertrösten und schrieb alle paar Monate einen Artikel für eine zweitklassige historische Zeitschrift, der in der Regel viel mit Mittelalterromantik oder Moorleichen aus der Bronzezeit, jedoch nie mit den Kunstschätzen Italiens zu tun hatte. Und weil man davon nicht leben kann, arbeitete ich zusätzlich in einer Privatschule, in der ich Kindern unheimlich reicher Eltern Nachhilfeunterricht gab. Diese quittierten meine Bemühungen regelmäßig mit abfälligen Bemerkungen über mein kleines Auto oder mein hoffnungslos veraltetes Handy. Ein Fünftklässler belehrte mich darüber, dass ihm Latein nicht so wichtig sei, er sei immerhin schon Besitzer einer Klinik. Was soll man da noch sagen? Mir fiel jedenfalls von Woche zu Woche weniger ein. Dafür stieg mein innerer Frustpegel in ungeahnte Höhen. Vor allem in den Wintermonaten, in denen ich vor Kälte schlotternd durch Schneematsch und Nieselregen zu meiner ungeliebten Arbeit fuhr und bei meiner Rückkehr einen mürrischen Verlobten vorfand, der sich unter irgendwelchen Zeitschriften aus dem 19. Jahrhundert vergraben hatte, die er für sein Seminar durcharbeiten musste.
„Weißt du, was der entscheidende Gedanke war? Der, der dazu geführt hat, dass ich tatsächlich zum Halbjahr in der Schule aufgehört habe und heute hier bin?“
Inzwischen haben Francesca und ich die vorzügliche Pasta bis auf den letzten Rest aufgegessen. Um mich für ihre Kochkünste zu revanchieren, habe ich darauf bestanden, den Abwasch zu übernehmen. Francesca sitzt noch an ihrem Platz am Küchentisch, nippt an ihrem Weinglas und hört mir aufmerksam zu.
„Es war der Gedanke an meinen Geburtstag. Der ist im Februar. Und als ich neulich mal wieder auf dem Heimweg war, nach einem wirklich miesen Tag, da habe ich mir gedacht: Dieses Jahr will ich an meinem Geburtstag in Italien sein! Als ich zu Hause war, habe ich sofort Florian davon erzählt und angefangen, alles in die Wege zu leiten.“
„Und Florian? Was hat er gesagt?“
„Er war von meiner Idee nicht sonderlich begeistert. Im Gegenteil! Wir haben fürchterlich gestritten. Doch das hatte ich eigentlich schon erwartet. Ich habe sowieso nicht mehr damit gerechnet, dass er mitkommen würde. Und vielleicht ist es ganz gut, dass wir mal ein wenig Abstand voneinander haben. In letzter Zeit war ich mir überhaupt nicht mehr sicher, welche Bestandteile meines Lebens mir eigentlich gut tun, und welche ich aussortieren muss. Verstehst du, was ich meine?“
„Ich glaube schon. Du willst Abstand von ihm haben, um zu sehen, ob er dir fehlen wird. Oder ob es dir ohne ihn vielleicht sogar besser geht.“
So klar habe ich mir das selbst noch nie vor Augen gehalten. Doch Francesca hat recht, genau so stehen die Dinge. Für einen Moment starre ich gedankenverloren auf die Schüssel, die ich gerade abgespült habe. Dann sehe ich Francesca an und sage:
„Das war wirklich die beste Pasta meines Lebens! Von dir kann ich noch einiges lernen!“
Als ich später fröstelnd im Bett liege – glücklicherweise habe ich eine Fleecedecke mitgebracht, die deutlich besser vor der Kälte schützt als das dünne Laken, das ich auf dem Bett vorgefunden habe –, komme ich nur schwer zur Ruhe. Ich nehme mir vor, sofort mit der Arbeit zu beginnen: Themen zu recherchieren, Artikel zu schreiben und diese dann Zeitungen und Zeitschriften anzubieten. Schon von zu Hause aus habe ich einige Orte ausfindig gemacht, die ich mir unbedingt ansehen will. Einer davon ist eine kleine, aber feine Kaffeerösterei in Affi. Ich beschließe, gleich morgen dort anzurufen und einen Termin zu vereinbaren.
Und wenn die Touristensaison losgeht, denke ich, kann ich mir immer noch einen Job in einer Bar oder Eisdiele suchen, um über die Runden zu kommen. Auf jeden Fall werde ich mich nicht unterkriegen lassen und meine Zeit hier genießen!
Als ich aufwache, sind meine Füße taub vor Kälte. Meine Nase ebenso. Ich schäle mich schlotternd aus dem Bett und überprüfe den kleinen Heizkörper unter dem Fenster, den ich am Abend zuvor auf die höchste Stufe eingestellt habe. Er ist bestenfalls lauwarm. Dafür spüre ich einen frischen Luftzug, der durch das geschlossene Fenster hereinströmt. „Es ist ein altes Haus, und das merkt man“, hat Francesca gestern gesagt, um dann noch hinzuzufügen: „Vor allem im Winter.“ Jetzt weiß ich, was sie damit gemeint hat.
Nach einer wohltuend heißen Dusche und einem kurzen Frühstück will ich unbedingt an den See, auch wenn das Wetter nicht gerade zu einem Spaziergang einlädt. Die dunklen Wolken, die ich gestern hinter mir gelassen zu haben glaubte, sind wieder da. Es nieselt. Die Mütze habe ich glücklicherweise in einem Koffer gefunden.
Bis zur Uferpromenade sind es nicht mal hundert Meter. Der See liegt ganz still da, die Regentropfen malen ein sich ständig veränderndes Muster aus kleinen Ringen auf die ansonsten regungslose Wasseroberfläche. Hier im Süden ist der See mehr als fünfzehn Kilometer breit, das gegenüberliegende Ufer ist im grauen Dunst dieses Wintertages nur schemenhaft zu erkennen. In Richtung Norden, wo sich der Gardasee wie ein Fjord zwischen steile Berghänge zwängt, erkenne ich gerade noch den verschneiten Gipfel des Monte Baldo, des höchsten Berges in dieser Gegend. Lazise erscheint mir mit seinen geschlossenen Geschäften und menschenleeren Gassen auf den ersten Blick wie im Winterschlaf erstarrt. Doch in den nächsten Tagen merke ich, dass es zwischen all den Häusern, die anscheinend nur während der Touristensaison zum Leben erwachen, einige kleine „Inseln“ gibt, in denen das ganze Jahr über Betrieb herrscht:
Das kleine Lebensmittelgeschäft zum Beispiel, in dem ich mir am ersten Tag Orangen, Brot und Kekse kaufe.
Eine tabaccheria, in der mir die beiden ebenso betagten wie freundlichen Damen hinter dem Tresen geduldig erklären, welche Telefonkarte am besten für Gespräche nach Deutschland geeignet ist.
Ein Damenfriseur, durch dessen Schaufenster nachmittags warmes Licht auf die kleine piazzetta vor der Kirche fällt.
Und „Gipis Bar“ am alten Hafen, in der ich täglich auf eine Tasse Pfefferminztee einkehre und möglichst lange bleibe, weil dort die Heizung besser funktioniert als in meinem Zimmer. Beim ersten Mal ernte ich noch ein Stirnrunzeln, weil ich den wunderbaren caffè verschmähe. Doch schon bald kennt mich nicht nur Giampaolo, nach dessen Spitznamen „Gipi“ die Bar benannt ist, sondern auch seine Schwester Rita und ihr Mann Luciano, die ebenfalls oft hinter dem Tresen anzutreffen sind. Nach einigen Tagen bekomme ich meine Teetasse bereits unaufgefordert vor mich auf den Tisch gestellt, und auch Sebastiano und Davide, die Söhne von Rita und Luciano, nicken mir zu wie einer alten Bekannten, wenn sie nachmittags aus der Schule kommen.
Der erste Eindruck der Kaffeerösterei in Affi enttäuscht mich ein wenig. Von einem Familienbetrieb mit überschaubarem Angebot, bei dem nicht in erster Linie auf den Preis, sondern hauptsächlich auf die Qualität der Produkte geachtet wird, hatte ich wohl eine etwas zu romantische Vorstellung. Doch schon die Lage der Rösterei belehrt mich eines Besseren: In einem abgelegenen Gewerbegebiet, zwischen gleichförmigen Lager- und Produktionshallen verschiedener Firmen und Handelsketten habe ich mit etwas Mühe schließlich die gesuchte Adresse gefunden. Der Betrieb ist in einem schmucklosen, kastenförmigen Zweckbau untergebracht, der sich nahtlos in seine triste Umgebung einfügt.
Inzwischen stehe ich mit Alessandro della Valle, dem Juniorchef, der mir vorgestern am Telefon auf meine vorsichtige Anfrage hin bereitwillig diesen Besichtigungstermin angeboten hat, im stilvoll-modern dekorierten Eingangsbereich der Rösterei. Ich ertappe mich bei dem Gedanken, dass mein Gegenüber – im Gegensatz zu dem Gebäude, in dem wir uns befinden – optisch durchaus überzeugt: Er ist groß gewachsen, dunkle Locken umspielen seine feinen Gesichtszüge. Seine wachen Augen versprühen spitzbübischen Charme, während der perfekt sitzende Anzug die lässige Eleganz ausstrahlt, die ich so nur von italienischen Männern kenne. Plötzlich schäme ich mich für meinen Strickpullover und für meine von der Wollmütze vermutlich total zerzausten Haare.
„Darf ich Ihnen zunächst einmal einen caffè anbieten?“ Alessandro deutet auf die kleine Theke mit Barhockern, die in einer Ecke des Eingangsbereichs platziert ist. Dahinter glänzt eine verchromte Espressomaschine, wie ich sie schon in unzähligen italienischen Bars gesehen habe. „Sie haben die freie Auswahl: Der ‚Costa del Sol‘ ist eher kräftig, der ‚Nero Extra‘ dagegen etwas milder. Oder möchten Sie den ‚Nero Classic‘ probieren? Das ist eine sehr ausgewogene, traditionelle Mischung.“
Ich spüre, dass ich rot werde.
„Danke. Aber leider ... also ...“ – Es hilft nichts, ich muss es ihm sagen, auch wenn es mir höchst unangenehm ist – „... um ehrlich zu sein: Ich liebe den Duft von frisch gemahlenem Kaffee, der hier in der Luft liegt – aber ich kann ihn leider nicht trinken. Wenn ich es tue, falle ich sofort in Ohnmacht! Mi dispiace, es tut mir leid.“
Alessandro sieht mich für einen Moment verblüfft an. Doch dann kehrt auch schon sein warmherziges Lächeln zurück.
„Che peccato! Umso mehr freut es mich, dass Sie sich trotzdem für unseren Betrieb interessieren!“
Ohne noch ein Wort über mein „Handicap“ zu verlieren, beginnt er mit der Führung durch die Anlage. Zwischen den Säcken mit Rohkaffee, der Röstanlage und der Verpackungseinheit erklärt mir Alessandro, woher die Kaffeebohnen kommen, die hier gemischt werden, und wodurch sich die verschiedenen Sorten unterscheiden. Außerdem erzählt er mir ausführlich, wie der Röstvorgang abläuft und was den caffè espresso, der um 1900 in Mailand erfunden wurde, so besonders macht. Nicht zuletzt gewährt mir der Juniorchef einen tiefen Einblick in die italienische Kaffeekultur.
„Überall in unserem Land wird caffè getrunken, das gehört zu unserer Lebensart. Aber dabei gibt es große regionale Unterschiede. In einer Bar im Süden ist zum Beispiel bei einem caffè espresso meist weniger in der Tasse als hier im Norden. Er ist dort nämlich in der Regel stärker – aber dafür nimmt man auch mehr Zucker!“
Am Ende habe ich mir jede Menge Notizen gemacht, und mein Kopf schwirrt vor Daten und Fakten. Ich merke, dass ich mich erst noch daran gewöhnen muss, mich so lange und konzentriert auf Italienisch zu unterhalten.
„Diese Rösterei ist ein junges Unternehmen, richtig?“, frage ich abschließend. „Ich habe auf der Internetseite gelesen, dass es sie erst seit wenigen Jahren gibt. Und dass es ein Familienbetrieb ist. Arbeiten denn noch weitere Familienmitglieder hier?“
„Es stimmt, was du gelesen hast“, bestätigt mir Alessandro, der – wie in Italien unter jüngeren Leuten durchaus üblich – bald vom förmlichen „Lei“ zum vertraulicheren „tu“ gewechselt ist. „Es ist ein Familienunternehmen. Aber meine Familie ist ... in verschiedenen Branchen engagiert. Eigentlich sind wir in Verona zu Hause. Die Rösterei ist meine Passion, und ich bin allein für das Unternehmen verantwortlich.“
Schließlich reicht er mir noch seine Visitenkarte.
„Es ist sehr nett, dass du über uns schreiben willst. Und es war mir eine Freude, dich kennenzulernen. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, kannst du dich jederzeit bei mir melden.“
Und weil ich zwischendurch erwähnt habe, dass ich erst vor wenigen Tagen nach Italien gekommen bin, fügt er noch augenzwinkernd hinzu: „Das gilt natürlich auch, falls du Hilfe bei der Eingewöhnung brauchst. Italien kann für Ausländer manchmal ganz schön kompliziert sein. Meine Familie und ich werden dich jedenfalls gern unterstützen.“
Später sitze ich mit meinem Laptop und einer Tasse Pfefferminztee in Gipis Bar und gebe die Begriffe „della Valle“ und „Verona“ in die Maske der Suchmaschine ein. Kurz darauf möchte ich vor Scham im Boden versinken. Warum habe ich diese kurze Recherche nicht schon vor meinem Besuch in der Rösterei erledigt? Dann hätte ich gewusst, dass Alessandro aus einer der angesehensten Bankiersfamilien Veronas stammt, die nicht nur ein Finanzinstitut, sondern auch ein Weingut und mehrere Spezialitätengeschäfte ihr Eigen nennt. Und ich hätte nicht diese Fragen nach seiner Familie gestellt, die mir nun schrecklich peinlich sind.
Andererseits wirkt Alessandros Hilfsangebot auf mich unter diesen Umständen noch beruhigender. Ich ziehe seine Visitenkarte aus meiner Tasche und betrachte sie eingehend. Ich habe bei meiner ersten Recherche nicht nur einen sehr charmanten, interessanten und gutaussehenden Mann kennengelernt, sondern auch Kontakt zu einer einflussreichen einheimischen Familie geknüpft. Wer hätte das gedacht?
Doch zunächst einmal steht noch ein anderes Thema an: mein Geburtstag. Francesca schlägt vor, ihn mit mir zusammen in Venedig zu verbringen.
„Man kann mit dem Zug vom Gardasee direkt dorthin fahren.Wir steigen in Peschiera ein – und knappe zwei Stunden später sind wir da. Ohne Parkplatz, ohne Stress!“
Am Morgen meines Geburtstags ruft mich Florian an, um mir zu gratulieren und sich zu erkundigen, wie es mir am Gardasee geht. Unser Gespräch verläuft etwas schleppend, wir wissen beide nicht so recht, was wir sagen sollen, und verabschieden uns bald wieder.
Dann verbringe ich mit Francesca einen wunderschönen Tag in der Lagunenstadt. Auf dem Markusplatz lassen wir uns von der strahlenden Wintersonne wärmen, und während wir durch die verwinkelten Gassen schlendern, erzähle ich von den drei Wochen, die ich nach meinem Studium in einer Sprachschule in Venedig zugebracht habe. Wir sitzen in meinem damaligen Stammcafé am Campo Santa Margherita, bestaunen das Altarbild von Giovanni Bellini in der Kirche San Zaccaria und die überwältigenden Gemälde Tintorettos in der Scuola di San Rocco. Als wir schließlich mit dem vaporetto zurück zum Bahnhof fahren, ist die Sonne bereits untergegangen, und am Canal Grande bilden die hell erleuchteten palazzi den edlen Rahmen, der der „schönsten Wasserstraße der Welt“ gebührt.
„Das war eine großartige Idee von dir!“, stelle ich fest, als wir – erschöpft, aber glücklich – wieder im Zug sitzen.„Mein schönster Geburtstag seit langem. Grazie, Francesca!“
Zufrieden lehne ich mich zurück und schließe die Augen. In diesem Moment bin ich einfach nur glücklich, nach Italien gekommen zu sein.
Marzo
MIT DER ZEIT HABE ICH MICH SO GUT ES GEHT damit abgefunden, morgens mit steifgefrorenen Gliedmaßen aufzuwachen, die erst nach intensivem Kontakt mit heißem Wasser wieder ihre volle Bewegungsfähigkeit zurückerlangen. Der Gedanke daran, dass der italienische Frühling nicht mehr weit sein dürfte, hilft mir dabei sehr.
Doch als ich eines Morgens in den ersten Märztagen aus dem Fenster blicke, traue ich meinen Augen kaum. Ich sehe etwas, dem ich mit meinem Abschied aus Deutschland fürs Erste entkommen zu sein hoffte: Schnee!
Es ist am Ende zwar nur eine dünne Schicht von höchstens drei Zentimetern, die in den Gassen und auf den Dächern liegen bleibt – doch in Lazise und am ganzen Gardasee herrscht an diesem Tag Ausnahmezustand: Schulen bleiben geschlossen, weil die Busse vorsorglich nicht fahren, Ladenbesitzer stehen kopfschüttelnd und mit dem Schicksal hadernd vor ihren Geschäften, in die sich kein einziger Kunde verirrt, weil die Leute bei diesem brutto tempo lieber zu Hause bleiben.
„Sei stata tu, che hai portato la neve?“, erkundigt sich Cristina – die Verkäuferin in dem kleinen alimentari im Zentrum – scherzhaft, während sie meine Einkäufe über den Scanner zieht. Sie hat mich bereits in ihr Herz geschlossen und begrüßt mich jedes Mal, wenn ich den Laden betrete mit einem liebevollen „Ciao, stella!“
Ich stelle lachend fest, dass ich keineswegs verantwortlich für den Wintereinbruch sei und frage, ob es hier – so weit im Norden Italiens und am Fuße der letzten Alpenausläufer – tatsächlich so ungewöhnlich sei, im Winter mit einem Hauch von Schnee zurechtkommen zu müssen.
„Nein, natürlich nicht!“, antwortet die resolute Frau mit ihrer tiefen, volltönenden Stimme. „Wir gehen nur davon aus, dass der Schnee dort bleibt, wo er hingehört.“ Sie deutet vage in Richtung Norden. „Auf dem Monte Baldo! Da kann man sogar Skifahren – und von unten sieht es auch ganz hübsch aus, wenn der Berg seine weiße Mütze auf dem Kopf hat. Aber hier? Auf der Straße? Das ist doch gefährlich!“
Das schlechte Wetter und die offensichtliche Ignoranz der hiesigen Bevölkerung, was Winterreifen betrifft, beschäftigen mich jedoch nur am Rande. Viel wichtiger ist für mich die Frage, wie der Artikel über italienische Kaffeekultur, den ich nach meinem Besuch in Alessandros Rösterei verfasst und dann einigen Redaktionen in Deutschland angeboten habe, ankommt.
Die ersten Rückmeldungen sind leider enttäuschend. In den höflicheren Absagen wird mein Bericht immerhin als „interessant“ und „stimmungsvoll“ bezeichnet – es gibt jedoch stets einen guten Grund, ihn trotzdem nicht im jeweiligen Blatt zu veröffentlichen. Andere Redaktionen halten sich gar nicht erst mit Freundlichkeiten auf, sondern teilen mir nüchtern mit: „... derzeit besteht kein Bedarf ...“ oder „... entspricht nicht unserem Profil ...“. Und dann gibt es da noch diejenigen, die tage- und wochenlang überhaupt nicht reagieren, sodass ich schließlich davon ausgehen muss, mit meinem Ansinnen auch hier auf taube Ohren gestoßen zu sein.
Diese Situation frustriert mich zunehmend, was auch an dem Schicksal liegt, das eine weitere meiner journalistischen Ideen ereilt:
Der Gedanke ist mir gekommen, als ich die beinahe panischen Reaktionen der Italiener auf den unerwarteten, späten Wintereinbruch beobachtet habe. Meine Heimatstadt Rosenheim ist die Partnerstadt von Lazise, viele Rosenheimer kommen regelmäßig im Sommer hierher. Ich habe mich gefragt, ob diese Leute überhaupt eine Vorstellung vom Leben am Gardasee außerhalb der Tourismussaison haben. Und ob es für sie nicht interessant wäre, ab und zu einen unterhaltsamen Bericht aus dem Alltagsleben in ihrem Lieblings-Urlaubsort nach Hause auf den Frühstückstisch geliefert zu bekommen – vielleicht noch garniert mit einem Bild, das den Betreiber ihres Stammcafés beim Schneeschippen zeigt. Wäre das nicht eine spannende Aufgabe für mich, und gleichzeitig eine Bereicherung, was den Austausch zwischen den beiden Partnerstädten betrifft?
Begeistert habe ich meine Idee sofort dem Chefredakteur der Rosenheimer Lokalzeitung in einer ausführlichen E-Mail erläutert und einen Probeartikel über das Schneechaos am Gardasee angefügt.
Als ich nach ein paar Tagen an meinem Stammplatz in Gipis Bar die Antwort aus Rosenheim lese, weicht meine Euphorie mit jeder weiteren Zeile der Enttäuschung. Zwar ist der Chefredakteur recht angetan von der Idee, einen „direkten Draht“ nach Lazise zu haben. Doch meine Vorstellung von launigen Geschichten aus dem italienischen Alltagsleben teilt er keineswegs. Dafür, so schreibt er, sehe er keinerlei Bedarf. Vielmehr sollten die Berichte aus der Partnerstadt seiner Meinung nach stets einen „Nutzwert“ für die Leser in Rosenheim aufweisen. So sei es für die Planung des nächsten Urlaubs von Interesse, wenn in der Stadt ein neuer Kreisverkehr eingerichtet, die Parkplatzsituation verändert oder ein neuer Supermarkt eröffnet werde. Falls ich einmal solcherlei Informationen hätte, dürfe ich mich gern wieder melden. Mehr als ein Bild mit dreizeiligem Begleittext könne er jedoch nicht unterbringen.
„Brutte notizie?“, fragt Luciano, während er mir unaufgefordert noch einen Tee bringt. Anscheinend ist ihm mein verzweifeltes Seufzen nicht entgangen.
Ich bemühe mich, ihm zu erklären, worum es in der E-Mail ging, die ich gerade gelesen habe – scheitere allerdings bei dem Versuch, das Wort „Nutzwert“ ins Italienische zu übersetzen.
Als ich schließlich entlang der Uferpromenade nach Hause spaziere, frage ich mich, ob ich vielleicht zu wählerisch bin. Immerhin hat mir die Rosenheimer Lokalzeitung nicht abgesagt – man hat dort eben nur seine eigenen Vorstellungen.





























