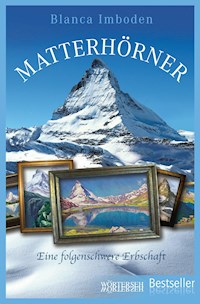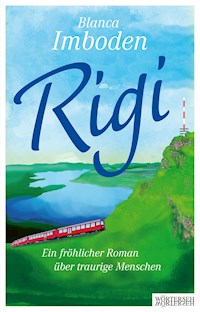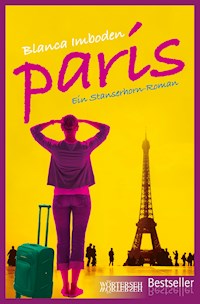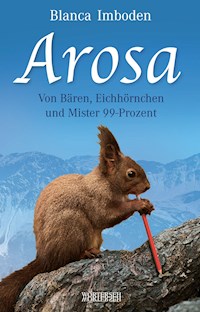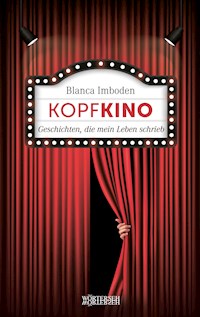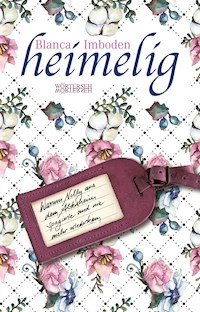4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Ein wunderbar romantischer Roman zwischen Europa und Afrika, Schweiz und Kenia, Herz und Verstand ...
Von wegen Sommer, Sonne, süßes Leben. Nach fünf Jahren Kenia sitzt Anita wieder im Flugzeug nach Hause. Ohne Job, ohne Mann, ohne Zukunftspläne. Und weil sie auch noch pleite ist, muss sie erst mal bei ihren stockkonservativen Eltern einziehen. Zum Glück ist da noch ihre Lieblingscousine, die lebenslustige Tessa, die Anita mit ihrem Optimismus ansteckt und für sie auf Männersuche geht. Doch dann begegnet Anita zufällig Simon wieder, dem kenianischen Arzt, den es wie sie nach Europa verschlagen hat …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Für Sibylle, Sigi, Wilfried und Anna, in Erinnerung an wunderschöne Zeiten in Matuga (Matuga Ocean View) Für meine Zweitfamilie in Chemogoch, in großer Liebe Für Petra Allmendinger, Mweiga, in Freundschaft
ISBN 978-3-492-98036-4
© für diese Ausgabe: Fahrenheitbooks, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2013 © Piper Verlag GmbH, München 2011 Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: © Anna Omelchenko, Mikhaylova Liubov, Andrzej Kubik, Elena Ray / Shutterstock.com Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2011
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich Fahrenheitbooks die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Deine Erinnerungen sind ein Land, aus dem dich keiner vertreiben kann.Afrikanische Weisheit
Wenn man mal kein Glück hat, dann kommt garantiert noch Pech dazu.«
Unglaublich, dass mir gerade jetzt so ein blöder Spruch von meinem Onkel Hugo in den Sinn kommt! Fast entwischt meinen Lippen ein völlig unangebrachtes Lächeln. Dabei gibt es keinerlei Anlass zur Heiterkeit.
Heute Morgen habe ich in Kenia ein Flugzeug bestiegen, das mich von Mombasa nach Zürich bringen soll.
Ich war traurig, verzweifelt, gefoltert vom Abschiedsschmerz.
Abschied von Afrika.
Ich wollte nicht gehen. Ich wollte nicht bleiben.
Ich war aufgewühlt und übernächtigt.
Verletzt.
Immerhin: Ich war nicht selbstmordgefährdet.
Noch nicht.
Dieser Flug aber, der gibt mir nun den Rest. Ich überlege ernsthaft, ob ich wohl schnell und geschickt genug wäre, um die Tür zum Notausgang des Fliegers aufzureißen und einfach hinauszuspringen. Ich stelle mir diesen Tod irgendwie schön vor: Einfach hineinfliegen in die Erlösung, in die Wolken, in den Himmel.
Das Flugwetter ist hässlich. Seit einer Stunde steuert uns der Pilot mitten durch einen heftigen Sturm. Windstöße und Böen schütteln das Flugzeug, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Gegenstände werden durch die Kabine geschleudert. Meinem Nachbarn, einem älteren Herrn, der mir erzählt hat, dass er schon seit dreißig Jahren regelmäßig nach Kenia fliegt, ist eine Flasche Kaffeelikör der Marke Kenya Gold aus dem Ablagefach auf den Kopf gefallen. Seit einiger Zeit rinnt immer wieder ein wenig Blut von seiner Kopfwunde über sein Gesicht und tropft auf sein ausgewaschenes Hawaii-Hemd. Das interessiert allerdings niemanden. Nicht einmal ihn selber, denn er ist vollkommen versteinert in seiner Panik. Er umklammert mit seinen Händen einen Rosenkranz und murmelt irgendwelche Gebete vor sich hin.
Ich frage mich, worum er in seinen Gebeten bittet. Mir persönlich wäre inzwischen ein sauberer, schneller Absturz am liebsten. Ein Ende mit Schrecken.
Mir ist erbärmlich übel. Dieses ständige Schaukeln in alle Richtungen, dieses ruckartige Abfallen der Flughöhe, als würde man in Wolkenschlaglöcher fahren: Wann hat das bloß ein Ende?
Mein Magen ist sauer. Ich glaube, er revoltiert gleich. Gibt es dafür nicht diese weißen Tüten in der Sitztasche vor mir? Ich muss meinen Gurt öffnen, um darin zu wühlen. Gerade als ich das Ding gefunden habe, geht es auch schon los. Und genau jetzt wird das Flugzeug wieder herumgeschleudert, und ich lande mit meiner Tüte auf dem Boden, eingeklemmt zwischen den Sitzen. Ich habe meine Kleider versaut, den Boden beschmutzt und liege im Dreck. Außerdem habe ich mir den Kopf gestoßen, und deshalb bleibe ich einfach liegen, als hätte es gar keinen Sinn mehr, sich wieder aufzurappeln und dem Leben zu stellen.
Kann man noch tiefer sinken?
Eine gefühlte Ewigkeit lang liege ich so da. Ich stelle mich tot, auch innerlich. Ich versuche, in ein imaginäres Mauseloch zu kriechen. Ich hoffe auf die Gnade einer Ohnmacht.
Irgendwann wird der Flug wieder ruhig. Der alte Herr mit dem Rosenkranz hilft mir in den Sitz zurück. Er zieht mich vorsichtig hoch und redet beruhigend auf mich ein. Dann holt er feuchte Tücher und hilft mir, mich und meine Umgebung einigermaßen zu reinigen. Er umsorgt mich wie ein Kleinkind, und ich lasse mich dankbar fallen in seine Fürsorge.
Eine Stewardess kommt und bietet uns Mineralwasser an. Sie sieht auch ziemlich mitgenommen aus, lächelt aber schon wieder sehr professionell. Einzig ihr leicht verschmierter Lippenstift und ein paar wilde Haarsträhnen, die ihr gar nicht korrekt ins bleiche Gesicht fallen, verraten ihren Gemütszustand. Sie klebt ein großes Heftpflaster auf die Schramme am Kopf meines Sitznachbarn.
Das kalte Trinkwasser belebt mich wieder ein wenig.
»Danke«, sage ich zu meinem Betreuer und schenke ihm ein schiefes Lächeln. Er sieht sympathisch aus. Ein alter Mann mit Bauch, aber ohne Haare. Er scheint ein bemerkenswertes Naturell zu haben, denn aus seinen Augen strahlt schon wieder pure Lebenslust.
Wir stoßen auf unser Leben an, auch wenn meines nun zwar vielleicht gerettet, aber immer noch völlig vermurkst ist.
»Ich heiße Lorenzo«, stellt sich der alte Mann höflich vor.
»Ich bin Anita«, antworte ich.
Wir fühlen uns irgendwie verbunden durch das gemeinsam ausgestandene Elend. Aber es ist uns beiden auch ein wenig peinlich, dass wir einander so verzweifelt und in Panik erlebt haben.
»Ich hatte noch nie in meinem Leben so große Angst. Und ich bin immerhin schon siebzig Jahre alt«, gesteht mir Lorenzo, und seine Hand zittert noch immer ein wenig.
»Ich wollte einfach nur noch sterben«, erkläre ich im Gegenzug. Mit besonderer Lebensfreude bin ich im Übrigen auch jetzt noch nicht gesegnet. Aber das muss ich dem Mann ja nicht auf die Nase binden.
Lorenzo hat seinen Rosenkranz weggesteckt.
»Das ist mein Glücksbringer«, erklärt er fast ein wenig verschämt. »Ich habe ihn von meiner Frau bekommen, als sie gerade ihre Krebsdiagnose erhalten hatte. Sie bat mich, damit für sie zu beten. Ich wusste gar nicht mehr, wie das geht.« Er lächelt. »Ich kann das bis heute nicht richtig. Ich spreche einfach meine eigenen Gebete und spiele dazu mit den Kügelchen«, gibt er zu.
»Der Rosenkranz gibt mir das Gefühl, leichter eine Verbindung zu meiner Lucia herstellen zu können. Außerdem sehe ich es nicht ein, warum ich nach strengen Regeln beten sollte. Das artet doch schnell in ein Herunterleiern der Texte aus«, sagt er und lacht auf einmal: »Einem Kenianer würde so etwas im Traum nicht einfallen.«
Da hat er recht. Die würden ihren Glauben und ihre Gebete nie in solche Korsetts zwingen, wie sie uns die Kirche antun will.
Die Stewardessen haben viel zu tun. Sie räumen auf, putzen die gröbsten Missgeschicke weg, leisten Erste Hilfe und beruhigen aufgebrachte Menschen, die sich von ihrem Schrecken kaum mehr erholen können.
Lorenzo holt die Flasche Kenya Gold unter seinem Sitz hervor, die im Sturm so unsanft auf seinem Kopf gelandet war. Die Flasche ist unbeschädigt.
Der alte Mann schaut mich fragend an und wackelt mit seinen buschigen Augenbrauen.
Ich nicke.
Lorenzo gießt den Kaffeelikör großzügig in unsere Wasserbecher. »Das tut unseren Nerven gut«, meint er.
Tatsächlich fühlt es sich gut an, als das süße Gebräu langsam meine Kehle hinunterrinnt. Fast so, als wäre es eine Medizin. Sein Aroma erinnert mich an viele schöne Nächte am Feuer in unserer Ferienanlage Amani Houses. Wenn Gäste da waren, machten wir immer ein Feuer auf dem großzügigen Gemeinschaftsplatz. Nach dem Abendessen saßen wir unter dem Sternenhimmel und tranken ein Gläschen Kenya Gold.
»Ich kaufe den Likör nur aus Sentimentalität. Lucia hat früher immer eine Flasche mit nach Hause genommen. Sie hat Kenya Gold getrunken, wenn sie Heimweh nach Kenia oder einfach einen moralischen Tiefpunkt hatte«, erzählt Lorenzo und schenkt großzügig nach.
So hat jeder seine Erinnerungen. In Zukunft werde ich wohl immer an Lorenzo denken, wenn ich Kenya Gold trinke.
Als die Flugbegleiterinnen das Frühstück servieren wollen, winken wir beide ab. Wir haben bereits auf Flüssignahrung umgestellt. Mein Magen nimmt den Likör erstaunlich gnädig an. Wir lassen uns nur eine Tasse Kaffee dazu einschenken.
Nach und nach trinke ich mir eine wohltuende Gleichgültigkeit an.
Ich rieche schlecht, ich bin erschöpft und ausgelaugt. Sicher sehe ich ganz furchtbar aus.
Egal.
In zwei Stunden landen wir in der Schweiz. Ich war schon seit fünf Jahren nicht mehr im Winter zu Hause. Ich hasse Kälte, empfinde Schnee als ein unnötiges Ärgernis. Und jetzt werde ich wieder bei meinen Eltern einziehen müssen. Ich bin eine Gestrandete, mittellos, frei von jeglicher Perspektive.
Egal.
Ob ich noch irgendwelche Winterkleider von mir auf dem Dachboden finden werde? Ob sie mir noch passen?
Egal.
Werde ich in der Schweiz wieder zurechtkommen, oder bin ich schon »verbuscht«, wie man in Afrika sagt, verdorben für die ach so zivilisierte Zivilisation?
Egal.
»Warum fährst du nach Hause, wenn du den Winter nicht leiden kannst?«, will Lorenzo plötzlich wissen.
»Meine persönliche Eiszeit hat schon vor Monaten begonnen. Da werde ich so einen Schweizer Winter locker wegstecken«, antworte ich, selber nicht überzeugt von meinen Worten.
Aber ich muss ihm schließlich alles erzählen, und warum auch nicht, wo doch das Kenya Gold meine Zunge so wunderbar gelöst hat?
»Ich habe fünf Jahre in Matuga, an der Südküste, gar nicht weit vom Meer, eine kleine Feriensiedlung geleitet. Sie gehörte einem Holländer, Jan. Wir haben perfekt zusammengearbeitet. Ich habe die Gäste vom Flughafen geholt, sie manchmal ans Meer gebracht, kleine Safaris und Ausflüge mit ihnen gemacht. Ich habe das Personal beaufsichtigt, die Touristen unterhalten und ihnen nach Wunsch die Ferien organisiert.« Fast gerate ich außer Atem, wenn ich alles so aufzähle. »Es war mein Traumjob. Manchmal war es ein riesiger Stress, dann wieder habe ich ganze Tage mein Kenia genießen können. Es hat mich aber auch gefreut, den Gästen die Schönheit des Landes näherzubringen. Der Job war abwechslungsreich. Ich habe nicht besonders viel verdient, aber ich brauchte auch wenig. Und ich durfte da leben, wo ich leben wollte: in Kenia.«
Ich trinke einen Schluck Kenya Gold. Lorenzo ist die Aufmerksamkeit in Person. Er hängt an meinen Lippen.
»Ja, und dann kamen die Präsidentschaftswahlen vom 27. Dezember 2007. Kibaki ließ sich als Sieger feiern. Odinga auch. Die Kenianer waren sich nicht einig, ob Kibaki oder Odinga die Wahlen manipuliert hatte. Wahrscheinlich haben beide betrogen. Es gab beispielsweise eine Provinz mit einer Wahlbeteiligung von über hundert Prozent. Die Wahlen brachten das ganze Land in Aufruhr. Die Stämme gingen aufeinander los, wurden teilweise von Politikern bewusst gegeneinander aufgehetzt.
1500 Tote und über 300.000 Vertriebene zählte man schon im Februar. Ich war schockiert. Nie hätte ich so etwas in Kenia erwartet. An der Südküste blieb es ruhig. Aber es herrschte ein Klima der Angst. Unsere Köchin, eine Kamba, verschwand über Nacht. Sie sei bedroht worden, erklärte sie uns Monate später, als sie einfach wieder vor dem Tor zur Anlage stand.
Natürlich blieben die Touristen aus. Monatelang. Alle Reservierungen wurden annulliert. Die Häuser standen leer. Ich konnte es den Gästen nicht verübeln. Die Bilder im Fernsehen waren grauenvoll. Aber an der Küste war es ruhig. Doch wer konnte in dieser Zeit wirklich Sicherheit garantieren?
Wir konnten das Personal nicht mehr bezahlen. Wir hatten keine Einnahmen mehr. Dazu schossen die Lebensmittelpreise in die Höhe.
Im April bildeten Kibaki und Odinga eine gemeinsame Regierung. Trotzdem: Die meisten Hotels an der Südküste mussten eine Weile schließen. Es gab unzählige Arbeitslose. Die meisten Angestellten hatten ohnehin keinen richtigen Arbeitsvertrag. Von einem Tag auf den anderen hat man sie auf die Straße gestellt. Dabei unterstützte jeder von ihnen auch noch Familienangehörige im Hinterland mit seinem Geld.
In den letzten Monaten sah es aus, als würde es endlich aufwärts gehen. Die Hotels waren wieder in Betrieb. Es gab erste Buchungen auch für unsere Anlage. Im Oktober hatten wir erstmals wieder drei Häuser vermietet. Dann passierte es: Eine Gruppe schwer bewaffneter Männer drang in unsere Anlage ein und hat uns überfallen. Sie haben uns alles genommen: Pässe, Papiere, Geld, teilweise sogar Kleidungsstücke und Schuhe, Kameras, Handys … Mein Chef hatte aus Spargründen nur noch einen Sicherheitsmann am Tor. Der wurde einfach niedergeschlagen. Besonders schlimm war, wie brutal die Männer gegen uns vorgingen. Wir wurden getreten, gestoßen und geprügelt. Wir hatten Todesangst.
Ich konnte ja die Verzweiflung mancher Einheimischen durchaus nachfühlen. Es war eine furchtbare Zeit. Und wo sonst konnte man etwas holen als bei den Weißen? So weit, so gut. Aber warum mit solcher Brutalität?
Unsere Gäste sind so schnell wie möglich abgereist, sobald sie Ersatzpapiere beschaffen konnten. Die Auslastung unserer Anlage, die ausgerechnet Amani Houses, Friedenshäuser, heißt, lebte von Mund-zu-Mund-Propaganda. Jetzt waren mein Chef und ich wirklich am Ende. Der Überfall sprach sich schnell herum. Jan beschloss aufzugeben.
Er brach am Tag nach dem Überfall zusammen. Und ich hatte keinen Wagen mehr, um ihn ins Spital zu bringen, kein Handy, um Hilfe herbeizurufen. Wir fühlten uns entsetzlich verlassen und hilflos.
Ich selber war voller blauer Flecken. Man hatte mich zu Boden gestoßen und dann mit Füßen getreten. Ich hatte versucht, mich vor unsere Gäste zu stellen.
Mich hat der Überfall auch psychisch fertiggemacht. Noch nie hatte ich mit so viel roher, körperlicher Gewalt zu tun. Ich habe seither Schlafstörungen, leide unter Panikattacken. Ich hatte seither keine einzige richtig schöne, entspannte Stunde mehr in Kenia.
Jan ist nun wieder in Holland. Eine Agentur wird die Siedlung verkaufen. Und ich werde vorübergehend zu meinen Eltern ziehen.«
Ein Traum ist gestorben.
Ein Lebensabschnitt ist vorbei.
Lorenzo ist sprachlos.
Er habe selber im Februar seine Reise nach Kenia annulliert, erzählt er nach einer Weile: »Ich fliege sonst immer zweimal im Jahr hin.« Auch diesmal sei er von den Vorfällen noch so verunsichert gewesen, dass er das Hotel kaum verlassen habe. Er meint: »Es braucht schon noch etwas Zeit, bis man sich in Kenia wieder so sicher fühlt wie früher. Kriminalität gab es ja schon immer. Aber diese Aufstände, das war zu viel. Das lässt sich nur schwer erklären, verstehen oder gar entschuldigen.«
Wir hängen in unseren Sitzen, ein wenig melancholisch, etwas angetrunken und reichlich müde. Bald höre ich Lorenzo vor sich hin schnarchen, und obwohl ich das Gefühl habe, nicht schlafen zu können, schrecke ich doch verdächtig hoch, als durch die Lautsprecher eine baldige Landung angekündigt wird.
Lorenzo und ich tauschen noch schnell unsere Adressen aus. Zum Abschied umarmen wir uns. So ein chaotischer Flug verbindet. Wir versprechen einander, in Kontakt zu bleiben. Lorenzo lebt in Luzern, was nur etwa dreißig Minuten von meinem Wohnort entfernt ist.
»Kwaheri«, ruft er mir nach.
SCHWEIZ
Das Flugzeug landet sicher in Zürich, und bald schon betrete ich auf etwas wackeligen Beinen Schweizer Boden.
Ich friere.
Innerlich und äußerlich.
Eiszeit in jeder Beziehung.
Es ist Nachmittag, und die Schweiz empfängt uns in ihrem schönsten Novembergrau. Düster und erdrückend tief hängen die Wolken über Zürich. Man könnte die Stimmung nur noch mit etwas Eisregen oder Graupelschauer toppen. Es schüttelt mich.
Noch während ich am Gepäckband auf meinen Koffer warte, suche ich durch die Glasscheiben nach meinen Eltern. Sie wollten mich abholen kommen. Mein Herz klopft vor Aufregung ein wenig lauter.
Nein!
Onkel Hugo ist da!
Es ist doch immer das Gleiche. Meine Eltern hatten wieder einmal Wichtigeres zu tun und haben, wie bereits so oft, Onkel Hugo als Ersatz geschickt.
Ich muss ein paar Mal schlucken.
Ich sehe meinen Koffer übers Rollband auf mich zukommen, aber ich lasse ihn einfach noch eine Runde drehen, damit ich mich sammeln kann. Ich zähle von hundert rückwärts. Das tut gut.
100, 99, 98 …
Möglicherweise tue ich Onkel Hugo unrecht.
87, 86, 85 …
Vielleicht verkenne ich, dass er ein echter Freund ist. Aber zu oft habe ich als Kind auf meine Eltern gewartet, und Hugo wurde vorgeschickt: bei meiner ersten Schultheateraufführung (ich spielte einen Baum), bei meinem ersten Musikschulkonzert (ich spielte Blockflöte), ja sogar bei meiner Lehrabschlussfeier kam Hugo, und dabei war ich so stolz auf den besten Lehrabschluss meines Jahrgangs.
80, 79, 78 …
Wahrscheinlich hat er sich nie aufgedrängt, sondern wurde ständig von meinen Eltern delegiert. Vielleicht kann er mich auch nicht sonderlich leiden?
73, 72, 71 …
Ich beschließe hier und jetzt, ihm noch einmal eine Chance zu geben, und winke ihm zu.
Hugos Empfang ist nicht gerade überschwänglich.
»Schnell, schnell, wir müssen weg«, meint er nach einer flüchtigen Umarmung, nimmt mir den Koffer ab und drängt mich zum Ausgang. Kein Wunder: Sein Auto steht direkt vor der Ankunftshalle im absoluten Parkverbot. Immerhin ist es noch da.
Ich schüttle den Kopf über seinen Leichtsinn.
»Ich habe mich in Zürich verfahren, und am Ende wäre ich fast zu spät gekommen«, entschuldigt er seinen ungewöhnlichen Parkplatz.
Nachdem wir losgefahren sind, fragt er: »Kann es sein, Anita, dass du ein wenig streng riechst? Es ist wohl Zeit, dass du wieder in die Zivilisation kommst.«
Was soll ich dazu sagen? Ich könnte ihm haarklein von meinem Übelkeitsanfall berichten, aber wirklich Spaß macht das ja auch nicht. Und ich habe noch ein wenig Kenya-Gold-Gelassenheit in mir. Nichts und niemand kann mich aus der Ruhe bringen.
Hugo ist inzwischen sowieso beschäftigt. Er muss sich konzentrieren. In Zürich ist der Verkehr dicht und hektisch. Wir Landeier haben immer ein wenig Mühe, uns darin zurechtzufinden.
Als wir dann endlich auf der Autobahn Richtung Schwyz sind, bin ich erleichtert, und auch Hugo entspannt sich ein wenig.
Was wird mich wohl zu Hause erwarten?
Als Dreißigjährige wieder in mein Elternhaus einzuziehen, mittellos und ohne Zukunftsperspektiven, so hatte ich mir mein Leben wirklich nicht vorgestellt.
Ist es das Eingeständnis meiner Niederlage? Habe ich versagt? Wie muss das für meine Eltern sein? Freuen sie sich auf mich?
Seit Jahren leben sie nun alleine in unserem Haus im Grossstein, einem Wohngebiet etwas oberhalb des Dorfkerns von Ibach, aber unterhalb von Schwyz. Die beiden führen seit Jahrzehnten eine Buchhandlung. Seit ein paar Jahren ist diese im Einkaufszentrum Kaufrausch eingemietet. Im Bücherverkaufen sind meine Eltern wirklich gut. Bücher sind ihr Lebensinhalt. Wie sie es geschafft haben, nebenbei auch noch drei Kinder zu zeugen und aufzuziehen, hat mich nachträglich oft gewundert. Wenn ich an meine Eltern denke, dann sehe ich sie immer mit einem Buch: im Urlaub, unter dem Weihnachtsbaum, beim Kochen, auf der Toilette. So bin ich aufgewachsen und wurde automatisch selber ein Bücherwurm. Auch als Teenager gab es für mich nur Bücher. Es war einfach selbstverständlich, dass ich eine Lehre als Buchhändlerin machte.
Erst nach der Lehre kam bei mir die Rebellin durch. Ich hatte eine richtige Wut auf Bücher, als ich merkte, dass das wahre Leben außerhalb von Buchdeckeln stattfand und wesentlich spannender war als in der Literatur. Ich hatte das Gefühl, viel verpasst zu haben, weil ich mich ständig hinter Büchern verkrochen hatte.
Was war ich doch immer für ein braves, pflegeleichtes Kind. Ich hatte ja meine Bücher.
Als Teenager hing ich nie mit zweifelhaften Freunden herum. Ich hatte ja meine Bücher.