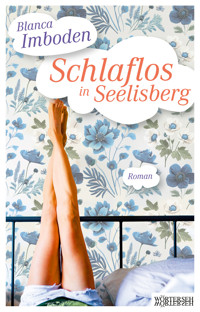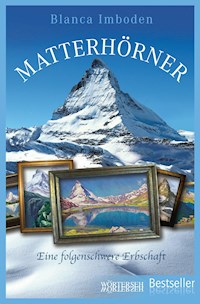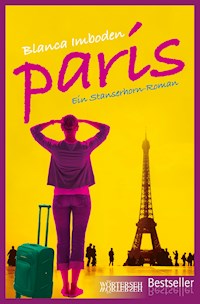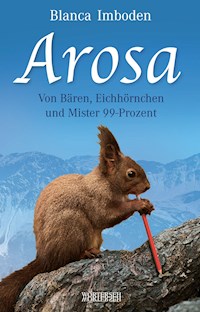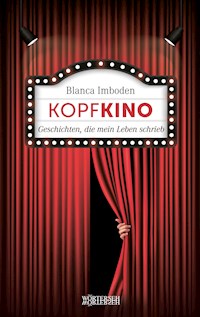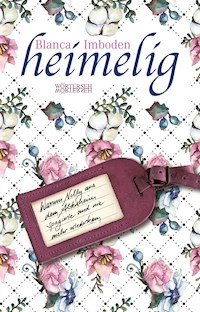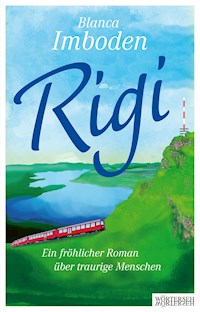
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wörterseh Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eliane, von Beruf freischaffende Journalistin, hat ihren Mann viel zu früh verloren. Seit einem Jahr trauert sie nun schon um ihn und realisiert irgendwann: Für viele Menschen hat Trauer ein Ablaufdatum. Bald einmal hat man gefälligst wieder zu funktionieren und sich dem Leben zuzuwenden. Allerdings sollte dies auf keinen Fall zu früh passieren, denn das wiederum käme auch völlig falsch an. Eliane hat genug – auch von den Wünschen ihrer Tochter Marie, die findet, das Zuhause, aus dem sie notabene längst ausgezogen ist, müsse eine Art Museum sein: Papas Hausschuhe sollten bei der Wohnungstür stehen, seine Jacke immer an der Garderobe hängen bleiben. Um zurück ins Leben zu finden, meldet sich Eliane schließlich bei einer Trauergruppe an und ist überrascht, dass dort nicht nur geweint, sondern auch viel gelacht wird. Sie knüpft neue Freundschaften und lernt sogar zwei Zwergpinguine kennen, die einander in ihrer Trauer beistehen. Und dann erhält Eliane einen Traumjob: Sie kann zum 150-Jahre-Jubiläum der Vitznau-Rigi-Bahn, der ersten Bergbahn Europas, eine Artikelserie schreiben und einen Monat lang auf der Rigi wohnen. Was folgt, sind viele bewegende Begegnungen, auch mit einem Hund, der wie ein Putzmittel heißt. Die Rigi ist ein Kraftort und verändert alles – auch Eliane. Blanca Imboden bringt in ihrem neusten Roman locker all das unter einen Hut, was unser Leben ausmacht. Die Autorin schrieb eine fröhliche, kecke, bunte und überraschende Geschichte, die uns die ganze Bandbreite des Lebens aufzeigt; ein Buch, das für gute Laune sorgt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Wörterseh wird vom Bundesamt für Kultur für die Jahre 2021 bis 2024 unterstützt.
Alle Rechte vorbehalten, einschließlich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.
© 2021 Wörterseh, Lachen 3. Auflage 2022
Lektorat: Andrea LeutholdKorrektorat: Lydia ZellerUmschlaggestaltung: Thomas JarzinaUmschlagillustration: © Thomas Jarzina unter Verwendung von Motiven von www.shutterstock.comUmschlag hinten: Briefmarke Sonderausgabe »150 Jahre Rigi Bahnen«, © Post CH Netz AGUmschlaginnenseiten: Panoramakarte © RigiPlus AG, von Wörterseh auf den Inhalt des Buches angepasstZeichnung Seite 7: Beate Simson nach einem Foto von Tobias Baumgaertner; www.tobiasvisuals.com/Special-MomentsLayout, Satz und herstellerische Betreuung: Beate SimsonDruck und Bindung: CPI Books GmbH
Print ISBN 978-3-03763-130-0 E-Book ISBN 978-3-03763-815-6
www.woerterseh.ch
»Wohin ich auch gehe, du bist überall nicht.«
unbekannt
»Der einzige Weg, den Tränen ein Ende zu setzen, ist – sie zu weinen.«
Jorge Bucay, argentinischer Autor und Psychiater, in »Das Buch der Trauer«
Alles verändert sich mit dem, der neben mir ist – oder neben mir fehlt.*
Für Peter – und Hans (†)
Inhalt
Über das Buch
Über die Autorin
1 Tränen und Thonbrötchen
2 Trauern wie Pinguine
3 Moritz und ich
4 Rigi-Pinguine
5 Trösten ist die Königsdisziplin
6 Rettet die Pinguine!
7 Ein toter Herzensbrecher
8 Groß wie ein Berg
9 In der Lichtkugel
10 Hans im Schneckenloch
11 Jetzt oder nie!
12 Pinguin-Alarm
13 Ein »oRIGInal«
14 Das dünne Wändchen
15 Unendliche Öde
16 Musik liegt in der Rigi-Luft
17 Raumfahrzeuge im Weltall
18 Tierisch
19 Emil
20 Gipfeltreffen
21 Hiiilfeee!
22 Rettung
23 Pippi Langstrumpf
24 Sauwetter
25 Schnecken und Lichtsäulen
26 Zweisamkeit
27 Alles Käse
28 Suchende
29 Bis dass der Tod uns scheidet
30 Anfang und Ende – oder umgekehrt
Dank
Über das Buch
Eliane, von Beruf freischaffende Journalistin, hat ihren Mann viel zu früh verloren. Seit einem Jahr trauert sie nun schon um ihn und realisiert irgendwann: Für viele Menschen hat Trauer ein Ablaufdatum. Bald einmal hat man gefälligst wieder zu funktionieren und sich dem Leben zuzuwenden. Allerdings sollte dies auf keinen Fall zu früh passieren, denn das wiederum käme auch völlig falsch an. Eliane hat genug – auch von den Wünschen ihrer Tochter Marie, die findet, das Zuhause, aus dem sie notabene längst ausgezogen ist, müsse eine Art Museum sein: Papas Hausschuhe sollten bei der Wohnungstür stehen, seine Jacke immer an der Garderobe hängen bleiben. Um zurück ins Leben zu finden, meldet sich Eliane schließlich bei einer Trauergruppe an und ist überrascht, dass dort nicht nur geweint, sondern auch viel gelacht wird. Sie knüpft neue Freundschaften und lernt sogar zwei Zwergpinguine kennen, die einander in ihrer Trauer beistehen.
Und dann erhält Eliane einen Traumjob: Sie kann zum 150-Jahre-Jubiläum der Vitznau-Rigi-Bahn, der ersten Bergbahn Europas, eine Artikelserie schreiben und einen Monat lang auf der Rigi wohnen. Was folgt, sind viele bewegende Begegnungen, auch mit einem Hund, der wie ein Putzmittel heißt. Die Rigi ist ein Kraftort und verändert alles – auch Eliane.
Was für ein Glück, dass die Vitznau-Rigi-Bahn, die erste Bergbahn Europas, im Jahr 2021 ihr 150-jähriges Bestehen feierte, denn dies war der Anlass für Blanca Imboden, eine Reise auf die Königin der Berge zu unternehmen. Ohne dieses Jubiläum hätte die Innerschwyzer Bestsellerautorin den Roman »Rigi«, in dem sie locker all das unter einen Hut bringt, was unseren Alltag ausmacht, wohl nie geschrieben. Die Rigi inspirierte sie zu einer fröhlichen, kecken, bunten, bewegenden und immer wieder überraschenden Geschichte, die uns die ganze Bandbreite des Lebens aufzeigt. »Rigi« ist ein weiteres wunderbares Buch von Blanca Imboden, das schlicht für gute Laune sorgt.
Über die Autorin
© René Lang
Blanca Imboden musste sich mit ihrer eigenen Trauer auseinandersetzen, als 2018 ihr langjähriger Lebenspartner plötzlich starb. Jetzt hat sie dieses Thema in einem – gar nicht traurigen – Roman verarbeitet. Die Rigi, wo die Autorin zu Recherchezwecken einen Monat lang im Hotel Rigi Kaltbad wohnen durfte, bot die spektakuläre Kulisse dazu. Blanca Imboden liebt die Berge, reist aber auch gern auf Lesetour durch die Schweiz. Sie schrieb für Wörterseh zahlreiche Bestseller – die erfolgreichsten: »Wandern ist doof – Ein Kreuzworträtsel mit Folgen« (2013) und »heimelig – Warum Nelly aus dem Altersheim spazierte und nie mehr wiederkam« (2019). Die Autorin, die im Schwyzer Talkessel ihre Wurzeln hat, lebt heute in Malters LU. www.blancaimboden.ch
Die Personen in diesem Roman sind wie fast alles frei erfunden. Folgende Menschen gibt es allerdings tatsächlich auf der Rigi, und auch ihre Geschichten stimmen:
Ferdi Camenzind, Rigi-Original
Renate Käppeli, Rigi Kulm-Hotel
Schwester Theresia Raberger, Tierschutzstelle Felsentor
Urban Frye, Klanghotel Bergsonne
Stefan Winiger, Chalet Schild
Tobias Ernst, Lokführer
Angela und Aron Boddé-Camenzind, Hotel Rigi Kaltbad
Gabriela und Gregor Vörös Egger, Kräuterhotel Edelweiß
Danke, dass ich euch in meinen Rigi-Roman einbauen durfte.
1 Tränen und Thonbrötchen
Wie viele Tränen hat ein Mensch?
Ich habe es heute gegoogelt. Wissenschaftler behaupten, dass ein Mensch in seinem Leben durchschnittlich fünf Millionen Tränen, also etwa achtzig bis hundert Liter Tränenflüssigkeit, vergieße – das ist mindestens eine Badewanne voll. Weil es ethisch fragwürdig sei, Experimente mit Trauernden zu machen, seien diese Angaben allerdings nicht so genau. Am meisten werde nämlich – so hat man immerhin festgestellt – um den Verlust eines Menschen geweint.
Aha!
Eben!
Ich selber habe im letzten Jahr diese Badewannen-Durchschnittswerte überboten. Mehrfach überboten.
Eine menschliche Träne wiege rund fünfzehn Milligramm, las ich weiter.
Meine waren schwerer.
Viel schwerer.
Tonnenschwer.
Gerade gestern bin ich wieder einmal in Tränen ausgebrochen. Peinlich! Eigentlich passiert mir das sonst nicht mehr oft. Zumindest nicht in so unmöglichen Situationen. Ich war im Einkaufszentrum und entdeckte eine Aktion: »Thonbrötchen. Zwei für eins«. Ich stand da, schaute auf die Thonbrötchen und heulte. Einfach nur, weil ich keine mehr kaufen muss. Nie mehr. Weder eines noch zwei.
Mario liebte Thonbrötchen.
Ich nicht.
Tatsächlich habe ich nach seinem Tod noch einige Thonbrötchen in meinen Einkaufswagen gelegt und sie sogar gegessen. Mario hätte mich ausgelacht, hätte er mich sehen können. Und eigentlich hoffe ich ja, dass er tatsächlich noch irgendwie hier ist, um mich herum, und alles sieht und spürt. Ich weiß natürlich, dass ich meine Liebe zu ihm nicht mit solch lächerlichen Aktionen unter Beweis stellen muss. Bestimmt nicht mit dem Kauf von Thonbrötchen. Wirklich nicht.
Trotzdem: Ich stand gestern mitten im Einkaufszentrum und habe geweint. Wegen dieser Brötchen. Wegen Mario. Wegen allem. Und ich habe mich geschämt.
Mein Mann Mario ist vor einem Jahr gestorben. Ich sollte mich langsam besser im Griff haben. Ich merke, dass Verständnis und Mitgefühl in meinem Umfeld nachlassen. Als hätte Trauer ein Ablaufdatum, und ich hätte jetzt, nach einem Jahr, kein Recht mehr darauf.
Aber das Umfeld kontrolliert genauso, ob man nicht etwa zu früh wieder lacht. Es gab ganz merkwürdige Reaktionen, als ich ein paar Wochen nach Marios Tod irgendwo öffentlich mit einer Freundin herumgealbert hatte und es ihr gelungen war, mich einen Moment lang alles vergessen zu lassen. »Sie lacht schon wieder«, tuschelte man hinter vorgehaltener Hand. Aber nicht etwa voller Freude, sondern missgünstig und vorwurfsvoll. Als müsste man daraus schließen, dass ich ihn zu wenig geliebt habe, meinen Mario.
»Mama, bist du da?«
Meine Tochter Marie steht plötzlich vor mir. Sie wohnt nicht mehr hier, platzt aber wie immer ohne Vorwarnung in meine Privatsphäre und erschreckt mich damit fürchterlich. Natürlich möchte ich sie nicht vor den Kopf stoßen und traue mich nicht, sie zu bitten, jeweils zu klingeln, bevor sie ihren Schlüssel benützt. Unsere Beziehung ist ohnehin grad nicht so einfach. Darum begrüße ich sie herzlich, ohne meine Gedanken zu äußern.
»Du hast wieder geweint«, sagt Marie verständnisvoll und lässt sich zu mir auf das Sofa plumpsen. Und ich weiß, es werden keine zehn Minuten vergehen, bis auch sie in Tränen ausbricht.
Marie war Papas Liebling. Sie war das verwöhnte Einzelkind, und Papa war der Beste, der Größte, das Maß aller Dinge. Sie wollte ihn heiraten, als sie noch ein kleines Mädchen mit roten Zöpfen war, und später mussten alle ihre möglichen Heiratskandidaten neben ihm bestehen können. Das war schwierig, hatte sie Mario doch auf einen sehr hohen Sockel gestellt. Mag sein, dass sie deshalb noch immer allein ist.
»Was hast du heute gemacht?«, fragt sie jetzt und lehnt sich an mich. Sie riecht nach Leben und nach Frühling. Ich atme ihren Duft ein, ganz tief, und gestehe dann: »Ich habe die Kleider von Mario zusammengeräumt. Morgen ist Altkleidersammlung.«
Und schon weint sie. Ich wusste es.
»Wie konntest du nur!«, schnaubt Marie und putzt sich aufgebracht die Nase.
Ich frage leise: »Wie lange hätte ich denn noch warten sollen? Es ist doch gut, wenn sonst jemand Freude an Papas Sachen hat. Das würde ihm gefallen.«
»Wieso musste das überhaupt sein? Haben dich seine Kleider denn gestört? Du hast doch riesige Schränke!«
Maries Fragen klingen vorwurfsvoll. Sie tun mir weh, aber ich habe nichts anderes erwartet.
Ich bleibe ganz ruhig, wähle meine Worte mit Bedacht und frage: »Wann, denkst du, hätte ich die Kleider denn weggeben dürfen? In zwei Jahren? In drei? Du kommst zu Besuch und möchtest, dass hier alles immer genau gleich bleibt. Aber das ist weder ein Mausoleum noch ein Museum. Ich lebe hier. Und ich werde hier noch viel mehr Dinge verändern, nach und nach.«
Marie kann es nicht fassen.
»Ihr wart dreißig Jahre zusammen. Dreißig! Und du räumst Papa einfach aus deinem Leben, sobald er tot ist?«
Ich atme tief durch.
Zweimal.
Damit ich nicht mit einer ganz und gar unfreundlichen Antwort herausplatze.
»Marie … ich bitte dich! Es ist schon ein Jahr her, dass dein Vater von uns gegangen ist. Auch du lebst doch wieder dein Leben, trauerst nur noch ab und zu, hast den Schmerz vielleicht für immer in deinem Herzen, genauso wie die Liebe zu ihm. So geht es mir auch. Ich möchte wieder vorwärtsschauen. Dazu gehört aber auch, dass hier nicht alles weiterhin so aussehen kann, als käme Papa grad wieder zur Tür herein.«
Marie putzt sich umständlich die Nase.
»Wenn es Dinge gibt, die dir besonders viel bedeuten, dann nimm sie mit«, schlage ich großzügig vor.
Sie schnaubt eingeschnappt: »Was willst du denn sonst noch alles wegwerfen?«
Will sie das wirklich wissen? Wohl kaum.
Ich antworte nur: »Ich werde nicht über jeden Gegenstand mit dir diskutieren.«
Ich weiß, Marie trauert.
Aber es gibt Grenzen. Und es scheint, dass ich diese langsam, aber sicher setzen muss.
»Ich wünschte, ich könnte Papa auch einfach so abhaken«, sagt meine wunderschöne Tochter, wirft ihr langes rotes Haar zurück und steht auf. »Ich gehe dann mal wieder. Ich wollte nur schauen, wie es dir geht. Und es scheint dir ja sehr gut zu gehen.«
Marie rauscht beleidigt und verletzt davon und lässt die Tür geräuschvoll hinter sich ins Schloss fallen.
Peng.
Wie eine Ohrfeige.
Schwierig.
Alles ist so schwierig.
Ich versuche, mir einzureden, dass ihre Wut nicht wirklich etwas mit mir zu tun hat. Und dass sie mich irgendwann verstehen wird.
Wir trauern beide um den gleichen Mann, nur halt eben anders, ganz anders. Anfangs hat uns die Trauer noch verbunden, als wir beide schockiert und fassungslos am Grab standen. Wir hielten uns an den Händen. Es war fast nicht auszuhalten: Zehn Tage zuvor hatten wir noch Marios zweiundfünfzigsten Geburtstag mit einem ausgelassenen Fest gefeiert. Am nächsten Tag fiel er beim Training vom Hometrainer und war wohl sofort tot. Herzstillstand. Ich muss nicht viel später aus der Küche gekommen sein, aber ich konnte nichts mehr tun. Diese Szene hat sich tief in meine Erinnerung eingegraben. Ich träume davon und schrecke nachts schweißgebadet auf. Auch wenn ich mich an schöne Erlebnisse mit Mario erinnern will, kommt mir immer dieser Moment in die Quere: Ich finde ihn am Boden liegend vor und gerate in Panik. Und ich weiß sogar noch, welches Lied von Udo Jürgens gerade aus der Stereoanlage dröhnte:
Wie könnt’ ich von dir gehen?
Mario konnte es.
Mario war ein eingefleischter Fan von Udo Jürgens. Als der Sänger 2014 als Achtzigjähriger bei einem Spaziergang in Gottlieben bewusstlos zusammenbrach und trotz Wiederbelebungsversuch an Herzversagen starb, betonte Mario immer wieder, dass er sich genau so einen Tod wünschen würde, irgendwann. Das sei doch eine Gnade, ein Geschenk.
Gnade?
Geschenk?
Vielleicht für ihn.
Für mich war es die Hölle. Und aus dieser Hölle habe ich mich noch immer nicht wirklich befreit. Und jedes Mal, wenn ich einen ersten Schritt mache, dann gibt mir ganz bestimmt jemand zu verstehen, dass es noch viel zu früh dafür sei. Viel zu früh.
Woher wissen die das?
Wer bestimmt das?
Seit ein paar Wochen besuche ich eine Trauergruppe. Diese hat mich dazu angestachelt, Marios Kleider wegzugeben. Gut, es gab da auch noch die Anregung, ein paar besondere Stücke zu behalten. Oder aus ein paar alten Hemden ein Kissen zu nähen. Schöne Ideen. Ich habe einfach Marios Schlafanzüge sorgfältig in meine Kommode umgeräumt und ziehe sie regelmäßig an. Sie riechen nicht mehr nach Mario, aber sie erinnern mich an seine Wärme, seine Umarmungen.
Es ist schwierig, mit einem Verlust umzugehen, mit dem Loslassen anzufangen, wenn die ganze Wohnung so aussieht, als würde der Verstorbene gleich wieder heimkommen: die Finken beim Hauseingang, die Jacke an der Garderobe, die Aktentasche im Flur, die Zahnbürste im Glas und die Bierflaschen noch immer im Kühlschrank.
Warum kann Marie mich nicht verstehen?
Warum versucht sie es gar nicht erst?
Marie wünscht sich, dass sich hier nichts verändert.
Ich aber weiß, dass ich Veränderungen brauche.
Und nein, ich räume Mario nicht aus meinem Leben.
Ha! Als ob man so was könnte! Und als ob ich das jemals wollte! Mario wird immer ein Teil von mir bleiben.
2 Trauern wie Pinguine
Als ich vor zwei Monaten nicht mehr aufhören konnte zu weinen, plötzlich, ohne dass es einen besonderen Anlass dafür gegeben hätte, nicht einmal ein Thonbrötchen, suchte ich Hilfe bei meiner Hausärztin. Ich hatte schließlich einen Job und furchtbare Angst, so ein Weinkrampf könnte einmal im falschen Moment über mich kommen, vielleicht mitten in einem Interview mit einer wichtigen Persönlichkeit oder während einer Gemeindeversammlung. Ich hatte meine Emotionen nicht mehr unter Kontrolle. Meine Hausärztin überwies mich an eine Psychiaterin im gleichen Haus.
Es war leicht, mich auf Frau Dr. Fuchs einzulassen. Mir gefiel die würdig ergraute Dame sofort. Ihre Augen, umrahmt von unzähligen Lachfältchen, strahlten Wärme und Empathie aus. Sie machte ein paar Tests mit mir, ließ mich zum Beispiel Farben und Formen sortieren und auswählen und hörte mir aufmerksam und verständnisvoll zu. Am Ende erklärte sie beruhigend, ich sei keineswegs krankhaft depressiv, hätte bloß eine Änderungsstörung. Sie empfahl mir ein leichtes Antidepressivum und schlug mir eine Therapie vor.
»Eine Therapie? Was soll ich da?«, fragte ich widerspenstig.
»Mit jemandem reden, der Ihnen bei Ihrer Trauerarbeit helfen kann, der Sie unterstützen kann«, erklärte Frau Fuchs ruhig.
»Ich brauche einfach Zeit. Ich brauche wohl auch keine Antidepressiva«, versuchte ich abzuwiegeln und wollte schnell wieder gehen.
»Wenn Sie alles allein schaffen, Frau Engel, warum sind Sie dann heute hier?«, fragte Frau Fuchs, und ihre Augen bohrten sich in meine.
Eins zu null für Frau Dr. Fuchs.
Zeit heilt alle Wunden.
Sagt man.
Aber ich glaube, ich saß dort auf diesem blauen Polsterstuhl bei der Psychiaterin, weil ich mir diese Zeit nicht geben wollte oder, besser: weil ich die Zeit nicht aushielt. Weil ich keine Geduld mehr hatte. Weil ich mein altes Leben zurückhaben wollte, meinen inneren Frieden, die Leichtigkeit. Jetzt. Sofort. Weil diese Zeit so schmerzte und ich vielleicht einfach ein verwöhntes Ding war, das solche Schmerzen bisher nicht gekannt hatte und daher nicht damit umgehen konnte – und es auch nicht wollte.
Das alles hätte ich sagen können, aber ich schwieg, und eine Träne rann über mein Gesicht. Nur eine kleine. Höchstens zehn Milligramm.
»Sie könnten auch eine Trauergruppe besuchen. So eine Art Selbsthilfegruppe. Mit ausgebildeten Betreuerinnen. Was meinen Sie? Würde Ihnen das eher entsprechen?«
Was für eine Frage!
Würde Ihnen eine Trauergruppe eher entsprechen?
Natürlich nicht! Ich sah mich schon dort sitzen.
Ich bin Eliane Engel und änderungsgestört.
Aber ich erklärte mich einverstanden mit diesem Kompromiss. Und ich versprach, das Antidepressivum ganz genau nach den Anweisungen der Füchsin einzunehmen. Man müsse es »einschleichen«, meinte sie. Und auf keinen Fall dürfe man es einfach wieder absetzen. Da müsse man es dann wieder »ausschleichen«.
Einschleichen.
Ausschleichen.
Trauergruppe.
Mensch! Diese Wörter wollte ich meinem Wortschatz wirklich nie antun. Ich hatte das Gefühl, ziemlich tief gesunken zu sein, und zwar zu einem Zeitpunkt – also nach fast einem Jahr –, zu dem ich längst wieder »normal« sein wollte und sollte, zumindest nach meinen eigenen Vorstellungen.
Das Antidepressivum hatte bei mir auch in kleinster Dosis eine wunderbare Wirkung. Ich fühlte mich nicht fremd, nicht berauscht oder gedämpft, aber sofort befreit von einem schweren Druck. Als hätte man mir einen tonnenschweren Rucksack abgenommen. Und ich hatte wieder die Kontrolle über meine Gefühle. Jedenfalls meist. Zumindest musste ich mich nicht mehr davor fürchten, gar nicht mehr mit dem Weinen aufhören zu können, wenn mir mal wieder die Tränen kamen.
Und jetzt treffe ich mich jede Woche mit anderen Trauernden. Zu meinem ersten Besuch in Goldau war ich widerwillig und bockig erschienen, entschlossen, mich nicht einzubringen und niemals meine innersten Gefühle vor Fremden nach außen zu kehren, meine Zeit dort einfach abzusitzen. Und heute freue ich mich auf diese Treffen. Wir sind eine Gruppe. Wir tun einander gut.
Eva ist die Jüngste in unserem Kreis. Sie hat ihren sechs Jahre alten Sohn Enrico bei einem Autounfall verloren. Zuerst habe ich mich gefragt, warum sie nicht bei ihrem Ehemann Trost findet. Aber dann habe ich begriffen: Sie hat Angst um diese Beziehung. Der Tod eines Kindes belastet eine Ehe sehr. Dafür habe ich großes Verständnis. Zuerst schweißt der Tod sicher zusammen, aber dann muss jeder mit seiner eigenen Trauer umgehen, und das geht nicht immer gemeinsam und im gleichen Tempo. Das sehe ich ja bei mir und meiner Tochter Marie. Ich bewundere Eva, weil die junge, zarte Frau so zerbrechlich wirkt in ihrer Trauer, aber doch stark ist. Ich mag es, wie sie redet. Sie wählt ihre Worte sorgfältig, sie spricht wenig – aber wenn, dann hört ihr jeder zu.
Moritz ist sechzig Jahre alt und hat vor drei Jahren seine Mutter verloren. Obwohl er Frau und Kinder hat, sitzt er hier in der Trauergruppe und weint fast bei jedem Treffen. Das bringt mich an die Grenzen meines Verständnisses. Seine Mutter war ganz langsam über Jahre hinweg dement geworden und starb dann an einer Lungenentzündung. Er hatte also genug Zeit, sich von ihr zu verabschieden, könnte man meinen. Warum schafft er es nicht, sie loszulassen?
Nein, wir werten nicht. Nein, wir schauen nicht, wessen Trauer mehr wiegt oder ob einer mehr Recht zu trauern hat als der andere. Sonst wären wir ja gerade so wie all die Menschen in unserem Umfeld, die uns nicht verstehen können, die uns in unserer Trauer nicht so nehmen können, wie wir sind.
Die Grundregeln unserer Treffen finde ich gut, und ich bemühe mich, sie einzuhalten.
Theoretisch.
Da ist aber zum Beispiel auch Doris. Sie ist Mitte vierzig und ein bisschen schwierig. Einerseits ist sie extrem katholisch und dabei oft päpstlicher als der Papst, aber auch wenn sie überzeugt davon ist, dass ihr Ehemann, der vor einem Jahr gestorben ist, nun bei Gott ist, sozusagen direkt an seiner Seite hockt, glücklich und erleuchtet, scheint sie selber doch sehr, sehr unglücklich zu sein, was ich nicht ganz verstehen kann. Ihr Glaube müsste ihr doch genug Trost spenden. Das scheint bei Doris nicht zu funktionieren.
Neulich hat sie zu Eva, deren Sohn Enrico erst vor fünf Monaten gestorben ist, allen Ernstes gesagt: »Gott gibt jedem nur das Päckchen mit, das er auch wirklich tragen kann.«
Da bin ich zum ersten Mal ein bisschen ausfällig geworden. Ich erklärte der Verklärten erbost: »Das stimmt einfach nicht! Viele zerbrechen an ihrem Schicksal und bringen sich um, verfallen irgendwelchen Drogen oder landen in der Psychiatrie. Weil das verdammte Päckchen zu schwer war!«
Doris meinte ungerührt: »Dann haben diese Menschen nicht wirklich geglaubt. Wenn man glaubt, dann vertraut man, dann kann man sich geborgen fühlen, auch in schweren Zeiten.«
Gerade als ich Doris entgegnen wollte, was auch meine Psychiaterin mich gefragt hatte, nämlich: »Warum bist du dann hier?«, wechselte Rosmarie das Thema.
Rosmarie, unsere Leiterin, ist sehr jung. Anfangs dachte ich: Viel zu jung. Ja, auch ich habe manchmal Vorurteile. Es kommt mir vor, als würden überall an wichtigen Stellen immer nur junge Leute sitzen. Der Notarzt, der zu meinem Mario kam, der war praktisch noch ein Kind! Mein neuer Zahnarzt sieht so jung aus, dass ich misstrauisch sein Diplom studiert habe, das an der Wand im Wartezimmer hängt. Dabei ist es wohl einfach so, dass ich immer älter werde.
Aber Rosmarie ist nicht nur jung, sie ist vor allem sehr intelligent und einfühlsam. Sie schließt nächstes Jahr ihr Psychologiestudium ab, und wir sind das Objekt ihrer Masterarbeit. Manchmal verzweifelt sie fast an uns, dann verdreht sie kurz ihre schönen Augen. Aber immerhin liefern wir ihr jede Woche neu wirklich gutes Material – wir sind ja ein recht bunter Haufen.
Rosmarie trägt mit Vorliebe farblose Kleider, bevorzugt Grau- und Beigetöne. Wahrscheinlich glaubt sie, dass sie so, zusammen mit ihrer altmodischen Brille, älter aussieht, als sie ist. Tut sie auch. Was auch wieder schade ist. Vielleicht erhofft sie sich von ihrem strengen Outfit auch mehr Autorität. Als könnte man sich Autorität anziehen!
Marie-Theres ist unsere Älteste. Ihr Ehemann ist schon seit drei Jahren tot. Aber sie kommt einfach nicht darüber hinweg, fühlt sich einsam und verlassen. Sie war ja auch fast ihr ganzes Leben mit ihm zusammen: fünfzig Jahre! Jetzt ist die rüstige Siebzigjährige allein. Sie hat nie etwas ohne ihren Köbi gemacht. Nichts. Gar nie. Sie ist direkt vom Elternhaus aus mit ihm zusammengezogen. Ihre drei Kinder können ihr in ihrer Trauer und Einsamkeit nicht wirklich helfen, weil sie über den ganzen Erdball verteilt leben. Und Marie-Theres sieht sich außerstande, die Schweiz ohne die Begleitung ihres Köbi zu verlassen. Sonst könnte sie ja eigentlich der Reihe nach ihre Kinder besuchen. Das wäre bestimmt spannend und würde sie auf andere Gedanken bringen. Aber nein, das macht sie nicht. Das kann sie nicht.
Weiter gehört Anita zu unserem Grüppchen. Sie ist wohl die Traurigste unter uns. Falls es da einen Wettbewerb gäbe, würde sie ihn gewinnen. Sie trägt selten etwas zu einem Gespräch bei, außer Tränen. Ihr Mann hat sich vor wenigen Monaten umgebracht. Anita ist vierzig, und sie war erst zwei Jahre verheiratet.
Ja, und dann bin da eben noch ich, Eliane Engel, fünfzig Jahre alt. Witwe mit einer erwachsenen Tochter. Journalistin. Eine Frau, die keine Geduld mehr hat mit dem Trauerprozess und die den Schmerz nicht mehr länger ertragen will. Eine »Änderungsgestörte«. Die braunen Haare trage ich kinnlang, und die ersten grauen Strähnen ignoriere ich. Ansonsten: mittelgroß, mittelschlank, mittelschön. Es gab einen Mann, der mich attraktiv, witzig und intelligent fand – aber der lebt nicht mehr.
Wir sechs bilden also den harten Kern dieser Trauergruppe um unsere Leiterin Rosmarie. Manchmal stoßen neue Trauernde zu uns. Aber viele finden dann doch nicht, was sie suchen, und steigen wieder aus.
Heute sind alle ganz außer sich, weil Rosmarie eine herzige Geschichte mitgebracht hat. Sie zeigt uns auf einer Großleinwand ein wunderschönes, berührendes Foto von zwei australischen Zwergpinguinen, die sich mit ihren Flossen umarmen. Sie stehen auf einem Felsen und betrachten die Lichter Melbournes. Da sie zu einer von Forschern genau beobachteten Gruppe gehören, weiß man: Beide haben ihre Partner verloren. Einer davon ist eine Sie, eine alte Dame, der andere ein junges Männchen. Sie kümmern sich jetzt umeinander. Sie stehen regelmäßig nahe zusammen und schauen auf das Lichtermeer der Stadt. Der deutsche Fotograf Tobias Baumgaertner, der das Bild gemacht hat, schrieb dazu: »Während die anderen Pinguine schliefen oder herumliefen, schienen diese beiden einfach nur da zu stehen und jede Sekunde zu genießen, die sie zusammen hatten.« Immer wenn es Abend werde, würden die beiden zusammenrücken und sich gegenseitig trösten.
Das Foto berührt mich.
Sehr.
Marie-Theres meint, die beiden seien eine Mini-Trauergruppe.
Doris fragt: »Leben Zwergpinguine denn monogam? Gibt es überhaupt Tiere, die monogam leben?«
Eva zückt ihr Handy, obwohl das in der Trauergruppe eigentlich verpönt ist, ignoriert Doris’ strengen Blick und verkündet bald einmal: »Es gibt erstaunlich viele Tiere, die monogam leben. Schabrackenschakale, Regenbogenpapageien, Schwertwale … Und natürlich Seepferdchen. Die sind ja bekannt für ihre Treue. Und ganz klar: Zwergpinguine.«
Rosmarie betont jedoch, das Bild drücke für sie vor allem aus, dass sich zwei Menschen durchaus gegenseitig beistehen können, selbst wenn beide trauern. Trauer könne auch verbinden. Und da wir heute ja sozusagen unter uns seien, nur der harte Kern anwesend sei, wolle sie ein kleines Experiment wagen. In eine Kartonschachtel, in der laut Aufschrift früher einmal Raviolibüchsen verpackt waren, hat sie mit unseren Namen beschriftete Kärtchen gelegt.
»Ich ziehe jetzt jeweils zwei Kärtchen. Die beiden von euch, deren Namen draufsteht, versuchen dann, in den nächsten Tagen einmal Kontakt miteinander aufzunehmen. Ihr könnt kurz telefonieren. Wenn euch das zu viel ist, schreibt ihr euch eine Ansichtskarte. Vielleicht trefft ihr euch aber auch zu einem Kaffee? Es ist euch überlassen. Jeder tut, was ihm möglich ist. Die Kontaktdaten haben wir ja längst ausgetauscht.«
Wie bitte?
Hier in diese Trauergruppe zu kommen, das ist eine Sache. Aber möchte ich beispielsweise Doris bei mir zu Hause bewirten? Und könnte ich den Schmerz von Anita aushalten?
Diese Rosmarie hat ja Ideen!
Wir sind wirklich das Experimentierfeld für ihre Masterarbeit. Weiß sie eigentlich, was sie da tut?
»Ich werde beim nächsten Mal nicht überprüfen, ob und welche Treffen stattgefunden haben. Es ist nur eine Anregung, eine Idee. Seht es als Chance. Traut euch. Seid offen. Seid Zwergpinguine!«
Ich will kein Pinguin sein!
Schon gar nicht ein Zwerg.
Aber schon geht es los. Die Verlosung beginnt. Und wer wird für mich ausgelost? Die Spannung steigt.
Und dann werde ich aufgerufen.
Mit Moritz.
Ausgerechnet!
Er schaut mich an, und ich kann in seinem Pokerface nicht erkennen, was er denkt. Ich selber versuche im Moment, überhaupt nicht darüber nachzudenken.
Rosmarie will dann noch wissen: »Hat jemand in den letzten vierzehn Tagen etwas Besonderes erlebt, das er mit uns teilen möchte? Hat jemand einen kleinen Fortschritt gemacht? Hat jemand Tipps vom letzten Treffen umgesetzt?«
Ohne es zu wollen, nicke ich, und Rosmarie spricht mich sofort an: »Erzähl, Eliane. Wenn du magst.«
»Ich habe die Kleider von meinem Mario in Altkleidersäcke geräumt.«
»Und wie hast du dich dabei gefühlt? Und wie fühlst du dich jetzt, Eliane?«
»Meine Tochter hat mir schwere Vorwürfe gemacht.« Es wird unruhig im Kreis. »Aber ich fühle mich trotzdem gut damit. Es war wirklich an der Zeit.«
Rosmarie fragt: »Du hast noch ein paar Sachen behalten?«
Ich nicke wieder, will aber dazu nicht noch mehr sagen.
»Wenn deine Tochter mit dem Tod ihres Vaters nicht zurechtkommt, liebe Eliane, dann sollte sie sich selber auch eine Trauergruppe suchen, statt auf dir herumzuhacken«, sagt Moritz plötzlich heftig.
Interessant. Von ihm hätte ich jetzt wirklich keine Unterstützung erwartet.
Rundherum bestätigen alle diese Aussage. Und das tut mir unerwartet gut. Natürlich wusste ich, dass ich jetzt auch mal für mich schauen muss. Aber so eine Bestätigung ist sehr wohltuend. Ich staune selber, dass ich das anscheinend brauche.
Eva meldet sich zu Wort und sagt, dass sie erstmals seit dem Tod ihres Sohnes mit ihrem Mann über ein weiteres Kind gesprochen habe. »Es soll kein Ersatz für Enrico sein. Das nicht. Aber wir wollten immer Kinder. Und wir könnten immer noch Kinder haben.«
Rosmarie findet das schön. »Lasst euch Zeit. Aber redet darüber. Wir wollen dann alle zur Taufe kommen!«
Das gibt ein kleines Gelächter in der Runde. Wir lachen eigentlich oft und viel, wenn man bedenkt, dass wir eine Trauergruppe sind.
»Wir gehören keiner Kirche an. Es gibt keine Taufe«, erklärt Eva, »aber zu Kaffee und Kuchen würden wir euch dann trotzdem gern einladen.«
Oh.
»Dann ist Enrico ohne Taufe gestorben?«, fragt Doris und vergisst fast zu atmen, bekreuzigt sich sogar.
Ich erinnere mich nur vage daran, dass wir im Religionsunterricht einmal furchtbare Dinge lernten über den Tod ohne Taufe. Von wegen Erlösung von der Erbsünde und so. Heute kann mich das nicht mehr erschrecken.
Eva sowieso nicht. Sie antwortet ungerührt: »Wenn dein Gott so großherzig und gütig ist, wie du immer sagst, wird er Enrico in den Himmel aufnehmen, falls es den überhaupt gibt.«
Sie scheint in dieser Beziehung völlig mit sich im Reinen zu sein. Das gefällt mir.
Die Zeit ist schon wieder um, und Rosmarie hat wie immer das letzte Wort, bevor wir uns verabschieden. Diesmal sagt sie, dass wir alle ab und zu einen Pinguin brauchen, der seine Flossen um uns legt.
»Und denkt doch auch daran, dass man ab und zu Hilfe und Nähe einfordern muss und darf. Wenn sich Freunde und Bekannte vielleicht unerwartet zurückgezogen haben, dann müssen wir uns halt selber mal wieder bei ihnen melden. Und wenn wir keinen Pinguin finden, bei dem wir uns anlehnen können, dann seien wir selber ein Pinguin – für andere. Ihr habt ein Namenskärtchen in der Tasche. Denkt darüber nach. Ich wünsche euch allen eine gute Woche.«
Schließlich löscht jeder die Kerze, die in der Mitte des Kreises für seinen Verstorbenen brennt. Das ist eine schöne Zeremonie, beim Anzünden und beim Löschen. Dazu läuft immer die gleiche, leise Musik. Ich nehme das Foto von Mario wieder an mich, das ich jeweils bei der Kerze ablege, wie das auch alle anderen tun.
Und dann gehen wir wieder unserer Wege.
3 Moritz und ich
Mein Mario wurde nicht im allgemeinen Gemeinschaftsgrab beigesetzt. Seine Familie, die Familie Engel, hat eine eigene Grabstätte auf dem Schwyzer Friedhof. Mario wollte dort begraben werden, wo bereits seine Eltern liegen, seine Großeltern und zwei Tanten. Das bestimmte er zu Lebzeiten so. Auch ich dürfe eines Tages hier liegen, hat man mir nun versprochen. Es gab Zeiten – sie sind noch nicht lange her –, da hätte ich mich liebend gern spontan dazugelegt. So einfach geht das allerdings nicht. Jeder hat seine Zeit, sein Ablaufdatum. Ich muss weitermachen, ob ich will oder nicht.
Der Grabstein mit einer imposanten Engelsstatue aus hellem Cristallina-Marmor, der aus dem Tessiner Maggiatal hierhergebracht wurde, ist sehr – wie soll ich sagen – auffällig. Bösartiger könnte man ihn auch als protzig bezeichnen. Nach Marios Tod hat mir seine Tante Hildegard sofort die Pflege des Familiengrabes übertragen. Bis dahin war sie dafür verantwortlich.
»Du bist ja jetzt sowieso regelmäßig hier«, meinte sie. »Also kannst du auch gleich die Blumen gießen, das Unkraut in Schach halten und schauen, dass es immer hübsch gepflegt aussieht.«
Ja, ich bin regelmäßig hier, aber eigentlich nur wegen dieser Verpflichtung. Sonst zieht es mich nämlich gar nicht hierher. Anfangs halfen mir die Grabbesuche, Marios Tod überhaupt zu realisieren. Der Schock saß so tief, dass ich Mühe hatte, zu akzeptieren, was geschehen war. Ich hatte immer noch die wahnwitzige, winzige Hoffnung, Mario würde plötzlich irgendwo um die Ecke kommen und mich lachend umarmen. Hier am Grab stirbt diese Hoffnung, dieser schöne Traum, immer wieder neu. Ansonsten gibt mir dieses Grab gar nichts, verstärkt nur mein Gefühl der Hilflosigkeit. Ich finde hier sicher keinen Trost. Und ich fühle mich Mario überall näher als hier bei diesem protzigen Engelsgrab.
In Spielfilmen ist das anders. Da stehen die Hinterbliebenen gern am Grab und reden mit ihrem Verstorbenen, erzählen ihm mit je nachdem erstickter oder tapfer gefasster Stimme alles, was gerade anfällt. Sie kommen zum Weinen, zum Jammern, zum Klagen, um Neuigkeiten zu verkünden. Schlimmstenfalls hämmern sie auf den Grabstein ein und stoßen Verwünschungen aus. Als würden uns die Toten auf dem Friedhof, wo bestenfalls ihre Leibeshüllen verwesen, besser hören, sehen und verstehen können als sonst wo.
Immerhin gibt es ein goldgerahmtes Foto von Mario auf dem Marmor. Ein gutes Foto, das ihn so zeigt, wie er war: keine Haare, aber dafür viel Platz für ein Gesicht voll von herzlichem Lachen und fröhlichem Strahlen. Irgendjemand fand, man müsste für eine Grabstätte ein ernsteres, offizielleres Foto auswählen. Ich wehrte mich erfolgreich.
In letzter Zeit begegnet mir hier häufig ein Mann in ungefähr meinem Alter. Ich kannte seine vor ein paar Monaten verstorbene Frau flüchtig. Und jetzt beobachte ich ihn manchmal heimlich, wenn er vor ihrem Grab steht, das sich ganz in der Nähe des Engel-Familiengrabes befindet, in sich und seine Trauer versunken. Ich sehe mich, wenn ich ihn sehe. Ich sehe mich, wie ich in den ersten Monaten war: ein Schatten meiner selbst, ein gebrochener Mensch, eine offene Wunde. Ich sehe seine Körperhaltung und verstehe ihn. Und ich spüre, dass ich doch schon ein gutes Stück weitergekommen bin, dass ich doch wieder aufrechter durchs Leben gehe. Vielleicht dank meinem Antidepressivum. Das ist etwas, was mir gar nicht gefällt: Ich weiß nie, wie es mir wirklich geht. Ich möchte die Tabletten baldmöglichst absetzen, habe aber Angst davor.
Ich weiß, dass der trauernde Mann Emil Eichhorn heißt und ein großes Dachdeckergeschäft hier in Schwyz hat. Manchmal bin ich versucht, ihm die Karte von unserem Trauertreff in die Hand zu drücken. Aber das würde er vielleicht falsch oder gar nicht verstehen, übergriffig finden. Unter Umständen braucht er keinen Pinguin, weil er genug Freunde und Familie hat, die ihn stützen.