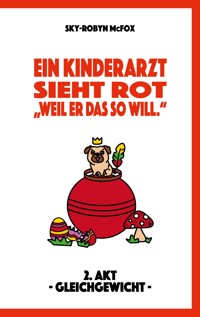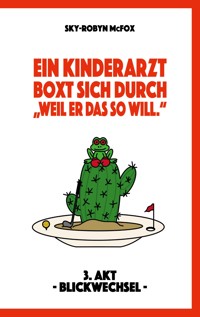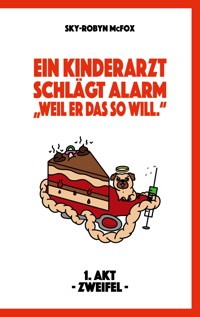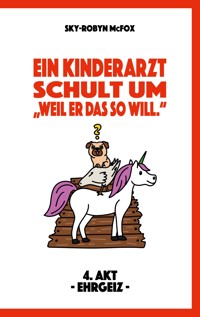
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: "Weil er das so will."
- Sprache: Deutsch
"Ein Kinderarzt schult um!" Was? Schon wieder so ein Quereinsteiger, der meint, er kann unterrichten, obwohl er gar nicht auf Lehramt studiert hat? Ganz genau! Pandemie, Krieg und Inflation, das alles regt einen doch schon genug auf! Wir wäre es dann mit ein "wenig" Humor? Dieser bitterbösen Alltagssatire folgend, begleitet der Leser einen Kinderarzt zurück auf die Schulbank. Nichts Geringeres als ein ultimativer Reiseführer voll schräger Kuriositäten und Absurditäten rund um das deutsche Bildungswesen erwartet Sie. Ein Leerplan ohne Druck. Dieser vierte Akt von insgesamt fünf beschäftigt sich mit den "Widrigkeiten" des Schulbesuches unserer Heranwachsenden*Innen. Lachen bis der Arzt kommt? Ganz im Gegenteil.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
4. Akt
Intro zu Aufzug 17
Aufzug 17
Einschulung
Föderalismus
Binnendifferenzierungsangebot
Intro zu Aufzug 18
Aufzug 18
Alternativpädagogik
Kontrolle
Bewertung
Pflicht
Motivation
Intro zu Aufzug 19
Aufzug 19
Folgeschule
Außerschule
Zeitmaschine
Herzlich willkommen zurück aus der Pause. Ich hoffe Sie haben wieder ein wenig frische Luft geschnappt, ein weiteres Getränk zu sich genommen oder sich abermals erleichtert. Das war bestimmt einmal nötig! Mir zumindest verschaffte der dritte Akt eine deutliche Erleichterung. Da hatte sich so einiges angestaut! Nun gut. Alle, die möglicherweise erst jetzt hinzugestoßen sind, beziehungsweise aus Versehen das vierte Buch vor dem ersten, zweiten und dritten gekauft haben, begrüße ich an dieser Stelle natürlich auch. Spätesten jetzt kann ich es aber auch nicht mehr schönreden! In der Schule hätten Sie dafür wahrscheinlich einen Eintrag bekommen, zumindest während meiner Schulzeit. Aber das ist ja heute alles anders. Heute beginnt man einfach mit dem vierten Akt und bekommt ein Lob, dass man überhaupt etwas liest. Nein, ich möchte Sie jetzt wirklich nicht für dumm verkaufen, dafür ist ja heutzutage schließlich die Schule zuständig. Ich habe nur vor, Sie eines Besseren zu belehren.
Und schon sind wir auch wieder mitten im Thema. Sie werden erstaunt sein wie sehr sich Bildungs- und Gesundheitswesen ähneln.
Vorhang auf und viel Vergnügen!
4. Akt
- Ehrgeiz -
Ehrgeiz erwächst. Er kann aus dem tiefsten Inneren von ganz allein kommen, oder aber er nimmt seinen Ursprung von außen. Nicht unwesentlich nimmt gerade der Ehrgeiz der Eltern Einfluss auf die Menschwerdung des Kindes. Diesen Unterschied wahrzunehmen stellt gleichwohl eine große Hürde dar, denn nicht selten erkennen Eltern zum ersten Mal ihre eigenen Grenzen, wenn ihre Ambitionen von denen ihrer Kinder abzuweichen drohen. -
„Retardation“ ist die Bezeichnung für den 4. Akt in unserem Drama. „Das retardierende Moment (frz. retarder „verzögern“) bezeichnet eine Szene im Handlungsverlauf eines Dramas, die nach dem Höhe- und Wendepunkt das Ende der dramatischen Handlung hinauszögert, indem sie kurzzeitig einen anderen Ausgang als erwartet möglich oder wahrscheinlich macht. Dadurch steigt die Spannung vor dem unweigerlichen Ende erneut an.“1
In diesem nun folgenden Akt steht das Thema „Schule“ im Zentrum meiner theatralischen Betrachtung. Was könnte die Spannung in unserem Stück noch dramatischer steigern, als das? Die Schule ist aus meiner Sicht das Bindeglied zwischen Kindheit und Erwachsensein.
Neben der Schule des Lebens ist es doch vor allem die Schule als Bildungseinrichtung, die einen prägt, zumindest den ein oder anderen. Die Schule, dieser zauberhafte Ort, wo man zum ersten Mal das Vergnügen hat, höhere Ziele zu verfolgen als den schnellen Weg zur nächsten Milchquelle, Mamas Brust. Was für eine noble Mission: der Schulabschluss! Dies stellt den wahren Prolog der Menschwerdung dar. Und ach ja, die Pubertät, dieser rauschende Ball der Hormone läuft ja parallel dazu, aber warten wir damit bis zu unserem spektakulären Finale im fünften Akt. Alle halten jetzt bitte ihren Atem an, denn wir werden uns bald in die wilden Gewässer von „Schulkonzepten“, dem labyrinthartigen „Schulföderalismus“, den rätselhaften „Binnendifferenzierungsangeboten“ und, Trommelwirbel, der „Alternativpädagogik“ stürzen! Ein Ritt auf der Rasierklinge der Bildung, prächtig und schmerzhaft zugleich! Ganz zu schweigen vom Druck, der darauf lastet, ein wahrhaft köstlicher Cocktail des Lebens, nicht wahr? Gemeinsam werden wir das Bildungssystem erkunden. Wir werden uns geschichtliche Hintergründe und politische Strukturen ansehen, den von mir oft kritisierten gesellschaftlichen Wandel hinterfragen und letztlich das menschliche Verlangen nach Wissen bis in seine DNA erforschen.
Natürlich werden wir auch ergründen wie es unserem Helden Max ergangen ist. Während ich kapitelweise über meinen eigenen emotionalen Dreck sinniert habe,
reifte er in aller Seelenruhe zu einem sechsjährigen Knaben heran. Nun hat er es geschafft. Er kann machen, was er will. Er hat die Krone auf, das Zepter in der Hand, waltet und schaltet, wie es ihm beliebt. Tine und Mario sind bedingungslos stolz auf ihn. Herrlich! Das ist Allmacht. Er muss nichts leisten und wird auch noch dafür gelobt! Schluss, aus, Ende? Nein, jetzt wird es erst richtig spannend. Das Märchenland liegt hinter ihm. Jetzt wird’s ernst. Er findet sich nämlich langsam in der realen Welt wieder. Wie wird er dort funktionieren und vor allem, wie reagiert das „System“ auf ihn? Soll er doch mal zeigen, aus was für einem „Holz“ er geschnitzt ist und was er mit seiner Selbstbestimmung so alles drauf hat! Auch wenn es ihn verwundern wird, aber selbst Allmacht hat irgendwann ihre Grenzen. Doch es irrt, wer glaubt, dass es das heutige Schulsystem ist, welches der Allmacht seine Grenzen setzt, mit Nichten! Gemeinsam mit den Eltern verschärft es eher noch das Problem. Nein, Grenzen setzt sich allein unser Held, wenn er will. Es ist der Verstand, der zwar zögerlich aber stetig in ihm wächst und ihm begreiflich machen wird, welche Hürden er nun bereit sein wird zu überwinden oder eben nicht. Wir werden sehen.
Ach, die Grundschule, diese magische Drehscheibe der Keime und Bakterien, wo Kinder nicht nur das Einmaleins lernen, sondern auch, wie man effektiv Krankheitserreger tauscht. Tja, die Kita war erst der Anfang! Für den niedergelassenen Kinderarzt ist gerade die Grundschule ein wahres Paradies, quasi das ständig fließende Band in einer Pralinenfabrik. Ohne die Grundschule wäre der Wartezimmerstuhl wahrscheinlich kälter und weniger abgenutzt. Die kleinen ABC-Schützen kommen tagein, tagaus fröhlich mit frisch ausgetauschten Viren und Bazillen in die Praxis. Was in der Schule als harmloses „Flüsterpost“-Spiel beginnt, endet bei mir als „Wer hat den stärksten Husten?“- Wettbewerb. Oh Gott, ich beginne ja schon wieder von meinem Beruf zu schwärmen. Ich bitte um Entschuldigung. Es soll ja eigentlich um etwas ganz anderes gehen.
Bevor es nun endlich losgeht, noch ein paar erklärende Worte für alle, die sich nun fragen: „Der ist doch Arzt, wieso meint er, Ahnung vom Schulsystem haben zu können?“ Das ist durchaus berechtigt! Zunächst einmal komme ich aus einer „Lehrerfamilie“. Man könnte sogar meinen, ich sei im Bildungsministerium aufgewachsen. Angefangen damit hatte mein Opa mütterlicherseits in den vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts. Er war Mathe- und Physiklehrer, später sogar Kreisschulinspekteur. Meine Mutter war Grundschullehrerin, mein Vater Berufsschullehrer, meine Tanten, meine Cousine und meine Schwägerin waren und sind Oberstufenlehrerinnen/Gymnasiallehrerinnen, mein Bruder lehrt an der Hochschule, ja selbst einen Quereinsteiger kenne ich, meinen Schwager. Zudem habe ich Freunde an Privatschulen, kirchlichen Schulen und freien Schulen (wie z.B. Montessori). Jedes Gespräch, was ich mit ihnen führe, endet früher oder später unweigerlich immer beim Thema Bildung. Der zweite Grund für meine „Ahnung“ basiert auf meiner Erfahrung. Ich begleite meine drei Kinder mittlerweile schon viele Jahre und das natürlich auch schulisch. Dass sich einer der fünf Akte um die Schule drehen würde, war also abzusehen. Der dritte Grund jedoch ist der wesentlichste. Es ist die Kompetenzverlagerung, um die es mir geht. Schulische Probleme und Defizite werden zunehmend in den medizinischen Bereich verlagert, sprich in die Kinderheilkunde und dafür bin ich nunmal zuständig. Es gibt sogar eine Diagnose, die ich dann verschlüsseln kann, „Schulproblem“. Kein Scherz! Doch was beinhaltet das? Vor allen Dingen sind es psychische Probleme, die mir da begegnen. Mir fallen da spontan Themen ein wie „Mobbing“, „Versagensängste“ und „Panikattacken“. Doch nicht nur Lehrer haben diese Probleme, zunehmend eben auch die Schüler und die bitten mich dann um Gesprächsangebote. Aber auch körperliche Leiden werden in der Schule mehr und mehr sichtbar. Da wird beispielsweise gern die Stifthaltung von Bente-Linus bemängelt, der Bewegungsdrang von Malte-Christofferus oder die Logorrhö von Lisa-Marie. Doch was ich dann immer als Vernachlässigung bezeichne, umschreiben die Eltern sehr gerne tiefenpsychologisch mit den Worten: „Bente will aber nicht schreiben üben. Der hat bestimmt eine Wahrnehmungsstörung. Unsere Grundschullehrerin empfiehlt eine Ergotherapie.“ und „Malte hat ein Restless-Leg-Syndrom, der kann nicht still sitzen. Der braucht nunmal viel Bewegung.“ oder auch „Die Lisa ist halt schlau und möchte sich mitteilen. Vielleicht kann da die Logopädie weiterhelfen?“ Und dann habe ich das Ganze wieder an der Backe!
Intro zu Aufzug 17
Herzlich willkommen in den unendlichen Weiten des Bildungswesens! Waren Sie auch mal in einer echten, altmodischen Schule? Eine, in der „Englisch“ noch nicht mit „LOL“ übersetzt wurde? Na bestimmt, zumindest die meisten von Ihnen. Wissen Sie noch was es mit Mathematik, Deutsch, Englisch, Biologie, Chemie, Physik, Religion, Musik oder Kunst auf sich hat? Natürlich wissen Sie das, das sind Schulfächer. Und jetzt frage ich Sie, ob Sie auch wissen, was es mit MuK, MeMo, ITG, WiWi, WAT, LER, PU, ND oder ILZ auf sich hat? Nein, das sind keine neuen Boybands, sondern tatsächlich moderne „Fächer“. Ja! Sie haben keine Ahnung, was sich hinter den ganzen Abkürzungen verbergen könnte? Genau das ist doch auch der Sinn! Den Kindern gehts da nicht anders! Das Tolle ist, dass es diese „Fächer“ noch zusätzlich oben drauf gibt und sie sich inhaltlich teilweise sogar völlig vermengen. Das ist so herrlich unstrukturiert. Wenn mir meine Kinder von ihrem Schultag berichten und davon, was sie so alles gelernt haben, frage ich schon fast reflektorisch: „Welches Fach?“ und danach: „Was‘n das für‘n Fach?“ Was haben wir dann immer für einen Spaß, wenn sie mir „Schule heute“ erklären!
Und das Gleiche versuche ich Ihnen gegenüber nun auch. Ich erkläre Ihnen „Schule heute“. Nehmen Sie Platz, wir werden gemeinsam noch einmal die Schulbank drücken. Ich höre förmlich Ihr Grummeln. Warum etwas erklären, was sich selbst erklärt? Tja, so einfach ist das nunmal nicht! Schule ist heute nicht mehr „nur“ Schule! Nein, heute hat Schule nämlich ein Konzept! Doch ich kann Sie beruhigen, mit „Schulbank drücken“ hat das mittlerweile nichts mehr zu tun, heute wird die Bank, wenn überhaupt, nur gestreichelt.
Ihre Lust auf Schule steigt? Gut, dann will ich Sie auch nicht weiter auf die Folter spannen und löse auf: „Medien und Kommunikation“, „Medien und Methoden“, „Informationstechnische Grundbildung“, „Wirtschaftswissenschaften“, „Wirtschaft-Arbeit-Technik“, „Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde“, „Projektunterricht“ (ein Gemenge aus Musik, Kunst, Werken, Schulgarten, Sachunterricht und Morgenkreis), „Neigungsdifferenzierung“ und mein Lieblingsfach „Individuelle Lernzeit“. Willkommen im Bildungswesen 2019!
Aufzug 17
- Konzept -
Es scheint, dass das wahre „Konzept“ der Bildung in der ständigen Suche nach einem Konzept besteht. Doch was beinhaltet das Konzept „Bildung“ und die damit verbundene Institution „Schule“ eigentlich? Zur Beantwortung dieser Frage blicke ich abermals in die 80er Jahre der DDR zurück. Ich tue dies, weil das Schulsystem damals so herrlich einfach und verständlich war. Die vorherrschende Ideologie außer Acht lassend, diente das Bildungssystem der DDR sogar als Vorlage für andere Länder, darunter Schweden und Finnland. In den 80er Jahren reisten doch tatsächlich Delegationen aus Skandinavien in die Deutsche Demokratische Republik, um sich das Schulwesen anzusehen. Im Sozialismus ging es vor allem darum, einen gemeinsamen Wissensstand zu gewährleisten und somit Chancengleichheit im Hinblick auf die Praxis- und Berufsorientierung zu schaffen.
Nein, ich fange nicht an zu schwärmen, ich schwelge in Erinnerungen, das ist ein Unterschied! Dass die Chancengleichheit gerade in der DDR leider auch ihre Grenzen hatte, verschweige ich natürlich nicht. Ein Hauptaugenmerk richteten die Delegationen vor allem auf das Lehramtsstudium. Dieses war größtenteils auf Methodik, Praxis, Pädagogik und Didaktik ausgerichtet. Lehrer lernten, wie man Kindern Wissen vermittelt, wobei Erziehung ebenfalls zum Berufsbild gehörte. Das „Konzept“ bestand darin, dass ein Lehrer an der Tafel vor der Klasse stand und den Schülern, die mal mehr, mal weniger aufmerksam waren, etwas beibrachte, etwa Deutsch oder Mathe. Hausaufgaben wurden aufgegeben und in sogenannten „Leistungskontrollen“ wurde der Wissenszuwachs überprüft, woraufhin man Noten erhielt, gute wie schlechte. Einige Male im Jahr wurden Eltern zu Elternabenden eingeladen, bei denen der Lehrer über Fortschritte und Defizite sowie anstehende Termine informierte. Dies ist das eigentliche, mehrheitlich anerkannte Grundkonzept von Schule, das seit Jahrhunderten weltweit in ähnlicher Weise umgesetzt wird. Das Bildungssystem der DDR war sicherlich nicht perfekt. Wie hätte es unter jener Führung auch sein können? Dennoch basierte es auf Strategien, also „Konzepten“ der Wissensvermittlung, die seit der Wende leider zunehmend geächtet werden.
Verglichen mit früher leben wir heute in einer scheinbar weit entfernten Zukunft. Heute gibt es nicht mehr nur das „Konzept Schule“, nein, jedes Bundesland, jede Stadt, jede Schule und ja, sogar jeder Lehrer entwickelt sein eigenes Konzept. Das ist der Föderalismus. Montessori- und Waldorfschulen sind längst nicht mehr nur etwas für Hippies und Künstler, sie sind zum Mainstream geworden und massentauglich. Namen tanzen und mit Holz spielen ist heutzutage weit überholt. Fortschrittlicher und zukunftsorientierter geht es nicht?
Weit gefehlt! Heute existieren sogar „Schulen“, die ganz ohne Lehrer auskommen, wo sogenannte Lernbegleiter die Schüler begleitend begleiten, kein Scherz! Sind das dann überhaupt noch Schüler? Ich weiß es nicht. Die Schule heute ist individualisiert, jeder kann machen, was er will. Das eigentliche Konzept scheint die Konzeptfreiheit zu sein.
Gerade weil ich dieses durch Arbeitskreise gebildete und weichgespülte Geschwafel nicht mag, bringe ich meine Arbeitshypothese für diesen Aufzug nun direkt auf den Punkt. Das eigentliche „Konzept“ scheint darin zu bestehen, uns glauben zu machen, dass jedes Kind individuell und entsprechend seinen Fähigkeiten gebildet werden kann. Das wäre toll! Doch dieser schöne Schein lenkt leider nur von der brüchigen und rückständigen Basis unseres aktuellen Bildungssystems ab. Durch einen immer aufgeblaseneren Föderalismus und Reformierungswahn hat sich das Bildungssystem von der Politik instrumentalisieren lassen und dabei fast sein Selbst verloren. Was die Wissenschaften mühselig aufgebaut haben, bauen die Bildungseinrichtungen auf der anderen Seite oft leichtfertig wieder ab. Bildung zielt nicht länger auf die Vermittlung von Wissen, sondern scheint heute vielmehr politische Selbstdarstellung zu sein, was ich für gefährlich halte. Auch die Vielfalt der Schulformen ist kaum noch zu überschauen: Von Privatschulen über kirchliche Einrichtungen, von sogenannten „Freien Schulen“ über Montessori- und Waldorfschulen bis hin zu elitären Spezialschulen in Bereichen wie Sport, Mathematik, Geisteswissenschaften und Musik, jeder scheint zu finden, was er sucht. Statt zentraler Organisation herrscht ein föderales Chaos. Aber wird dadurch tatsächlich Chancengleichheit gewährleistet? Um dieser Hypothese nachzugehen, sollten wir uns dem Thema doch lieber behutsam nähern, so wie es auch die Schüler von Anfang an tun.
Einschulung
Ich habe gehört, dass es Kinder gibt, die in die sogenannte „6-Jahres-Krise“, auch „Vorschulpubertät“ genannt, geraten. Das ist eine dieser „Phasen“, die Pädagogen erfunden haben, um das Fehlverhalten kleiner „Rotzlöffel“ positiv darzustellen. Dieser „Entwicklungsschub“ soll angeblich im Übergang vom Kindergarten zur Schule auftreten und die emotionale Zerrissenheit instabiler Kleinkinder darstellen. Kürzlich erzählte eine Mutter, dass ihr Sohn Yael-Julien ausflippt, sobald er hört, dass er bald eingeschult wird, obwohl er bereits ein Jahr zurückgestellt war. Er spuckte seine Eltern an und schlug sogar nach ihnen. Es war unmöglich, ihn auch nur in die Nähe der zukünftigen Schule zu bringen. Keine Beschönigung konnte ihm diese „Schreckensvorstellung“ nehmen. Zumindest gab es jetzt eine Erklärung für sein Verhalten.
Natürlich habe ich versucht, es ernst zu nehmen. Kinder in diesem Alter sind irgendwo zwischen süß und frech, niedlich und nervig, kindlich und rebellisch. Sie werden zunehmend wählerisch, entwickeln langsam ihren eigenen Stil und testen ihre Eltern, indem sie aufmüpfig oder trotzig reagieren. Es ist eine Zeit voller Neugierde und Kreativität. Oh Gott, jetzt fange ich auch schon damit an. Ich verharmlose unangemessenes Verhalten mit positiven Beschreibungen. Aber mal im Ernst, trifft das nicht auch auf das zweite, dritte, vierte und fünfte Lebensjahr zu? Bitte hört auf mit dem Gerede von „Phasen“. Wenn jemand eine „Phase“ durchlebt, dann sind es die Eltern. Und das ist keine Phase mehr, das ist eine Ära und die dauert den Rest des gesamten Lebens an. Ich erinnere noch einmal an die „Big 5“: Rückgewinnung von Raum, Zeit, Schlaf, Stil und Sex. In Wirklichkeit hat Yael-Julien vielleicht Muttis langsam herannahende Freiheit gespürt. Und sie empfand Unbehagen bei dem Gedanken, dass ihr Kind bald mit Aufgaben konfrontiert wird, die als „Druck“ empfunden werden könnten. Sie nennen es Krise, um sich besser zu fühlen, seltsam.
Die Einschulung ist doch eigentlich das Großereignis der gesamten Kindheit. Doch dazu muss es erst einmal kommen. Bevor ein Kind eingeschult wird, erfolgt eine Schuleingangsuntersuchung durch das Gesundheitsamt. Selbst wenn ein Kind von Amtsärzten für schultauglich erklärt wurde, können Eltern immer noch anders entscheiden. Dies variiert je nach Bundesland. Grundsätzlich finde ich das nicht verkehrt. Die Frage ist jedoch: Welchem Zweck dient dann ein amtlicher Check-Up? Ich weiß es, meine Frau hat drei Jahre im Gesundheitsamt gearbeitet. Die Schuleingangsuntersuchung dient hauptsächlich statistischen Zwecken und hat eigentlich keine echte Bedeutung. Was erwartet das Amt nach ganzen ZEHN Vorsorgeuntersuchungen, bei denen alles „altersgerecht“ war? Kann ein Amtsarzt, der ein Kind zum ersten Mal sieht, wirklich dessen Schulfähigkeit beurteilen? Noch seltsamer sind die Kita-Reihenuntersuchungen, die das Gesundheitsamt durchführt. Was könnte man an Zeit und Geld sparen, wenn die Kinderheilkunde besser vernetzt wäre! Aber das ist nur so eine Idee von mir.
Nach der Schuleingangsuntersuchung sitzt dann nicht selten ein Kind an meinem Schreibtisch, das entweder hochgradig schulfähig ist, die Eltern es aber noch nicht einschulen wollen, oder ein Kind, das in seiner Entwicklung etwas zurückliegt, das die Eltern jedoch für hochbegabt halten. Schwierige Entscheidung! Sie wünschen ein Attest, welches ihre Sichtweise unterstützt. Bei einer Schulrückstellung soll das Kind die Möglichkeit haben „nachzureifen“, wie ein guter Wein, der Zeit braucht. Ich bin kein Sommelier, aber nicht alle nachgereiften Weine sind gut. Geschmacksache! Ob eine vorzeitige Einschulung wegen angenommener Hochbegabung richtig war, zeigt sich erst später. Meiner Meinung nach wäre die Frage des Einschulungszeitpunkts hinfällig, wenn das Bildungssystem wirklich so individuell und angemessen fördern könnte, wie es behauptet wird. Mehr dazu später.
Der Trend geht meiner Erfahrung nach jedenfalls hin zum „Nachreifen lassen“. Eine befreundete Kindergartenleiterin berichtete mir, dass sie dadurch zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen stößt. Denn wenn die Kinder nicht aus dem Kindergarten austreten, fehlen am anderen Ende dann wieder freie Plätze für die Krippenkinder. Der Personalschlüssel wird natürlich nicht angepasst. Die Eltern der „nachreifenden“ Kinder wünschen oft eine zweite Runde Vorschule, was aber nicht möglich ist, wenn andere Kinder nachrücken. Ein unnötiger und selbst verursachter Teufelskreis! Andererseits erfahren diese kleinen, unreifen „Rohlinge“ im Kindergarten bereits, was es heißt sitzenzubleiben. Ist das vielleicht die Idee der Eltern, so etwas wie das Hamburger Modell fürs Sitzenbleiben?
Doch kehren wir nun wieder zurück auf den Pfad, welcher nach vorn führt. Die amtsärztliche Schuleingangsuntersuchung samt elterlicher Entscheidung ist nur die erste von insgesamt fünf Hürden auf dem Weg zur Einschulung. Es folgen der Ansturm auf die Ausstattung (Schulranzen, Federmäppchen, Hefte, ...), der Tag der offenen Tür (Auswahl der Schule), die Einschulungsfeier (Schultüte, Familienfest, Fotos, ...) und zu guter Letzt die Überprüfung der Horttauglichkeit, welche natürlich in meiner Kinderarztpraxis stattfindet.
In exakt dieser Reihenfolge frönte auch Tine der Einschulungs-Odyssee vom Max. Zeit dafür gab es ja genug, denn auch der Max bekam selbstverständlich ein weiteres Jahr Nachreifungszeit in der Kita. Dr. Brinkmann war in einer Zwickmühle, aus der er nicht mehr rauskam. War er es doch, der Max all die Jahre lang sämtliche Therapien hat zukommen lassen, welche die Heil- und Hilfsmittelverordnung so hergab. Von Osteopathie für Fortgeschrittene über bilinguale Logopädie für Sprachbegabte bis hin zu tiergestützter Ergotherapie mit Delfinen in Antalya, Max belastete das Praxisbudget von Dr. Brinkmann wie kein anderer. Selbstredend musste der Kinderarzt Tine nun auch in ihrem Begehr unterstützten, den Max per Attest zurückzustellen. Laut Tines Recherchen und dem Schwerbehindertengesetz war der Max nunmal in hohem Maße entwicklungsverzögert, das konnte Dr. Brinkmann nun drehen und wenden, wie er wollte. Entgegen sämtlicher Bestrebungen auch seitens Kindergarten-Tante Emmi, ihn lieber früher als später einschulen zu lassen, hatte sie ihn schlussendlich doch noch ein weiteres Jahr am Hals. Was sich für Tante Emmi als eine sehr qualvolle Form von Halsschmerzen darstellte, war in den Augen von Tine schlicht und einfach die perfekte Möglichkeit, sich intensiv auf den Höhepunkt der kindlichen Evolution ihres Sohnes vorzubereiten.
Los ging es mit dem „Run auf das Equipment“. Schulranzen mit Brotdose, Federmappe samt Stifteset, Sporttasche plus integriertes Erste Hilfe Paket, ach war das herrlich, alles musste besorgt werden. Tine konnte sich komplett ausleben. Es durfte nur das Beste vom Besten sein. Vor allem die Brotdose hatte es Tine angetan. Die richtige zu finden war ein Projekt für sich. Nach mehrwöchiger Suche im Inn- und Ausland, fand sie endlich ihren wahr gewordenen Traum vom Speisebehälter. Er war dreistöckig, in mehrere Kammern untergliedert und zudem ausgestattet mit Belüftungs- und Kühlsystem. Brotzeit, Vesper und Snack sollten so ihren geordneten Platz finden. Bestückt wurde das Wunderwerk aus biologisch abbaubaren Materialien dann mit allem, was der Bio-Markt so hergab. Max trug das Ganze später schließlich mit Fassung und zwar erst in die Schule und dann wieder zurück nach Hause. Die von Tine sehr aufwendig künstlerisch gestalteten und mit Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen angereicherten Horsd’oeuvre landeten abends dann meist auf Marios Teller. „Das schmeckt nicht!“, flüsterte Max seinem Papa allabendlich zu.
Weiter ging es mit dem „Tag der offenen Tür“. Eigentlich waren es ganze „Wochenenden der offenen Türen“, die Tine damit verbrachte mit ihren Jungs die Schulen zu inspizieren. Ja, auch Mario wurde mitgeschleift. „Schliesslich geht es hier um nichts Geringeres als die Zukunft unseres Sohnes.“, fauchte Tine den Mario an, als sie bei der dritten Schulinspektion angekommen waren und Mario sich einmal traute, leise zu seufzen. Tine zerrte die beiden von Schule zu Schule, um sich von den vielen Angeboten beeindrucken zu lassen. Jede Bildungsstätte hatte ja schließlich auch ihren ganz eigenen konzeptionellen Ansatz und Schwerpunkt, ob religiös, sprachlich, sportlich, naturwissenschaftlich, geisteswissenschaftlich oder künstlerisch. Max sollte ganz individuell die für ihn passende Bildung erfahren. Nachdem sie sich zehn Schulen angeschaut hatten, ging selbst Tine langsam die Puste aus. Marios pragmatischem Ansatz mit den Worten: „Lass uns doch die Albert-Einstein-Grundschule nehmen, die klingt gut und ist gleich um die Ecke!“, konnte sie einfach nicht folgen. Schlussendlich sollte Max entscheiden. Während Mario einfach nur die Augen rollte, bekam Tine Pippi in den Augen und feuchte Hände, als sie auf die Beschlussfassung warteten. „Ich will entweder auf die Waldoof- oder auf die Makkaroni-Schule.“, plapperte es auf der Heimfahrt aus Max heraus. „Und warum möchtest du das? …“, fragte Tine ihn. „... Was war es denn, das dich überzeugt hat? Die Kooperation mit der französischen Partnerschule in Lourdes, die Projekte der Robotik-AG mit dem Ziel bei „Jugend Forscht mit Holz“ teilzunehmen oder die heileurythmische Frühförderung auf japanisch?“ „Och, ich fand’s cool, dass die ne Tischtennisplatte auf dem Schulhof haben.“ Daraufhin raunte Tine ihrem Mario zu: „Er ist ja so sportlich! Siehst du Mario, gut, dass wir beim „Tag der offenen Tür“ waren!“
Sowohl Equipment als auch eine passende Schule waren also gefunden. Die Rudolf-Steiner-Waldorf-Schule sollte es also sein. Nun brauchte es „nur“ noch eine angemessene Zuckertüte für die „Einschulungsfeier“. Die „gekaufte Zuckertüte“ war laut Tine ein Relikt vergangener Tage. Selbstverständlich bastelte sie die „Zuckertüte“ für Max selbst. Aber warum eine Tüte, wenn es