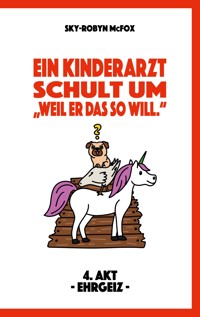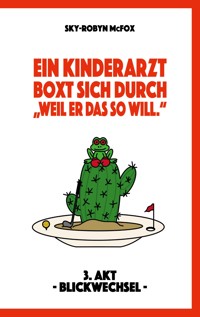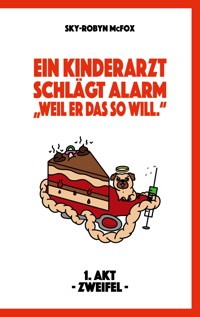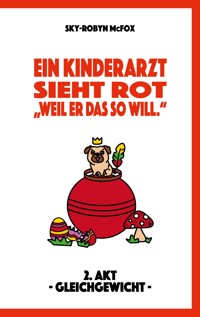
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Kinderarzt sieht rot - "Weil er das so will."
- Sprache: Deutsch
Ein Kinderarzt sieht rot! Was? Schon wieder einer, der rot sieht? Pandemie, Krieg und Inflation, das alles regt einen doch schon genug auf! Wie wäre es dann mit ein wenig Humor? Dieser bitterbösen Alltagssatire folgend, begleitet der Leser einen Kinderarzt auf die große Reise der Menschwerdung. Nichts Geringeres als das ultimative Kompendium schräger Kuriositäten und Absurditäten moderner Kinderaufzucht erwartet Sie. Dieser zweite Akt von insgesamt fünf beschäftigt sich mit den Widrigkeiten der Elternschaft während der Kleinkindzeit. Lachen bis der Arzt kommt? Ganz im Gegenteil.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
gewidmet meiner Bubub
Inhaltsverzeichnis
2. Akt
Intro zu Aufzug 7
Aufzug 7
Autorität
Autonomie
Analogie
Intro zu Aufzug 8
Aufzug 8
Zauberwörter
Erklärphänomene
Quotenpapa
Bewertungsgesellschaft
Intro zu Aufzug 9
Aufzug 9
Eingewöhnung
Kindheitserinnerungen
Kita
Intro zu Aufzug 10
Aufzug 10
Einzelkind
Geschwisterkind
Trennungskind
Intro zu Aufzug 11
Aufzug 11
Behandlungsflatrate
Alternative Medizin
Medizinische Alternative
Quellenverzeichnis
Herzlich willkommen zurück aus der Pause. Ich hoffe, Sie haben ein wenig frische Luft geschnappt, ein Getränk zu sich genommen oder sich erleichtert. Und ich meine dabei natürlich nicht vom eigenen Kind! Alle, die möglicherweise erst jetzt hinzugestoßen sind, beziehungsweise aus Versehen das zweite Buch vor dem ersten gekauft haben, begrüße ich an dieser Stelle natürlich auch. Verzagen Sie nicht, dies ist keine schwere Lektüre. Sehen Sie es positiv, Sie haben einfach das erste Jahr der Menschwerdung übersprungen und steigen direkt in die Erziehung ein. Viele Eltern hätten sich das sogar gewünscht. Und einige von denen wiederum überspringen gleich noch die ganze Erziehung ihrer Kinder. Sie sehen, wir sind schon mittendrin im Thema.
Vorhang auf und viel Vergnügen!
2. Akt
- Gleichgewicht -
- „Verzweiflung befällt zwangsläufig die, deren Seele aus dem Gleichgewicht ist.“1, sagte schon der römische Kaiser und Philosoph Marc Aurel. Vor allem die durch das Internet, den PEKiP-Kurs oder Hebammen verunsicherte Seelen gehören ins Gleichgewicht gebracht. Individuelle Meinungen oder Handlungen dürfen und sollen von denen der Mehrheit natürlich abweichen. Das ist Vielfalt. Jedoch ist Abwägen gefragt, denn aus gesundem Zweifel darf keine Verzweiflung werden, schon gar nicht, wenn es um Kinder geht. Möglicherweise ist gerade bei der Kindererziehung auch der Weg das Ziel und nicht, welche Methode richtig oder falsch ist. Auf eben diesem Weg gilt es nun die Balance zu halten und ein Gleichgewicht zu finden in allen nun folgenden Entscheidungen. -
Nach der „Exposition“ nimmt unser Drama so langsam Fahrt auf. Es folgt der zweite Akt. Er wird im klassischen Theaterstück auch „Komplikation“ genannt. Es kommt zur Steigerung der Dramatik unserer Handlung mit dem sogenannten erregenden Moment. „Das erregende Moment ist ein dramaturgisches Mittel im Handlungsablauf eines Dramas. Es dient dazu, den dramatischen Konflikt aufzubauen und die Spannung zu erregen. Ausgelöst wird es durch eine Aktion des Protagonisten oder des Antagonisten, die den weiteren Verlauf der Handlung bestimmt.“2
Und so dreht sich im nächsten Akt auch alles um einen wahrlich dramatischen Konflikt, die Erziehung des eigenen Kindes.
Intro zu Aufzug 7
Sind Sie eigentlich erzogen worden? Was für eine Frage! Selbstverständlich sind Sie das! Wo kämen denn sonst Ihre vorbildlichen Tugenden, Ihr beispielhaftes Werteverständnis und Ihr gutes Benehmen her? Wie könnten Sie sich sonst sozial anpassen oder ein Gespür für das menschliche Miteinander haben? Und woher sonst hätten Sie in jungen Jahren schon solch ein prächtiges Verständnis für Kausalität gehabt, sprich die Kenntnis vom Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung? Wie ich das meine? Nichts anderes bewirkt Erziehung.
Ich will es Ihnen am „Herdplatten-Beispiel“ verdeutlichen. Sie stimmen mir doch gewiss zu, dass es einen kausalen Zusammenhang zwischen einer heißen Herdplatte und einer Verbrennung an der Hand geben kann? Richtig, die wortwörtliche Verbindung von beidem ist das Berühren der Herdplatte. Auf die Aktion folgt eine Reaktion, nämlich ein lautes „Ahhhhhuuu!!!“, mit einer leichten nach verbranntem Fleisch riechenden Geruchsnote. Das erklärt sich doch von selbst, sagen Sie? Nein, das tut es eben nicht! Es ist kompliziert, gibt es doch tatsächlich drei sehr unterschiedliche Erkenntnis-Methoden.
Die erste ist die „Learning by Doing-Methode“ und erfreut sich in vielen Familien große Beliebtheit.
Diese Technik kann man im Prinzip anwenden, sobald das Kind krabbelt. Man braucht es nur auf den Herd zu heben. „Weil er das so wollte, fasste Freddy auf die heiße Herdplatte und verbrannte sich die Hände.“ So sind jedenfalls oft die Ausführungen von Eltern, die diese Art von Erziehung anwenden und folgend dann einen Rat bei mir zur Behandlung der Verletzung einholen.
Die zweite Möglichkeit ist das „Frag-die-Maus-Prinzip“. Die Anwendung dieser Verfahrensweise ist jedoch eigentlich erst sinnvoll, wenn das Kind drei oder vier Jahre alt ist. Dazu braucht es nämlich ein wenig Grips. Angewendet wird sie dennoch bereits ab der Geburt. Man erklärt dem Kind, dass es „bitte“ nicht auf die heiße Herdplatte fassen solle, andernfalls könnte es höllische Schmerzen erleiden und ein Leben lang hässliche Narben davontragen würde. Klingt komisch, ist aber so!
Das dritte Verfahren kommt zumindest in Deutschland sehr selten zum Einsatz. Es nennt sich die „Back to the Roots-Taktik“ (engl.: „Zurück zu den Wurzeln“). Man orientiert sich dabei an sogenannten Entwicklungsländern. Man kocht das Essen einfach nicht und hat demnach einfach keinen Herd im Haushalt.
Welche Erziehungsmethode ist nun beim „Herdplatten-Beispiel“ die Optimalste? Gibt es womöglich noch andere Herangehensweisen?
Ich behaupte nicht, den einzig wahren Pfad der Erziehung zu kennen. Dass diese drei Möglichkeiten, also das Ertragen von Geschrei und der Geruch nach verbrannter Haut, das Diskutieren über ein Für und Wider mit einem Einjährigen oder gar der Verzicht auf gekochtes Essen, aber auf keinen Fall die Lösungen sein können, das möchte ich Ihnen im Folgenden beweisen.
P.S.: Nein, ich verrate Ihnen jetzt nicht meinen Lösungsansatz für das „Herdplatten-Beispiel“, das würde ja die Pointe für die komplette Buchreihe vorwegnehmen.
Aufzug 7
- Erziehung -
Doch was verbirgt sich hinter dem Wort „Erziehung“ überhaupt? Im Duden wird der Begriff unter anderem auch als „[…] jemandes Geist und Charakter zu bilden und seine Entwicklung zu fördern […]“3 erklärt. Eine andere Definition wäre: „Unter Erziehung versteht man die pädagogische Einflussnahme auf die Entwicklung und das Verhalten Heranwachsender. Dabei beinhaltet der Begriff sowohl den Prozess als auch das Resultat dieser Einflussnahme.“4
Und genau das scheint das Problem vieler moderner Erziehungsansätze zu sein. Die meisten Strategien definieren sich allein durch den Prozess und viel zu wenig durch das Resultat. Ich gewinne mehr und mehr den Eindruck, dass zunehmend das jetzige Verhalten im Vordergrund steht und weniger der zukünftige Geist und Charakter. Jetzt soll das Kind ruhig sein, jetzt soll das Kind schlafen, jetzt soll es etwas essen, ... . Um das „Jetzt“ zu erreichen, wird jedoch immer häufiger der einfachste Weg gewählt. Anstatt „jetzt“ zu handeln, also die Persönlichkeit des Kindes zu Formen, beugt man sich selbst dem Willen des Kindes. Und was passiert? Na, zumindest nichts „erzieherisch“ Sinnvolles. Wo Ruhe einkehren sollte, gibt es Geschrei, wo geschlafen werden sollte, wird gespielt und was eigentlich geges sen werden sollte, ist schließlich auf Muttis Kleid verteilt.
Doch Erziehung ist aufwendig, zäh und mühsam und das Ergebnis liegt in ferner Zukunft. Die Eltern von heute möchten aber nicht so lange warten. Sie möchten die Früchte ihrer Saat am liebsten sofort ernten, jetzt. Und so bleibt für sie häufig nur eine Möglichkeit: der unreife Ertrag muss ertragen werden. Das nennen sie dann Erziehung!? Dabei braucht es doch eine ausgewogene Balance zwischen Erziehen und Ertragen.
Besteht bei den Eltern jedoch noch ein Quäntchen Selbsterhaltungstrieb, so steht ihnen ein ganzes Potpourri an Erziehungsmöglichkeiten zur Verfügung. In der kinderpsychologischen Betrachtung haben sich in den vergangenen Jahrzehnten vier recht klare Erziehungsvarianten5 herauskristallisiert.
Ich möchte sie im Folgenden vorstellen und beginne mit der „autoritären Erziehung“. Bei ihr steht die unabdingbare Gehorsamkeit im Vordergrund. Strenge Regeln bestimmen dabei den Alltag. Es herrscht ein sehr unterkühltes Eltern-Kind-Verhältnis, welches fast ausschließlich auf Lob und Tadel reduziert ist. Auch ich schätze klare und strukturierte Regeln in der Erziehung, denn sie geben einem Kind Sicherheit und Orientierung. Die Kombination mit einer gefühlskalten Elternbeziehung schlägt mir da jedoch ziemlich auf den Ma gen. Einem Kind aber höchstwahrscheinlich noch viel mehr. Und was, wenn eben dieses Kind dann auch noch einem anderen auf den Magen oder womöglich in den Magen schlägt? So oder so, die Eltern, das Kind oder bisher Unbeteiligte, irgendwer bekommt früher oder später bei dieser Form der Kindererziehung ganz sicher Magenbeschwerden!
Im Gegensatz zu der „autoritären Erziehung“ sind die Methoden der „autoritativen Erziehung“ da schon ein ganzes Stück liberaler. Bei ihr sind Regeln und Normen per se auch vorgesehen, nur werden Lösungen von Problemen und Konflikten dabei gemeinsam mit dem Heranwachsenden erarbeitet, quasi in Form eines familiären Arbeitskreises. Wenn du mal nicht weiterweißt, dann bilde einen ..., oder frag halt das Kind! Die „Meinung“ des Zöglings fließt somit in die elterlichen Entscheidungen ein. Mutter und Vater pflegen dabei einen sehr liebevollen Umgang. Ich finde das gut, durchaus! Die Frage, die sich mir dabei stellt ist, ab wann hat ein Kind überhaupt eine Meinung? Wenn es um persönliche Ansichten, Überzeugungen und Einstellungen geht, dann wird der Gedankenaustausch mit einem Zweijährigen schwierig. Und auch, wenn man ihn noch so lieb hat und ihm unentwegt wie ein Muppet aus der Sesamstrasse die Welt erklärt, hochbegabt wird er davon noch lange nicht!
Die „permissive Erziehung“ wiederum wird geprägt durch Großzügigkeit und Nachgiebigkeit. Es existieren so gut wie keine Regeln. Für das Kind ist es mit Sicherheit die komfortabelste Situation. Seine Autonomie steht gänzlich im Vordergrund. Unbestreitbar ist es die Liebe zum Kind, die hier den größten Einfluss nimmt, aber sollte diese Liebe und das damit verbundene Erfüllen von Wünschen denn auch bedingungslos sein? Ich persönlich kenne solch eine Art von emotionaler Abhängigkeit nur vom jugendlichen Hochgefühl des Verliebtseins. Das Hirn kann da schon einmal aussteigen! Ist das denn aber wirklich auch ein gutes Fundament für Kindererziehung?
Es bleibt die „vernachlässigende Erziehung“. Bei ihr gibt es sowohl keine Regeln als auch keine zwischenmenschliche Wärme. Die Worte „Vernachlässigen“ und „Erziehung“ lassen sich, meiner Ansicht nach, eigentlich nicht miteinander vereinbaren. Naja, die Psychologen werden sich schon etwas dabei gedacht haben. Bei dieser Form der Kindergeldbeschaffung haben neben den Kindern selbst, zweifelsohne die Eltern die größten Verhaltensauffälligkeiten. Wie oft habe ich sie schon gehört, die Geschichten vom Kiki-Kaka-Land? Während Papa wochenlang als „Außendienstler“ unterwegs ist, läuft es in der Villa Muttermund drunter und drüber. Zur Befriedung des elterlichen Seelenheils werden dem vernachlässigten Kind natürlich auch alle Wünsche erfüllt und seien sie noch so abstrus. Da gibt’s schon mal ne Kiste voll Gold oder ein Pferd, das aussieht wie ein Dalmatiner. Dass sich Mutti damit zum Affen macht, merkt letztlich auch keiner mehr! Da spielt es dann widdewiddewitt auch keine Rolle, ob sich das verzogene Gör mit 10 Jahren immer noch unterschiedliche Strümpfe anzieht oder ständig die Schule schwänzt.
Die „Weil er das so will.“-Erziehung wäre dann im Prinzip die fünfte Variante des elterlichen Einflusses. Der ein oder andere fragt sich jetzt bestimmt, wie kann das nun noch gesteigert werden? Na ganz einfach, indem man sich das „Beste“ aus den anderen vier Methoden herauspickt und das Ganze dann frei von der Leber weg kombiniert! Das eigene Konzept ist doch sowieso das Beste. Wenn ich die „Weil er das so will.“-Erziehung auch einmal kurz beschreiben sollte, würde ich sie so definieren: Während die bedingungslose Liebe zum Kind deutlich im Vordergrund steht, befindet sich die zum Partner weit versteckt im Abseits. Aus diesem Grund ist auch das Eltern-Kind-Verhältnis alles andere als warmherzig, man könnte es eher als überhitzt bezeichnen. Soziale Überwachung und Kontrolle bestimmen den Alltag und das sowohl seitens der Eltern als auch seitens des Kindes. Angeblich gibt es keine Konflikte mit dem Sprössling, dass postulieren jedenfalls die Erziehungsverweigerer. Ungezogenes Verhalten wird einfach ignoriert oder heruntergespielt.
Frei nach dem Motto: Wenn im Wald ein Baum umfällt und niemand hat’s gesehen, ist der Baum dann tatsächlich umgefallen?
Das wesentlichste Merkmal der „Weil er das so will.“-Erziehung ist jedoch, dass das Kind keine Meinung hat, es hat Recht. Doch anstatt dieses „Recht haben“ zu hinterfragen, wird es wertgeschätzt, ja sogar schöngeredet.
Fasse ich das Ganze nun zu einem einzigen Gesamtkunstwerk zusammen, dann erblicke ich Folgendes vor meinem geistigen Auge. Einen vor Selbstbewusstsein nur so strotzenden zu Fleisch gewordenen Magenulkus mit roten Zöpfen und bunten Kniestrümpfen, wie er über absolut jeden Zweifel erhaben „... fünf durch acht macht zehn, Duddelduddeldei und sechs macht zwölfe, ...“ vor sich her krakeelt und dafür dann auch noch gelobt wird. Das kommt dann im eigens geschaffenen Erklärwerk dabei heraus, wenn Eltern mit Verbaldurchfall die „Hörstörung“ ihres Kindes versuchen zu beeinflussen.
Tja, für welche der fünf Erziehungsmethoden entscheidet man sich denn da nun? Das haben sich schon viele Eltern gefragt und nach Antworten gesucht. Und so bin ich auch nicht der Erste, der sie zur Erziehung ihrer Kinder mahnen und somit vor der Entstehung von Gören und Lümmeln warnen möchte. Einer meiner bekanntesten Vordenker war der Frankfurter Arzt und Psychiater Heinrich Hoffmann6. Seine Illustrationen und Geschichten zum Kind, welches macht, was es will, gehörten über 150 Jahre in jedes Kinderzimmerregal. Ich rede vom 1844 veröffentlichten „Struwwelpeter“. Er ist neben Neo-Maximilian eines der berühmtesten „Weil er das so will.“-Kinder der Literatur. Leider sind die Geschichten vom „Suppen-Kaspar“, „Zappel-Philipp“ oder „Daumenlutscher“ in Vergessenheit geraten. Seit den 1970ern steht das Werk in harscher Kritik. Zu deutlich, zu geradlinig und zu unnachgiebig sei die Darstellung der Verhaltensmodelle. Nein, heute werden sich abstruse Konzepte, wie „Baby led weaning“ ausgedacht, anstatt den „Suppen-Kaspar“ beim Namen zu nennen. Und jeder zweite „Zappel-Philipp“ bekommt willkürlich die Diagnose ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung) aufgebrummt, denn es muss schließlich auch eine Erklärung für ungezogenes Verhalten geben. Ja, selbst der „Daumenlutscher“ (heute „Dauernuckler“) wird in seiner Selbstverwirklichung bis weit in die Grundschulzeit hinein noch bestärkt.
„Meine Tochter rastet fast täglich zu Hause aus. Wegen Kleinigkeiten brüllt sie auf einmal los oder wirft sogar Dinge nach uns. Im Kindergarten sei sowas noch nie passiert.“ Ich frage die Eltern dann immer, ob sie Ideen hätten, woran das liegen könnte. Diese haben sie leider meistens nicht.
Im Laufe der Jahre kam ich zu folgender These: Die Bereitschaft zu erziehen verhält sich umgekehrt proportional zum Leidensdruck, den Eltern empfinden, wenn ihnen ihre Kinder auf dem Kopf herumtanzen. Was für ein Satz! Ich drücke es nochmal anders aus. Obwohl viele Eltern unter ihren Kindern offensichtlich sehr leiden, verspüren sie dennoch keinen Druck erzieherisch Einfluß zu nehmen. Meiner Ansicht nach ist das schwerwiegendste Problem, dass sie Erziehung nicht als Lösungsvariante in Betracht ziehen. Die Eltern sehen die Erziehung vielmehr als zusätzliches Problem und meiden sie daher regelrecht. Stattdessen finden sie Erklärungen für Fehlverhalten und weichen ihrer Verantwortung aus. Und so bildete sich neben dem Erziehen und dem Ertragen doch tatsächlich noch eine dritte elterliche Herangehensweise im Umgang mit dem Zögling, das „Erschieben“. Gerne wird auch vom sogenannten „Entwicklungsschub“ gesprochen, wenn das Verhalten von Tore-Raphael wieder einmal unerklärlich erscheint. Ist er aggressiv, hat er einen „Entwicklungsschub“. Ist er frech, hat er einen „Entwicklungsschub“. Ist er beides, dann liegt es an seinen Fördermaßnahmen, welche mal wieder angepasst werden müssen. Nach drei aufeinanderfolgenden Entwicklungsschüben heißt es dann auch gerne: „Unser Tore-Raphael ist frühreif.“ oder „Unser Tore-Raphael ist schon ganz schön weit.“ Ja, ganz schön weit entfernt davon, erzogen zu sein!
Eigentlich beginnt Erziehung doch mit einer gewissen Grundeinstellung. Ich meine damit, dass die Kinderstube, die wir selbst genossen haben, in hohem Maße auch die Erziehung unserer eigenen Kinder beeinflusst. Gleichsam sind es Verhaltensweisen, die prägend Einfluss nehmen, welche wir im Lauf unseres Lebens aus verschiedenen Gründen heraus entwickelt haben und nun unseren Kindern vorleben. Viel zu selten machen sich das manche Eltern bewusst und viel zu häufig wiederholen gerade sie dann sogar die Fehler ihrer eigenen Erziehung. Aber hat der Mensch das nicht schon von Anbeginn so gemacht? Betrachten wir doch einmal kurz des Menschen spirituelle Schöpfung. War es nicht der berühmteste „Vater unser ...“ selbst sogar, der seinen „Sohn“ Adam nach eigenem Bilde erschuf? Ja, ich weiß, ein richtiger Sohn war er nicht, eher ein Klumpen Lehm. Wir wollen mal nicht so kleinlich sein! Immerhin formte Gott aus ihm etwas Stattliches. Und was die Erziehung des Jungen und seiner Rippe (Eva) anbelangte, auch die war alles andere als konventionell.
Zunächst entschied sich Gott für die permissive Erziehung. Er legte den beiden quasi das Paradies zu Füßen, „herrlich“. Doch wie endete das Ganze? Selbstverständlich nahm „Der Mensch“ das Geschenk an, hielt sich jedoch nicht an die Regeln, brachte stattdessen Leid auf die Erde, führte Kriege und war sogar im Begriff sich selbst zu zerstören, so die Kurzfassung. Für eine „Weile“ schaute Gott sich das so an. Ungläubige unterstellten ihm sogar Vernachlässigung. Also änderte der Schöpfer seine Taktik und probierte sich in autoritärer Erziehung. Die große Sintflut sollte es nun richten. Noah überlebte und dann ging alles wieder von vorn los. Sollte denn alles umsonst gewesen sein? Mitnichten! Irgendwann nullte der Allmächtige das Ganze und versuchte sich nochmal in autoritativer Erziehung. Und so entsandte er Jesus Christus, welcher mit seinen Aposteln einen Arbeitskreis bildete, um den Menschen seine Lehren zu vermitteln. Das ging nur auch leider nicht gut aus, wie wir wissen. Doch welchem Zweck sollte dieses jahrtausendelange Ausprobieren von Erziehungsmethoden eigentlich dienen? Hatte er denn gar keinen Plan? Im Grunde genommen schon, denn es ging ihm um Erkenntnis. Laut Theologenmeinung hatte Gott nämlich einen entscheidenden Vorteil vielen heutigen Eltern gegenüber. Er wusste vom Scheitern des Menschen, von dessen Fehlentscheidungen und vom Leid, welches zu durchleben war.7
Zu erkennen, dass es einen göttlichen Entwurf für all das gab, ließ den Menschen Vertrauen entwickeln und an Gott glauben. Die Frage, die ich mir nun aber stelle ist: Liegt der „Weil er das so will.“-Erziehung auch irgendein Plan zu Grunde? Erkenne ich ihn nicht oder brauche ich nur noch eine „Weile“ bis zum Aha-Erlebnis? Amen!
Schauen wir doch mal auf die Schöpfungsgeschichte von Neo-Maximilian. Welche Rolle könnte die Erziehung von Tine und Mario dabei wohl gespielt haben?
Der Mario hatte natürlich eine sozialistische Erziehung, beziehungsweise Prägung „genossen“. Er verbrachte ja auch seine Kindheit und Jugend in der Deutschen Demokratischen Republik. Ungeachtet des politischen Systems, in dem er unweigerlich aufgewachsen war, hatte er aber auch Eltern, die ihn liebten und ihm den Weg wiesen, ganz ohne Parteiauftrag. Mario und sein Bruder Rainer Georg wuchsen in einer Plattenbauwohnung eines Elfgeschössers auf. Sein Vater Rolf arbeitete im VEB (Volkseigener Betrieb) Kombinat „Aufbereitung tierischer Rohstoffe und Pelztierproduktion“ und seine Mutter Inge in einem Konsum. In der Produktion und im Verkauf zu arbeiten hatte durchaus Vorteile, vor allem zu Weihnachten. Neben dem Standardgeschenk („Schwarzer Samt“ - DDR-Kult-Parfüm) gab es für Mutti fast jedes Jahr ein neues Kaninchenfell. Und statt schnödem Rotkäppchen-Sekt wurde edler Krim-Sekt gereicht. Tja, ein Jahr lang Rabattmarken unter die Konsumtheke fallen lassen, machte sich schon ganz schön bemerkbar. Inge beschrieb ihren Konsum immer kichernd mit: „Mein Konsum ist der Aldi des Ostens, wo es aldi schönen Dinge zu kaufen gibt.“ Als fahrbaren Untersatz nannte Familie Meier einen dunkelblauen Moskwitsch (russische Automarke) ihr Eigen und in der Nähe von Berlin wartete eine Datsche (Kleingartenparzelle mit Bretterbude) wochenends auf Besuch. Für Rolf sah sein Moskwitsch aus wie ein Mercedes, zumindest aus der Ferne, im Dunkeln und bei Nebel. Was wollten sie noch mehr? Insgesamt könnte man also sagen, Familie Meier hatte alles, was man brauchte.
Marios Mutter Inge, so hoch wie breit, war ein sehr resolutes und strenges Familienoberhaupt. Widerreden gab es nicht. Was gesagt wurde, wurde auch gemacht. Sowohl die Kinder als auch „Rolfi“ hielten sich an diese eiserne Regel. Religiös waren die Meiers nicht. Oder sagen wir eher, ein anderer Glauben als an das Parteisystem wurde vom Staatsapparat nicht gern gesehen. Darum zog Inge alternative Glaubensrichtungen vor. Sie war der Astrologie und dem Tele-Lotto (die Lottoausziehung des Ostens) verfallen. Die Horoskope aus den „Fachzeitschriften“, die ihr Großtante Ursel in den West-Paketen schickte, verschlang sie allzu gern. Die rosigsten Aussichten und blühendsten Landschaften wurden da versprochen. Und auch der Glauben beim Tele-Lotto irgendwann einmal „Alu-Chip-Millionär“ (maximal: 20.000 Mark; heute: < 5.000 €) zu werden, ließ sie positiv in Zukunftsträumen schwelgen.
Marios Vater Rolf, ein zartes Männchen, war eher vom ruhigen Schlag. Ihn konnte nichts aus der Fassung bringen. Vielleicht lag das aber auch an seinem wahnsinnig hohen Zigarettenkonsum. Ohne seine zwei Schachteln „F6“ pro Tag konnte er nämlich auch sehr aufbrausend sein. An den Wochenenden und in den Ferien nahm er sich immer viel Zeit für die Jungs. Oft fuhren sie zur Datsche nach Berlin. Dort brachte er Mario und Rainer vor allem lebenspraktische Dinge bei. Mitunter schraubten sie stundenlang am Moskwitsch rum, anders wären sie manchmal auch nicht mehr nach Hause gekommen.
Als Babys besuchten Mario und Rainer die Krippe, als Kleinkinder den Kindergarten und später dann gingen sie in die Schule und den Hort. Inge und Rolf kamen oft spät von der Arbeit. Die Hausaufgaben waren von den Kindern dann schon im Hort erledigt worden. Der ging meist bis 17 Uhr. 18 Uhr gab es Abendessen, 18:30 Uhr ging es in die Badewanne, 18:50 Uhr wurde Sandmännchen geschaut und dann ging es 19 Uhr ins Bett. Als Jugendliche mussten Mario und Rainer natürlich keinen Sandmann mehr schauen. Stattdessen gab es politische Bildung mit Vati um 20 Uhr während die „Aktuelle Kamera“ lief. Außerschulisch leisteten sie ehrenamtliche Vereinsarbeit für das Volk, erst als Jungpioniere, dann als Thälmann-Pioniere und später als Jugendliche in der FDJ („Freie Deutsche Jugend“). Auch wenn ihnen der Umstand sehr wohl bewusst war, dass auch die Jugend nicht frei war, es klang zumindest schon mal vielversprechend.
Kurz erklärt:
In der DDR war so gut wie jedes Kind Jungpionier (Schulklassen 1 bis 4). Formal war das freiwillig, wurde aber vom System eigentlich vorausgesetzt. Thälmann-Pionier war man dann von der 4. bis zur 7. Klasse. Der Unterschied war nun statt einem blauen, ein rotes Halstuch tragen zu dürfen. Käppis gab es bei den Pionieren auch, das hatte so einen gewissen militärischen Charme. Mit der 9. Klasse trat der Jugendliche in die FDJ ein. Da hatte man dann sogar Embleme am geschniegelten Blauhemd. Natürlich ging es bei dieser ganzen Pseudopfadfinderorganisation darum, Kinder und Jugendliche auf den sozialistischen Weg zu bringen und zu halten. Das war so eine Art Rote-Socken-Aufzucht. Da gibt es auch überhaupt nichts schönzureden. Dennoch muss ich, der „zumindest“ 4 Jahre lang Jungpionier war, unterscheiden zwischen politischer Gehirnwäsche und erzieherisch-gesellschaftlicher Prägung. Ganz eindrücklich wird das, wenn man sich einmal die Gebote der Jungpioniere anschaut:
Wir Jungpioniere lieben unsere Deutsche Demokratische Republik.
Wir Jungpioniere lieben unsere Eltern.
Wir Jungpioniere lieben den Frieden.
Wir Jungpioniere halten Freundschaft mit den Kindern der Sowjetunion und aller Länder.
Wir Jungpioniere lernen fleißig, sind ordentlich und diszipliniert.
Wir Jungpioniere achten alle arbeitenden Menschen und helfen überall tüchtig mit.