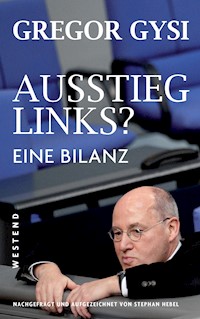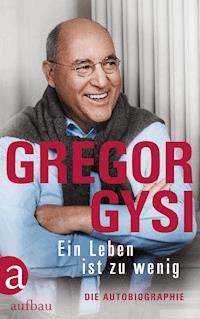
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Gregor Gysi hat linkes Denken geprägt und wurde zu einem seiner wichtigsten Protagonisten. Hier erzählt er von seinen zahlreichen Leben: als Familienvater, Anwalt, Politiker, Autor und Moderator. Seine Autobiographie ist ein Geschichts-Buch, das die Erschütterungen und Extreme, die Entwürfe und Enttäuschungen des 20. Jahrhunderts auf sehr persönliche Weise erlebbar macht.
„Erstaunlich, was sich alles ereignen muss, damit irgendwann das eigene Leben entstehen kann.“ Gregor Gysi.
"Gregor Gysi ist wohl der amüsanteste und schlagfertigste, auch geistig beweglichste Politiker, der seit Menschengedenken die Bühne der deutschen Öffentlichkeit betreten hat." ZEIT.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 751
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über Gregor Gysi
Gregor Gysi, geboren 1948, Rechtsanwalt und Politiker. Sohn des DDR-Kulturministers Klaus Gysi und Neffe der Literaturnobelpreisträgerin Doris Lessing. 1967 Eintritt in die SED. Vertrat als Rechtsanwalt u. a. Robert Havemann, Rudolf Bahro und andere Regimekritiker. 1989–1993 Parteivorsitzender der PDS. 1990–2002 und 2005–2016 MdB und Fraktionsvorsitzender der PDS und der Partei Die Linke. Seit Dezember 2016 ist er Präsident der Europäischen Linken. Zahlreiche Publikationen.
Informationen zum Buch
So offen und persönlich wie noch nie: die Autobiographie
Gregor Gysi hat linkes Denken geprägt und wurde zu einem seiner wichtigsten Protagonisten. Hier erzählt er von seinen zahlreichen Leben: als Familienvater, Anwalt, Politiker, Autor und Moderator. Seine Autobiographie ist ein Geschichts-Buch, das die Erschütterungen und Extreme, die Entwürfe und Enttäuschungen des 20. Jahrhunderts auf sehr persönliche Weise erlebbar macht.
»Erstaunlich, was sich alles ereignen muss, damit irgendwann das eigene Leben entstehen kann.« Gregor Gysi
Kaum ein deutscher Politiker wurde so geschmäht, kaum einer schlug sich so erfolgreich durchs Gestrüpp der Anfeindungen – hin zu einer anerkannten Prominenz: In seiner Autobiographie erzählt Gregor Gysi von seiner Kindheit und Jugend, schildert seinen Weg zum Rechtsanwalt, gibt Einblicke in sein Verhältnis zu Dissidenten (»Bahro war mein spannendster Fall«) und in die Spannungsfelder an der Spitze von Partei und Bundestagsfraktion. Vor allem aber berichtet er von der erstaunlichen Wendung, die sein Leben mit dem Herbst 1989 nahm: Der Jurist wird Politiker. »Einfach wegrennen, das wollte ich nie«, sagt Gysi und trifft damit einen Kern seines Wesens: Widersprüche aushalten. Ein Leben und eine Familiengeschichte, die von Russland bis Rhodesien führt, in einen Gerichtsalltag mit Mördern und Dieben und zu der ein Lob Lenins und die Nobelpreisträgerin Doris Lessing gehören.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Gregor Gysi
Ein Leben ist zu wenig
Die Autobiographie
Inhaltsübersicht
Über Gregor Gysi
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
Epilog
Personenregister
Bildteil
Bildnachweis
Impressum
Prolog
Ich habe schon als Kind gelernt, dass man Sätze nicht mit »ich« beginnen soll.
1. Kapitel
Ich kann von meinem Leben nicht behaupten, es verlaufe ruhig. Sehr oft hatte ich das bedrängende Gefühl, dass mir für bestimmte Dinge die Zeit fehle. Besser: dass ich mir keine Zeit nahm – etwa für Fragen nach den Wurzeln der eigenen Existenz. In welche Familiengeschichte bin ich eingebunden, welchem Erbe bin ich zugehörig?
An meiner Schwester Gabriele bewunderte ich stets die Intensität, mit der sie auch Ahnenforschung betrieb. Ich bin da weit unbekümmerter. Deshalb ist mir beim Schreiben dieses Buches Gabrieles historisches Interesse, ihre Sorgfalt beim Blick auf unsere recht verschlungenen und weit verzweigten Herkunftslinien sehr zugutegekommen. Was ich als Gang durch meine Ahnengalerie an den Anfang dieses Buches setze, habe ich also zu einem großen Teil von meiner Schwester erfahren. Staunend stehe ich vor einem Panorama spannender Schicksale im wechselnden Geschehen der Jahrhunderte.
Das wird augenfällig schon bei der mütterlichen Linie. Meine Mutter, Irene Gysi, ist eine geborene Lessing. Sie erblickte 1912 in Sankt Petersburg das Licht dieser wirren, schönen Welt, ihr Bruder Gottfried zwei Jahre später. Sie starb 2007 in Berlin, mein Onkel wurde 1979 in Kampala (Uganda) als Botschafter der DDR erschossen. Es waren Unruhen in dem afrikanischen Land ausgebrochen, das gesamte Diplomatische Korps bekam die Order, die Hauptstadt zu verlassen. Warum auch immer: Gottfried Lessing nahm mit seiner Frau sowie seinem Stellvertreter und dessen Frau einen anderen als den offiziell vorgeschriebenen Weg. Die vier wurden unterwegs ermordet; niemals wurde ermittelt, von wem und warum.
Die Beerdigung in Berlin fand sechs Monate später statt, weil die Opfer erst offiziell für tot erklärt werden mussten, dieses gesetzliche Verfahren sich aber lange hinzog. Denn die Toten wurden nie aufgefunden. Bei der Trauerfeier in Berlin sprach Außenminister Oskar Fischer. Man merkte seiner Rede, seinem Ton deutlich an, dass ihm die Biographie meines Onkels fremd war. Aufenthalt in Rhodesien, heute Simbabwe; erste Heirat mit einer Schriftstellerin, die in London lebte und als Doris Lessing berühmt wurde; der gemeinsame Sohn auch in London – das war DDR-untypisch. Da fühlte sich der Redner im Lebenslauf des ebenfalls zu betrauernden Stellvertreters von Gottfried Lessing deutlich wohler: Pionier, FDJler, Parteischüler, Arbeit im Außenministerium der DDR. Aber seltsam: Für die Berufung zum Botschafter war den Genossen mein Onkel trotzdem geeigneter erschienen.
Die Mutter meiner Mutter, also meine Großmutter Tatjana Lessing, war eine geborene von Schwanebach. Im 18.Jahrhundert war diese adlige Familie nach Russland ausgewandert, konkret: die zweiten und dritten Söhne. Sie kehrten der Heimat den Rücken, weil für sie das Erbe nicht reichte. Ihre letzte Hoffnung, wie meist in solchen Fällen: Militärkarrieren. Aber bei der Armee – in welchem System auch immer – begegnet man zwar dem mir ewig fremd bleibenden Kitzel, Leute zu erschießen oder selbst erschossen zu werden, wird aber in aller Regel nicht reich. Das sollten auch die ausgewanderten Söhne erfahren. Immerhin gab es in dieser Familie von Schwanebach einen General. Er war vom russischen Zaren in Finnland eingesetzt worden. Dort erschoss ihn ein national gesinnter Student.
So stelle ich bereits zu Beginn dieses Buches fest: An meiner Familie schieden sich schon immer die Geister, egal, ob auf der linken oder der rechten Seite irgendeiner Front.
*
Bleiben wir bei den mütterlichen Vorfahren, und gehen wir noch ein Stück in der Geschichte zurück. Der Vater meiner Großmutter, also mein Urgroßvater, diente ebenfalls beim Militär. Seine Frau war eine geborene Saburowa. Sie kam aus einer altrussischen Fürstenfamilie, verwandt mit den Dolgorukis, die einen der Gründer Moskaus hervorbrachten. Diese Familie war also zweifellos bedeutender als etwa die weit bekannteren Romanows, die erst sehr viel später einzig dadurch auffielen, dass sie überflüssige Zaren stellten.
Meine Urgroßmutter hatte den Mut zu etwas Außergewöhnlichem in jener Zeit: Sie ließ sich scheiden, und das auch noch wegen eines anderen Mannes. Und als sei dieser eine Skandal nicht genug, sorgte sie für einen zweiten, denn: Der Nebenbuhler war »nur« ein Bürgerlicher. Aus der Ehe mit ihm gingen weitere Kinder hervor. Meine Großmutter Tatjana wurde von ihrer Mutter in eine andere Stadt und zum neuen Ehemann mitgenommen und galt als mitgebrachte, arme Verwandte – ein klassischer Typus der russischen Literatur und Dramatik. Als junge Frau sprengte meine Großmutter übrigens die Fesseln der aristokratischen Langeweile, sie arbeitete bei einem Armeegeneral – als Sekretärin. Dort lernte sie zufällig ihren späteren Ehemann, meinen Großvater, kennen. Ihm imponierte ungemein, dass eine Adelige arbeitete – und dann auch noch als Sekretärin.
Na, schwindelt der geneigten Leserschaft schon etwas? Dann geht es ihr wie mir. Namen, Hierarchien, Epochen. Der Stammbaum undurchdringlich? Auch ich war sehr schnell wirr im Kopf, als ich mich suchend ins Netzwerk dieser Verwandtschaft begab. Mit den aufgeführten Namen will ich nicht langweilen, nicht als penibler Chronist ergreife ich das Wort, und merken kann man sich alles und alle eh nicht. Aber das Schillernde des Geschichtlichen, das mit dieser Familienhistorie gestreift wird – mich hat es verblüfft und berührt. Erstaunlich, was sich im Laufe so vieler Jahre alles ereignen, wer auf wen treffen und welche Zufälle einander kreuzen müssen, damit irgendwann das eigene Leben entstehen und hervortreten kann.
Und das Ende der Verzweigungen ist ja noch lange nicht erreicht! Es werden noch Lenin, ein bayrischer Kapitalist und ein Hahn in Görlitz die Szene betreten …
*
Jener Urgroßvater, der der Vater meines Großvaters mütterlicherseits war, auch ein Lessing, wurde in Mühlhausen bei Bamberg geboren. Das erwähne ich, weil ich damit etwas sehr Spezielles enthüllen kann: meine bayerische Wurzel! Mich stört das nicht. Aber wie einige Bayern darüber denken, wenn sie’s nun erfahren sollten, weiß ich nicht. Dieser Urgroßvater Anton Lessing entstammte einer jüdischen Familie. Sein kaufmännischer Lehrbetrieb soll das Geschäft Konrad Raab gewesen sein, das noch heute in Mühlhausen existiert. Einer seiner Söhne, Wilhelm Heinrich Lessing, brachte mit Beginn der Hitlerdiktatur seine Frau und seinen Sohn ins sichere Ausland, nach London. Er selbst versuchte in der sogenannten Reichskristallnacht aus der brennenden Synagoge in Bamberg die Tora-Rolle zu retten. Die Brandstifter entdeckten ihn und schlugen ihn, die Tora-Rolle wurde zurückgeworfen ins Feuer. Wilhelm Lessing floh in seine Wohnung, die Nazis folgten ihm. Sie zerrten ihn heraus, zündeten das Haus an und misshandelten ihn auf der Straße. Wenige Monate später erlag er seinen Verletzungen. Die Straße, in der seine Familie in Bamberg lebte, wurde 1948 nach ihm benannt.
Zurück zu meinem Urgroßvater Anton Lessing – eben jener Bayer aus Mühlhausen bei Bamberg: Er wurde ein erfolgreicher Unternehmer, selbstverständlich kann man auch sagen: Kapitalist. Er ging ebenfalls nach London, lernte Englisch und organisierte den Handel zwischen Großbritannien und Russland. Er exportierte moderne Technik. Später wurden die Gebrüder von Struwe auf ihn aufmerksam, Ingenieure, die im russischen Kolomna Werke besaßen, in denen Lokomotiven hergestellt werden sollten. Sie schätzten selbstkritisch ein, vom Handel nichts zu verstehen und bestimmten daher meinen Urgroßvater zum Geschäftsführer in Kolomna.
Rudolf Diesel hatte bekanntlich den Dieselmotor erfunden. Allerdings fehlte ihm das Geld, diesen Motor herstellungsreif zu entwickeln. Mein Urgroßvater kaufte deshalb eine Lizenz für diesen Motor und war somit tatsächlich in der Lage, in Kolomna modernste Lokomotiven produzieren zu lassen. Der Betrieb lief so gut, dass mit der Hilfe des Werkes sogar noch die Schifffahrtsindustrie angekurbelt werden konnte. Mein Urgroßvater wandelte die Kolomna-Werke schließlich in eine Aktiengesellschaft um. So kam Geld für mehr und mehr Investitionen in das Unternehmen. Im benachbarten Wyksa entstand ein Stahlwerk. Das Erz dort war besonders leicht abzubauen, man konnte es bereits von der Erdoberfläche aus aufspüren. Anton Lessing begann dort, Rohre herzustellen.
Erstaunlicherweise werden in den Kolomna-Werken bis heute Lokomotiven produziert, und in Wyksa existiert nach wie vor jene Stahlfabrik, die jetzt allerdings Stahlröhren für Gas- und Erdölpipelines herstellt. Nach der Jahrtausendwende kam eine kleine russische Delegation nach Berlin und lud mich zu einem Besuch ein, der jedoch bis heute nicht zustande kam. Interessant war, dass die Russen bei ihrer Visite in Deutschland erwähnten, mein Urgroßvater sei sogar von Lenin gewürdigt worden, und zwar als ein Pionier, der endlich hochwertige, moderne Industrietechnik nach Russland gebracht habe. Inzwischen steht eine Skulptur meines Urgroßvaters vor dem Werk in Wyksa.
Dieser Anton Lessing war nie bloß Unternehmer. Er hat in gleichem Maße an die Entwicklung der Stadt gedacht, er unterstützte in Kolomna den Bau des Theaters und des Krankenhauses. In seiner Heimatstadt Mühlhausen etablierte und finanzierte er Kindereinrichtungen, in Lahnstein besitzt er ein Ehrengrab. Er war offenbar ein lebensfroher, energiegeladener Mensch. Er wollte auch Familie, Kinder. In der Petersburger Gesellschaft lernte er eine Witwe kennen, Lydia de Cuyper. Sie war eine geborene Sasportas, Belgierin und hatte hochadelige spanische Vorfahren. Sie heirateten – so wurde Lydia meine Urgroßmutter – und verbrachten gemeinsam eine Zeit in Russland. Dann entschied sich Anton Lessing, für seine Familie ein mondänes Haus in Oberlahnstein zu bauen. Auf einem Bild kann man sehen, dass es wahrlich etwas mehr als nur eine schöne Villa war. Inzwischen habe ich das Haus, das Grab, das Archiv besichtigt. Im Haus leben heute mehrere Familien, eine ist mit mir verwandt.
Dort lebte also früher Lydia, während ihr Mann durch Europa reiste. Einmal im Jahr soll er bei seiner Frau erschienen sein, sie geschwängert haben, um danach sofort wieder zu verschwinden. Eine zehn Jahre andauernde Praxis – die demnach zehn Kinder hervorbrachte. Eines von ihnen war mein Großvater. Er studierte in Deutschland und wurde Hütteningenieur. Sein Vater setzte ihn dann als Direktor des Werkes in Wyksa ein.
*
Logischerweise war mein Großvater als junger Mann des Öfteren bei seinem Vater in Russland. Erinnern Sie sich an die Adlige, die als Sekretärin beim General arbeitete? Ihr begegnete er, verliebte sich, hielt um ihre Hand an, war aber nicht sofort erfolgreich. Das lag daran, dass meine zukünftige Großmutter in einen Cousin verliebt war, der malte. Sowohl meine Schwester als auch ich haben je ein Gemälde von ihm. Alle Angehörigen redeten damals auf meine Großmutter ein: Nimm den Direktor des Stahlwerkes, nicht den Maler, diesen brotlosen Künstler! Sie gab den durchaus materiell gesteuerten Ratschlägen nach, warum auch immer. Interessant ist aber, dass rationale, teils sogar sehr materielle Überlegungen irgendwann doch auch zu Liebe und Zuneigung führen können. Geduld bringt Rosen, besagt ein Sprichwort.
Der Ehe verdanke ich die Geburt meiner Mutter Irene und meines Onkels Gottfried. Sie lebten als Familie sowohl in Sankt Petersburg als auch in Wyksa. In Sankt Petersburg besaßen sie eine Wohnung und in Wyksa ein großes Haus.
Nun aber griff radikal die Weltpolitik ein. 1914 brach jener Weltkrieg aus, den man später den »Ersten« nannte. Deutschland und Russland standen sich als Feindesländer gegenüber. Mein Großvater wurde in die deutsche Armee eingezogen. Der Zar entschied, feindliche Ausländer zu enteignen. Das traf auch die Lessings. Ich betone: enteignet vom Zaren, nicht von Lenin. So wurde Lessing die geerbten Anteile an den Fabriken und auch sein Haus in Wyksa los.
Meine Großmutter Tatjana musste mit ihren beiden Kindern, also meiner Mutter und deren Bruder, zu ihrer Mutter nach Pensa ziehen, um überhaupt einen Aufenthalt zu finden. Sie waren Deutsche, die kein Wort Deutsch sprachen. Mein Großvater holte die Familie um 1918/19 herum nach Lahnstein. Meine Mutter war da sechs oder sieben, ihr Bruder vier oder fünf Jahre alt. Sie kamen aber nicht zu dritt, sondern zu viert. Denn das Kindermädchen Mascha Krylowa, das sich auch um den Haushalt kümmerte, wurde selbstverständlich mitgenommen. Mascha, eine klassische russische Seele, war äußerst liebenswert. Meine Großmutter unterhielt sich mit den Kindern weiter auf Russisch, im Laufe der Jahrzehnte hat sie ein schwaches, schlechtes Deutsch gelernt. Das Deutsch von Mascha war etwas besser. In der Schule litt meine Mutter, weil sie die anderen Kinder nicht verstand. Ihr wurde immer hinterhergerufen, sie sei »Polin, Spionin«. Sie konnte mit beiden Begriffen nichts anfangen, fühlte aber instinktiv, dass es irgend etwas Schlimmes bedeuten musste.
Der Aufenthalt der Familie in Lahnstein dauerte nicht lange, meine Großmutter wollte dort nicht leben. So wurde in Berlin die Villa Lessing gebaut, die in der Straße Am Schlachtensee lag und liegt. Die Lessings waren zu diesem Zeitpunkt zwar nicht mehr reich, aber auch nicht unvermögend. Kindermädchen und Haushälterin Mascha behauptete immer, dass bei der Geburt meiner Mutter die Familie die neuntreichste in Europa gewesen sei. Das war sie jetzt mit Sicherheit nicht mehr.
Meine Mutter und ihr Bruder erhielten in Berlin eine gute Bildung. Nach dem Abitur studierte sie Volkswirtschaft, er Jura. Sie lebten fest in der bürgerlichen Gesellschaft, es ging ihnen gut. Es zog sie in die Welt. Meine Mutter hielt sich ein Jahr in Südafrika und ein Jahr in Großbritannien auf. Mein Onkel Gottfried war ebenfalls in Großbritannien und lebte später – wie bereits erwähnt – in Rhodesien. Beide lernten reiten, Tennis spielen, Ski laufen. Meine Mutter berichtete später mit einem gewissen Stolz, auch mit dem Sohn von Gustav Stresemann auf dem Tennisplatz gestanden zu haben.
Aber das gute Leben hatte bald ein Ende. Die politische Situation in Deutschland verschärfte sich zusehends, gerade auch in Berlin. Die Hitlerdiktatur rückte immer näher. Für meine Mutter und ihren Bruder waren die Nazis schon aus humanistischen Gründen völlig indiskutabel. Außerdem liebten sie Russland, und jene staatlich forcierte und festgeschriebene Feindschaft mit der Sowjetunion war für sie nicht hinnehmbar. Bei meiner Mutter kam noch hinzu, dass sie meinen Vater kennenlernte. Einen Kommunisten.
Für meinen Onkel Gottfried Lessing stand 1933 die Frage, ob er nach Mexiko oder nach Rhodesien emigrieren solle. Warum auch immer, er entschied sich für das damalige Rhodesien, das heutige Simbabwe. Dort lernte er – wie bereits erwähnt – seine spätere Frau Doris kennen. Nach 1945 kam es zur Scheidung. Die Schriftstellerin traf ich mehrfach, 2007 auch während eines ihrer Aufenthalte in Deutschland. Ich prophezeite ihr den Literaturnobelpreis. Sie schüttelte den Kopf, denn sie wisse nur zu genau: Das Nobelpreiskomitee könne sie nicht leiden. Aber wenige Monate später erhielt sie den Preis tatsächlich. Medienvertreter versammelten sich bei mir, ich spendierte Sekt, bekundete den Stolz auf meine Tante – wenngleich mein Leistungsanteil an ihrem Werk natürlich bei null liegt. Sie selbst glaubte bis zu ihrem Tod 2013, dass ich Einfluss auf das Komitee genommen hätte. Welch freundliche Überschätzung meiner Möglichkeiten – aber ich entschied mich irgendwann, sie in ihrem Glauben zu belassen.
Mein Onkel Gottfried gründete übrigens in Rhodesien mit zwanzig weiteren Frauen und Männern die Kommunistische Partei und wurde deren Vorsitzender. Er versicherte mir, dass es nie mehr als zwanzig Parteimitglieder gab.
Mit der Eroberung der Macht durch die Nazis war für meine Mutter und ihren Bruder nicht nur die Unbeschwertheit, sondern auch die Jugend vorbei. Man wurde durch die Umstände sehr schnell und sehr unnatürlich erwachsen. Unseren Großvater erlebten meine Schwester und ich nicht mehr bewusst, unsere Großmutter und Mascha, das Kindermädchen und die Haushälterin, schon. Wir nannten beide immer in der Reihenfolge Mascha und Mama (auf der zweiten Silbe betont) und besuchten sie manchmal – vor dem Mauerbau – in Nikolassee in Westberlin.
2. Kapitel
Selbstverständlich hatte ich nicht nur eine Mutter, sondern auch einen Vater. Es handelt sich um Klaus Gysi, der im Jahre 1912 nur sieben Tage vor meiner Mutter in Berlin geboren wurde, wo er 1999 starb.
Die Familiengeschichte der Gysis ist nicht minder verschlungen, sie verlief ebenso wie die der Lessings äußerst widersprüchlich. Beide Familien unterschieden sich aber erheblich. Die ursprünglichen Vorfahren der Gysis kamen aus der Schweiz, und zwar aus Läufelfingen in der Nähe von Basel. Viele von ihnen waren zunächst Bader, später Chirurgen. Ich weiß, dass es in der Gegend von Basel noch heute eine Schuhfabrik »Gysi« und eine Schokoladenfabrik gleichen Namens gibt. Mehrfach wurde ich gefragt, ob mir das eine oder das andere Werk gehöre. Leider bin ich erbrechtlich weder an dem einen noch an dem anderen in irgendeiner Form beteiligt. In der Schweiz lernte ich eine Frau kennen, Mitglied des dortigen Nationalrats, die den Namen Gysi trägt. Aber wir sind nicht miteinander verwandt oder wissen zumindest nichts davon.
Irgendwann zogen die Gysis aus der Schweiz nach Berlin. Bei dem ersten Auswanderer handelte es sich um Samuel Gysi, einen Schneidermeister. Ich muss befürchten, dass der Umzug aus bitteren sozialen Gründen erfolgte; ich will nicht darüber nachdenken, wie man ihn heute benennen und behandeln würde. Sein Sohn Karl Friedrich Samuel Gysi wurde Arzt in Berlin. Ich besitze noch dessen Meisterbrief vom 10.April 1817, aus dem hervorgeht, er sei »Meister des Handwerks der Chirurgie«. Offenbar empfand man das körperbezogene Sägen eher als Handwerk denn als medizinische Kunst. Er wurde nur siebenundvierzig Jahre alt, weil er in einem Berliner Gewässer ertrank.
Karl Friedrich Samuel hatte mehrere Kinder, darunter einen Sohn namens Hermann – meinen Urgroßvater. Geboren wurde er 1840 in Berlin. Meine Schwester und ich besitzen ein Album, und ich zitiere gern aus dem Text darin, auch wenn ich nicht die geringste Ahnung habe, wer ihn verfasste. »Er verlor mit sieben Jahren seinen Vater, mit acht Jahren seine Mutter, wuchs im Militär-Waisenhaus in Berlin auf, lernte Sattler, ging als Geselle auf die Wanderschaft, bis er zum Militärdienst in das brandenburgische Train-Bataillon Nummer drei eingezogen wurde. Er wurde Berufssoldat, machte den Krieg gegen Dänemark 1864 an der Front, die Kriege gegen Österreich und Frankreich 1866 und 1870/71 in der Heimat mit.« Er war also zweifellos kein Pazifist. Weiter steht da: »Durch einen Sturz vom Pferde dienstlich unfähig geworden, kam er als Militäranwärter zum Magistrat Berlin und war zuletzt Magistratssekretär und Vorsteher der Steuerkasse XII A in der Albrechtstraße 26 neben dem Schulgebäude. Bis zu seinem 47.Lebensjahr war er Junggeselle und schätzte und pflegte sehr Wein, Weib und Gesang. Er war ein glänzender Gesellschafter, guter Redner und Erzähler. Er war sehr belesen und hatte eine gute Bibliothek. Er zitierte oft und las gern und gut vor. Für alle Wissensgebiete hatte er ein reges Interesse. Er überragte geistig fraglos den Durchschnitt seiner Berufskollegen, erheblich den der nächsten und ganz bedeutend den der dann folgenden Generationen. Er war innerlich anständig und äußerlich korrekt, liebenswürdig und stets hilfsbereit.«
An irgendwen erinnert er mich.
Er lebte in einem Haus in der Köllnischen Straße 8, das ihm gehörte. Dort gab es auch eine Gaststätte mit Garten, die von einem Freund und dessen Frau bewirtschaftet wurde. Im erwähnten Text heißt es dazu: »Im Garten dieser Gaststätte baute er Käfige auf, in denen er Eulen, Bussarde und andere Raubvögel hielt. In seiner Wohnung stand ein großes Aquarium, in dem er eine Zeit lang einen Wels hatte. Er besaß auch eine Neufundländer-Hündin Lotte, die ihn gelegentlich morgens aus seinem Stammlokal in seine Wohnung ziehen musste.«
Meine Urgroßmutter väterlicherseits, Käthe Kienitz, wird es also nicht ganz leicht mit ihm gehabt haben. Auf jeden Fall heirateten sie. Sie selbst stammte aus Görlitz. Ihr Großvater war Robert Oettel, ein begeisterter Hühnerzüchter. Er importierte als Erster asiatische Hühnerrassen. Bei Wikipedia kann man lesen: »Diese asiatischen Hühner waren wüchsige Fleischhühner von großer Formen- und Farbenvielfalt, die auch im Winter Eier legten. Das war ein großer Fortschritt, gab es bis dahin doch nur leichte Landhühner mit saisongebundener Legetätigkeit.«
Oettel gründete den »Hühnerologischen Verein Görlitz« und damit den ersten Geflügelzuchtverein in Deutschland. Zu seinen Ehren wurde in Görlitz ein Denkmal errichtet, das im Jahre 1901 eingeweiht wurde. Man sieht da nicht nur ein Konterfei Oettels, sondern auch einen wunderschönen Hahn. Sowohl die Schrifttafel als auch den Hahn haben die Nazis gestohlen, denn beides war aus Bronze, und alle Bronze, die aufgetrieben werden konnte, wurde für den Krieg eingeschmolzen. Aber wenigstens die Tafel »überlebte«. Sie war nach 1945 von einem – wie es hieß »beherzten« – Hühnerzüchter gefunden und wieder angebracht worden. So gab es 1952 eine erneute Einweihung in Görlitz, zum 100.Jahrestag des »Hühnerologischen Vereins«, der damals noch von den Geflügelzüchtern aus ganz Deutschland begangen und gefeiert wurde. Aber erst nach Herstellung der deutschen Einheit wurde auf Veranlassung des »Bundes deutscher Rassegeflügelzüchter« auch wieder ein Hahn auf den Granitblock gesetzt.
Robert Oettel soll humorvoll gewesen sein, er wünschte sich für sein Grab folgende Inschrift: »Auf mein Grab müsst ihr mir setzen einen schönen stolzen Hahn./Kräht er, wird es mich ergötzen, auch wenn ich’s nicht hören kann.«
Wieder und wieder staune ich, was für seltsame, eigenwillige Vorfahren ich doch habe.
*
Mein Großvater Hermann Gysi – er hatte den gleichen Vornamen wie sein Vater – war Arzt in Berlin-Neukölln. Er soll ein sehr guter Mediziner gewesen sein und ein Mann mit Eigenheiten. Damals galt es als wissenschaftlich erwiesen, dass kaltes Wasser auf Brandwunden ein großer Fehler sei. Er aber versorgte unbeirrt alle seine Brandwunden mit kaltem Wasser. Das Argument dafür fiel kurz und knapp aus: Wasser tut so gut! Inzwischen hat sich die wissenschaftliche Meinung geändert und ihm recht gegeben. Abergläubisch fürchtete er die Operation von Rothaarigen: Ihnen sei vorbestimmt, beim Eingriff zu sterben. Deshalb mied er sie und überließ solche Patienten seinen Kollegen. Von seinem Vater muss er aber das besagte Verhältnis zu »Wein, Weib und Gesang« geerbt haben – so jedenfalls hat es mir mein Vater erzählt.
Interessant ist folgende Begebenheit, die mir mein Vater erzählte, indem er über sich selbst den Kopf schüttelte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde mein Großvater Hermann Gysi einer der Chefärzte im Berliner Oskar-Ziethen-Krankenhaus. In einer merkwürdigen Aufwallung von Parteilichkeit beschwerte sich mein Vater darüber, denn: Sein Vater sei doch ein ausgewiesener Sozialdemokrat, also überhaupt nicht geeignet für eine so hohe Leitungsposition. Ein »höherer Genosse« wies dies zurück und machte meinem Vater klar, dass über Berufungen glücklicherweise nicht die Söhne zu entscheiden hätten.
Mein Vater nannte seine Großmutter Käthe die kleine Großmutter. Sie hatte ihn als Kind mitgenommen, wenn sie den Maler Heinrich Zille besuchte, mit dem sie befreundet war. Auch durfte der Enkel die Großmutter begleiten, wenn sie versuchte, in der Köllnischen Straße 8 die Miete zu kassieren. Mein Vater nannte dies später eine wichtige soziale Erfahrung.
Erna Potolowski, die Frau meines Großvaters Hermann und mithin meine Großmutter, hatte bemerkenswerte Eltern: Da ihnen mit jüdischer Familienstrenge die Eheschließung verboten worden war, gingen beide nach Gretna Green zur berühmten schottischen Hochzeitsschmiede, wo man ohne Einwilligung der Eltern und trotzdem amtlich anerkannt heiraten darf. Mit einem gewissen Vergnügen las ich in einem Gesetzbuch der DDR, dass die Eheschließungen vor diesem Schmied auch in der DDR anerkannt wurden. Durch Gretna Green wurde mir klar, dass es in jedem gesetzlichen Regelwerk untilgbar und klug Ausnahmen von der Regel gibt – diese Sonderregelung in Schottland hatte ein englischer König geschaffen.
Der Vater von Erna Gysi war ein Kaufmann. Unter anderem verkaufte er Handschuhe, es gibt ein wunderschönes Plakat, auf dem meine Großmutter diese Handschuhe trägt. Einer ihrer Brüder, Theodor Potolowski, war in Berlin Börsenvertreter des Bankhauses Frommberg und durchaus wohlhabend. Seine Familie besaß einen Bechstein-Flügel sowie extra angefertigte Möbel aus den Hellerauer Werkstätten, Bilder und Zeichnungen von Kokoschka, Corinth sowie Pechstein, außerdem ostasiatische Kunst und eine große Bibliothek. 1934, nach der sogenannten Arisierung des Bankhauses, verlor Theodor Potolowski seine Anstellung. Er konnte mit seiner Frau nur noch von der Substanz leben, erlitt Demütigungen, war verdammt, den Judenstern zu tragen. 1943 erhielten beide den »Deportationsbescheid«. Auf einem achtseitigen Finanzformular mussten sie eine detaillierte Vermögenserklärung abgeben. Der Besitz wurde beschlagnahmt. Am 15.Mai1943, einem Samstag, trieb man das Ehepaar aus seiner Wohnung in der Taunusstraße. Zwei Nächte verbrachten sie noch in einem Sammellager in der Synagoge Levetzowstraße, am darauffolgenden Montag brachte man sie mit 406 anderen Menschen zum nahe gelegenen Güterbahnhof Moabit am Westhafen. Dort gingen sie auf den 36., den letzten »Osttransport«.
Der Zug war zwei Tage unterwegs. Ungewöhnlich lange für eine Strecke von etwa 570 Kilometern. Am 19.Mai1943 erreichten sie Auschwitz. Noch auf der Rampe entschied sich ihr weiteres Schicksal. Theodor Potolowski und seine Frau kamen gar nicht erst ins Lager und erhielten auch keine Nummer auf den Unterarm tätowiert. Sie wurden sofort auf Lastwagen verladen und zu einem der gerade in Betrieb genommenen neuen Krematorien in Birkenau gefahren. Dort endete ihr Leben, das nur fünfzig Jahre währen durfte, in einer Gaskammer. Ihre Asche wurde in der Nähe des Lagers in die vorbeifließende Weichsel gekippt.
An diesem Mittwoch, dem 19.Mai1943, erklärte der Gauleiter der NSDAP in Berlin und Minister für Volksaufklärung und Propaganda, Joseph Goebbels, die Reichshauptstadt offiziell für »judenfrei«.
Die Mutter von Erna Gysi, meine Urgroßmutter Lina Potolowski, überstand eineinhalb Jahre Hunger, Seuchen und andere Entbehrungen in Theresienstadt. Sie wurde von dort am 18.Dezember1943, kurz nach ihrem 76.Geburtstag, ebenfalls nach Auschwitz deportiert. Meine Schwester und ich besitzen von ihr eine Postkarte aus dem Vernichtungslager, auf der sie mitteilt, dass es ihr gut gehe, und man möge ihr bitte schreiben, selbst wenn sie nicht antworte. Auch sie kam dort um. Ihr zum Gedenken wurde inzwischen vor ihrem ehemaligen Wohnhaus ein »Stolperstein« gesetzt.
*
Schicksale, Leidenschaften, bittere politische Einschnitte. Meine Großmutter Erna Gysi und mein Großvater Hermann Gysi wurden 1929 geschieden. Sie lebte dann mit Kurt Levy zusammen. Eine große Liebe. Als die Nazis Deutschland übernahmen, ging er allein nach Paris, wo auch seine Töchter aus seiner ersten Ehe, Marie und Eva, lebten. Plötzlich leitete die Gestapo in Berlin ein Verfahren gegen ihn ein, wegen angeblicher Devisenvergehen. Nach einer brutalen Hausdurchsuchung und Vernehmung floh auch meine Großmutter; mit einem gefälschten Pass gelangte sie ebenfalls nach Paris. Sie versteckte sich später, bis die Nazidiktatur vorbei war, in einem Dorf in Südfrankreich. Gemeinsam mit den beiden Töchtern Levys – deren Mutter ihr die Kinder gebracht hatte, weil sie selber in die USA auswandern wollte. Meine Großmutter nahm die Mädchen ganz selbstverständlich zu sich. Kurt Levy selbst hatte sich im Gefangenenlager in Gurs zur Fremdenlegion gemeldet, um zu überleben.
Ein Dorfpolizist kam eines Tages zu meiner Großmutter und warnte sie: Am nächsten Tag würde sie abgeholt. Sie versteckte sich mit Marie und Eva im Wald und erzählte ihnen nächtelang Witze. Lachen für den Lebensmut.
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wollten Kurt Levy und meine Großmutter Erna gemeinsam nach Amerika auswandern. Levy reiste vor, fand dort seine erste Frau wieder, und also wurde nichts aus dem Leben mit meiner Großmutter. Aber die enge Beziehung zwischen ihr und seinen Töchtern Marie und Eva in Paris blieb.
Unsere Großmutter Erna wurde eine besondere Partnerin für meine Schwester und mich. Sie lebte bis zu ihrem Tode in Paris. Wir durften zwar nicht sie, aber sie durfte uns besuchen. Ihre Bildung, ihre Güte, ihr Humor imponierten uns sehr. Wir nannten sie Mummi.
Sie lebte mit Rücksicht auf die politische Funktion meines Vaters später als Staatenlose in Paris. Denn eine BRD-Bürgerin als Mutter? Das wäre schwierig für ihn geworden. Diese Staatenlosigkeit war für Mummi freilich unangenehm, da der Status erforderte, sich regelmäßig bei der französischen Polizei zu melden, und Schwierigkeiten beim Reisen in andere Länder gab es auch. Aber wie gesagt, für ihren Sohn nahm sie das alles auf sich. Mein Vater bemühte sich dann beim ZK der SED, diesen lästigen Zustand zu beenden, und schließlich bekam er grünes Licht: Sie durfte, ohne dass es Konsequenzen für ihn hatte, die Staatsbürgerschaft der BRD annehmen und erhielt den dazugehörigen Reisepass. Ihr stand beides zu, sie erhielt beides und lebte erleichtert.
Heute, mit großem historischen Abstand, klingt es beinahe unglaubwürdig: Das Zentralkomitee der SED entschied indirekt über die Staatsbürgerschaft meiner Großmutter! Aber sie liebte ihren Sohn viel zu sehr, um ihr Recht ohne seine Erlaubnis und mit der Gefahr einzufordern, ihn in Schwierigkeiten zu bringen.
3. Kapitel
Wie haben sich meine Eltern kennengelernt? Meine Mutter, Irene Lessing, studierte Volkswirtschaft in mehreren Städten, zum Schluss in Berlin. Eines Tages saß sie auf der kleinen Umgrenzungsmauer vor der Friedrich-Wilhelms-, der heutigen Humboldt-Universität, als ein Taxi vorfuhr. Aus stieg hastig ein junger Mann, eilig rannte er, lauter Zettel in den Händen, ins Lehrgebäude. Nach einer Weile kam er wieder heraus, setzte sich leicht erschöpft neben meine Mutter, und es entspann sich ein kurzes Gespräch.
Dieser junge Mann, Klaus Gysi, mein zukünftiger Vater, studierte ebenfalls Volkswirtschaft, nach einer Zeit in Frankfurt am Main und der Sorbonne in Paris nun gleichfalls in Berlin. Er hatte an diesem Tag bis Punkt zwölf Uhr eine schriftliche Arbeit abzugeben; versäumte er diesen Termin, wäre sie nicht mehr zulässig gewesen – was sein Studium deutlich verzögert hätte. Eine Minute vor zwölf war er aufgekreuzt. Nun saß er neben meiner Mutter, und sie bemerkte, dass er das alles ja ziemlich knapp organisiert habe. Mein Vater erklärte nur, dass sein Bruder gerade gestorben sei, an Leukämie. Damit war alles erklärt. Ein einziger Satz schuf Nähe.
Sein Bruder Gerd war als Junge auf die Odenwald-Schule gegangen, mein Vater hatte ihn dort besucht und war so fasziniert, dass er darum bat, ebenfalls auf diese Schule gehen zu dürfen. So kam es. Er war ein guter Schüler, nur im Fach Religion hatte er Schwierigkeiten. Auf der Odenwald-Schule lernte er den Sohn von Ernst Barlach kennen, von dem er mir später nur erzählte, er sei sehr gern stundenlang allein im Wald spazieren gegangen. Zu einem Freund für meinen Vater wurde der Schriftsteller Felix Hartlaub. Dieser war bis April 1945 als Historiker in mehreren Führerhauptquartieren tätig, arbeitete beim Oberkommando der Wehrmacht mit am sogenannten Kriegstagebuch, wurde aber noch im April 1945 eingezogen. Meine Mutter bot an, ihn zu verstecken. Er lehnte ab, wobei er noch den Humor besaß, sich mit ihr für einen Tag nach Kriegsende in einem Berliner Café zu verabreden. Er kam nicht wieder.
Zurück zur ersten Begegnung zwischen meinen Eltern: Sie verabredeten sich im Café Bauer, später das Lindencorso Unter den Linden, Ecke Friedrichstraße. Zu dieser Zeit herrschten schon die Nazis. Meine Mutter meinte ihren neuen Bekannten darüber informieren zu müssen, dass sie als sogenannte Vierteljüdin – ihr Großvater war Jude – einen gelben Streifen auf ihrem Studentenausweis habe. Mein Vater tat, als ob er sie nicht verstünde, er fragte immer wieder nach. Nach etwa zwanzig Minuten zog er seinen eigenen Studentenausweis: Das Dokument trug ebenfalls einen gelben Streifen. Denn seine Mutter war Jüdin, also galt er bei den Nazis als Halbjude. Meine Mutter erzählte mir, in diesem Moment habe sie überlegt, entweder sofort aufzustehen und für immer zu gehen – oder sich auf immer für diesen Mann zu entscheiden.
Mein Vater war 1928 dem Kommunistischen Jugendverband Deutschlands beigetreten, gehörte der Internationalen Arbeiterhilfe und dem Sozialistischen Schülerverband an, später der Roten Studentenbewegung. 1931 wurde er Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD).
Zu dieser Zeit war meine Mutter nicht politisch organisiert, aber eindeutig und klar gegen die Nazis. Sie studierte nun also gemeinsam mit meinem Vater an der Humboldt-Universität, beide wurden jedoch der Uni verwiesen, glücklicherweise erst nachdem sie ihre Diplome als Volkswirte erworben hatten. An Freunden aus jener Zeit hielten sie ein Leben lang fest. Dabei denke ich an Heinz Barwich, einer der erfolgreichsten Physikprofessoren der DDR, der später im sowjetischen Dubna arbeitete, dann aber in die Bundesrepublik wechselte. Oder an Hans Wittbrodt, ebenfalls Professor der Physik, der mit meinem Vater zusammen in Neukölln zur Schule gegangen war. Oder an Karl Burckhardt, mit dem gemeinsam sich mein Vater während der Nazidiktatur in Frankreich aufhielt. Und an Bruno Haid, der auch in Frankreich war. Er wurde später in der DDR, als mein Vater Kulturminister war, einer seiner Stellvertreter.
Meinen Vater zog es in seiner Studentenzeit nach Cambridge. In Paris an der Sorbonne hatte er bereits Französisch gelernt, bald beherrschte er auch die englische Sprache. Meine Mutter sprach Russisch, Englisch und Französisch. Zwei, die in schwieriger, politisch immer drückender werdender Zeit ihre Weltläufigkeit lebten und sich darin wunderbar verstanden. Trotzdem kam es zwischen ihnen zu einem Zerwürfnis, meine Mutter ging für ein Jahr nach Südafrika. Später schilderte sie mir, was sie dort so beeindruckt hatte: das so unterschiedliche kulturelle Verständnis von Weißen und Schwarzen – das der Schwarzen, geprägt von Lebensfreude und Leidenschaft, war ihr eindeutig sympathischer.
Weshalb ein Zerwürfnis? Mein Vater schien plötzlich Angst vor einer festen Bindung zu haben, er fürchtete wohl um seine Freiheit und Unabhängigkeit. Bald schon bereute er seine Zweifel, ärgerte sich über seine Unentschlossenheit und schrieb meiner Mutter lange Liebesbriefe. Er bat sie um Rückkehr. So fanden sie erneut zueinander; nach einem kurzen Aufenthalt in Großbritannien kam meine Mutter wieder nach Berlin. Sie lebten allerdings nicht gleich zusammen.
*
Die existenzielle Situation wurde für meinen Vater immer bedrückender und gefährlicher. Später in der DDR nannte er drei Gründe für die wachsende Bedrohung seines Lebens durch die Nazis. Erstens sei er Mitglied der KPD gewesen, zweitens habe er eine jüdische Mutter, und drittens sei er Brillenträger. Erstaunt wurde dann zurückgefragt, wieso eine Brille das Motiv für eine Verfolgung gewesen sei. Seine Gegenfrage: »Und wieso das andere?«
Meine Eltern entschlossen sich 1939, gemeinsam nach Frankreich zu gehen. Mein Vater hatte zunächst versucht, unter Hinweis auf seine eidgenössischen Vorfahren für meine Mutter und sich einen schweizerischen Pass zu bekommen. Dies scheiterte ebenso wie der Erwerb eines US-amerikanischen Passes. Also Paris. Dort arbeitete er in der Leitung der kommunistischen deutschen Studenten, deren Zahl wohl eher übersichtlich war. Auf einem internationalen Kongress antifaschistisch gesinnter Schriftsteller lernte er bedeutende Autoren kennen. Es entstanden Kontakte, die ihm später bei seinen kulturpolitischen Aufgaben in der DDR sehr zugutekamen. Bei meinem Vater und meiner Mutter gab es nicht nur eine große Bindung an die Literatur – beide hatten die Fähigkeit, Bücher in einer so unglaublichen Schnelligkeit zu lesen, wie ich es bei niemand anderem erlebte. Und diese Geschwindigkeit ging nicht auf Kosten der Intensität. Darauf war ich durchaus ein bisschen neidisch.
1940 überfiel Deutschland Frankreich. Meine Mutter, meine Großmutter und mein Vater wurden von den Franzosen verhaftet und in Gurs getrennt voneinander eingesperrt. Sie galten als feindliche Ausländer. Nach einigen Monaten wurden meine Großmutter und meine Mutter wieder entlassen. Mein Vater blieb eingesperrt, freute sich aber, mit seinen Freunden Karl Burckhardt, Bruno Haid und dem Geliebten seiner Mutter, Kurt Levy, zusammen sein zu können. Er verrichtete Arbeiten als Dachdecker.
Kurt Levy hatte sich zur Fremdenlegion gemeldet; für meinen Vater und seine beiden Freunde kam das nicht in Frage. Irgendwann stand die Verlegung in das Straflager Le Vernet an. Mein Vater ging zu einem französischen Offizier und erklärte, er habe für diese bevorstehende Verlegung eine inständige Bitte: Er wolle auf gar keinen Fall zusammen mit diesem Karl Burckhardt untergebracht werden, das sei ein unausstehlicher Kerl. Der Offizier hörte sich das an und versprach, sich zu kümmern. Natürlich landete mein Vater in einem Raum mit Karl Burckhardt. Genau das hatte er gewollt. Er hatte erfolgreich mit der Psychologie des Offiziers gespielt.
Menschen mit militärischen Machtbefugnissen sind aber keinesfalls automatisch negativ zu beurteilen. Als das Straflager 1940 an die Deutschen übergeben werden sollte, befahl ein französischer Offizier in lautem, brüllendem Ton den Deutschen Karl Burckhardt, Bruno Haid und Klaus Gysi, auf einen LKW zu steigen. Alle rundum befürchteten das Schlimmste, auch die drei Betroffenen. Der Offizier stieg mit in den Wagen, er fuhr diesen LKW in den nicht besetzten Teil Frankreichs, ließ absteigen und erklärte den Dreien, dass er mehr für sie nicht tun könne. Und fuhr wieder ab. Natürlich nannte er seinen Namen nicht, allein schon wegen der Gefahr, dass einer von den Dreien verhaftet, verhört, gar gefoltert und dann womöglich aussagen würde. So blieb der Retter anonym. Mein Vater bedauerte das sehr, so konnte er ihm nach 1945 nicht danken. Ohne diesen Offizier hätten die drei wohl nicht überlebt.
Meine Eltern trafen sich im nicht besetzten Teil Frankreichs und konnten sich dort gut verstecken. Sie besaßen noch gültige Pässe, und die Leitung der Kommunistischen Partei Deutschlands in Frankreich beschloss die Rückkehr beider nach Berlin. Eine harte, angesichts der politischen Verhältnisse unter Hitler im Grunde unmenschliche Entscheidung. Doch obschon ihn einige Freunde warnten, war mein Vater willens, die Order der Partei umzusetzen. Das Risiko war für beide erheblich, für ihn noch größer als für meine Mutter.
Oft habe ich mich gefragt, woher er diesen unvorstellbaren Mut und diese Konsequenz nahm, in ein Land zurückzukehren, wo sein Leben fortan an weniger als einem seidenen Faden hing. Und ebenso fragte ich mich, weshalb dieser Mut später in der DDR, gegenüber der SED-Führung und deren Enge und Starre und unter friedlichen Bedingungen, so fehlte.
Eines Tages also saßen meine Eltern allein in einem Abteil – in jenem Zug, der sie aus dem noch nicht besetzten Teil Frankreichs nach Deutschland brachte. Die Szene, die sich im Waggon abspielte, hat mir meine Mutter geschildert, und diese Episode verstärkte mein Erstaunen über meinen Vater, über eine Geistesgegenwart, die in gefährlichen Momenten rettend über Angst und Panik siegte. Denn plötzlich öffnete sich die Tür, und eine Schar von SS-Leuten nahm Platz. Was tat mein Vater? Er riss die Situation sofort an sich und erzählte am laufenden Band – jüdische Witze. Ausschließlich jüdische Witze. Die SS-Leute hielten sich die Bäuche vor Lachen und bemerkten nichts. Meiner Mutter freilich stockte in einem fort der Atem, ihr war hundsmiserabel zumute, und nur mit großer Anstrengung gelang ihr die gute Miene zum Spiel, das ja auch böse hätte ausgehen können.
1999 traf ich mich mit dem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl. Bei der Gelegenheit erzählte ich ihm diese Geschichte, wir kamen auf das Thema des Mutes innerhalb verschiedener Gesellschaftssysteme – und Helmut Kohl erklärte mir meinen Vater! Wenn er sich in der DDR gegen die SED gestellt hätte, so Kohl, wäre er keiner mehr von den Seinen und mithin sehr einsam geworden unter den eigenen Genossen. Der Mut gegen die Nazidiktatur wurde durch das Gefühl angetrieben und bestärkt, Teil einer kämpferischen Solidargemeinschaft zu sein, die auch etwas mit Märtyrerschaft zu tun hatte, mit der Gewissheit von Wirkungen also, die über den Tod hinaus lebendig geblieben wären.
Über dieses Argument dachte ich lange nach. Natürlich kommt für mich bei der Bewertung späterer Parteidisziplin auch noch jene politische Grundüberzeugung hinzu, die Menschen wie meinen Vater vieles relativieren und dulden ließ. Der Filmregisseur Frank Beyer hat einmal gesagt: »Was einen hemmte, war doch schlicht und einfach diese Tatsache: Gegen den Stalinismus vorzugehen, hieß gegen Antifaschisten vorzugehen. Das musste man erst mal übers Herz bringen.«
Trotzdem: Helmut Kohl hatte ebenfalls recht. Es ärgerte mich allerdings ein wenig, dass ausgerechnet er mir meinen Vater besser erklären konnte als ich mir selbst.
Jene Zugfahrt meiner Eltern, die letztlich bis Berlin führte, wurde auch deshalb schwierig, weil ihnen in Deutschland eine gültige Fahrkarte fehlte, sie konnten zudem das Hotel für eine erste Unterkunft in München nicht bezahlen, und außerdem fehlten ihnen Marken für Lebensmittel. Trotz dieser Schwierigkeiten gelang es ihnen, sich nach Berlin-Nikolassee durchzuschlagen, in die Schlachtenseestraße zu den Eltern meiner Mutter und zu Mascha. Sie waren nicht angemeldet und konnten nur deshalb überleben, weil sie sich gewissermaßen im Auge des Taifuns befanden: In der Umgebung wohnten viele Nazigrößen, es gab im Viertel also weder Polizeieinsätze noch Razzien. In dem Bezirk, in dem mein Vater früher gelebt hatte, in Neukölln, wäre ein solch geradezu geschützter Unterschlupf wohl kaum möglich gewesen.
Über Verbindungen meiner Mutter konnte organisiert werden, dass beide für denselben Verlag arbeiteten; sie verfassten Festschriften für Unternehmen, immer zu irgendwelchen runden Jahrestagen dieser Firmen. Dafür mussten sie den jeweiligen Betrieb besichtigen, und parallel zu ihren offiziellen Recherchen sammelten sie Informationen über mögliche Rüstungsproduktionen. Mein Vater gab diese Fakten und Wahrnehmungen an einen Verbindungsmann weiter. Wohin sie von dort aus flossen, erfuhr er nicht, er konnte es nur ahnen. Wahrscheinlich gingen sie nicht nur an die KPD, sondern möglicherweise auch nach Großbritannien. 1952 sollte ihm das, im Rahmen einer Untersuchung seiner Partei, Schwierigkeiten bereiten.
Meine Mutter organisierte für einige Menschen Verstecke, beschützte aber vor allem meinen Vater. Dieser verdankte sein Überleben nicht nur meiner Mutter, sondern auch deren Mutter und Vater sowie Mascha – und seinem eigenen Vater, dem Arzt Hermann Gysi. Denn kurz vor Kriegsende kam eine Militärkontrolle und war völlig verwirrt, sie verstand die gesamte Zusammensetzung im Haus nicht. Mein Vater gab sich bettlägerig, natürlich fragte die Patrouille, warum er nicht bei der Wehrmacht sei. Er zeigte sein Attest, wonach er an Diphterie leide. Der Militärarzt untersuchte ihn, sah sich dann noch einmal das Attest an und fragte, wer der behandelnde Arzt sei. Mein Vater erklärte: »Mein Vater.« Der Militärarzt schaute ihn lange an, sehr lange, und rief dann seinen Leuten laut zu, ja, dieser Mann leide tatsächlich an Diphterie. Die Kolonne zog wieder ab.
Das Motiv dieses Militärarztes kann ich nicht beurteilen. In diesem Moment überkam ihn offensichtlich Mitgefühl gegenüber seinem »Kollegen«, das heißt meinem Großvater. Er war sich offenbar sicher: In einer ähnlichen Notlage hätte er auch seinem eigenen Sohn auf die gleiche Weise zu helfen versucht. Ich weiß es nicht. Ein Leben kann jedenfalls von einer solchen Sekundenentscheidung eines anderen Menschen abhängen.
Der 8.Mai1945 bedeutete das Ende der Nazidiktatur und das Ende des Zweiten Weltkrieges. Die DDR feierte diesen 8.Mai von Anfang an als Tag der Befreiung. Die offizielle Bundesrepublik Deutschland brauchte, um das auszusprechen, vierzig Jahre – bis 1985, als der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker endlich und eindeutig auch für Westdeutschland feststellte, dass dieser 8.Mai1945 ein Tag der Befreiung gewesen sei.
4. Kapitel
Besatzungszeit, nach dem Krieg. Ich habe sie nicht selbst bewusst erlebt, Erzählungen der Eltern aber befestigten Eindrücke und verdeutlichten eine Atmosphäre. Die sowjetische Besatzungsmacht sorgte für Essen und am Deutschen Theater in der Schumannstraße dafür, dass zur Wiedereröffnung Lessings »Nathan der Weise« inszeniert wurde. Ein programmatischer Auftakt, ein Aufruf zur Toleranz zwischen Christen, Juden und Muslimen. Der auch heute wieder so akut, so wichtig geworden ist.
Meine Mutter erzählte mir aber auch, dass ein sowjetischer Soldat versucht hatte, ihr das Fahrrad zu stehlen, einen in der damaligen Zeit unschätzbaren Wertgegenstand. Daraufhin schimpfte sie ihm in fehlerlosem Russisch hinterher, was diesen absolut verblüffte, ja erschreckte, er ließ ab und ergriff die Flucht. Er muss wohl gedacht haben, sie sei die Tochter eines hohen sowjetischen Generals – wie sonst wäre die Existenz einer so gut russisch sprechenden Frau in Berlin zu erklären.
Später erfuhr ich von einer anderen Frau, ein Soldat der Roten Armee sei in ihre Wohnung eingedrungen und habe mit vorgehaltener Maschinenpistole ihre Uhr verlangt. Sie gab ihm die Uhr, er verschwand. In ihrer Wut ging die Frau zur Kommandantur und beschwerte sich. Ein Offizier ging mit ihr hinaus, ließ antreten, beide gingen die Reihe der Soldaten entlang, die Frau erkannte den Dieb, zeigte auf ihn. Man ging zu seinem Spind und fand die Uhr. Die Frau bekam sie zurück, und der Offizier bat sie, noch kurz mitzukommen. Sie ging mit und sah den Soldaten an der Mauer stehen. Er wurde sofort erschossen. Ein etwa Zwanzigjähriger! Dieses erschütternde Erlebnis ist die Frau nie losgeworden – nie wieder konnte sie diese verhängnisvolle, unglückselige Uhr tragen.
Als ich in die erste Klasse ging, stritt ich mich mit einem Mitschüler über die Frage, ob die Russen Frauen vergewaltigt hätten oder nicht. Wir wussten beide nicht, was eine Vergewaltigung ist, aber uns war klar: etwas Negatives – und deshalb bestritt ich es. So etwas täten die Russen nicht! Eine selbstverständliche Wirkung meines Elternhauses. Auch meinem Mitschüler war klar, dass Vergewaltigung etwas Böses sein musste. Der Unterschied: Er hob es anklagend hervor. Es war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich mich geprügelt habe. Abends fragte ich meinen Vater, was eine Vergewaltigung sei, und ob es stimme, dass die Russen Frauen vergewaltigt hätten. Er versuchte, mir eine Vergewaltigung zu erklären, und ich habe es so halbwegs verstanden. Dann meinte er, der prinzipielle, völlig undifferenzierte, also pauschale Vorwurf gegen die Russen sei falsch, »aber …«. Die Erläuterung zum »aber« dauerte ziemlich lange und war vor allem sehr umständlich. In Wirklichkeit gab er mir zu verstehen, dass ich recht hatte – und dennoch falschlag. Ein früher Unterricht in Dialektik.
Tatsächlich ist es in den ersten Wochen der Besatzungszeit zu schlimmen Vorfällen gegen Frauen und Mädchen gekommen. Dann aber, im Juni des Jahres 1945, gab es einen strikten Befehl der Sowjets an die eigenen Soldaten, dies unverzüglich zu unterbinden. Was dann auch geschah. Später erfuhr ich von Politikern aus den westlichen Bundesländern, dass es ähnliche Übergriffe auch von französischen, britischen und US-amerikanischen Soldaten gegeben habe. Man darf nie vergessen, dass in einem Krieg das Leben eines Menschen, seine Rechte, seine Würde nicht den geringsten Wert behalten. Freilich: Von energischer Aufarbeitung, wie sie im Falle der sowjetischen Soldaten – besonders nach dem Untergang der DDR! – gefordert und betrieben wurde, habe ich aus den westlichen Landesteilen kaum gehört.
*
Meine Eltern lebten nach dem Krieg im US-amerikanisch besetzten Sektor von Berlin. Die US-Offiziere kamen, sahen sich das Haus an und entschieden sofort, diese Villa Lessing zu übernehmen. Meine Eltern zogen in eine kleine Wohnung in der Libellenstraße 4, ebenfalls in Nikolassee. Meine Mutter verdingte sich übrigens später bei den US-Offizieren in der Villa Lessing eine Zeit lang als Hausmädchen – ohne dass diese wussten, in welcher Beziehung sie zu diesem Gebäude stand. Sie tat das, um die wichtigsten Gegenstände des Hausrats, Schritt für Schritt, durch »Entnahme« in Sicherheit zu bringen.
In Nikolassee wohnten meine Eltern, als meine Schwester im Jahr 1946 und ich im Jahr 1948 geboren wurden. Zur Geburt ging unsere Mutter in das Oskar-Ziethen-Krankenhaus, weil dort – wie bereits erwähnt – ihr Schwiegervater, Dr. Hermann Gysi, einer der Chefärzte war.
Irgendwann wurde ich gefragt, in welchem Land ich zur Welt kam. Meine Eltern wohnten, wie gesagt, im US-Sektor. Geboren aber wurde ich im sowjetisch besetzten Teil der Stadt. Das Deutsche Reich war untergegangen. Weder die Bundesrepublik Deutschland noch die Deutsche Demokratische Republik gab es zu diesem Zeitpunkt schon. Aus welchem Land also komme ich? Keine Ahnung, eines zumindest weiß ich: Ich stamme aus Berlin.
*
Im Mai 1949 wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Im August jenes Jahres zogen meine Eltern mit meiner Schwester und mir von Berlin-Nikolassee in den Ostteil der Stadt, und zwar in den Bezirk Treptow, Ortsteil Johannisthal. Sie hatten die Hälfte eines Zweifamilienhauses mit Grundstück in der Waldstraße erworben. Dort verlebten meine Schwester und ich unsere Kindheit.
Meine Mutter arbeitete nach 1945 zunächst in der Industrieverwaltung der sowjetischen Besatzungszone. Später gründete und leitete sie den Verlag Kultur und Fortschritt. Er sollte sich in erster Linie der Edition russischer und sowjetischer Literatur widmen. 1951 wechselte sie zum ebenfalls belletristisch ausgerichteten Verlag Rütten & Loening und wurde dort Verlegerin.
Unter ihrer Verantwortung brachte der Verlag die Werke von Rolland, Stendhal, Zola, Maupassant, Tolstoi, Tschechow, Dickens heraus, um nur die wichtigsten zu nennen. Auch zeitgenössische Autoren wie Hermann Kant veröffentlichten dort später. Herausgegeben wurden auch Beiträge zur romanischen Philologie unter Mitwirkung von Victor Klemperer sowie die Zeitschrift »Sinn und Form«. Noch heute wird der Verlag in entsprechenden Lexika gewürdigt: »Hinsichtlich der Qualität des literarischen Anspruchs, der Tiefe und Breite des Programms waren die 1950er Jahre eine Blütezeit des Verlages Rütten & Loening.«
Mein Vater wurde von den US-Offizieren als Stellvertretender Bürgermeister für Ordnung und Sicherheit in Zehlendorf eingesetzt. Eher eine Fehlbesetzung. Er erzählte gern zwei Geschichten aus dieser Zeit. Bei den US-Militärs gingen deutsche Prostituierte ein und aus, vor allem natürlich nachts. Am Morgen wurden sie von den Soldaten entlassen – aber ohne ihre Kleidung. Mein Vater war zuständig dafür, diese Frauen wieder einzukleiden. Das war mehr als schwierig, Kleidung war knapp. Er ging zur Kommandantur der US-Amerikaner und bat darum, man möge den Frauen doch wenigstens ihre Sachen hinterherwerfen, wenn man sie aus der Kaserne »entließ«. Das wurde akzeptiert, und damit kam es zu einer anderen Umgangskultur mit den nächtlichen Besucherinnen.
Die zweite Episode gab er sehr viel später in einem größeren Freundeskreis zum Besten. Eines Tages sei eine etwa achtzehnjährige junge Frau zu ihm gekommen, mit irgendeinem dringlichen Problem. Er habe ihr zugehört und versprochen, so gut wie möglich zu helfen. Daraufhin habe sie gesagt, eines habe sie schnell fürs Leben gelernt: Nichts sei umsonst. Und sie begann, ihr Kleid aufzuknöpfen. Mein Vater bedeutete ihr sofort, damit aufzuhören. Nun muss man wissen, dass mein Vater rhetorisch höchst begabt war; ihn im Redefluss zu unterbrechen und in dieser Unterbrechung selber zu bestehen, dazu bedurfte es einer Idee. Er war für mich eine wirksame Schule für Zwischenbemerkungen. Als er nun erzählte, wie er diese Frau gewissermaßen zur Ordnung rief, konkret zur Kleiderordnung, da sagte ich: »Hier wird die Geschichte unglaubwürdig.« Alle Freunde lachten, er selbst empörte sich – aber ebenfalls lachend.
Noch 1945 flog er als Bürgermeister in Zehlendorf raus. Wenn ich das mit der Dauer meiner Tätigkeit als Bürgermeister in Berlin 2002 vergleiche (über die noch zu berichten sein wird), so kommen wir beide auf die jeweils gleiche Amtszeit: ein halbes Jahr. Er wurde Chefredakteur der kulturpolitischen Zeitschrift »Aufbau«, herausgegeben vom Kulturbund. Außerdem war mein Vater, mit Geld dieses Bundes, einer der Mitbegründer des Aufbau-Verlages.
Der Kulturbund spielte damals eine wichtige Rolle. Er war eine hilfreiche Institution zur Überwindung des rassistischen und antisemitischen Denkens; die deutsche Klassik sollte auf neue Art und Weise wiederbelebt werden. Präsident des Kulturbundes wurde der Schriftsteller Johannes R.Becher. Erster Sekretär war Alexander Abusch, der dann über viele Jahre einen wichtigen administrativen, auch einengenden Einfluss auf die Kulturpolitik der DDR ausübte.
Mein Vater wurde zweiter Sekretär des Kulturbundes. Zunächst allerdings endete seine Laufbahn, bevor sie richtig begonnen hatte. 1952 kamen vermeintlich ungeklärte Fragen auf, sie betrafen seine Emigration in Frankreich und die Adressaten seiner Informationen gegen das Naziregime. Er geriet in die Mühle jenes Misstrauens, das vielen Westemigranten entgegenschlug, und war von einem auf den anderen Tag arbeitslos. Meine Mutter blieb Verlegerin, und das mit Dienstwagen. Sie bekam Einladungen auch für ihren Ehemann. Natürlich weigerte er sich vehement, bei offiziellen Anlässen als »Prinzgemahl« zu agieren.
*
Wenn ich über meine Eltern nachdenke, dann auch über ihre Scheidung. Was führt Menschen zueinander, was hält sie beieinander, was bringt sie auseinander? Logische Erklärungsmuster gehen zum großen Teil fehl. Wie beschrieben: Mein Vater war Mitglied der KPD gewesen, meine Mutter kam aus gänzlich anderen sozialen und kulturellen Kreisen. Plötzlich hatte sie in der DDR eine leitende Funktion, er jedoch war ohne Beschäftigung – und das in einer Zeit, Anfang der fünfziger Jahre, da eigentlich jede und jeder gebraucht wurde. Er muss sich zurückgesetzt gefühlt haben, er trug sein Los natürlich würdevoll, aber wahrscheinlich gab es erste, zunächst kaum wahrnehmbare Risse in der Beziehung, und vielleicht waren so schon früh die Grundlagen für die spätere Trennung gelegt. Es ist ein Problem, wenn Stärke auf Stärke trifft.
Mein Vater blieb ein halbes Jahr ohne Arbeit. Freunde besorgten ihm dann eine Anstellung im Verlag Volk und Wissen, dem Schulbuchverlag der DDR. Mag die pädagogisch-methodische Ausrichtung des Hauses seinen kulturellen Neigungen wenig entsprochen haben – immerhin gelang es ihm, in diesem Verlag ein mehrbändiges Werk zur deutschen Literaturgeschichte herauszugeben. Er war ein Mensch, der genügend Energie und Ideen besaß, sich unter jeweils gegebenen Umständen Erfolgserlebnisse zu verschaffen.
Manchmal hält das Leben Fügungen bereit, bei denen sich die Tragik des einen Menschen mit dem Glück eines anderen sehr unsentimental verbindet. 1956 wurde der Chef des Aufbau-Verlages, Walter Janka, verhaftet. Er hatte diesen Verlag zur Weltliteratur hin geöffnet. Im Zusammenhang mit dem Aufstand in Ungarn und aktiver Solidarität für den Literaturwissenschaftler Georg Lukács war Janka konterrevolutionärer Umtriebe bezichtigt worden. Er musste für fünf Jahre ins Gefängnis. Mein Vater wurde Jankas Nachfolger im Amt des Aufbau-Verlagsleiters. In solchen Wechseln zeigten sich die Härte und die Unerbittlichkeit, mit denen diese Generation zu leben hatte. Alles bedeutete Kampf. Man rückte vor und zurück, man rückte nach, man rückte auf, man füllte Leerstellen aus, die jemand hinterließ, der in diesen Kämpfen von der Partei gerichtet worden war. Das trieb die Gefühlswelten in eine oft gnadenlose Lakonik. Man hielt stand, man hielt aus, man hielt zusammen – auch im Schweigen über ertragenes Unrecht.
Zu den glücklichen Begebenheiten meines Lebens zählt, dass ich infolge des Herbstes 1989 gerade mit Walter Janka eine enge Beziehung knüpfen konnte. Eine Lesung seines Buches »Schwierigkeiten mit der Wahrheit« im Deutschen Theater Berlin gehörte in jener Umbruchphase der DDR unbedingt zu den geistigen Impulsen für eine grundsätzliche gesellschaftliche Erneuerung.
Bruno Haid, der Freund meines Vaters aus der Emigration, war in den fünfziger Jahren stellvertretender Generalstaatsanwalt der DDR und hatte verlangt, mit Leuten wie Walter Janka eine politische, aber keine strafrechtliche Auseinandersetzung zu führen. Deshalb wurde er entlassen und zunächst als Hilfsarbeiter in einer Fabrik eingesetzt. Später gelang es meinem Vater als Kulturminister, ihn zu einem seiner Stellvertreter zu berufen, zuständig für Verlage.
1956 wurde auch meine Mutter im Zusammenhang mit ihrer Westemigration unter Hitler als Verlegerin abgesetzt. Der Westen, das war der Feind – mancher, der sich dort in Sicherheit gebracht hatte, galt plötzlich als unzuverlässig. Der Verlag Rütten & Loening, den meine Mutter geleitet hatte, wurde bald darauf dem Aufbau-Verlag zugeordnet, dem mein Vater vorstand. Eine verlegerische Übernahme, die bis auf den heutigen Tag Bestand hat. Für meine Mutter ging die Sache insofern gut aus, als sie kurz nach ihrer Abberufung aus dem Verlag ins Kulturministerium kam – in der Abteilung Kulturelle Beziehungen zum Ausland leitete sie den Sektor, der für Kontakte zu den kapitalistischen Staaten zuständig war. Eine höchst interessante Tätigkeit, die vor allem auch nach dem Mauerbau 1961 mit vielen Dienstreisen in westliche Länder verbunden war. Später wurde sie Chefin der gesamten Abteilung, und noch später leitete sie die Abteilung UNESCO und andere internationale Organisationen.
Das Leben meiner Eltern vollzog sich in kultureller Unrast, man war viel beschäftigt, oft unterwegs. Wirklich häuslich, was die äußeren Abläufe betraf, konnte man dieses Familienleben nicht nennen. Aber vielleicht lag hier ein Grund für meine Mutter, in der Haushaltsführung für Ruhe, Gleichmaß und Beständigkeit zu sorgen – alles war eher aristokratisch strukturiert. Dazu gehörte ein spezielles Verständnis von Zugehörigkeit. Das heißt: Jene übliche Praxis in bürgerlichen Familien, die Haushälterinnen oder Kindermädchen häufig zu wechseln, lehnte meine Mutter strikt ab. Zugehörig wurde man bei ihr durch das Wohnen im Haus.
Ab 1951 war Gertrud Stapel, von uns allen Schätzi genannt, Haushälterin und Kindermädchen zugleich, sie blieb im Haus bis zum Tod unserer Mutter. Schätzi nahm an jedem Essen teil. Ein Weihnachtsfest ohne sie war undenkbar. Sie gehörte auf ihre Art vollständig zur Familie. In gewisser Hinsicht war sie sogar deren Kern. Typisch für die Situation war, dass meine Mutter und Schätzi sich bis zum Schluss siezten. Wenige Jahre vor ihrem Tod hatte meine Mutter Schätzi das Du angeboten, was von dieser aber sehr bestimmt abgelehnt worden war. Das fand ich mehr als witzig. Zwischen beiden Frauen herrschte eine enge Vertrautheit, bei der jedoch genauestens darauf geachtet wurde, eine bestimmte Distanz nicht zu unterschreiten.
Familie, das ist immer auch ein Abhängigkeitsverhältnis. Natürlich war Schätzi abhängig von meiner Mutter. Wir drei aber, meine Mutter, meine Schwester und ich – wir waren weit abhängiger von Schätzi. Ein aristokratischer Haushalt bedeutet ja für Kinder, dass sie einerseits besonders unter Kontrolle stehen – andererseits freilich soll sich in ihnen das Gefühl von Freiheit und Sonderstellung entwickeln. Meine Schwester und ich liebten Schätzi. Sie besaß einen überdurchschnittlichen Gerechtigkeitssinn, den sie auch auf uns übertrug. Sie hat uns also völlig gleich behandelt, was in der Erfahrung von Geschwistern keinesfalls eine Selbstverständlichkeit ist. Zum Beispiel war die Zuneigung meiner Mutter zu mir etwas größer als zu meiner Schwester. Bei meinem Vater war es umgekehrt. So glich sich letztlich alles auf gerechte Weise aus.
5. Kapitel
Unser Gedächtnis würfelt, die Erinnerung springt wie das Leben selbst; und in der Rückschau eine Ordnung des Erlebten herzustellen, ist jederzeit ein unvollkommener Versuch. Oft bewahren wir nur Augenblicke. So erinnere ich mich nur vage an den Kindergarten. Aber ich weiß noch, dass ich im Märchenstück »Die sieben Geißlein« jenes kleinste Geißlein spielte, das sich im Uhrkasten versteckt. Der Darsteller des Wolfs machte seine Sache nicht richtig, ich musste ihm vorspielen. Eine frühe Einübung in die besondere Aura öffentlicher Räume. Vor allem aber erinnere ich mich daran, dass da ein sehr hübsches Mädchen in der Gruppe war und ich Schätzi bat, mich doch zu einer späteren Stunde abzuholen. Vermutlich war ich das einzige Kind, das je darum bat, länger als nötig im Kindergarten bleiben zu dürfen.
Politische Ereignisse in größtenteils friedlichen Zeiten erreichen ein Kind nur spärlich. Am 17.Juni1953 etwa war ich fünf Jahre alt. Ich stand aus Gründen, die ich vergessen habe, im Königsheideweg. Gegenüber war das Polizeirevier. Dort standen viele Männer in Zivil, aber in Reih und Glied, die Gesichter mir zugewandt. Vor ihnen zwei Polizisten mit Gewehren. In der ersten Reihe der Zivilisten stand ein alter Mann mit langen weißen Haaren. Unser Blick traf sich, ich habe diesen Blick bis heute nicht vergessen. Begegneten da einander zwei unterschiedliche Alter der Unschuld? Eine natürliche, die ich als Kind verkörperte, und eine politische dieses Mannes? Oder hatte sich der Mann mit den weißen Haaren schuldig gemacht, und mir begegnete da der Blick des Menschen, der Beistand suchte? Traf ich da also auf einen Blick, den ich in meinem späteren Anwaltsleben noch öfter auffangen würde? Das alles ist, wenn man eine Logik unterstellen will, blanker Unsinn. Aber wir klopfen unser Leben gern nach existenziellen Zeichen ab, und dass ich den seltsamen, zufälligen Blick dieses Mannes nie vergaß, hat mich in Abständen beschäftigt, sogar etwas beunruhigt.
*
Als Kind aß ich besonders gern Eis. Da ich aber kein Geld hatte, ging ich zu unserem Eisladen an der Ecke und bezahlte mit Bauklötzen. Die Verkäuferin ging lächelnd auf meine Währung ein, mein Vater löste abends im Geschäft die Bauklötze ein, sodass ich sie wiederbekam. Das ermutigte mich, diese Zahlungsmethode so lange wie möglich fortzusetzen. Auch erinnere ich mich, mit meinem Vater auf dem Weihnachtsmarkt gewesen zu sein – er bot mir an, ich könne Polareis essen, so viel ich wolle. Es handelte sich um Vanilleeis mit einem Schokoladenüberzug. Nach der 23.Portion war es mit seiner Freigiebigkeit zu Ende, denn diese Menge hatte er natürlich nicht erwartet. Und natürlich hielt er sie auch nicht meiner Gesundheit zuträglich. Es kann von Vorteil sein, wenn man unterschätzt wird.
1954 wurde ich in Johannisthal eingeschult und besuchte zunächst die Grundschule in der Winckelmannstraße. Sie lag in der Nähe des DEFA